Erzählungen

Ich will den HERRN preisen mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle seine Wundertaten.
Psalm 9,1
Groß sind die Taten des HERRN,sie werden erforscht, von allen, die Lust an ihnen haben.
Psalm 111,2
Es werden dich loben, HERR, alle deine Werke,und deine Frommen dich preisen.
Psalm 145,10
Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit.
Jesaja 6,3
Die Werke des Herrn sind unbeschreiblich schön. Jedes einzelne Seiner Geschöpfe ist ein Wunder. Eine winzige Zelle erregt mit ihrem sinnvollen Aufbau und ihrer Komplexität genauso unser Staunen wie der gestirnte Himmel über uns. Der große englische Prediger Charles Haddon Spurgeon hat das so gesagt:
»Gottes Werke sind allesamt großartig, betrachtet man ihre Planung, ihre Ausdehnung, ihre Anzahl oder die Vortrefflichkeit ihres Baus. Auf irgendeine Weise wird sich jedes Werk Seiner Macht, Seiner Schöpfung oder Seiner Weisheit dem weisen Herzen als großartig erweisen. Alle, die den Schöpfer lieben, freuen sich über Seiner Hinde Werk; sie verstehen, daß sie mehr beinhalten, als was man oberflächlich erkennt, und darum wenden sie alle Kraft daran, sie zu studieren und verstehen zu lernen. Der ehrfürchtige Naturwissenschaftler durchforscht die Natur.., und bewahrt jedes Körnchen ihrer goldenen Wahrheiten.«'
cLv Ein Gott der Wunder tut ISBN 3893973761
Tränen die man nicht vergißt, Jean Marie Campbell
1 ZWÖLF JAHRE
Ich gähnte herzhaft und klopfte mit meinem Buch Der scharlachrote Buchstabe gegen die Scheibe. Vier oder fünf Goldfische auf meiner Seite des Aquariums wurden durch das Geräusch aufgestört und schossen davon. Drei gestreifte Fische huschten spielerisch durch die Algen. Doch der kleine rote Neonfisch bewegte sich nicht.
Erneut versuchte ich, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Diesmal wölbte sich der kleine Körper und bewegte sich ruckartig ein wenig nach links, bis er in Seitenlage an die Oberfläche gelangte. Er war krank und dem Tode nahe. Das erkannte ich.
„Campbell,Jean!"
Ich starrte weiter auf den winzigen Körper. Warum mußte er sterben? Warum? Warum gerade dieser und nicht die anderen? Er war so :wunderschön.
Jeanie?" unterbrach die Stimme an der Tür. Die weißgekleidete Frau lächelte mir zu und hielt die Tür auf. „Du bist dran"
Ich nickte, tastete nach meinem Täschchen und stand auf. Kurz vor der Tür drehte ich mich um und warf noch einen letzten Blick -auf das Aquarium.,, Ich vermute, das ist ein Neonfisch dadrin", sagte
Ich zu der Schwester und deutete auf das Aquarium. „Er ist krank. Man sollte ihn lieber rausnehmen, damit er die anderen nicht ansteckt Vielleicht wird er wieder gesund wenn er allein ist Ich machte eine Pause und fügte dann hinzu „Meinen Sie nicht auch? 0Ich weiß nicht ‚erwiderte die Frau mittleren Alters, „aber danke für den Hinweis. Ich werde mich später darum kümmern. Hast du zu Hause Fische?
„Nein",erwiderte ich und sauste an ihr vorbei in den engen Gang Fische nicht."
Sie deutete auf eine Tür zur Rechten „Tjntersuchungsraum C ist
Ich folgte ihr auf den Fersen und fuhr fort: „Fische nicht, aber ei-
11
nen Kater. Er heißt Tiger. Und Bernd— das ist mein einer Bruder - hat einen Hund. Das ist vielleicht ein Köter! Er will einen immer abschlecken. Immerzu. Ich mag keine Hunde", meinte ich sachlich, „nur Katzen. Aber ein Aquarium hätte ich gern, wenn ich dürfte. Fische sehen so friedlich aus, finden Sie nicht? Sogar der kleine rote da drüben. Er kämpft um sein Leben. Halten Sie es für möglich, daß Fische Gefühle haben? Nehmen Sie an, daß der Fisch da weiß, daß e krank ist und daß er bald stirbt?"
„Du stellst heute aber viele Fragen", lachte sie. Die Schwester zögerte einen Augenblick an der Tür zum Behandlungsraum, wandte sich dann um und schaute mich an.
„Ich denke schon, daß Fische fühlen können. Warum eigentlich nicht?"
‚Ja", erwiderte ich „Warum nicht? Aber ich mag nicht sehen, wie der Neonfisch leidet. Ich meine, ich mag nicht
Sie hob die Hand wie ein Polizist an einer Kreuzung. „Dieser Fisch macht dir ja wirklich zu schaffen. Nun sei nicht traurig, Jeanie. Wir kümmern uns um ihn. Geh jetzt am besten hinein, damit wir dich wiegen und deine Temperatur messen können, bevor Dr. Bradford zu dir kommt! Kopf hoch! Deine Sachen legst du auf den gelben Tisch da drüben."
Ich betrat das kleine Zimmer und schmiß mein Täschchen und das Buch auf den Tisch. Das Buch blieb liegen, doch das Täschchen rutschte über die Kante und fiel zu Boden.
„Es ist leicht wie eine Feder", sagte ich nervös und kniete mich hin, um den verstreuten Inhalt aufzusammeln. „Nichts weiter drin als ein Kamm, ein Notizbuch und ein paar Zettel von der Schule."
Die Schwester trat einen Schritt zurück und verdrehte ihre großen braunen Augen. „Vergiß deinen Kuli nicht! Er ist unter dem Untersuchungstisch Ganz hinten."
Ich lag nun in voller Länge auf dem Boden und tastete mit verdrehtem Arm unter den Tisch. „Tut mit leid. Ich hab's nicht mit Absicht getan. Sie ist einfach runtergefallen. Es. . . es war ein Versehen. Es tut mir leid, weil - -
„Beruhige dich, Jeanie. Das macht doch nichts. Ist ja nichts passiert. Laß dir nur Zeit!"
‚Ja, aber ich möchte nicht.. . nicht.. . ach nichts. Ich hab ihn", flüsterte ich und kroch wieder hervor. Umständlich stopfte ich den Kuli in die Tasche, wischte mit der Hand über meine Hose und hielt mich am Tischbein fest, um schneller hochzukommen. Als ich mich auf richtete, rutschte ich mit dem rechten Fuß nach hinten aus und verfing mich in einem fahrbaren Dreifuß aus Metall, an dem eine besondere Lampe befestigt war. Ich hatte ihn weder gesehen noch ge-
spürt. Da war es geschehen!
„Volltreffer!" rief die Schwester, während sie das Tischchen auffing. „Das nächste Mal müssen wir größere Untersuchungsräume bauen!"
Sie versuchte, dem ganzen Vorfall eine lustige Seite abzugewinnen, aber ich war zutiefst erschrocken. Zudem hatte ich mir das Knie ziemlich angeschlagen, als ich auf den harten Boden hinknallte. Ich spürte einen klopfenden Schmerz. Nur mit Mühe konnte ich die Tränen zurückhalten. Das Blut schoß mir ins Gesicht und ich stotterte: ‚Meine Schuld. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich mache alles verkehrt. Überall, wo ich bin..
„Nun hör einmal auf, Jeanie!" sagte die Schwester und zog mich hoch. „Ist doch alles in Ordnung, oder? Es war doch nur ein Versehen. Stell dir vor, ich selbst hab diese Lampe auch schon runtergeworfen! Vor ungefähr acht Monaten. Da stand nur niemand hinter mir, der sie auffing." Sie lächelte mir aufmunternd zu und fuhr fort.
‚Du hast also wirklich Glück gehabt, kleines Fräulein."
‚Nein. Nein, Sie verstehen das nicht", brachte ich zitternd hervor.
‚Das war meine Schuld. Ich bin unvorsichtig und ungeschickt. Ich... ich bemühe mich wirklich, aber dann passiert doch wieder etwas." „Ist doch nichts geschehen", sagte die Schwester. „Setz dich hin und beruhige dich erstmal! Lies doch ein wenig, bis der Doktor kommt! Wovon handelt dein Buch eigentlich?"
Mein Knie schmerzte noch immer, und ich beugte mich hinunter,
--um es zu massieren. Ich tat einen tiefenAtemzug. „Ich habe es letzte Woche im Schulbuchladen gekauft. Es heißt Der scharlachrote Buchstabe. Ich habe es fast durch."
‚Wie! In welcher Klasse bist du denn?" -
„In der siebten."
„Und wie alt bist du?"
‚Zwölf."
Sie griff nach dem Buch. /
- - „Das habe ich erst gelesen, als ich mindestens in der letzten Klasse
des Gymnasiums war oder sogar erst, als ich mein Studium begonnen hatte. Ich kann mich gar nicht mehr recht erinnern. Es ist schon solange her."
Sie warf einen flüchtigen Blick auf den Einband und blätterte ein wenig darin herum. „Nathanlel Hawthorne. Das ist ganz schön ha pig für ein Kind in deinem Alter, weißt du das eigentlich?"
„Ich ... ich lese viel", sagte ich und setzte mich hin. Ich fühlt mich jetzt wohler und wurde ruhiger. Bei diesem Thema war ich meinem Element. „Wenn ich lese, habe ich etwas zu tun und kom nicht in Schwierigkeiten. Dies Buch gefällt mir besonders gut."
„Verstehst du es denn?" Ihre Stimme klang überrascht.
„Einige Abschnitte sind schwer. Aber ich denke schon. Ich meine ich verstehe es. Die Frau im Buch heißt Hester, und sie hat ein klei nes Baby. Aber sie will nicht sagen, wer der Vater ist. Wissen Sie, ihr Mann ist drüben in England." Ich hob meinen Zeigefinger zur Beto nung. „Und sie ist hier. Diese Leute - Puritaner waren das— wolleij sie dafür bestrafen. Darum muß sie immer den Buchstaben E an da..
Kleidung tragen, der für. . . für. . . Sie wissen schon ... für Ehebruch steht."
„Ganz genau, das war's. Na dann, du Kanone, nur weiter so!" „Kanone?" wiederholte ich. „Hat Ihnen das Buch gefallen?"
„Sagen wir mal so: ich beschäftigte mich damals mehr mit Natu wissenschaften. Mit Literatur hatte ich nichts im Sinn."
„Aha", bemerkte ich. ‚Jetzt habe ich Sie drangekriegt" Sie lachte nur.
„Ich vermute, wenn ich das Buch durchhabe, werde ich es nochmal lesen." Ich machte eine Pause. „Da steckt viel drin. Besonders wie Menschen in ihrem Innern denken und fühlen."
Die Schwester runzelte die Stirn und nickte zustimmend. Dann legte sie das Buch auf den Tisch zurück und war wieder voller Taten drang. „Sag mal, meinst du, ich könnte dich dazu bewegen, ein paar Sekunden auf der Waage zu stehen? Wenn ich deine Temperatur
messe, kannst du dich wieder deinem Buch und Lady Hester zuwenden. Was hältst du davon?"
„Klar", sagte ich. „Ganz wie Sie wollen."
Als Dr. Bradford kam, hatte ich schon alle Gegenstände auf seinem Instrumententisch genau betrachtet und mir eingeprägt: ein großes Glasgefäß mit kleinen und großen Holzspateln, drei Thermometer in einem Metallbehälter, einige bunte Glasfläschchen und verschiedene Ampullen, ein Karton mit Mull, verschiedene Bandagen, drei unterschiedlich große Scheren, Zangen, eine riesige Flasche Alkohol mit der Aufschrift Gift in leuchtend roten Buchstaben, fünf Päckchen mit Spritzen (ohne Nadeln), einige Tupfer, zwei Rollen weiße
Mullbinden und ein Gerät zum Blutdruckmessen. Das war nur die obere Ablagefläche.
„Wie geht es uns denn heute, kleines FräuleinJeanie?" fragte Dr.
aciford und gab mir einen kräftigen Klaps aufs Bein. Er war ein lustiger rundlicher Mann, der mich stets auf die gleiche Weise begrüßte.
Ich zuckte mit den Schultern. „Wenn Sie es wirklich wissen wollen
‚.Aber unbedingt!" erwiderte er fröhlich.
„Mir geht es nicht gerade glänzend. Meine Mutter war beunruhigt und hat mir darum für heute nach der Schule einen Termin bei hnen geben lassen. Sie muß bald hier sein, um mich abzuholen.
Das hoffe ich wenigstens."
Er öffnete die braune Mappe, auf der mein Name stand. „Nun sag
mal, wo es dir wehtut!"
- »Es ist der Magen. Immer noch der Magen."
„Na, dann wollen wir mal sehen", sagte er und blätterte einige zu-snmmengeheftete Unterlagen im Ordner durch. „Am fünfzehnten letzten Monats habe ich dir ein Rezept ausgestellt. Hat das Medika-
ment nicht geholfen?"
„Etwas. Aber hier ist alles so angespannt." Ich legte meine Hand auf die betreffende Stelle. „Genau hier. Und manchmal muß ich mich übergeben, wenn es wirklich schlimm wird."
Dr. Bradford kratzte sich am Kopf und erwiderte: „Nimmst du an, daß es am Essen liegt? Oder schlingst du es zu schnell hinunter?
Was meinst du?"
„Ich denke nicht, daß es daran liegt. Manchmal kann ich gar nichts essen. Dann stochere ich nur im Teller herum."
„Hast du Schmerzen? Ungefähr eine halbe Stunde nach dem
‚Nein, eigentlich nicht. Das heißt, zumindest nicht mehr, als zu
anderen Zeiten."
„Leg dich mal hier oben hin!" forderte er mich auf und klopfte mit der Handfläche auf den Untersuchungstisch.
Nachdem ich seiner Anweisung gefolgt war, zog er meinen Pullover ein Stückchen hoch und tastete mit den Fingern meinen Bauch ab. Zuerst kitzelte es. „Tut es jetzt weh? Wenn ich hier drücke?"
„Nein, nein, es ist eine andere Art von Schmerz. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll."
Dr. Bradford drehte sich nach meiner Akte um, öffnete sie und nahm einen silbernen Kuli aus seiner Kitteltasche. „Versuch einmal, ganz genau zu beschreiben, was für ein Gefühl es ist, wenn es dir wehtut!"
„Meistens ist es so eine Art langsamer Schmerz", erklärte ich. „Und dann ist es oft so, als würde sich alles zusammenziehen. Es ist ganz angespannt da drinnen. Ich wache sogar manchmal mitten in der Nacht davon auf"
Er machte ein paar Notizen auf meiner Karteikarte. Dann mußte ich mich aufsetzen. Zuerst hörte er sorgfältig meinen Herzschlag ah. „Es ist ein wenig schnell heute. Doch das ist kein Grund zur Beunruhigung. Wollen mal sehen, wie es in deinem Hals aussieht. Mach mal deinen Mund auf."
Der trockene Holzspatel hinten im Rachen war sehr unangenehm. „Dein Hals ist leicht gerötet. Bekommst du ausreichend Schlaf?" „Ich liege lange genug im Bett, wenn Sie das meinen. Aber ich weiß nicht, wieviel ich schlafe. In Stunden, meine ich. Manchmal kann ich schlafen, manchmal nicht." „Dreh dich jetzt mal um,Jeanie! Wir wollen uns mal unterhalten."- Ich ließ meine Füße vom Tisch baumeln, und Dr. Bradford setzte sich neben mich. Er klopfte mit der Hand auf mein Knie, während er nach den richtigen Worten suchte.
‚Jeanie,Jeanie", sagte er leise, fast flüsternd. „Ich kenne deine Familie seit vielen Jahren, und dich kannte ich schon, als du noch so klein warst." Er hielt die Hände ein Stück weit auseinander. „Ich war am Krankenbett deiner Mutter, als sie mehrfach diese Herzschwäche haue. Zwei - nein drei —Jahre lang habe ich deine ältere Schwester behandelt. Und als dein Bruder Bernd Blutvergiftung hatte und vor Jahren den Unfall überstand, war ich an seiner Seite. Ich war im Krankenhaus bei deiner Familie. Ich war mehrfach bei euch zu Hause, und deine ganze Familie hat mich oft in meiner Praxis aufgesucht."
Er hielt inne, um sich zu räuspern. „Wenn ich zurückblicke, so kann ich sagen, daß deine Familie mehr als genug Belastungen überstanden hat, Jeanie. Aber dies hier? Das ist etwas anderes. Kannst du mir sagen, was mit dir los ist, Jeanie? Was macht dir wirklich zu schaffen?"
Der Kloß in meinem Hals war trügerisch. Gerade, als ich dachte, er sei groß genug, um Worte und Tränen aufzuhalten, zerbarst er unvermittelt wie ein morsches Schleusentor, und die Wellen stürzten hervor.
Die Zeit schien stillzustehen. Ich schluchzte und schluchzte und hielt dabei meine Hände vors Gesicht. „Doktor", weinte ich, „ich weiß selbst nicht mehr, was los ist. Zu Hause geht alles kaputt. Wirklich alles."
„l3eruhige dich, mein Kleines", sagte Dr. Bradford behutsam. Sein langer Arm umschloß mich, und seine Hand drückte meine Schulter 80 fest, daß es wehtat.
‚Es war schon schlimm, ehe Mama im letzten Jahr die Scheidung einreichte. Aber jetzt ist es furchtbar. Streit! Streit! Streit! Wenn es ruhig ist, dann sitze ich da und warte, daß es von neuem knallt. Morgens und abends. Und besonders am Wochenende. Es kommt mirso vor, als ob es schon immer so gewesen ist. Ich habe das Gefühl, es wird nie aufhören. Mein Papa... mein Papa...!"
„Sch, sch", unterbrach der einfühlsame Arzt mein Wehklagen. ‚Sch, sch." Sein starker Arm stützte meine bebenden Schultern.
„Nichts kann ihn beruhigen, wenn er wütend ist. Dann brüllt er. Und nicht nur das. Ich habe solche Angst vor ihm. Ich gehe raus oder verstecke mich in meinem Zimmer. Dort kann ich ihn aber immer noch hören. Ich sitze dann auf meinem Bett und weine und weine. ßinen Augenblick lang geht es mir besser. Dann ist mir wieder so Übel, daß ich mich übergeben muß. Alles geht kaputt! Alles! Manchmal denke ich, ich selbst auch."
„Oh, Jeanie!" Dr. Bradford seufzte und zog mich noch näher zu sich heran. „Das habe ich nicht gewußt. Das habe ich wirklich nicht gewußt."
lin angrenzenden Waschraum des Arztes hatte ich mein Gesicht in eiskaltes Wasser getaucht. Aber es war noch immer krebsrot. Ich betrachtete es im Spiegel über dem Waschbecken. Meine Nase lief Die Augen brannten. Die Lippen waren geschwollen. Das Haar war zottelig und stumpf Selbst bei leicht verschwommener Sicht erkannte Ich, daß ich fürchterlich aussah.
Ich trocknete mir die Hände und setzte mich auf einen Stuhl. Er bot meinem erschöpften Körper etwas Halt, während ich versuchte, - mich zu sammeln. Wenn ich allein war, haue ich schon oft so geweint, doch niemals in der Gegenwart eines Erwachsenen. Ganz besonders nicht vor einem Fremden.
- Einerseits fühlte ich mich leichter und freier als seit Monaten. Andererseits aber hatte ich Angst. Was wäre, wenn Dr. Bradford meiner Mutter die ganze Geschichte erzählte? Es wäre mir lieber, sie wüßte nichts davon. Ich wußte zwar, daß sie mich liebhatte. Aber sie würde fürchterlich böse werden. Dessen war ich mir sicher.
Selbst jetzt, während ich über die samtene Armlehne des Stuhles strich, kamen mir wieder ihre Worte aus der vergangenen Woche in den Sinn. ‚Halt dich da raus, Jean" befahl sie streng. „Geh in dein Zimmer und halt dich raus! Es wird dir nicht so viel ausmachen, wenn du nicht dabei bist und alles mitkriegst."
Ich hatte nicht den Mut, meiner Mutter zu widersprechen, aber nichts war weiter von der Wahrheit entfernt. Das Durcheinander zu Hause machte mir sehr wohl etwas aus. Es zerfraß mich im Innern wie eine Säure. Tag und Nacht.
Langsam verstrich die Zeit, und ich blieb wohl noch weitere zehn oder fünfzehn Minuten sitzen. Schließlich betrachtete ich noch einmal mein Gesicht im Spiegel und stellte fest, daß ich wieder einigermaßen normal aussah. Dieses neue Bewußtsein, daß das Leben von selbst wieder in mich zurückkehrte, gab mir Mut, wieder in den Untersuchungsraum zurückzukehren. Dr. Bradford war gerade von einem anderen Patienten gekommen. Ich fand ihn in der kleinen Nische am Fenster, wo er sich mit seinem silbernen Kugelschreiber Notizen machte.
‚Jeanie", begann er und drehte sich zu mir. „Geht es dir besser?" Er wartete einen Augenblick und fuhr dann behutsam fort: „Da hast du dich aber ordentlich ausgeweint."
„Ich bin müde", antwortete ich, „und erschöpft. Heute nacht werde ich wahrscheinlich schlafen wie ein Stein. Das ist mal was anderes."
Er schrieb einen letzten Satz in meine Akte und griff dann nach dem Rezeptblock. ‚Jeanie, ich werde dir zwei Medikamente verschreiben. Das eine wird deinen Magen ein wenig mehr beruhigen 1 als die Tabletten, die ich dir das letzte Mal verschrieben habe. Das andere ist eine kleine blaue Pille. Die wird dir helfen, dich insgesamt 1 zu entspannen. Wir wollen es damit einmal versuchen und hoffen, daß sich die Lage zu Hause bald normalisiert."
„Ich bete jeden Tag darum", flüsterte ich. „Wirklich."
Dr. Bradford riß die Zettel vom Rezeptblock und reichte sie mir. „Sag deiner Mutter, sie soll die Rezepte sofort einlösen! Heute abend oder morgen."
„Was meine Mutter betrifft", begann ich verlegen, „bitte, sagen Sie ihr doch nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Bitte! Sie würde es nicht verstehen. Manchmal denkt sie, ich würde alles nur vorspielen, um zu Hause nichts tun oder nicht in die Schule gehen zu müssen. Bitte,
bitte, sagen Sie ihr nichts!"
DerArzt kratzte sich am Kinn und dachte nach. „Na gut, ich werde ihr erstmal nichts sagen. Wollen einmal sehen, wie die Arznei an-
schlägt."
Dann war es lange still zwischen uns. Ich war zu erleichtert, um
ein Wort herauszubringen.
‚Jeanie, du sollst wissen, daß ich mir um dich und um deine
Familie Gedanken mache. Verstehst du?"
Verlegen wich ich seinem Blick aus und gab die einzige Antwort,
die mir einfiel: „Ich bin davon überzeugt!"
„Hast du dich jetzt ein wenig gefangen?"
»Ja, ein bißchen. Ich brauche nur etwas Schlaf. Das ist alles."
„Ich möchte, daß du in ein paar Wochen wiederkommst. Anfang
des nächsten Monats. Dann wollen wir sehen, wie es dir geht."
„Klar", erwiderte ich. „Dann habe ich schon etwas, worauf ich
mich freuen kann . . . falls . . . falls es zu Hause schlimmer wird.
Wenigstens kann ich mit Ihnen darüber reden."
„Gut", meinte er zustimmend. Er drückte mir kurz die Hand.
Ich versuchte ein Lächeln, doch es wollte mir nicht gelingen. Dann griff ich nach meinem braunen Täschchen. „Bis dann", verab-
schiedete ich mich.
„Vergiß dein Buch nicht!"
„Ach ja." Ich griff nach dem Buch, öffnete es und stopfte die Rezepte hinein. Wir nickten uns zu, und ich trat auf den Flur.
Ich war überrascht, als ich das Wartezimmer auf der anderen Seite des Korridors völlig leer fand. Auf meinem weg zum Ausgang machte ich noch einen kurzen Abstecher ins Schwesternzimmer und warf einen Blick auf die Wanduhr. Wie lange mochte ich wohl hiergewe-
sen sein? Es kam mir vor wie Stunden.
„Ach, Jeanie", rief mir die freundliche Schwester von hinten zu. „Deine Mutter ist gerade noch einmal zum Auto gegangen, um die Scheinwerfer auszumachen. Jetzt ist es erst halb sechs und schon dunkel draußen. Ich mag den Herbst. Aber daß die Tage immer kur-
zer werden, gefällt mir gar nicht."
Ich nickte zustimmend.
‚Wenn du dich beeilst, kannst du ihr den Rückweg ersparen", fuhr
die Schwester fort.
Geistesabwesend schaute ich sie an, und sie wiederholte: „Deine
Mutter. Draußen auf dem Parkplatz."
Jennifer, Marjorie Buckingham
„Bis bald, Mutti, ich muß jetzt gehen." Jennifer nahm ihre Handschuhe und ihre Handtasche und blieb einen Augenblick in der Tür stehen. „Ich muß mich um sieben mit Doreen treffen."
blieb einen Augenblick in der Tür stehen. „Ich muß mich um sieben mit Doreen treffen."
Frau Deane legte ihren Wandteppich hin und wandte sich ihrer achtzehnjährigen Tochter zu, die in diesem Augenblick ungeduldig mit dem Fuß an die Wohnzimmertür stieß. „Ein reizendes Mädchen", dachte sie in mütterlichem Stolz.
Ja, Jennifer sah wirklich sehr hübsch aus in, ihrem gut-sitzenden Tweedmantel, während das helle Seidenkopftuch, das sie lässig um ihr dunkles Lockenhaar gebunden hatte, die feinen Konturen ihres Gesichtes besonders klar betonte.
„Komm nicht so spät nach Hause, Jennifer", sagte sie laut, „du bist in letzter Zeit sehr oft recht spät gewesen - und dazu ist heute Sonntag."
Jennifer warf den Kopf hoch. ‚Und seit wann machst du dir etwas aus dem Sonntag?" entgegnete sie schlagfertig. „Es ist ein Wunder, daß du nicht wieder anfängst, zur Kirche zu gehen."
Anton Deane legte das Buch, in dem er gelesen hatte, beiseite und langte nach einem Holzscheit. „Na ja, junge Dame", mahnte er, „du brauchst dich nicht so aufzuspielen. Deine Mutter hat ganz recht: du bist schon zu viele Abende bis spät ausgewesen. Wenn du nicht achtgibst, werde ich dir den Ball im nächsten Monat streichen."
„Ach nein", lachte Jennifer trotzig, „ich möchte doch sehen, ob ihr oder sonst irgendwer mich aufhalten kann! Ich lebe nur noch für diesen Ball. Und es sind noch drei Wochen! Na ja", fügte sie lebhaft hinzu, „ich muß jetzt weg. Erwartet mich, wenn ich wieder da bin. Wiedersehen."
Sie warf ihnen eine Kußhand zu, und wenig später hörten sie die Haustür hinter ihr zuschlagen.
„Hm", Anton Deane machte es sich in seinem Sessel wieder bequem und stützte seine Füße auf das Gitter vor dem offenen Kamin, „das Mächen wird langsam ein Problem für uns, Julia."
„Es wird schon noch alles gut mit ihr werden, mein Lieber", sagte seine Frau beschwichtigend. „Sie ist doch noch so jung und möchte ihr Leben genießen. Sie hat später noch Zeit genug, um sich häuslich niederzulassen."
Herr Deane schien von dieser Feststellung nicht sonderlich beeindruckt. „Wo geht sie eigentlich heute Abend hin? " wollte er wissen.
„Ach, ich denke, da ist eine Party, die einer der Jungens gibt. Einer aus ihrem Bekanntenkreis, weißt du."
„Nun, sie täte besser daran, zu einer anständigen Zeit nach Hause zu kommen, sonst wird es Ärger geben", murmelte er, mehr zu sich selbst, als er sah, daß Julia sich wieder ganz ihrer Näharbeit zuwandte.
Anton Deane war ein merkwürdiger Mann. Er pflegte nicht viel zu sagen, und es war schwierig, zu erfahren, was er wirklich dachte. Seine Kollegen kannten ihn als einen erfolgreichen Geschäftsmann, der rücksichtslos seinen Vorteil zu wahren wusste; seine Familie kannte ihn als einen ruhigen, aber pflichtbewussten Gatten und Vater. Er sorgte großzügig für ihr äußeres Wohl, doch gelegentlich zeigte er eine unerwartete Besorgnis über ihr Benehmen und ihre Lebensweise; es schien, als verberge sich hinter seinem verschlossenen Äußeren die leise Ahnung, daß sich seine Pflicht gegenüber der Familie nicht in der Sorge für ein gutes Heim, gute Kleider, gute Erziehung und freizügiges Taschengeld erschöpfte.
Aber Julia war sehr zufrieden. Sie hatte ein schönes Heim; sie konnte sich elegante Kleidung leisten, und jetzt, da ihre Kinder heranwuchsen, hatte sie viel Zeit für gesellschaftliche Verpflichtungen. Sie war wirklich eine stolze Mutter. Rodger, der Älteste, folgte den Spuren seines Vaters und war mit seinen einundzwanzig Jahren ein vielversprechender junger Buchhalter. Philip, der Jüngste, war erst sechzehn, aber er hatte so viele Schulfreunde, daß sie ihn selten sah, außer zu den Mahlzeiten. Und dann Jennifer! Julia setzte große Hoffnungen auf Jennifer. Sie war fest entschlossen, sie in die besten Kreise einzuführen. Jennifer war ein reizendes Mädchen und allseits sehr beliebt.
Eines Tages würde sie sich gut verheiraten - mit einem, der standesgemäß gut zu ihr paßte - und Julia hatte schon Pläne, die sich als sehr weitreichend erweisen sollten. Der große Ball in drei Wochen stand bevor! Alles, was Rang und Namen hat, würde dort vertreten sein, und sicherlich sollte nicht Julia Deane daran schuld sein, wenn ihre Tochter nicht alle Sympathien im Sturm eroberte! Und Jennifer...
- Jennifer eilte die Straße hinab zu der Ecke, au der sie sich mit Doreen Jackson verabredet hatte. Es war schon sieben Uhr durch, und sie hasste es, unpünktlich zu sein.
Doreen kam gerade die Straße herunter. „Nicht so eilig, Jenn!" rief sie. „Die Jungens sind noch gar nicht hier." Als Doreen ihre Freundin eingeholt hatte, fuhr sie fort: „Es scheint so, als seien sie uns entwischt."
Doreen und Jennifer waren schon seit ihrer gemeinsamen Schulzeit befreundet. Eigentlich gleichaltrig, sah Doreen mit ihrem blonden Haar und dem auffälligen Make-up um Jahre älter aus, und sie übernahm gewöhnlich die Führung, wenn es galt, ein neues gesellschaftliches Abenteuer, zu wagen.
„Puh, ist das ein kalter Abend!" Jennifer schlug gegen den rauen Wind ihren Mantelkragen hoch. „Nicht länger als zehn Minuten bleibe ich hier frierend stehen!"
„Sie können ja noch kommen", sagte Doreen hoffnungsvoll, „ich weiß es - komm, wir warten hier - da stehen wir nicht so im Wind." Sie stellten sich dicht beieinander in den Eingang einer kleinen wettergeschützten Vorhalle, die nicht weit von der Straßenecke entfernt war. Die inneren Türen waren geschlossen, aber der Klang von Musik war deutlich zu hören.
„Klingt so, als sollten wir hier beim Warten Unterhaltung bekommen", bemerkte Jennifer trocken, „hör mal"
„Vielleicht ist es Gemeinschaftssingen", meinte Doreen heiter, „wenn sie nicht bald kommen, könnten wir ja hineingehen."
„Warum eigentlich nicht", unterbrach, sie eine angenehme, freundliche Stimme, „drinnen ist es nämlich wärmer!" Sie waren so völlig überrascht durch das Erscheinen eines jungen Mannes mit einem Gesangbuch in der Hand, daß sie gar keine Worte fanden, um Einwände zu erheben; sie ließen sich durch die grünen Türen hineinfuhren und fanden sich auf der hintersten Bank im Saal einer Missionsgemeinde wieder.
„Wir sind jetzt richtig drin", flüsterte Doreen, „es ist eine Kirche."
Es war so etwas wie ein Gottesdienst, zweifellos. Jennifer reizte es zum Lachen. Was würden die zu Hause wohl sagen, wenn sie sie hier sehen könnten? Hier war nichts von der reichen, prunkvollen Kathedrale, an die sie sich aus Kindheitstagen erinnerte, aber über dem Podest war in großen, deutlichen Lettern zu lesen: „CHRISTUS STARB FÜR UNS".
Der Saal war nahezu besetzt, meistens junge Leute, wie Jennifer bei einem kurzen Blick in die Runde bemerkte.
Vorne erhob sich gerade ein Mann; offensichtlich wollte er eine Predigt halten. Seine suchenden Augen glitten in einem Augenblick über seine Zuhörer, und Jennifer fühlte plötzlich, daß sein fester Blick auf sie gerichtet war. In dem Augenblick kam ihr die Gewißheit, daß alles, was er jetzt sagen würde, für sie persönlich bestimmt war.
„Wir könnten geradesogut hierbleiben", flüsterte sie ihrer Begleiterin zu. Da begann der Mann vorn auch schon zu sprechen.
„Ich habe nicht die Absicht, euch heute Abend eine Predigt zu halten, Freunde", begann er in einer schlichten, ernsten Art, die Jennifer sofort ergriff und sie zu aufmerksamem Zuhören zwang, „ich möchte nur einige Minuten lang über einige der herrlichsten Worte in der Bibel zu euch sprechen. Der Apostel Johannes hat sie vor vielen, vielen Jahren geschrieben, aber sie sind heute genauso wahr wie damals: ‚Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat'. Und heute Abend möchte ich diese Worte zu meinem ganz persönlichen Zeugnis machen und euch sagen: Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat."
Jennifer hörte wie gebannt zu, wie er kurz die Geschichte seines früheren Lebens erzählte; wie er sich immer weiter von Gott entfernt hatte und in ein selbstsüchtiges Trachten geriet. Dann hatte er eines Tages in einer ähnlichen Versammlung wie dieser hier erfahren, daß er trotz aller seiner Sünden von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geliebt wurde. Aus Liebe habe Jesus sich selbst am Kreuz auf Golgatha für die Sünden des jungen Mannes dahingegeben.
Jennifer vergaß alle Verabredungen für diesen Abend, ja, sie vergaß auch das Mädchen neben sich, so hörte sie diesem Mann zu, der den wahren Sinn des Kreuzes zu erklären versuchte.
Natürlich hatte sie von Christus gehört - sie glaubte sogar, daß er auf Erden gelebt hatte und von denen, die ihn haßten, hingerichtet wurde. Aber niemals hatte sie bisher gehört, daß er bei seiner Kreuzigung die Sünde der Welt auf sich nahm, und daß er tatsächlich sein Leben dahingab, um die Welt zu retten, weil er die Welt liebte •... weil er diesen Mann liebte, der da vorn sprach . . . diese Leute, die in dieser Halle saßen . . . weil er sie, Jennifer Deane, liebte!
„Nun frage ich euch: Liebt ihr ihn?" fuhr der Prediger fort. „Selbst wenn ihr auf diese Frage mit Nein antworten müßtet, ändert das nichts an der Tatsache, daß er euch liebt und daß er auch eurer Sünden wegen ans Kreuz ging.
Bisher habt ihr für die Freuden der Sünde gelebt; ihr habt ihm in seiner Liebe und Barmherzigkeit den Rücken gekehrt Vielleicht habt ihr es wirklich nicht besser gewußt und es bisher niemals erfahren, daß der Herr Jesus euch so sehr geliebt hat."
Jennifer mußte hart schlucken. Das war die Wahrheit, was er gesagt hatte, jedes Wort. Sie hatte sich manchmal gefragt, was sie wohl tun würde, wenn sie Gott Auge in Auge begegnen müßte, aber sie hatte es im betäubenden Wirbel der Vergnügungen zu vergessen gesucht. Sie war bis zu ihrer Schulentlassung regelmäßig zur Kirche und Sonntagsschule gegangen, aber niemals hatte sie etwas Derartiges gehört. Dies war für sie etwas völlig Neues.
Und während der Prediger versuchte, das Leiden des Heilandes am Kreuz, das makellose Lamm Gottes, „zur Sünde gemacht", um eine sündige Welt zu erlösen, seinen Hörern bildhaft deutlich zu machen, wurden Jennifer die Augen geöffnet. Sie sah sich entblößt von all ihrem Glanz, den sie bei Menschen genoß, als ein durch und durch schuldiger Mensch im Angesichte Gottes. Dort am • Kreuz streckten sich zwei Arme nach ihr aus, um sie zu retten. Jennifer verlor jeden Sinn für Zeit und Raum; ihr Herz pochte rasend, und die Gedanken jagten sich in ihrem Hirn.
Der Prediger war zum Schluß gekommen, und eine junge Frau stand auf, um zu singen. Jennifer hatte noch nie eine Stimme gehört, die sie so tief angerührt hätte, und diese Worte - diese Worte:
„Da war eine; der wollte für mich sterben,
daß ich Unwürdiger sollte Leben erben,
den Pfad des Kreuzes wollte er beschreiten,
alle Schulden meines Lebens zu begleichen."
Die Versammlung war zu Ende. Der Prediger ging zum Ausgang, um den Leuten beim Hinausgehen noch die Hand zu geben.
„Komm schon, Jennifer", sagte Doreen ungeduldig, „daß wir nur bald hier rauskommen!"
Jennifer erhob sich und folgte ihrer Freundin in dem Strom der Menge, die sich langsam zur Tür hin bewegte.
„Guten Abend." Der Prediger nahm ihre Hand und drückte sie freundlich. „Sie sind fremd hier?"
Seine leuchtenden Augen schauten sie durchdringend an. Ihr Blick wurde unsicher.
„J-ja", stammelte sie, „aber Sie müssen gewußt haben, daß ich heute hierherkomme; denn alles, was Sie in Ihrer Predigt sagten, war auf mich gemünzt."
Er zog sie beiseite. „Ich wußte nicht, daß Sie kommen", sagte er schlicht, aber bestimmt, „der Herr aber wußte es; er gab mir diese Botschaft für Sie. Der Herr hat heute abend zu Ihnen geredet. Sagen Sie, haben Sie ihn als Ihren Heiland angenommen?"
Jennifer schaute blaß und gequält zu ihm auf und begegnete seinen forschenden Augen.
„Das ist mir alles so neu", sagte sie unsicher. „Ich habe es vorher nie gehört. Ich wußte nie, daß Jesus für mich starb. Ich möchte wissen - ich möchte Sie fragen, ob Sie eine Bibel für mich hätten, so daß ich das alles für mich selbst noch einmal lesen kann? Natürlich haben wir zu Hause irgendwo eine", fügte sie hastig hinzu, „aber ich glaube, ich weiß nicht, wo ich sie finden könnte."
Er lächelte, als er ein Neues Testament, mit einer besonderen Aufschrift versehen, vom Bücherregal nahm. „Dieses hier können Sie gern haben. Die Verse, die Sie suchen, sind alle besonders gekennzeichnet Wenn Sie über all diese Fragen irgendwann einmal mit mir sprechen wollen; würde ich mich freuen, Ihnen helfen zu dürfen. Ich heiße Ransome, Pastor Ransome."
„Danke"; sagte Jennifer und griff hastig nach dem Buch.
„Morgen Abend findet hier wieder eine Versammlung statt, wenn Ihnen daran liegt, zu kommen", fuhr er fort. „Ich werde für Sie beten. Leben Sie wohl. Gute Nacht, und Gott segne Sie!"
„Ich danke Ihnen!" sagte Jennifer noch einmal
Draußen auf der Straße, eilte sie zu Doreen hinüber, die ungeduldig am Bordstein stand. „Komm doch endlich, Jennifer", sagte sie schroff. „Diese Bude geht mir auf die Nerven. Was in aller Welt hast du dort noch zu tun gehabt?"
„0, ich habe ihn um eine Bibel gebeten, daß ich das alles noch einmal für mich lesen kann. Doreen, war es nicht wunderbar, was er uns heute Abend gesagt hat?"
Doreen zuckte mit den Schultern. „Das hat mich nicht getroffen" sagte sie leichthin. „Komm, wir trinken ein Glas Malzmilch und vergessen das alles. Und wenn ich diese Jungens das nächste Mal sehe - - !"
Sie gingen in die Milchbar und Doreen bestellte. Aber Jennifer machte keinen Versuch, ihr Glas auch nur anzurühren; so sehr war sie in ihr aufgeblättertes Testament vertieft.
„Doreen, hier ist es - schau her!" rief sie plötzlich aus. „Hier steht es schwarz auf weiß: ‚Christus Jesus kam in die Welt, Sünder zu retten, unter denen ich der erste bin'. Doreen, das gilt mir!"
Doreen stellte ihr Glas hin und schaute ihre Freundin fragend an. Auf deren Gesicht lag ein Glanz, den sie noch nie gesehen hatte, und ihre Stimme klang ungewohnt heftig. Doreen war plötzlich beunruhigt.
„Jennifer, du denkst doch nicht ernstlich daran, fromm zu werden? " fragte sie bestürzt.
Nach einer Pause antwortete Jennifer. „Nein, Doreen", sagte sie langsam, „es ist mehr als das. Es geht darum, daß ich Jesus Christus als meinen Retter annehme."
„Jennifer, sei doch nicht dumm!" rief die andere erregt. „Das kannst du doch nicht machen. Was werden die Leute sagen? Was werden deine Freunde von dir denken? Und was werden deine Eltern sagen? Wenn du wirklich tust, was dieser Prediger da sagt, wirst du noch eine richtige alte ‚Betschwester' werden. Ein Mädchen wie du kann doch gar nicht leben ohne Tanz und Partys und andere schöne Dinge!"
Jennifer stand auf und sah der anderen offen ins Gesicht.
„Ja", sagte sie ruhig, „bisher meinte ich auch immer, ich könnte ohne meine Vergnügungen nicht leben, aber das scheint mir jetzt gar nicht wesentlich zu sein. Doreen, ich habe es mir gründlich überlegt. Ich werde jetzt heimgehen."
Doreen sah, daß hier jeder Einwand zwecklos war; verärgert begleitete sie ihre Freundin an die Tür.
„Vielleicht ist es das beste, was du tun kannst", wagte sie noch zu äußern, „schlaf erst mal drüber, morgen läßt es sich wahrscheinlich vernünftiger mit dir reden."
Schweigend gingen sie zur Haltestelle.
„Ich warte noch, bis deine Bahn kommt, Doreen", begann Jennifer. aber ihre Begleiterin schnitt ihr mit einer ungeduldigen Handbewegung das Wort ab.
„Laß mich in Ruhe" sagte sie kühl, „geh lieber nach Hause und lies deine Bibel."
Jennifer zuckte unter dieser spöttischen Bemerkung zusammen, aber im Augenblick hatte sie keine Antwort darauf. Ihr Herz war zu voll. Ein unangenehmes Schweigen stand zwischen ihnen.
„Na schön", sagte sie schließlich, „gute Nacht!" Sie wandte sich rasch um und eilte nach Hause.
2
Als Jennifer die Pforte öffnete, bemerkte sie, daß das Licht im Wohnzimmer noch brannte. Die Familie mußte noch
auf sein. Aber natürlich, es war noch früh - etwas nach
neun Uhr. Rodger und Philip waren wohl zu Hause und unterhielten sich mit ihren Freunden. Sie fühlte sich nicht
imstande, ihnen gerade jetzt zu begegnen. Allein wollte sie sein. Vielleicht konnte sie leise hinaufgehen, ohne gesehen zu' werden; denn niemand würde sie jetzt erwarten. Sie öffnete leise die Haustür und trat in den Flur. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen; nun wußte sie, daß sie die Ihrigen nun doch begrüßen mußte; denn es war unmöglich, die Treppe ungesehen zu erreichen.
„Wer ist da? " hörte sie ihren Vater rufen.
‚Ach, ich bin es nur", antwortete Jennifer und kam näher. Alle waren da - Rodger und seine Freundin, Philip und einer von seinen Klassenkameraden, und Vater und Mutter.
„Jennifer, was ist denn los?" rief Frau Deane erstaunt. „Fehlt dir etwas?"
Jennifer versuchte zu lachen. „Ach was, natürlich nichts. Du hast doch selbst gesagt, ich sollte früh zurück sein, nicht wahr, Mutter?
Frau Deane lehnte sich in die Polster zurück. „Na ja, aber—"
„Wohl zuviel für dich, Mutti? "meinte Rodger, in einem Tonfall, der dem seines Vaters sehr ähnlich war. Er drehte sich in der gönnerhaften Art des „großen Bruders", die Jennifer immer in Wut brachte, zu ihr um. „Was ist denn passiert, Schwesterlein? Wolltest du heute ein braves, kleines Mädchen sein - oder ist die Party ins Wasser gefallen?" Bei diesen Worten zwinkerte er dem Mädchen, das neben ihm auf dem Sofa saß, bedeutungsvoll zu.
Jennifer merkte, wie sie rot wurde. „Ach nein," - sie suchte einen gleichgültigen Tonfall zu heucheln - „es hat überhaupt keine Party stattgefunden."
„Wo bist du denn dann gewesen? " fragte ihr Vater neugierig dazwischen.
Jennifer ging hinüber zum Kimin und wärmte ihre Hände am offenen Feuer; sie wollte es sich gut überlegen, ehe sie zu antworten versuchte. Sie sah, wie Glaire Neilson hinter der vorgehaltenen Hand Rodger eine Bemerkung zuflüsterte, während die Eltern vielsagende Blicke tauschten. Philip und Peter Thompson erwarteten mit jungenhafter Begeisterung das lustige Schauspiel, das nun folgen würde.
„Nun, um ehrlich zu sein, ich bin in der Kirche gewesen." Jennifer wandte sich wn und blickte sie bei diesen Worten fest an.
„Kirche?"
Das Wort kam unwillkürlich von allen, die im Zimmer waren, als wollten sie es nicht glauben, während Rodger lauthals lachte.
„Hoffentlich hast du auch für mich gebetet, meine Liebe", sagte er in gespielter Demut.
„Nein, ich habe noch nicht einmal an dich gedacht, Rodger", antwortete sie ruhig, „ich war zu sehr damit beschäftigt, für mich selbst zu beten." Es lag etwas- Ungewöhnliches in ihrem Tonfall; darum richteten sich jetzt wieder alle Blicke mit besonderem Interesse auf sie. Philip, der Jüngste, brach als erster das Schweigen.
„Das Gebetbuch hast du dir wohl als Andenken mitgenommen", sagte er erheitert und wies dabei auf das Buch in-ihrer Hand. -
Jennifer hielt es hoch, daß es alle sehen konnten.
„Es ist eine Bibel, ein Neues Testament", erklärte sie. „Ich habe es -bekommen, um einiges für mich nachzulesen. Ihr könnt euch gar nicht denken, was da alles drinsteht. Bis..
Die englische Ausgabe erschien unter dem Titel
"In all these things" im Verlag Oliphants Ltd., London
© 1953 by Marjorie Buckingham
© der deutschen Ausgabe 1969 beim
Verlag Hermann Schulte Wetzlar
Aus dem Englischen von Joachim Hoene
ISBN 3-87739-206-7
Darlene Deibler Rose Gottes Hand im Dschungel des Zweiten Weltkrieges
Kapitel 1
Nachdem wir sechs Monate lang in Holland die niederländische Sprache gelernt hatten, gingen mein Mann Russell Deibler, ein Missionar mit langen Jahren Missionserfahrung, und ich, seine junge Frau, an Bord der RMS Volendam, die uns zu den ostindischen
Inseln bringen sollte.
Auf den ersten Blick zeigten sich die Inseln mir als ein Garten Eden mit heißem Klima und hoher Luftfeuchtigkeit. Die mehr als 13 500 Inseln, die sich vom Südchinesischen Meer bis zum Indischen Ozean hin erstreckten, wurden zweimal im Jahr von starken Monsunregenfällen heimgesucht, die die meisten größeren Inseln in ein Meer von Schlamm verwandelten. Verschieden geartete Sümpfe und undurchdringliche Dschungel waren überall zu finden. Auf vielen Inseln gab es noch aktive Vulkane, die hin und wieder Flammen und glühende Lava ausspien. An den Inseln entlang zogen sich Korallenriffe, stille Lagunen und weiße Sandstrände, auf denen sich Kokospalmen und Hibiskuspflanzen sachte im Wind wiegten. »Wie herrlich«, jubelte ich, »ein Inselparadies.«
Am 18. August 1938, an unserem ersten Hochzeitstag, landeten wir in Batavia(3)
auf Java. Die Düfte meines neuen Heimatlandes waren fremdartig und doch verlockend, so ganz anders als alles, was ich vorher gekannt hatte. Jede Insel war einzigartig und unterschied sich von ihrer Nachbarinsel in vielerlei Hinsicht. Auf einigen gab es schwefelhaltige Mangrovensümpfe, die einen modrigen Geruch verbreiteten. Andere stanken nach Kopra, dem getrockneten Mark der Kokosnuss. Auf den Gewürzinseln konnte ich auch den Duft von Zimt, Muskatnuss und Nelken ausmachen. Und überall mischte sich der Geruch von Meersalz mit dem schweren Duft des in der Nacht blühenden Jasmin. Über die Märkte zu schlendern – ein buntes Treiben mit provisorischen Ständen, auf denen sich bunte Früchte und Gemüsesorten, von Eingeborenen gewebte Stoffe, Tontöpfe, wunderschöne Sarongs und Nippes-Sachen aus Gold und Silber türmten –, war viel interessanter als das Einkaufen in einem amerikanischen Supermarkt.
Die Kaufleute schlugen zwei Holzstückchen aufeinander und priesen mit monotoner Stimme ihre Waren an. Es gab keinen Marktpreis. Als ich das erste Mal einen Preis hörte, der doppelt so hoch war wie der Wert der Ware, ging ich davon … »Boleh tawar! Boleh tawar!«(4)
riefen die Kaufleute immer wieder und luden mich ein zu handeln.
Das tat ich dann auch! Das Leben dort war sehr interessant und fesselnd. Ich fühlte mich sofort zu den Leuten und dem Ort hingezogen. Unablässig quälte ich Russell mit tausend Fragen. In dem offenen Stadtkanal badeten Männer, Frauen und Kinder, fröhlich miteinander plaudernd, dort wuschen sie ihre Kleider oder ihr Gemüse, spritzten sich gegenseitig nass oder verrichteten ihre Notdurft – alles in unmittelbarer Nähe.
Mit dem Zug fuhren wir nach Surabaya weiter. Wir kamen vorüber an vielen terrassenförmig angelegten Reisfeldern und Teeplantagen. Drei Tage später setzten Russell und ich unsere Reise mit einem Dampfschiff nach Celebes fort, wo sich die Missionsstation befand.
Makassar, die Haupt- und Hafenstadt von Celebes, war eine wundervolle tropische Stadt. Weiße Sandstrände erstreckten sich rechts der Reisfelder. Eine große, sehr alte Festung mit einer altmodischen Kanone wachte über dem Hafen. Ozeanriesen gingen vor Anker und entluden ihre importierten Waren im Austausch gegen eine Ladung Kopra, Kaffee, Reis, Korn, Salz oder exotischer Gewürze.
Russell, der Schiffsreisen noch nie besonders gut vertragen konnte, hatte sich so weit erholt, dass er mir, nachdem die Gangway heruntergelassen worden war, an der Reling Gesellschaft leisten konnte: Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf eine Gruppe, die sich auf der rechten Seite der Gangway versammelt hatte.
»Die große Dame ist Margaret Kemp aus Endicott im Bundesstaat New York«, erklärte er. »Sie und die anderen alleinstehenden Damen arbeiten im Büro der Station und unterrichten in der Bibelschule.« Ich erkannte Lilian Marsh, denn sie sah ihrer Schwester Ethel – einer freundlichen Engländerin, die ich in London kennengelernt hatte – verblüffend ähnlich. Ihr Vater war der bekannte britische Prediger und Schriftsteller F.E. Marsh. Sowohl Ethel als auch Lilian hatten schon viele Jahre im umkämpften China Dienst getan, bevor Lilian nach Niederländisch-Ostindien versetzt worden war. Während ich die kleine Dame mit dem lockigen, im Nacken zusammengesteckten Haar betrachtete, konnte ich kaum glauben, dass sie all die Härten des Dienstes in Südchina durchlebt hatte. Neben ihr stand Philoma Seely.
Philoma, die Russell mir als ein wenig exzentrisch beschrieben hatte, war kleiner als Lilian. Ihr graues Haar glänzte wie Silber in der tropischen Sonne. Philoma war völlig taub, beherrschte seltsamerweise jedoch fließend die chinesische Sprache. Sie führte die Bücher der Missionsstation, unterrichtete in der Bibelschule und tat auch hin und wieder Dienst in der chinesischen Gemeinde.
Am Ende der Reihe der alleinstehenden Damen stand Margaret Jaffray. Sie war die Tochter von Dr. Jaffray, dem Vorsitzenden der Niederländisch-Ostindien-Mission. Ihr dunkles Haar war durchzogen von weißen Strähnen; eine randlose Brille saß auf ihrer dicken Nase, die jedoch dem fröhlichen Funkeln ihrer haselnussbraunen Augen keinen Abbruch tat.
»Willkommen daheim, Fremder!«, rief einer aus der Gruppe. Die anderen begannen zu winken.
»Das ist Wesley Brill, der Leiter der Bibelschule, begleitet von seiner Frau Ruby und der kleinen Tochter Donna«, erklärte Russell.
Vollkommen verzagt und voller Furcht schritt ich die Gangway hinab. Die Brills erreichten Russell als Erste und hießen ihn herzlich willkommen. Etwas unsicher stand ich abseits, doch die beiden Margarets, Lilian und Philoma kamen auf mich zu. Etwas zögernd schaute ich sie an und fürchtete, dass sie ein so junges Mädchen wie mich nicht so leicht akzeptieren würden; doch sie nahmen mich sehr herzlich auf. Ihre Freundlichkeit tat mir gut. Von diesem Augenblick an empfand ich Respekt und Liebe für sie, die auch während unserer gemeinsamen Arbeit, während des Krieges und des gemeinsamen Leidens nicht schwand.
Die Brills informierten uns darüber, dass Russell und ich in dem am Stadtrand gelegenen Gästehaus der Mission wohnen würden. Das Gästehaus verfügte über große, luftige, spärlich möblierte Schlafräume, die in ein Gemeinschaftsesszimmer und das Wohnzimmer mündeten. Der Kochbereich, das Badezimmer, die Toilette und die Zimmer für das Personal waren in einem separaten, durch einen Weg mit dem Haupthaus verbundenen Gebäude untergebracht.
Die Keramikfliesen waren angenehm kühl unter den Füßen. Nach dem Mittagessen zogen wir uns alle zurück – es war Zeit für die Mittagsruhe. Erschöpft kroch ich unter mein Moskitonetz. Es gab keinen elektrischen Ventilator, und die Hitze war überaus drückend. Ich schlief ein wenig, wachte jedoch schweißgebadet und unausgeruht wieder auf. Wie angenehm war jetzt ein erfrischendes Bad!
Nach einer belebenden Tasse Tee leerte sich das Haus. Jeder ging seinen Pflichten nach. Russell und Wesley gingen zum Büro der Schifffahrtslinie, um nach unseren Koffern zu fragen. Ich packte das Handgepäck aus, danach setzte ich mich auf unser Bett, schaute zum
Fenster hinaus und versuchte, all die vielen neuen und unterschiedlichen Geräusche und Düfte einzuordnen. Wie schön war es doch, hier zu sein, welch ein Vorrecht!
Beim Abendessen informierte mich Mr. Brill darüber, dass mein Sprachlehrer mich am nächsten Morgen um halb neun erwarten würde. Schon bald würde ich mich mit den Eingeborenen unterhalten können. Gott hatte mich in seinen Dienst berufen, und er würde mich auch für die mir zugedachte Aufgabe zurüsten. Die Sprache war ein Werkzeug, das zu gebrauchen ich lernen musste – und wenn er mir die Kraft dazu gab, dann würde ich sie gut einsetzen können.
Pünktlich um halb neun am nächsten Morgen wurde ich einem Indonesier mittleren Alters vorgestellt. Er nickte mir zu, und ich nickte zurück. Dann verließ Russell den Raum. Ich sprach kein einziges Wort Indonesisch, und der Sprachlehrer kein einziges Wort Englisch.
Er erhob sich vom Stuhl und verließ den Raum. Doch sofort kam er zurück, verbeugte sich und sagte: »Selamat pagi, Njonja!« Ich starrte ihn schweigend an. ›Ja, sicher‹, dachte ich bei mir. ›Was hat er jetzt nur gesagt?‹
Als ich nicht antwortete, verließ mein Lehrer abermals das Zimmer, kam wieder zurück und sprach diesmal ganz deutlich: »Selamat pagi, Njonja.«
Meine Gedanken überschlugen sich. Das war bestimmt eine Begrüßungsformel! Als er nun zum dritten Mal vor die Tür ging, war ich vorbereitet. Er kam zurück, verbeugte sich und wiederholte den Gruß.
Ich erhob mich von meinem Stuhl, verbeugte mich und erwiderte: »Selamat pagi, Njonja.«
Der kleine, korpulente Mann in dem gestärkten Baumwollanzug gestikulierte wild mit den Händen und schüttelte den Kopf. Er zeigte Das Bild der Deiblers auf ihrer offiziellen Arbeitserlaubnis auf sich und sagte immer wieder: »Tuan, Tuan.« Dann zeigte er auf
mich und sagte: »Njonja, Njonja.«
Ich musste schrecklich lachen, denn ich hatte gerade zu meinem Lehrer gesagt: »Guten Morgen, meine Dame!« Um ihm zu versichern, dass ich verstanden hatte, verbeugte ich mich und sagte:
»Selamat pagi, Tuan«, worauf er lächelnd erwiderte: »Baik, baik!«
(»Gut, gut!«) Diese erste Lektion hatte ich gelernt, und nie wieder sprach ich einen Mann mit »meine Dame« an.
Jeden Tag lernte ich mit meinem Lehrer die Sprache. Er machte seine Sache ausgezeichnet, forderte aber auch eine Menge von mir. Wenn er sich nachmittags mit einer Verbeugung von mir verabschiedet hatte, schlenderte ich in das Quartier der Dienstboten hinüber. Die Köchin, eine junge Frau, und der Wäschejunge lachten über mein Indonesisch und korrigierten mich. Wenn ich ein Wort falsch aussprach oder sie bat, etwas zu wiederholen, wurden sie immer lauter. Doch schließlich lernte ich, ihnen zu sagen, dass mein Gehör ausgezeichnet sei und dass ich nur Probleme mit der indonesischen Sprache hätte.
Celebes war eine Insel voller Gegensätze. Mehrere Tausend Meter hohe Berge erstreckten sich im Norden und Süden des Landes, und die geheimnisvollen blauen Seen waren Hunderte Meter tief. Dazwischen bedeckte üppige, tropische Vegetation die Landschaft. Auf den Bergen im Landesinnern waren viele Kalksteinhöhlen zu finden.
Ich liebte die Insel und ihre Bewohner. Doch ich wusste auch, dass mein Aufenthalt zeitlich begrenzt war. Schon bald würden wir weiterreisen in das »große unbekannte Land«, nach Neuguinea, und ich war sicher, dass die Gebete der Menschen hier auf der Insel Celebes uns dorthin begleiten würden. An einem Septembermorgen lernte ich einen von diesen Menschen kennen, Dr. Robert A. Jaffray.
»Da, neben Margaret, das ist Mr. Jaffray«, erklärte Russell, als das Schiff anlegte. Ich erkannte ihn sofort. Wie hätte man ihn übersehen können? Er überragte seine Mitreisenden um Haupteslänge und winkte uns mit seinem Tropenhelm zu. Sein kurzes, weißes Haar war ordentlich gekämmt, und er war glattrasiert. Sein Oberlippenbart war sorgfältig gestutzt. Er stand an der Reling mit der Würde eines Mannes von vornehmer Herkunft.
Margaret – er nannte sie zärtlich Muggins oder Muggie – half ihm von Bord. Sie trug die vielen Päckchen, die er als Geschenke für die Missionare mitgebracht hatte, und sah aus wie ein reich geschmückter Weihnachtsbaum. Dr. Jaffray kam auf mich zu und drückte mir herzlich die Hand.
»Das muss Darlene sein. Jetzt kann ich verstehen, warum Russell seinen Urlaub verlängert hat.« Seiner Größe und auffallenden Erscheinung nach zu urteilen, hätte ich ihn für einen sehr strengen Mann gehalten, doch sein warmes Lächeln und seine blitzenden Augen zeigten mir sehr schnell, dass ich mich geirrt hatte.
»Ich fürchte, wir haben Ihr Haus immer noch mit Beschlag belegt«, entschuldigte ich mich nervös.
»Das macht doch nichts. Mutter besucht noch Freunde in Singapur und Java. Sie wird vermutlich erst nach der Konferenz eintreffen.«
Die Konferenz für die Missionare in Niederländisch-Ostindien würde erst im November stattfinden; es blieb viel Zeit, sich von Mr. Jaffrays Begeisterung für Neuguinea anstecken zu lassen. Er trug eine zerknitterte Landkarte bei sich, auf der die Strecke von Oeta(5) bis zu den Wisselseen zu sehen war. Sobald sie ausgepackt hatten, begannen wir, Listen mit Ausrüstungsgegenständen und Versorgungsgütern zusammenzustellen und die Kosten zu überschlagen. Wir drei waren begeistert von dem Plan, das Innere Neuguineas für Gott zu gewinnen. Jede Information, die wir bekommen konnten, überprüften wir sehr sorgfältig.
Wir erfuhren, dass am 1. Januar 1937 ein holländischer Pilot mit Namen Mr. Wissel und sein amerikanischer Kopilot, Mr. Jack Atkinson, für die Babo-Ölgesellschaft einen Erkundungsflug über Neuguinea gemacht hatten. Das neue Jahr war gerade erst angebrochen,
und die Wolken hatten sich gelichtet, sodass die Piloten das schneebedeckte Zentralgebirge sehen konnten. Etwa 50 Kilometer weit erstreckten sich die Schneefelder, die hier und da von zerklüfteten, schneebedeckten Gipfeln und Gletscherseen unterbrochen wurden.
Ehrfürchtig betrachteten sie die unberührte Natur. Als sie über die Nordseite des Gebirgszuges flogen, entdeckten sie unter sich etwas, das aussah wie drei runde Wolken, die sich in die Berge schmiegten. Sie flogen etwas niedriger und erkannten, dass es sich nicht um eine Wolkenformation, sondern um drei kristallklare Seen handelte, und auf dem größten davon ruderten Männer und Frauen in Kanus. Und das in einem Teil der Welt, der als unbewohnt galt!
Als ich mit Russell zusammen die Luftberichte studierte, erfuhren wir, dass der Oeta, der in die Bandasee an Neuguineas Südküste fließt, im größten der Wisselseen, dem Paniaisee, entspringt. Wenn man dem Oeta zu seiner Quelle folgte, würde man ganz sicher auch noch andere Dörfer und bisher unbekannte Völker entdecken. Die niederländische Regierung, die die Ostindischen Inseln kontrollierte, stellte schon bald Geldmittel und Begleitmannschaften für diese Expedition zur Verfügung. Die Gruppe kämpfte sich am Fluss entlang durch den dichten tropischen Dschungel. Sie bestieg mit dichten Wäldern bewachsene Berge, um am Gipfel feststellen
zu müssen, dass ein neuer Gebirgszug sie erwartete, der noch steiler und noch zerklüfteter war als der vorige. Am Ende eines jeden ermüdenden Tages wurde schnell ein Schutzdach errichtet, worunter sie lagerte. Viele der Träger, vorwiegend Eingeborene der Küstenregionen, starben und wurden in flachen Gräbern entlang des nächtlichen Lagerplatzes begraben. Alle litten unter Hunger, da die Nahrungsmittel knapp waren, und unter der Kälte in den höheren Regionen. Als etwa einen Monat nach ihrem Aufbruch von der Küste die Überlebenden den letzten Gebirgszug ins Steinzeitalter hinabstiegen, folgte ihnen eine große Horde fast nackter Eingeborener
zum Paniaisee.
Einige Polizeibeamte, mehrere Gefangene und ein Offizier wurden in Enarotali zurückgelassen, wobei sie die hastig errichteten Zelte auf einem Bergabhang bewohnten, von dem man auf den
See blicken konnte. Die einzige Verbindung zwischen diesem primitiven Außenposten und der Außenwelt war ein batteriebetriebenes Radio.
Je mehr wir erfuhren, desto lieber wurden uns die Landkarte und die Geschichte Neuguineas. 1545 hatten die Spanier Anspruch auf die zweitgrößte Insel der Welt erhoben und ihr den Namen Neuguinea gegeben, weil ihre Bewohner den Volksstämmen an Afrikas Westküste ähnelten. Anfang des 19. Jahrhunderts etablierten holländische Händler die ersten europäischen Außenposten auf der Insel, und 1828 annektierten die Niederlande den westlichen Teil der Insel.
Intensiv studierten wir die Karte Neuguineas. Die Insel ähnelte einem riesigen paläozoischen Beutevogel – mit erhobenem Kopf und offenem Schnabel bereit, mit der hereinströmenden Flut die kleineren Molukkeninseln zu verschlingen. Der Brustteil Neuguineas liegt über dem obersten Zipfel von Australien und sein Schwanz in der Korallensee. Die ungeheuer lange Küstenlinie, die undurchdringlichen, die fast überall von Krokodilen und giftigen
Schlangen bewachten Mangrovensümpfe und die Kannibalenstämme hatten schon über die Jahrhunderte hinweg selbst die wagemutigsten Seefahrer davon abgeschreckt, das Land einzunehmen.
Am 21. Juni 1938 folgten Angehörige einer vom amerikanischen Museum of Natural History gesponserten Expedition unter der Führung von Richard Archbold dem Flusslauf des Baliem durch ein ca. 400 Kilometer östlich der Wisselseen gelegenes Tal. Sie wollten
Proben der Flora und Fauna am Fuß des Mount Wilhelm, eines der höchsten Gipfel Neuguineas, sammeln. Dort trafen sie auf ein dichtbesiedeltes Gebiet von Steinzeit-Kannibalen.
Immer wieder lasen wir die Berichte über die Ergebnisse der
Expedition und waren aufs Neue beeindruckt von der riesigen Aufgabe, die unzähligen Volksstämme Neuguineas zu erreichen, die im Gebirge lebten.
Die Missionskonferenz fand im November in Benteng Tinggi statt, einem Anwesen in den Bergen, etwa 60 Kilometer von Makassar entfernt gelegen. Benteng Tinggi bedeutet »hohe Festung«, und in der Tat war es ein Zufluchtsort vor der sengenden Hitze der Küste. Die Versammlungen wurden in einem riesigen, achteckigen Gebäude abgehalten, an das sich die Unterbringungsmöglichkeiten der Teilnehmer anschlossen. Zum ersten Mal lernte ich die anderen Missionarsfamilien kennen. Wir lachten viel zusammen, und die Konferenz verlief sehr harmonisch.
Einstimmig wurde beschlossen, dass Russell und ich zusammen mit einem anderen Ehepaar, Walter und Viola Post, zu den Wisselseen aufbrechen sollten. Schon vor der Konferenz hatten wir uns eine Arbeitserlaubnis beschafft, doch die Regierung wollte nicht gestatten,
dass Frauen die anstrengende Reise ins Landesinnere antraten. Bis sich die Zustände gebessert hatten, sollten Russell und Walter Post allein zu den Wisselseen reisen. Viola und ich würden in Makassar bleiben.
Anfang Dezember bestiegen Walter Post und Russell den Dampfer nach Ambon, wo sich der Sitz der Regionalregierung der Gewürzinseln befand. Dort kauften sie Schlauchboote, Campingausrüstung und Nahrungsmittel für sich und ihre Träger ein.
Der Gouverneur war sehr hilfsbereit und arrangierte für sie, dass
sie mit einem Schiff der Regierung nach Oeta an Neuguineas Südküste reisen konnten. Sie kamen sicher dort an und entluden ihre
Vorräte. Dann kehrte Walter Post nach Ambon zurück. Am Tag nach Weihnachten fuhren Russell und seine zehn eingeborenen Träger mit den Vorräten in einem Regierungsdampfer, ein Kanu im Schlepptau, stromaufwärts bis dorthin, wo die Stromschnellen begannen.
Von dort aus würden die Vorräte und das Kanu getragen werden müssen. Sie erreichten das Lager am späten Nachmittag des dritten Tages. Dies erfuhr ich aus einem Brief, den der Regierungsbeamte
mir freundlicherweise mitbrachte.
Ich erinnerte mich an das, was ich in dem Bericht der Pioniermissionare gelesen hatte, und unaufhörlich bat ich Gott um Hilfe und Kraft, um Sicherheit, Mut und Geduld für Russell. Zusammen mit den anderen Missionaren betete ich, dass Gott seine Hand über
ihn halten möge, damit er die Wisselseen erreiche. Wie sehr er litt und wie notwendig unsere Fürbitte war, sollte ich erst viele Wochen später erfahren.
Während Russells Abwesenheit drängte und ermutigte Margaret Kemp mich, mehr zu tun, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Die wöchentlichen Lektionen der Sonntagschule für die Jüngeren zu übersetzen und mehreren Lehrern zur Seite zu stehen – und das nach nur wenigen Monaten des Sprachstudiums –, war ihre Idee.
In regelmäßigen Abständen wurde ich dafür eingeteilt, mich in der Gemeindearbeit einzubringen, und man bat mich auch, im Kindergarten für die Kinder der Lehrer und Studenten auszuhelfen. Das war eine wertvolle Erfahrung für mich.
Auch weiterhin betrieb ich mein Sprachstudium, jetzt mit einem Lehrer der Schule für Angehörige der Kolonialverwaltung in Menado (Manado). Sein ausgezeichnetes Indonesisch spornte mich an, meine Sprachkenntnisse zu vervollkommnen. Schon nach wenigen Wochen kann jeder sich in Pasar, dem Umgangsmalaiisch, verständlich machen. Doch das richtige Indonesisch ist eine sehr schöne Sprache, es hat keine harten, kehligen Laute. Diese Sprache so gut ausgesprochen zu hören, ist, als würde man einer Sinfonie lauschen, die auf Wortinstrumenten gespielt wird – als würde man einen Renoir anschauen, ein Meisterwerk von Licht und Schatten.
Zu Beginn des neuen Schuljahres gab man mir ein englischsprachiges Buch für Kirchengeschichte und fragte, ob ich die Studenten des zweiten Jahrgangs unterrichten könnte. Gern war ich
dazu bereit, doch nachdem ich mich durch die ersten Kapitel gekämpft hatte, kam ich immer mehr zu der Überzeugung, dass ich mehr Begeisterung als Vernunft hatte walten lassen. Wie vermittelt man Kirchengeschichte an Studenten, die frisch aus dem Dschungel kamen und nur ihre eigene Küstenlinie und den Ozean kannten und erst seit einem Jahr wussten, dass überhaupt eine Welt außerhalb ihres begrenzten Horizonts existierte?
Das war eine anspruchsvolle Aufgabe! Die meisten Studenten in meinen Klassen waren Dyaks (Dayaks) aus Borneo. Da alle Stunden in Indonesisch abgehalten wurden, mussten sie sich ein Arbeitswissen in einer Sprache aneignen, die ihnen vollkommen fremd war. Viele von ihnen hatten noch nie einen Stift in der Hand gehalten. Neben ihren Sprachstunden brachte man ihnen Lesen, Schreiben, Mathematik, Musik und Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament bei. Allein schon still in einem Klassenzimmer sitzen zu müssen, war eine schwere Prüfung für sie; sie waren ein freies Volk, das am Rand der Zivilisation gelebt hatte. Nie hatten sie sich einem Zeitplan unterwerfen müssen. Ich liebte und bewunderte sie, wenn sie mit gerunzelter Stirn über ihre Bücher gebeugt im Klassenzimmer saßen und ihnen angesichts der extremen Hitze und der Konzentration Schweißtropfen die Wangen herunterliefen.
Ich fand Erfüllung, Freude und außerordentliche Befriedigung in all meinen Aufgaben. Dies war eines von Gottes wertvollen Geschenken an mich – schon als kleines Kind hatte ich Verantwortung übernehmen müssen. Niemals hatte ich Zeit gehabt, mich zu langweilen! Die Trennung von Russell hätte ich mir auch nie selbst ausgesucht, doch der Herr hatte mir, als ich auf seinen Ruf in die Mission antwortete, versprochen: »Geh … ich werde immer bei dir sein!« Die Gegenwart Gottes und seines Volkes machte mich ruhig.
Im Februar erhielten wir die Nachricht, dass Russell aus Manokwari ankommen würde. Meine Aufregung steigerte sich ins Unermessliche. Aber warum aus Manokwari, einem Ort an der Nordküste Neuguineas? Als das Schiff in den Hafen Makassars einlief, konnte ich es kaum noch erwarten. Ich stand ganz vorn unter den Leuten, die sich versammelt hatten, um die ankommenden Reisenden zu begrüßen. Doch wie erschrak ich, als ich einen ausgezehrten, verfallenen Fremden an der Seite von Walter Post entdeckte.
Die anderen Missionare erkannten den abgemagerten Russell als den Mann, den sie vor seiner Reise gekannt hatten. Doch wo war der Mann, den ich geheiratet hatte – der Mann, der nach Neuguinea aufgebrochen war? In nur 18 Tagen im Dschungel und wenigen Monaten spärlicher Ernährung hatte er mehr als 30 Kilogramm verloren! Darlene als frisch gebackene Missionarin (kurz nach ihrer Hochzeit).
»Darlene?« Als ich seine Stimme hörte, wusste ich, dass es Russell war, doch diese Stimme sollte nicht diesem ausgemergelten Fremden gehören. Schnell schlug ich die Augen nieder; ich wollte nicht, dass er mein Unbehagen bemerkte. Meine Zurückhaltung amüsierte ihn, doch der Schock, den ich empfand bei dem Gedanken, was er erlitten haben musste, saß sehr tief.
Nur mit Mühe konnte er gehen, und als er zu Hause die Schuhe und Strümpfe auszog, wusste ich auch, warum. Er hatte keine Haut mehr an den Fußsohlen und an den Zehen und litt unter fortgeschrittener Dschungelfäule.
Dr. Jaffray verständigte sofort einen Arzt. Nachdem dieser Russells Füße untersucht hatte, wandte er sich an mich und sagte: »Sehen Sie dieses Gewebe, das sich ablöst? Nehmen Sie jeden Morgen eine
Pinzette und reißen Sie es ab, bis das rohe Fleisch sichtbar wird.
Wenden Sie die Salbe, die ich Ihnen gebe, erst an, wenn Sie das verfaulte Gewebe entfernt haben. Das wird sehr schmerzhaft sein, doch es gibt keinen anderen Weg, den Pilz zu entfernen, der die Ursache für Mr. Deiblers Zustand ist.«
Jeden Morgen saß ich auf dem Bett und verband Russells Füße.
In meine unerfreuliche Aufgabe mischte sich noch das Gefühl der Fremdheit, die ich diesem abgemagerten Mann gegenüber empfand.
Russell lachte immer, wenn ich scheu zu ihm hochsah, während ich seine Füße versorgte. Es amüsierte ihn, dass mein überschäumendes Temperament gezügelt worden war.
Dr. Jaffray, seine Tochter Margaret und ich hörten stundenlang Russells Berichten über seine Erlebnisse bei dem Marsch zu den Wisselseen zu. Ich begann, mich darüber zu wundem, dass er dieses Abenteuer überhaupt überlebt hatte.
Während der ersten drei Tage hatten sich die Träger flussaufwärts gekämpft, und Russell erzählte, er habe sich bei allen seinen Reisen auf Borneos tückischen Flüssen niemals so unbehaglich gefühlt
wie angesichts dieser unfähigen Ruderer, die einmal mitten auf dem Fluss das Boot fast zum Kentern gebracht hätten. Russell hatte kein gutes Gefühl gehabt, als man ihm seine Träger vorstellte, und nun wusste er, dass er seiner Intuition hätte trauen sollen. Wie viele der Küstenbewohner Neuguineas bewegten sie sich lethargisch und langsam. Russell führte das auf die Auswirkungen des Dschungellebens zurück.
Die Küstenbewohner waren geschwächt vom Denguefieber und von immer wiederkehrenden Malariaanfällen. Sie kannten noch kein Chinin, das ihnen Linderung hätte schaffen können.
In Orawaja erwarteten sie, ein stabiles Basislager vorzufinden. Sie fanden jedoch nur eine Bambuskonstruktion mit einem Grasdach vor, das kaum Schutz vor dem Regen bot. Krankheitsbedingt standen Russell nur noch sieben Träger zur Verfügung. Die drei Kranken kehrten mit dem Kanu nach Oeta zurück. Nachdem sie sich hastig eine Mahlzeit bereitet hatten, teilten Russell und die übrigen Männer die Vorräte unter sich auf, packten ihre Rucksäcke, weil sie früh am nächsten Morgen aufbrechen wollten. Die Träger streckten sich auf dem Boden aus und waren bald eingeschlafen. Russell holte seine Bibel und sein Tagebuch aus seinem Rucksack. Er zündete eine Kerze an, las in der Bibel und schrieb die Ereignisse der vergangenen drei Tage nieder.
Der Weg war so gefährlich, wie er beschrieben worden war. Den ganzen Tag bahnten sich die Träger den Weg durch das dichte Dschungelunterholz. Jeder Tag führte sie tiefer ins Zentralgebirge
hinein, jeder Gebirgszug war höher als der vorhergehende. Sie überquerten vorsichtig schmale, über tiefe Schluchten ragende Felsvorsprünge, die der Oeta in den Felsen gegraben hatte. Der
Fluss tobte drohend unter ihnen hinweg, diente ihnen jedoch als Orientierung, damit sie den Weg zu seiner Quelle, den Wisselseen, finden konnten.
Die mit dichtem Dschungel bewachsenen Berge gaben nur ungern den Weg frei zu den Gebirgszügen, die mit teilweise unter Moos versteckten Tonscherben bedeckt waren. Diese gezackten Scherben schnitten sich durch die Ledersohlen von Russells Stiefeln. Am Neujahrstag erwachte Russell mit dem Gefühl, körperlich vollkommen erschöpft zu sein. Außerdem war er besorgt. Er hatte nur noch wenige Träger, zu wenige. Würden die Vorräte ausreichen?
Er brauchte Ermutigung für den Marsch hinein in die unbekannte Wildnis und öffnete seine Bibel an einer Stelle, wo es hieß: »Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst« (Josua 1,9). In seiner unnachahmlichen Weise hatte Gott Russell mit diesem Zuspruch gestärkt für die schrecklichen Tage, die noch vor ihm lagen.
Die vorausgehenden Träger mussten sehr sorgfältig darauf achten, die Steine und Felsbrocken, die ihnen im Weg lagen, nicht loszutreten, denn auf diese Weise konnte leicht ein Erdrutsch entstehen. Beim Hochklettern der fast senkrechten Berge mussten die Männer zuerst überprüfen, ob die Steine auch festsaßen, damit sich nicht ein Stein lockerte und die Nachkommenden verletzte.
Und dann immer der Monsunregen!
Spät am Nachmittag schlugen sie ihr Lager auf. Obwohl Russell bereits sehr erschöpft war, ging er zurück, um den Trägern zu helfen. Sie nahmen die notwendigen
Reparaturen an den Biwaks vor, doch es regnete trotzdem durch. Die Biwaks bestanden aus vier Pfählen, die in die Erde geschlagen und mit Rattan zusammengebunden wurden, mit einem Dach aus Gras oder Rinde. Die Kleidung der Männer war immer nass. Sie kauerten sich vors Feuer, um warm zu werden, und aßen apathisch ihren Reis, getrocknete Erbsen und gesalzenen Fisch.
Russell nahm sein Tagebuch zur Hand und las uns vor: »Dies war ein schrecklicher Tag; ich zwang mich, etwas zu essen und Wasser abzukochen, um etwas zu trinken, doch ich habe keinen Hunger.
Den ganzen Tag bin ich am Ende der Reihe geblieben und habe versucht, die Träger im Auge zu behalten. Aus ihren flüchtigen Blicken in meine Richtung und ihren geflüsterten Unterhaltungen schließe ich, dass sie planen zu verschwinden. Nachdem wir an diesem Abend unser Lager aufgeschlagen hatten, habe ich gebetet und mit ihnen gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir nur durchkommen können, wenn wir zusammenbleiben, und dass wir auf Gott vertrauen
und weitergehen müssen …«
Die Nacht verbrachte er im Gebet. Er bat Gott, er möge die Träger davon abhalten, die Flucht zu ergreifen. In den frühen Morgenstunden fiel er in einen unruhigen Schlaf. Das Geräusch der im Lager hin und her gehenden Träger weckte ihn auf. Wunder über Wunder, sie waren alle noch da.
Er konnte die Männer verstehen. Sechs Träger waren bei einer früheren Expedition auf dieser Route schon gestorben. Jeden Abend half Russell denen, die unter ihrer Last taumelten, das Lager aufzuschlagen. Er fühlte sich körperlich ausgelaugt durch den ständig steigenden Druck, während seine Kräfte schnell schwanden. Dies war keine Expedition mit einer großen Mannschaft, genügend Trägern und Vorräten; er war allein, erschöpft in einem unwirtlichen Dschungel, zusammen mit sieben ebenfalls erschöpften Trägern.
Jetzt aufzugeben, wo sie ein Drittel des Weges bereits hinter sich hatten, wäre ihr sicherer Tod gewesen. Immerhin konnte er die Träger überreden, ihn auch weiterhin zu begleiten, indem er ihnen versprach, einen Teil ihrer Vorräte zurückzulassen. Dennoch wusste Russell, dass es gut möglich war, eines Morgens aufzuwachen und festzustellen, dass seine Männer ihn während der Nacht im Stich gelassen und seine Vorräte mitgenommen hatten.
Seine einzige Zuflucht war das Gebet. So verbrachte er nach dem anstrengenden Tag die Nacht im Gebet um göttlichen Schutz. Er ermutigte sich immer wieder selbst mit dem Zuspruch vom Neujahrstag, wo es hieß: »Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? … Denn der
HERR, dein Gott, ist mit dir …« – und machte weiter.
Eine Woche später stellte Russell fest, dass es unumgänglich war, die zurückgelassenen Vorräte zu holen. Er und einige der stärkeren Männer gingen zurück. Nach dieser Pause waren die Träger wieder
in besserer Gemütsverfassung.
Als die Männer immer höher stiegen, waren die Tage zwar warm, nachts jedoch war es sehr kalt. Russell und die Männer kauerten sich in Decken gehüllt um das Feuer und hofften, durch die körperliche Nähe noch zusätzliche Wärme zu bekommen. Die Eingeborenen waren Küstenbewohner und die Kälte der höheren Lagen nicht gewöhnt. Sie litten sehr, einige weinten, weil sie glaubten, dass der Tod auf sie lauere. Es gab keinen Schutz vor den kalten Winden, die alles durchdrangen. Sie begannen, den Sonnenuntergang zu fürchten.
Dann kam dieser letzte schreckliche Tag, der 18. Tag – ein Tag, an dem die Expedition bald in einer Katastrophe geendet hätte, was nur durch die Gnade und Güte Gottes abgewendet wurde!
Sie bestiegen den vierzehnten Gebirgszug und kamen ins Land der Kapauku. Das Gebiet war relativ eben, und ein Pfad wand sich durch Gärten, in denen Süßkartoffeln angebaut wurden. Manchmal
steckten die Männer bis zu den Hüften im Schlamm.
Gegen 15 Uhr führte der Pfad sie zum Flussufer, wo sie Kanus fanden, die offensichtlich von Vertretern der Kolonialverwaltung benutzt worden waren. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie erkannten, dass es Selbstmord war, auf dem Fluss weiterzufahren.
Ein Sturm auf dem Paniaisee verursachte hohen Wellengang und gefährliche Stromschnellen an der Stelle, wo der See ins schmale Flussbett des Oeta drängte. Sechs Stunden lang warteten sie in den Kanus, dass der Sturm sich beruhigte. Gegen 21 Uhr zitterten sie alle vor Kälte, und Russell hatte das Gefühl, dass er nicht mehr länger warten konnte. Sie ruderten gegen die Wellen an, und die körperliche Anstrengung half ihnen, die Kälte zu ertragen. Dankbaren Herzensjubelten sie, als der Fluss sich endlich in den See öffnete. Sie mussten den See noch teilweise überqueren, um Enarotali, den Regierungsposten, zu erreichen.
Am Ufer waren schwache Lichter zu erkennen. Als sie gerade anfingen, sich zu entspannen, stieß Russells Kanu gegen einen aus dem Wasser ragenden Felsen und kenterte. Alle Männer und Teile
der Ausrüstung fielen in den aufgewühlten, eiskalten See. Die durchdringenden Hilferufe der Träger weckten das Personal des Regierungspostens auf. Russell und die Träger kämpften gegen die Strömung an, und es gelang ihnen, das zweite Kanu zu erreichen. Verzweifelt schöpften sie das Wasser aus dem Kanu. Fackeln tauchten am Ufer auf, und hilfreiche Hände zogen das Kanu ans Ufer. Zwar waren sie vollkommen durchnässt, doch alle Männer und das meiste Gepäck waren gerettet worden.
Am 13. Januar 1939 um Mitternacht setzte Russell, ein einsamer Pioniermissionar, seinen Fuß auf das Land, wie damals Josua in der Bibel, um den einheimischen Stämmen im Innern Neuguineas das
Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Bei Tagesanbruch schaute Russell aus der provisorischen Hütte des Regierungspostens. Er hatte sich noch nicht richtig erholt, doch er konnte es kaum erwarten, die Eingeborenen kennenzulernen. Dutzende brauner, sehr kleiner Menschen mit vollen Lippen und breiten Nasen drängten sich im Lager. Sie waren neugierig und wollten die Neuankömmlinge sehen. Ein ganz mutiger Mann bot Russell seinen gekrümmten Zeigefinger. Russell trat zurück und beobachtete, wie einer der Angestellten des Postens vortrat und den Finger des
Eingeborenen mit seinem ebenfalls gekrümmten Zeigefinger ergriff.
Beide Männer zogen ihre Hand nun fort, wobei sie einen scharfen Knall verursachten. Diese Zeremonie wurde mehrmals wiederholt je mehr und je lauter die Knalle, desto tiefer die Freundschaftsbande. Mutig trat nun auch Russell mit seinem neu gelernten Gruß vor und mischte sich unter die Stammesangehörigen. Ihr drahtiges Haar war mit einer Kruste aus Schmutz und Asche überzogen, und ihre kleinen Körper waren mit einer Mischung aus Schlamm und Schweinefett eingerieben, die die Poren verschloss und so die Kleidung ersetzte. Das einzige »Kleidungsstück«, das die Männer an ihrem Körper trugen, war ein Flaschenkürbis, der mit einer Schnur um die Lenden gebunden wurde und von einer anderen Schnur um den Hodensack festgehalten wurde.
Die kleinen Mädchen trugen Grasröcke, die Frauen kurze Röcke, die aus Bändern gefertigt waren. Von den Köpfen der Frauen und Mädchen hingen Netze, in denen sie bei Tag alles trugen, was nötig war, und die sie nachts sozusagen als steinzeitalterliche Thermounterwäsche um ihre kleinen Körper wickelten.
Schon im Kindesalter wurde bei Jungen und Mädchen die Nasenwand durchstochen. Man steckte einen Strohhalm hinein, bis die Wunde heilte, danach ersetzte ein kleines Schilfrohr den Strohhalm.
Von Zeit zu Zeit wurde das Schilfrohr gegen ein etwas größeres ausgetauscht, bis das Loch groß genug war, dass die Männer den Hauer eines Wildschweins oder ein Bambusstück und die Frauen einen an beiden Enden angespitzten Stock hineinstecken konnten. Auch die Ohrläppchen waren durchstochen – nicht für Ohrringe, sondern für einen Federkiel. Manchmal dienten die Löcher auch als Aufbewahrungsort für selbst gedrehte Zigaretten oder Bambuspfeifen.
Da sie keine Hosen und Hemden trugen, mussten sie einen anderen Weg finden, um verschiedene Dinge aufzubewahren! Ketten, die man aus Schneckengehäusen oder den Zähnen von Hunden und Ratten angefertigt hatte, wurden von beiden Geschlechtern getragen. Haarschmuck aus Federn zierten die kahl werdenden Köpfe der älteren Männer.
Die Hütten der Kapauku bestanden aus handgefertigten Holzlatten, die an einem Ende spitz zuliefen. Die Bäume wurden mit Steinäxten gefällt, die Stämme mit einem steinernen Krummbeil bearbeitet. Das Dach bestand aus Baumrinde, der Boden war die blanke Erde. Drei Steine bildeten die Feuerstelle. Die Familie schlief dicht gedrängt um das Feuer herum, zusammen mit den Schweinen, vor allem den Ferkeln. Starb eine Muttersau, wurden die Ferkel von den Frauen gesäugt.
Die Frauen bauten mehr als dreißig verschiedene Sorten Süßkartoffeln in dem Gebiet um den See herum an. Da sie kein Kochgeschirr besaßen, wurden die Kartoffeln manchmal draußen an der Feuerstelle mit heißen Steinen gedämpft, doch vorwiegend röstete man sie in der heißen Asche unter der Kohle auf der Feuerstelle im Innern der Hütte.
Schweine, Ratten, Langusten, Kaulquappen, Vögel, Raupen sowie Bienen- und Wespenlarven, Grashüpfer, Stinkwanzen und andere Insekten lieferten ihrem Speiseplan eine interessante Mischung zusätzlicher Proteine.
Muschelgeld diente den Kapauku als Zahlungsmittel. Russell stellte fest, dass man ein fettes Schwein für denselben Betrag bekommen konnte wie eine junge, kräftige Frau – mit einer Schnur von 40 bis 60 yo (die alten, dünnen Kaurimuscheln). Es war ein schwerer Schlag für meine weibliche Eitelkeit zu erfahren, dass ich bei diesem Stamm nicht wertvoller sein sollte als ein schmutziges fettes Schwein! Obwohl Russell einen Großteil seiner Zeit den Kapauku widmete, verbrachte er auch viele Stunden mit den freundlichen und sehr erfahrenen Angestellten des Regierungspostens. Auf diese Weise konnte er eine Liste mit Dingen zusammenstellen, die nötig waren, um eine Missionsstation hier an diesem Ort einzurichten.
Russell stand vor dem vollkommenen körperlichen Zusammenbruch. Er wusste nicht, wie er den gefährlichen und anstrengenden Rückmarsch zur Küste schaffen sollte. Doch da griff der Herr
ein: Während seines Aufenthalts bei verschiedenen Außenposten wurde ein Angestellter ernstlich krank. Der Gouverneur ließ ein Wasserflugzeug kommen, um den Mann fortbringen zu lassen.
Der Offizier von Enarotali bat um die Erlaubnis, dass entgegen den Gepflogenheiten Russell ihn begleiten dürfe. »Sehen Sie nur seine Füße an! Er wird es niemals bis Oeta schaffen!« Drei Stunden später landeten sie in Manokwari. Von dort buchte er eine Passage nach Ambon, wo Mr. Post zu ihm stieß. Zusammen fuhren sie nach Makassar weiter. Dieser Flug bewahrte Russell vor dem mörderischen Marsch zurück nach Oeta und sparte einen Monat Zeit.
Am Morgen, nachdem Russell uns die letzte Episode seiner Geschichte erzählt hatte, kam Dr. Jaffray in unser Schlafzimmer und sah, wie ich das abgefaulte Gewebe von Russells Füßen riss. Das Blut und der Eiter liefen mir die Arme hinunter. Eine Welle von Übelkeit ergriff Dr. Jaffray, und er drehte sich um und verließ wortlos das Zimmer. Er schloss sich in seinem Schlafzimmer ein, und als ich ihn mittags zum Essen rief, sagte er, er wolle nichts essen. Gegen 16 Uhr
kam er heraus und legte ein Manuskript vor mich hin.
Ich nahm es zur Hand und las das Vorwort für unsere Feldzeitschrift, The Pioneer (Der Pionier):
»An diesem Morgen schaute ich auf die blutenden Füße eines Missionars, sah seine Frau, die ihn versorgte, sah das Blut und den Eiter herausströmen, und ich dachte bei mir: Was für ein schrecklicher Anblick! Doch als ich das Zimmer verließ, sagte der Herr immer wieder zu mir: ›In meinen Augen sind es wunderschöne Füße!‹
Dann erinnerte ich mich an das Wort: ›Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt‹(6) – Frieden und Gutes den Männern und Frauen wie jenen in Neuguinea, die in Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Eines Tages wird alles vorüber sein. Eines Tages werden die müden, blutenden Füße der Missionare zum letzten Mal diese mit Tonscherben übersäten Berge überqueren. Eines Tages werden sie zum letzten Mal in eines jener neu entdeckten Täler hinabsteigen und die Frohe Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn, verkündigen. Eines Tages wird sich dieser Letzte zu Jesus
bekehren. Dann werden sich die Wolken teilen, und unser Heiland wird erscheinen.«
Ehrfürchtig legte ich das Manuskript auf den Tisch und schaute mit meinen tränennassen Augen in Richtung Osten. Ich wusste, bald würde auch ich mich in die lange Reihe unerschrockener Missionare einreihen, die ins Unbekannte aufgebrochen waren, um Gottes Frohe Botschaft zu verkündigen. Von jenem Tag an musste ich immer, wenn ich Russells Füße verband, an diese Bibelstelle denken. Ich stellte mir vor, wie unser Herr auf seine Füße blickte und sagte: »In meinen Augen sind das wunderschöne Füße!« Diese Erfahrung steigerte meine Sehnsucht,
Russell beim nächsten Mal zu den Wisselseen zu begleiten. Ich war ungeduldig. Dr. Jaffray hatte in seinem Artikel den Blick auf den Tag gelenkt, an dem alles vorüber sein würde. Doch ich wollte gerade erst anfangen! »Wann, Herr, wann?«
Kapitel 2
Unser Schlafzimmer wurde unser »Büro«, von wo aus alles, was zum Aufbau einer Missionsstation in Neuguinea gehörte, geplant und durchgesprochen wurde – das Problem der Träger, des Transports, der Vorräte und der Unterbringung. Russell konnte noch immer
nicht aufstehen. Eines Morgens kam Dr. Jaffray zu uns und verkündete: »Rus
(3) A.d.H.: Heute Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens.(4) A.d.H.: Svw. »Sie können feilschen! Sie können feilschen!« (5) A.d.H.: Heute meist als »Uta« bezeichnet. Damit ist sowohl der entsprechende Fluss als auch der gleichnamige Küstenort an dessen Mündung gemeint. (6) A.d.H.: Vgl. Jesaja 52,7.
Mütter in des Meisters Hand, Elisabeth Zentz
MUTTERS ERSTES FEST
Es mag vor etwa 30 Jahren gewesen sein, als hierzulande noch nicht die Rede war von Muttertag. Da las ich in einem Blatt des Auslandes von diesem sinnigen Fest. Und sogleich stand mir mein Mütterlein vor der Seele, dieses schlichte, vielgeplagte, allzeit überlastete, nie gefeierte und dennoch so hingebende Mütterlein, dem ich so viel verdankte.
Wenn eine einzige Mutter auf der Welt diesen Festtag verdiente, war nicht sie es? Und warum sollte sie nicht die erste sein in unserem Dorf, die diesen Tag feiern durfte?
Ich schrieb meinem ältesten Bruder, der gleich mir vor kurzem auswärts seine erste Anstellung erhalten hatte, und meinem jüngsten, der in Paris in der Lehre war. Beide gingen begeistert auf meinen Plan ein und machten es möglich, für diesen Tag Urlaub zu bekommen. Dann wandte ich mich an meine Schwester im Elternhaus.
Die mußte ja das Fest vorbereiten. Ein ordentlicher Anteil meines Monatsgehalts sollte ihr dabei behilflich sein. Und der zweite meiner Brüder, der zu Hause das Bäckerhandwerk erlernte, sollte seine ganze Kunst erproben. Bei ihm wurde eine Torte bestellt - nun, die größte Form, die er auftreiben würde, und verziert sollte sie sein. Er sollte einfach zeigen, was er konnte. Auf jeden Fall mußte draufstehen: „Unserer lieben Mutter zum Muttertag", damit sie wenigstens wußte, was los war.
Die Überraschung gelang prächtig. Als ich, die ich sonst nur in längeren Ferien zu Hause war, eines Samstagabends der Mutter beim Kartoffelschälen in der Küche plötzlich gegenüberstand, fiel ihr vor
freudigem Schreck das Messer aus der Hand. Ein wenig Schrecken war schon dabei, und erst, als ich sie überzeugt hatte, daß wirklich nichts passiert war und nur die „Sehnsucht nach Hause" mich hergetrieben hatte, siegte die Freude. Beim Abendbrot lachte unversehens der Älteste durchs Fenster mit einem mächtigen Maiblumenstrauß. Ja, da brachte sie den Mund nicht mehr zusammen vor Vergnügen.
„Gib acht, Mutter", neckten wir, „was sich zweit, das dritt sich." Aber da blitzten ihre sanften braunen Augen uns vorwurfsvoll an. „Seit wann seid ihr abergläubisch?" Dennoch verriet das Leuchten, das auf ihre Züge trat, daß ihre Gedanken nur, den Letzten und Fernsten, ihren Liebling, suchten. Der schlug dann in der grauen Sonntagmorgenfrühe ihren Bettvorhang zurück - wir hatten ihr strenge und außergewöhnliche Sonntagsruhe verordnet, um ungestört den Festtisch rüsten zu können - und diesmal gab es beiderseits Tränen. „Und nun will ich wissen, was los ist", schluchzte sie unter ihrem Betthimmel hervor. „Denn das habt ihr doch ausgemacht! Und es hat doch niemand Geburtstag!"
Als wir sie dann aber im Triumph an den festlich geschmückten Frühstückstisch geleiteten und sie die Widmung auf der wirklich kunstvollen Torte und den Glückwunschkarten las, begriff sie gar nichts. Ich mußte meine eigene Rührung bemeistern und ihr einen ausführlichen Vortrag halten über die Bedeutung des Tages. Als ich ihr von dem Jugendblatt sprach, in dem vom Muttertag die Rede war, sah sie mich von der Seite an: „Geh mir doch weg", sagte sie, und es war nicht zu ergründen, ob sie damit ihre Abneigung gegen ausländische „Moden" oder etwa den Zweifel in die Worte der Tochter bekunden wollte, der sie zutraute, daß sie diesen Tag extra erfunden hatte, weil - nun, weil sie manchmal an etwas phantastischen Ideen litt und an der Neigung, Feste zu feiern, wenn kein Mensch daran dachte.
Es gab dann einige buntbebänderte Päckchen zu öffnen, die allerhand Nützliches enthielten, und die Vater, der die Entwicklung der Dinge mit schmunzelndem Lächeln begleitete, zur Begutachtung unterbreitet wurden. Gerade als die Kirchenglocke das erstemal läutete, kam ein Pariser Schal zum Vorschein, ein Schal aus schwarzer Seide - nein, aus Samt? - Wir einigten uns auf „Seidensamt" - mit unwirklich blaßschimmernden Lilarosen. „Und den ziehst du heute an", kommandierte strahlend der Jüngste, „und dann gehen wir wieder einmal alle fünf mit euch in die Kirche."
„Geh mir doch weg!" sagte die Mutter zum zweitenmal und versuchte, sich des eitlen Prunkstückes zu entledigen. Aber was können zwei schwache Mutterhände ausrichten, wenn zehn starke, junge Arme sie umklammert halten? -
So wurde denn der Lilarosenschal in entsprechende Falten gelegt und mit einer alten Brosche festgesteckt. Dann wurde der Hahn, der zum Fest das Leben gelassen hatte, in die vorsichtig geheizte Backröhre geschoben. Ein mächtiger Holzklotz garantierte die Feuerung für eine Stunde - und Vater und Mutter gingen mit ihren fünf Kindern nach alter, lieber Gewohnheit zum Gottesdienst. Kein Mensch wußte von dem Fest, das in unserem Haus gefeiert wurde. Man wunderte sich bloß darüber, uns wieder einmal so alle zusammen zu sehen. Wir aber wandelten den ganzen Tag wie auf Rosen.
Denn jede Stunde trug den Duft des Niedagewesenen, Erstmaligen und Ursprünglichen, einen Schmelz, den alle späteren Muttertage, die vielleicht noch reicher ausgestaltet waren, entbehren mußten. Am Nachmittag, als der Vater mit den Brüdern einen Gang durch die Maienflur machte und Schwesterlein noch in der Küche hantierte, saß ich, die ich ja in wenigen Stunden wieder abreisen mußte, einen seltenen Augenblick allein bei der Mutter an ihrem trauten Fensterplatz. Sie unterrichtete mich über die jüngsten Dorfereignisse. Unwillkürlich glitten unser beider Blicke über die Straße hinüber zu dem stattlichen Nachbarhaus: „Ja, es ist hart", sagte die Mutter, „sehr hart! Du mußt doch einen Augenblick zur Karlintante hinübergehn. Sie dauert einen so in ihrer schrecklichen Einsamkeit."
Dann erzählte mir meine Mutter ausführlich, was sie mir in einem Brief nur knapp berichtet hatte: Drüben in dem großen, reichen Haus, in dem wir als Kinder so oft gespielt hatten, war während meiner Abwesenheit die einzige Tochter gestorben - im Wochenbett mit dem ersten Kind. Das Kindlein hatte sie nur acht Tage überlebt. Der Schlag hatte ihre Eltern um so härter getroffen, als vor fünf Jahren ihre andere ältere Tochter in wenigen Tagen durch eine Gehirnentzündung dahingerafft worden war. „Und nun haben sie niemand mehr", schloß meine Mutter ihren Bericht.
Es graute mir wirklich, als ich aus unserem heute. so besonders durchsonnten, belebten Haus in die totenstille, kalte Stube drüben trat, um die leidgeprüfte, einsame Mutter meiner Jugendfreundin zu grüßen. Ich fand sie über die aufgeschlagene Bibel gebeugt. Bei meinem Anblick stürzten ihr Tränenbäche aus den Augen. „Du", schrie sie mir entgegen, und alle Verzweiflung und ein wilder Vorwurf klang aus ihrem Wort. „Du kommst wieder! Und ihr alle kommt wieder! Und bei euch ist Leben, und hier ist alles tot, alles still, alles kalt! Denn von den Meinen kommt keins wieder, keins!"
Und die Hand, die sie mir so vorwurfsvoll ent-gegengereckt hatte, ballte sich zur Faust, und ein hagerer Finger wies auf die beiden, in dicke Goldrahmen gefaßten lebensgroßen Fotografien der Töchter, die in ihrer Jugendblüte von den Wänden lächelten. Ja, dies war Christine, an deren Totenbett ich gestanden, drin in der Kammer. Noch empfand ich den Schauer, der mich damals durchbebte, als meine Hand ihre kalte Stirn berührte, weil ich nicht fassen konnte, daß eine, die in diesen Stuben so wild mit uns getollt, plötzlich so starr daliegen konnte.
Und dies war das Brautbild von Emmy.
Sie war meine Freundin gewesen, ein feines Mädchen, das nicht die ausgetretenen Wege der wilden Dorflust gegangen war. Wie strahlte sie auf dem Bild! Ja, an ihrer Hochzeit hatte ich sie zum letztenmal gesehen. Und das Bildchen des winzigen, in Woll-wämschen gepackten Jüngelchens, sollte das ihr BUb-lein darstellen?
Mir selbst kamen die Tränen, und ich brachte kein Wort hervor. Aber das gequälte Mutterherz mußte sich Luft machen. „Wo", sagte sie, „wo ist ein gerechter Gott? Wo? Wo ist ein barmherziger Heiland? Waren sie nicht beide brav? Und besonders die Emmy, seit ihrer Schwester Tod! Hat sie sich nicht von allem Weltlichen zurückgehalten? War sie nicht das frömmste Mädchen im ganzen Dorf? Hat sie es nicht verdient, daß sie endlich in dem jungen Lehrer einen Mann bekam, der zu ihr paßte?
Warum durfte sie ihr Glück nicht genießen? Nicht einmal ein ganzes Jahr? Warum? Warum? -
Und warum müssen wir beide jetzt so ganz allein sein, der Vater und ich? Jetzt, wo wir alt werden? - Denn der Tochtermann, der Fred, hat sich von hier fortgemeldet. Es ist ihm nicht zu verdenken - er hält es in seinem verödeten Schulhaus nicht aus."
Ach, ich war so jung, so jung in meiner Lebens-und in meiner Glaubenserfahrung. Und ich war selbst so erschüttert. Ich wußte kaum ein Trostwörtlein diesem abgrundtiefen Leid gegenüber. Und ich war nur froh, als ich wieder in unsere sonnige Stube zu meiner Mutter flüchten konnte.
„Was soll man da sagen, Mutter?" Ich fragte es angstvoll, als ich wieder an ihrer Seite saß. „Man kann wirklich nicht begreifen, warum Gott so etwas zuläßt, und man kann verstehen, daß sie mit Ihm hadert." Da nickte meine Mutter ernsthaft.
„Freilich - man kann vieles nicht begreifen. Aber mit Gott hadern darf ein Mensch nicht, auch wenn er nicht begreift. Er soll aber in sich gehen."
Meine Mutter schwieg eine Weile. Mir war, sie kämpfte mit sich selbst, ob sie weiter reden sollte. Dann fuhr sie fort: „Sieh, ein Menschenleben ist wohl kurz, aber doch manchmal lang genug, daß man vieles begreifen lernt. Der Mensch ist oft selbst verantwortlich, wo er Gott Verantwortung zuschieben will. Manches rächt sich eben."
„Sieh" - sie mochte merken, daß ich ihren rätselhaften Worten nachsann - „du bist nun alt genug, daß man ein verständiges Wort mit dir reden kann. Und was ich dir jetzt sage, das hat mir meine Mutter schon gesagt.
Ich will gewiß niemand verurteilen. Aber ich denke so manchmal an vergangene Zeiten zurück. Du weißt, wir sind von jeher mit drüben - sie sah nach dem mir so düster erscheinenden Haus hinüber - verbunden gewesen. Schon die Großeltern waren verwandt und haben immer gute Nachbarschaft gehalten. Karolines Vater war mein Pate. Aber ein wenig schauten sie immer auf uns herab. Denn sie waren stets die wenigen - ein oder zwei Kinder - und wir waren immer viele. Darum sind sie wohl auch reicher geworden als wir.
Karlintante, in meinem Alter, war auch die einzige. Wir sind zusammen jung gewesen. Wir haben die Karoline manchmal beneidet, wir fünf Schwestern, weil sie drei Reihen breites Samtband auf ihren Röcken trug, während wir es höchsens zu einem schmalen Litzchen brachten.
Unsere Hochzeit war fast gleichzeitig. Aber als ihre Älteste, die Christine, auf die Welt kam, hatten wir schon ein Kindergräblein auf dem Gottesacker. Und kurz ehe ihre Zweite, die Emmy, geboren wurde, trugen wir unser Liesele zu seinem kleinen Schwe-sterlein hinaus. Damals kam sie oft, um mich zu trösten. Aber ihr Trost klang manchmal nach einem kleinen Triumph über ihre wohlgedeihenden Kinder oder nach einem leisen Vorwurf, als ob ich doch vielleicht an den meinen irgend etwas versäumt hätte.
Als du geboren wurdest, stärkte es meinen Mut nicht sehr, daß sie auch dir kein langes Leben prophezeite. Dann kam dein Bruder - und er erweckte ein wenig ihren Neid, weil's ein strammer Bub war. Als ich sie aber damit trösten wollte, daß der sich bei ihr auch noch einstellen könnte, lachte sie mich tüchtig aus: ‚Nein', sagte sie ganz offen. ‚Mehr als zwei sind bei uns nicht Mode. Und wo Mädchen sind, finden sich die Buben schon ein, wenn eine gute Mitgift bereit ist.'
Jedes deiner Geschwister bekam zu seiner Geburt seinen besonderen Spruch von ihr. Bei deinem zweiten Bruder meinte sie: ‚Jetzt heißt es aber früh aufstehen, daß die Stücke nicht zu klein werden.'
Als deine Schwester kam, sagte sie trocken und unverschämt: ‚Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.' Und an der Wiege unseres Jüngsten hielt sie es wohl für angebracht, mir dennoch gute Ratschläge zu erteilen. Ich lehnte sie aber ab, indem ich ihr kurzerhand erklärte: ‚Wir sind auch fünf Mädchen gewesen und haben uns alle fünf gefreut, als ganz spät ein kleiner Bruder ankam. Und unsere Mutter hat mich gelehrt: Besser sechs auf dem Kissen als eins auf dem Gewissen. Daran will ich mich halten.'
Von da an hat sie geschwiegen. Aber sie hat es nicht unterlassen können, bei Gelegenheit ein wenig zu sticheln über die Häuser mit dem vielen Kindergeschrei und -gekrabbel. Und das alte Lied ging von vorn an: Ihr beklagtet euch so manchesmal, daß die Nachbarsmädchen schönere Zopfbänder und bessere Kleider trugen als ihr. Und weißt du noch, wie eifersüchtig du warst, als sie vor einigen Jahren ihr Haus umbauten und neu und fein einrichteten? Und nun: wes wird es sein. .
„Hast du nie mit ihr davon gesprochen?" forschte ich leise, als meine Mutter schieg.
„Ich? Ach Kind, das ist nicht meine Sache. Das sähe nun so aus, als wollte ich triumphieren. Es ist hart genug - und lauter Gnade, wenn man seine Kinder großziehen und behalten darf und sie auf rechte Wege kommen. Und nur, damit du in diesen Dingen einen hellen Blick bekommst, darum erzähle ich dir das. Mit ihr zu reden über diesen Punkt, das will ich Gott überlassen. Er gibt nicht umsonst die stillen Stunden der schlaflosen Nächte. Und Er kommt mit jedem zurecht." - Damit endete das Gespräch, denn die Trennungsstunde schlug rasch.
Ob Er mit ihr zurechtgekommen ist? - Ich weiß es nicht. Ich habe sie in späteren Jahren nur selten besucht, weil mein Besuch immer die alten Wunden aufriß. Sie ist dann noch verhältnismäßig früh an einer Operation im Krankenhaus gestorben. Ihr Mann lebte zuletzt ganz allein und fand ein noch trostloseres Ende: Er lag eines Morgens tot im Stall. Niemand wußte, wie er gestorben war. Fremde teilten mit dem Schwiegersohn das Erbe. Und einmal, als ich wieder nach Hause kam, sahen fremde Gesichter hinter den gleichen Vorhängen hervor, die meine Freundin zur Hochzeit aufgesteckt hatte.
Mein Mütterlein feierte ihren letzten Muttertag mit uns vor dem Krieg. Hochbetagt erlitt sie dann einen Unfall, als der Kriegssturm über das Dorf brauste. Der Sohn, der im Elternhaus wohnte, setzte sein Leben ein, um ihr ärztliche Hilfe zu verschaffen. Sie aber ging still, wie sie gelebt, hinüber, ohne daß ihre drei in der Ferne weilenden Kinder etwas davon ahnten.
„Ich habe sie für euch alle versorgt", versicherte der Bruder, der mir, als man wieder zusammenkommen konnte, die schmerzliche Nachricht brachte. „Es hat ihr an nichts gefehlt. Ihr hättet nicht mehr tun können. Während der Beschießung trug ich sie in den Keller. Als es nicht mehr ging, blieb ich bei ihr und hielt sie im Arm. Dort ist sie entschlafen."
Dieses Bruders vier Kinder erfüllen nun das alte Elternhaus mit frohem Leben.
Neulich wanderte ich mit dem Jüngsten über den Heimatfriedhof, um all die Lieben vergangener Tage zu grüßen. So stand ich auch mit ihm an der Familiengruft des Nachbarhauses. Der prunkvolle Grabstein war der letzte Zeuge einstiger Wohlhabenheit. Da kam mir's in den Sinn, daß der Kleine, den sie eine Woche nach seiner Mutter hier eingesenkt, nun ein Mann wäre, der das Leben hätte weitertragen können in dem Haus, in dem jetzt Fremde wohnten.
Dann ging ich mit meinem Neffen, dem kleinen Albert, weiter an Großmutters Grab, um das unter-Wegs gepflückte Sträußlein niederzulegen. „Mutter?" sagte das Büblein, das eben die ersten Sprechversuche machte, und sah mit großen, fragenden Augen zu mir auf, als ich ihm die schon leise welkenden Wiesenkinder aus den lebenswarmenHändkin nahm. Irgendwie hatte er an diesem Ort dieses Wort aufgeschnappt.
Und mir war es einen Augenblick, als streiche ihre segnende Hand linde über die fröhlich flatternden Flachshärlein des Enkels, den ihre irdischen Augen nie geschaut hatten.
SPÄTE BLÜTEN
Mit besonderer Freude denke ich an jenes letzte Mutterfest zurück, das mein liebes Mütterlein auf dieser Erde feierte. Es war vor dem Krieg, und wir waren zum letztenmal im lückenlosen Familienkreis um sie versammelt. Ich genoß damals so ganz besonders das Zusammensein mit meinem jüngsten Bruder, den ich mit seiner Familie über ein Jahrzehnt nicht mehr sehen hatte, da er in weiter Ferne wohnte. Wi/ hatten einander so viel zu sagen und nütztejninchen Frühlingstag zum Gang über die heimitliche Flur, manche späte, stille Stunde zu trauter Zwiesprache.
Da nahm mich meine Mutter beiseite. „Höre", sagte sie in ihrer herzlich eindringlichen Weise, „paß ein wenig auf! Deine Schwägerin wird eifersüchtig, wenn du ihren Mann so oft mit Beschlag belegst und von ihrer Seite holst. Und du weißt ja doch . . . man muß besonders zart mit ihr umgehen."
Ich verstand, was meine Mutter mir sagen wollte. Mein Bruder hatte mir anvertraut, daß seine Frau ihr drittes Kindchen erwartete. Das war nicht so leicht. Die beiden Ältesten waren bereits erwachsen: Christa auf einem Büro, Christoph in einer kaufmännischen Lehre. Die Sorgen um dieses bevorstehende Ereignis waren öfters der Gegenstand unserer Gespräche.
Nun versuchte ich, meiner Schwägerin näherzukommen. Und eines Nachmittags, als wir miteinander Muster zu Kinderjäckchen studierten, öffnete sie mir ihr Herz.
„Ja", gab ich zu, „mit den großen Geschwistern
Geschichte des bekannten Neurochirurgen Ben Carson
Die siamesischen Zwillinge Lea und Tabea aus Lemgo wurden von Ben Carson getrennt. Leider überlebte Tabea diesen Eingriff nicht. In seiner Biographie erzählt Dr. Carson nicht nur von seinen beruflichen Erfolgen: Er lässt den Leser auch an seinem tiefen Glauben teilhaben, der ihn dazu motiviert, anderen Menschen zu helfen. Sein warmherziger Humor und seine geistreiche Art zu erzählen, machen diese Autobiographie zu einem echten Lese-Erlebnis!
überlebte Tabea diesen Eingriff nicht. In seiner Biographie erzählt Dr. Carson nicht nur von seinen beruflichen Erfolgen: Er lässt den Leser auch an seinem tiefen Glauben teilhaben, der ihn dazu motiviert, anderen Menschen zu helfen. Sein warmherziger Humor und seine geistreiche Art zu erzählen, machen diese Autobiographie zu einem echten Lese-Erlebnis!
VOR WORT Mehr Blut! Die Stille im Operationssaal wurde von erstaunlich ruhig erteilten Anweisungen unterbrochen. 50 Bluteinheiten hatten die Zwillinge bereits erhalten, doch die Blutung war noch immer nicht gestillt. „Es ist, kein typenspezifisches Blut mehr da", hieß es, „wir haben alles aufgebraucht' Diese Aussage löste unterdrückte Panik aus. Alle Konserven der Blutgruppe AB negativ waren von der Blutbank des Johns-Hop-kins-Krankenhauses abgerufen worden. Dabei brauchten die sieben Monate alten Patienten, die seit Geburt am Hinterkopf zusammengewachsen waren, unbedingt mehr Blut - oder sie würden sterben. Die einzige Chance auf ein normales Leben hatten sie nur jetzt und hier. Ihre Mutter, Theresa Binder (aus Ulm), hatte sich durch die &esamte medizinische Fachwelt durchgefragt und nur ein einziges Arzteteam gefunden, das bereit war, die Trennung ihrer Zwillinge zu versuchen, um beide am Leben zu erhalten.
Die meisten Chirurgen hatten ihr schlichtweg erklärt, das sei nicht möglich - wenigstens einer der Jungen würde die Operation nicht überstehen. Einen ihrer geliebten Söhne opfern? Theresa konnte den Gedanken nicht ertragen. Obwohl beide Kinder am Kopf miteinander verwachsen waren, hatte jedes schon im Alter von sieben Monaten eine eigene Persönlichkeit. Unter keinen Umständen wollte sie den Kampf um ihre Jungen aufgeben. Nach Monaten der verzweifelten Suche entdeckte sie schließlich das Ärzteteam des Johns-Hop-kins-Krankenhauses. Viele der 70 Mitarbeiter in dieser chirurgischen Abteilung erboten sich, Blut zu spenden; denn die Dringlichkeit der Situation war ihnen bewußt. Die mühsame, spannungsreiche 17stündige Operation hatte bereits gute Fortschritte gemacht.
An alles war gedacht worden. Nach nur kurzer Zeit hatte die Narkose gewirkt - ihr war eine komplizierte Prozedur vorausgegangen, denn die Patienten hatten einen gemeinsamen Blutkreislauf. Die Vorbereitungen zum kardiovaskulären Bypass hatten nicht länger gedauert als geplant (die fünf Planungsmonate und die zahllosen Proben hatten sich bezahlt gemacht). Auch an die Stelle zu gelangen, wo die Zwillinge miteinander verbunden waren, hatte den jungen erfahrenen Neurochirur-gen nicht allzu große Schwierigkeiten bereitet. Infolge der Maßnahmen zum Bypass hatte das Blut seine Gerin-nungseigenschaft verloren.
Nun blutete jede Stelle am Kopf der Kinder, die nur bluten konnte! Glücklicherweise konnte die städtische Blutbank innerhalb kürzester Zeit die benötigte Anzahl von Bluteinheiten ausfindig machen und zustellen, um die Operation fortzusetzen. Dank ihrer Fähigkeit und Erfahrung in ihrem Spezialgebiet schafften es die Chirurgen schließlich, die Blutung innerhalb weniger Stunden zu stillen. Die Operation konnte weitergehen. Endlich wurden die letzten Hautlappen über die offenen Wunden genäht, und die 22 Stunden dauernde Anspannung war vorüber. Die siamesischen Zwillinge Patrick und Benjamin waren zum ersten Mal in ihrem Leben eigenständige Menschen! Der leitende Neurochirurg, der den Operationsplan ausgearbeitet hatte, stammte aus einem Ghetto Detroits. Candy Carson
TSCHÜS, VATI! „Tja, Bennie und Curtis. Euer Vater wird nun nicht mehr bei uns wohnen." „Ja, warum denn nicht?" fragte ich nun schon zum soundsovielten Male und versuchte verzweifelt, den Kloß in meinem Hals runterzuschlucken. Ich konnte mich einfach nicht abfinden mit der merkwürdigen Unnachgiebigkeit in Mutters Worten. „Ich hab' ihn doch lieb, meinen Vati!" »Er dich auch, Bennie ... aber er muß gehen. Zu seinem und unserem Besten' - »Aber warum denn? Ich will nicht, daß er geht. Ich will, daß er bleibt, hier bei uns!" „Er muß gehen ..." „Hab ich irgendwas getan, weswegen er jetzt gehen will?" „0 nein, Bennie, absolut nicht. Dein Vater hat dich wirklich liebt' Nun kamen die Tränen doch, und zwar gewaltig. „Dann unternimm etwas, damit er zurückkommt!" - „Ich kann nicht. Daran läßt sich einfach nichts ändern' Mutters starke Arme hielten mich fest, sie versuchte mich zu trösten. Allmählich erstarb mein Schluchzen, und ich beruhigte mich. Sobald mich meine Mutter aber losließ, kamen die Fragen wieder. „Euer Vater hat ..' Sie machte eine Pause.
Obgleich ich noch jung war, wußte ich doch, daß sie nach Worten suchte, um mir zu erklären, was ich nicht begreifen konnte. „Bennie, dein Vater hat schlimme Sachen gemacht, etwas ganz Schlechtes' Ich wischte mir mit der Hand über die Augen. „Dann vergib ihm doch! Laß ihn nicht fort!" „Es geht um mehr als nur um vergeben, Bennie ..." - »Aber ich will, daß er hierbleibt mit Curtis und mir und dir!" Noch einmal versuchte Mutter, mir verständlich zu machen, warum Vater fortging, aber ihre Erklärung war für einen Achtjährigen nicht zu verstehen. Ich kann heute nicht mehr sagen, inwieweit ich begriff, warum mein Vater gegangen war. Und das, was in meinen Kopf hineinging, wollte ich nicht wahrhaben. Es tat mir so weh, von Mutter zu hören, daß mein Vater nie zurückkommen würde. Wo ich ihn doch so liebhatte!
Vater war stets aufmerksam und liebevoll. Er war oft unterwegs, aber wenn er nach Hause kam, nahm er mich auf den Schoß und spielte mit mir, wann ich nur wollte. Er hatte große Geduld. Ich staunte über die großen Adern auf seinem kräftigen Handrücken und drückte gern auf ihnen herum. Dabei beobachtete ich, wie sie sich wieder auffüllten. „Schau! Da sind sie wieder!" Wir hatten viel zu lachen, und ich versuchte mit der ganzen Kraft meiner kleinen Hände, seine Adern einzudrücken. Vater saß immer ruhig da und ließ mich spielen, solange ich woljte. Manchmal sagte er dann: „Schatz, du bist einfach nicht stark genug!' und ich drückte noch fester drauf. Natürlich bewirkte ich nichts, verlor irgendwann die Lust und spielte mit etwas anderem. Obwohl Mutter sagte, Vater habe schlimme Dinge getan, konnte ich ihn mir einfach nicht als „schlecht" vorstellen. Curtis, mein Bruder, und ich hatten ihn nie so erlebt. Hin und wieder hatte Vati uns etwas mitgebracht, ohne besonderen Grund. „Ich dachte, das könnte euch gefallen", meinte er dann augenzwinkernd. Abends ließ ich meiner Mutter oft keine Ruhe. Ich beobachtete die Uhr, bis es Zeit war, daß Vati von der Arbeit heimkam. Wenn es soweit war, rannte ich nach draußen, um auf ihn zu warten. Ich schaute so lange nach ihm aus, bis ich ihn auf dem Weg zu unserm Haus entdeckte. Mit einem „Vati, Vati!" lief ich ihm entgegen. Er fing mich mit offenen Armen auf, schwang mich hoch und trug mich ins Haus.
All das war zu Ende, als ich acht Jahre alt war und Vater 1959 unser Heim für immer verließ. Für mich jungen, seelisch tief verletzten Menschen sah die Zukunft unendlich trostlos aus. Ich konnte mir kein Leben ohne meinen Vater vorstellen und wußte auch nicht, ob wir, mein zehnjähriger Bruder Curtis und ich, ihn jemals wiedersehen würden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange ich an dem Tag, als Vater verschwand, noch weinte und fragte; ich weiß nur, daß es der traurigste Tag meines Lebens war.
Die Tränen trockneten zwar, aber das Fragen hörte nicht auf. Wochenlang bedrängte ich meine Mutter mit jedem nur vorstellbaren Argument, das sie dazu bewegen sollte, meinen Vater zurückzuholen. Sollte es nicht doch einen Weg geben? „Wie sollen wir denn ohne Vater zurechtkommen?" „Warum willst du ihn nicht mehr haben?« »Er wird bestimmt wieder anständig sein. Frag ihn doch! Bestimmt macht er nichts Dummes mehr!" Mein Betteln brachte jedoch nichts. Meine Eltern hatten schon alles besprochen und geregelt, ehe Curtis und ich davon erfuhren. „Mütter und Väter sollten zusammenbleiben", beharrte ich, „und beide sollten bei ihren kleinen Jungen sein." - „Ja, Bennie, du hast recht! Aber manchmal klappt das einfach nicht."
- „Ich verstehe nur nicht, warum!" sagte ich. Dabei dachte ich an alles, was Vati mit uns unternommen hatte. Fast jeden Sonntag war er mit uns im Auto unterwegs gewesen. Wir besuchten Freunde, und besonders bei einer Familie hielten wir oft an. Vater unterhielt sich mit den Eltern, während Curtis und ich mit den Kindern spielten. Erst viel später erfuhren wir die Wahrheit. Mein Vater hatte eine andere Frau und Kinder, von denen wir nichts gewußt hatten. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter hinter Vaters Doppelleben kam, denn sie belastete Curtis und mich nie mit dieser Sache. Heute, wo ich erwachsen bin, kann ich ihr nur das eine vorwerfen: sie sprang über ihren eigenen Schatten, nur um uns zu verheimlichen, wie schlecht es stand. Nie ließ sie uns wissen, wie tief der Schmerz bei ihr saß. Aber das war nun einmal Mutters Art. Sie wollte uns schonen und war überzeugt, sich richtig zu verhalten.
Erst Jahre später verstand ich, was „sein Betrug mit Frauen und Drogen« zu bedeuten hatte. Noch ehe meine Mutter von der anderen Familie erfuhr, hatte ich gespürt, daß es zwischen meinen Eltern nicht gerade gut stand. Streit hatten sie nicht miteinander; mein Vater ging einfach weg, wenn es Unstimmigkeiten gab. Immer öfter verließ er das Haus und blieb immer länger fort. Ich wußte nie, warum. Mutters Worte brachen mir aber dann doch das Herz, als sie sagte: »Dein Vater kommt nicht wieder' Ich habe ihr nie erzählt, daß ich jede Nacht vor dem Einschlafen betete: „Lieber Herr Jesus, hilf, daß Mutter und Vater wieder zusammenfinden." Ich war ganz sicher, daß Gott ihnen helfen würde, ihre Ehe zu heilen, damit wir wieder ein glückliche Familie sein könnten.
Eine Zukunft ohne Vater war für mich einfach nicht vorstellbar. Vater aber kam nie mehr nach Hause. Tage und Wochen vergingen, und ich stellte fest, daß wir auch ohne ihn zurechtkamen. Wir waren zwar ärmer dran, und ich merkte, daß Mutter sich Sorgen machte, obwohl sie gegenüber Cur-tis oder mir kaum etwas verlauten ließ. Allmählich (ich war etwa elf Jahre alt) wurde mir klar, daß wir drei tatsächlich glücklicher lebten als zu der Zeit, da Vater noch bei uns war. Es ging friedlich zu bei uns. Die Zeiten eisigen Schweigens waren vorbei. Wir verkrochen uns nicht mehr vor Angst in unser Zimmer so wie früher, wenn Mutter und Vater nicht miteinander redeten.
Damals hörte ich auf, um Vaters Rückkehr zu beten. „Ich glaube, es ist besser für beide, getrennt zu bleiben; was meinst du?" fragte ich Curtis. ‚ja, glaub' ich auch: So wie Mutter erzählte auch er nicht viel über seine Gefühle. Aber vermutlich hatte er ebenfalls festgestellt, daß es uns ohne Vater besser ging. An Wutausbrüche oder zornige Reaktionen kann ich mich nicht erinnern. Meine Mutter sagte aber, daß diese Erfahrung Cur-tis und mir viel zu schaffen gemacht hat. Zweifellos fiel uns die Umstellung sehr schwer. Trotzdem kann ich mich kaum an das erinnern, was vor Vaters Weggehen geschah. Vielleicht war das die beste Art, mit dem Schmerz umzugehen: ich vergaß.
„Dafür haben wir kein Geld, Bennie!" Nachdem uns Vati verlassen hatte, haben wir diese Rede wohl hundertmal gehört! Natürlich hatte Mutter recht. Bettelten wir wie in früheren Zeiten um Spielzeug oder Süßigkeiten, so mußten wir nun an Mutters Gesichtsausdruck ablesen, daß es ihr weh tat, unsere Bitten abschlagen zu müssen. Schließlich ließ ich die Fragerei bleiben. Es hatte doch keinen Sinn, um etwas zu bitten, was wir sowieso nicht bekommen konnten. Manchmal war ein Anflug von Arger in Mutters Gesicht. Ihre Stimme wurde dann ruhig und fest, und sie erklärte, daß uns Vater zwar sehr liebhabe, aber kein Geld für uns geben wolle. Ich kann mich dunkel daran erinnern, daß Mutter etliche Male vor Gericht ging, um Unterhalt für uns einzufordern.
Kurz darauf schickte Vater für ein oder zwei Monate Geld, jedoch nie den vollen Betrag, und jedesmal hatte er eine anscheinend stichhaltige Ausrede. „Ich kann euch dieses Mal nicht das ganze Geld geben, aber der Rest kommt bestimmt beim nächsten Mal. Versprochen:' Die Rückstände wurden nie beglichen. Kein Wunder, daß es Mutter schließlich aufgab, sich um finanzielle Unterstützung seinerseits zu bemühen. Daß Vater kein Geld gab, erschwerte unser Leben beträchtlich. Doch in meiner kindlichen Liebe zu einem Vater, der freundlich und liebevoll zu uns gewesen war, rechnete ich ihm das nicht an. Trotzdem konnte ich nicht verstehen, wie er uns liebhaben wollte und gleichzeitig das Geld für das Notwendigste verweigerte.
Ein Grund dafür, daß ich gegenüber Vater weder Wut noch Haß empfand, lag in Mutters Verhalten. Sie beschuldigte ihn fast nie, zumindest nicht, wenn wir dabei waren. Ich kann mich nicht erinnern, sie je schlecht über Vater reden gehört zu haben. Was für uns jedoch noch viel wichtiger war: Mutter schaffte es, ein Gefühl der Geborgenheit in unserem Drei-Personen-Haushalt auszustrahlen. Ich vermißte meinen Vater zwar sehr, fühlte mich aber zufrieden und wohl, nur mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammenzusein; denn wir waren eine wirklich glückliche Familie. -. Meine Mutter, eine fast ungebildete Frau, war In einer großen Familie unter schwierigen Umständen aufgewachsen.
Dennoch leistete sie Unvorstellbares in ihrem Leben, und obendrein schaffte sie ein kleines Wunder in unserem. Ich höre noch ihre Stimme, selbst wenn es schlecht um uns stand: „Bennie, es wird alles gut' Das war kein leeres Versprechen, sondern sie glaubte daran. Und weil sie so fest darauf vertraute, fühlten Curtis und ich uns sicher. Mutters Worte beruhigten und boten einen tröstlichen Schutz. Ihre Stärke wurzelte in ihrem tiefen Glauben an Gott und in ihrer Fähigkeit, Curtis und mir das zu vermitteln, was sie meinte. Wir wußten beide, daß wir nicht reich waren; und doch sorgten wir uns nicht darum, was wir essen oder wo wir wohnen würden, ganz gleich, wie düster es aussah. Mutter trug schwer an den täglichen Sorgen und der Verantwortung, uns ohne Vater zu erziehen.
Aber sie beklagte sich nie, jedenfalls nicht uns gegenüber. Auch bemitleidete sie sich nie selbst, sondern versuchte nach besten Kräften, die Lage zu meistern. Wenn sie lange von zu Hause weg war, um Geld zu verdienen, tat sie es für uns. Ihre Hingabe und Opferbereitschaft beeindruckten mich sehr. Abraham Lincoln sagte einmal: „Was ich bin oder jemals sein kann, verdanke ich meiner Mutter:' So würde ich es vielleicht nicht sagen, doch meine Mutter, Sonya Carson, übte wirklich den stärksten Einfluß in meinem Leben aus. Uber meine Erfolge zu reden, ohne zuerst auf meine Mutter einzugehen, wäre nicht möglich. Deshalb beginnt meine Geschichte mit ihr.
Wie die Weiten des Himmels, Tamera Alexander
 Kapitel 1
Kapitel 1
Sulfur Falls, Colorado-Territorium
26. Juli 1876
Molly Ellen Whitcomb stieg aus dem Zug und betrat den Bahnsteig von Sulfur Falls. Einen Moment
lang blieb sie stehen, da sie nicht sicher war, wohin sie gehen und was sie tun sollte. Und das nicht
nur in einer Hinsicht. Der Pfiff des Zuges hallte schrill von den Bahnhofswänden wider und wehte
über den offenen Bahnsteig, auf dem sich viele Menschen drängten.
Die Lokomotive stieß unablässig Rauch und Ruß aus. Ein unmissverständliches Räuspern hinter ihr
drängte sie, endlich weiterzugehen. Jeder Schritt kostete sie viel Kraft und machte ihr schmerzlich
bewusst, warum sie überhaupt hier war. Und wie tief sie gefallen war.
Sie klemmte sich die abgegriffene Zeitschrift unter den Arm und folgte dem Strom der aussteigenden
Fahrgäste. Vier Tage früher als geplant kam sie in Sulfur Falls an. Dem Bürgermeister von Timber
Ridge hatte sie ein Telegramm geschickt, um ihn über ihr früheres Eintreffen zu informieren, aber auf dem Telegrafenamt hatte man ihr mitgeteilt, dass die Telegrafenleitungen aufgrund schwerer Regenfälle außer Betrieb waren.
Sie warf einen Blick zum grauen Himmel hinauf, rieb sich den schmerzenden Rücken und bezweifelte, dass sich daran etwas geändert haben könnte. Hoch über der kleinen Viehhandelsstadt thronten im Westen die majestätischen Gipfel der Rocky Mountains, die stellenweise immer noch schneebedeckt waren. Bilder von den Bergen hatte sie schon gesehen. Schon die grauen Schwarz-Weiß-Fotos waren sehr eindrucksvoll gewesen, aber diese Pracht mit eigenen Augen zu sehen, war etwas völlig anderes.
Fast hatte sie das Gefühl, sie müsse aus Respekt einen Knicks machen. Doch dann kam plötzlich ein stärkerer Wind auf und sie verzog das Gesicht. Der Gestank von Dung lag schwer in der Luft, Müll säumte den Bahnsteig und den Straßenrand. Plötzlich reagierte ihr Magen auf den unangenehmen Geruch, und sie hielt sich eine Hand vor die Nase. Als der Schaffner ihr gestern in Denver erklärt hatte, dass Sulfur Falls die Endstation sei, hatte er nicht übertrieben. Hundert Meter hinter dem Bahnhof endeten die Zuggleise und führten in einem Bogen zum Bahnhof zurück.
"Das Gepäck kann dort hinten abgeholt werden, Ma am! Ganz hinten, links."
Obwohl sie kaum Luft bekam, hob Molly den Blick und sah, wohin der Schaffner deutete.
Er warf einen Blick auf die Zeitschrift unter ihrem Arm. "Soll ich das für Sie entsorgen, Ma am?"
Sie verstärkte ihren Griff um die Zeitschrift. "Nein, ich will sie noch behalten. Trotzdem vielen " Der
Dank erstarb ihr auf den Lippen, weil sich der Mann bereits abgewandt hatte.
Sie bewegte sich in die Richtung, in die er gedeutet hatte, als ihr Blick auf ein Geschäft auf der
anderen Straßenseite fiel. Das Holzschild über der Ladentür schaukelte im Wind, als wolle es Molly zu
sich locken. So leise wie das Flattern eines Schmetterlingsflügels regte sich ein Gedanke in ihr.
Sie zögerte und trat zur Seite, um die anderen Fahrgäste vorbeizulassen.
Sie hatte Skrupel. Dieser Gedanke stellte ihre Integrität infrage und widersprach allem, was sie ihren
Studenten am Franklin College in Athens, Georgia, nach Kräften hatte vermitteln wollen.
Skrupel. Integrität. Ehrlichkeit.
"Unrecht gepaart mit Unrecht ergibt noch kein Recht, Miss Cassidy", hatte sie im letzten Herbst eine
Studentin getadelt, die betrogen hatte und danach versucht hatte, sich durch Lügen aus der Affäre zu
ziehen.
Molly starrte das Holzschild an und wusste, dass sie genau das Gleiche versuchen würde, wenn sie
jetzt ihrem Impuls folgte: Sie würde versuchen, ein Unrecht durch ein zweites aufzuheben.
Plötzlich wurde ihr heiß und kalt, als sie sich daran erinnerte, wie sie erst vor drei Wochen am frühen
Morgen vor Beginn der ersten Vorlesung ins Büro des Collegepräsidenten bestellt worden war. Ihre
Entlassung vom Franklin College war schnell und demütigend gewesen. Was sie getan hatte, war
falsch gewesen. Das wusste sie. Das hatte sie nie infrage gestellt. Aber die Strafe war viel zu hart
ausgefallen, und sie hatte sich nicht damit abfinden wollen. Zumindest anfangs nicht.
Doch als Präsident Northrop ihr dargelegt hatte, was geschehen würde, falls sie sich weigerte, das
College zu verlassen und ihre Stelle aufzugeben, hatte sie sich gefügt. Sofort. Er hatte ihre einzige
Schwachstelle gefunden und sie erbarmungslos ausgenutzt.
Seinem "eindringlichen Rat", diese Stelle anzunehmen und hier ein neues Leben zu beginnen, hatte
er dadurch Nachdruck verliehen, dass er sich geweigert hatte, ihr für irgendeine andere Stelle ein
Referenzschreiben zu geben; nicht einmal für die Schulen im Osten, die sie ihm vorgeschlagen hatte.
Und ohne ein Referenzschreiben würde ihr kein angesehenes College und keine Schule je eine
Chance geben.
Sie atmete vorsichtig ein und strich mit ihrem Spitzenhandschuh über ihre blaue Jacquardweste. Sie
hatte hart dafür gearbeitet, sich ihren Doktortitel zu verdienen und einige Zeit später genauso wie ihr
Vater den Professorentitel zu bekommen. Damit hatte sie für Frauen in akademischen Berufen eine
Bresche geschlagen. Aber das alles hatte sie durch eine einzige Dummheit zunichte gemacht.
Am Ende hatte Präsident Northrop gewonnen, wie das bei Männern in einflussreichen Positionen
immer der Fall war. Denn jetzt stand sie hier, weitab von der Zivilisation und der Gesellschaft, und
alles, was sie sich erarbeitet hatte, zählte nicht mehr.
Molly traf ihre Entscheidung und steuerte zielstrebig auf das Geschäft zu.
Sie schaute sich um, um sich zu vergewissern, dass niemand sie beobachtete, doch dann schüttelte
sie leicht den Kopf und schluckte ein bitteres Lachen hinunter. In dieser Stadt kannte sie niemand.
Keine einzige Menschenseele. Einen entlegeneren Ort hätte man nicht für sie finden können, außer
vielleicht die Wildnis in Alaska. Wenn dort eine Stelle frei gewesen wäre, würde sie jetzt
höchstwahrscheinlich in der weiten, gefrorenen Tundra aus einem Zug steigen.
Gleichzeitig hatte das Franklin College Professor Jeremy Fowler eine strenge Ermahnung erteilt und
seine Professur bestätigt. Jeremy Fowler verschickte bereits Hochzeitseinladungen. Aber darauf
stand nicht ihr Name. Den bitteren Geschmack in ihrem Mund schluckte sie herunter. Vielleicht hätte
sie sich inzwischen an die ungleichen Maßstäbe für Männer und Frauen gewöhnen sollen, aber damit
tat sie sich immer noch schwer. Mit gesenktem Blick wartete sie, bis eine Kutsche vorbeigefahren war, bevor sie ihren Fuß auf die Straße setzte.
"Entschuldigen Sie, Ma am, aber das Gepäck müssen Sie dort hinten abholen."
Sie drehte sich um, um dem Schaffner zu sagen, dass sie nur eine kurze Besorgung erledigen müsse,
aber dieses Mal stand nicht der Schaffner hinter ihr. Aus dem regennassen Mantel und dem
triefenden, weitkrempigen Hut des Mannes schloss sie, dass er kein Angestellter der Eisenbahn war.
Und sie war sich ganz sicher, dass sie ihn noch nie gesehen hatte. An diesen Mann würde sie sich
erinnern.
Das Wort "attraktiv" beschrieb ihn nicht einmal ansatzweise. Früher hätte das genügt, um ihr
Interesse zu wecken. Doch das war vorbei.
Das Gesicht dieses Mannes wirkte offen und ehrlich, besonders sein Lächeln. "Mir ist aufgefallen,
dass Sie gerade erst aus dem Zug gestiegen sind, und nun ja, Ma am, dieser Stadtteil ist nicht
gerade besonders sicher. Ich wollte nur, dass Sie wissen, wohin Sie gehen. Denn falls Sie das nicht
wissen, Mädchen " Ein verschmitztes Funkeln trat in seine Augen, als er in einen makellosen
schottischen Akzent wechselte. " könnte es leicht passieren, dass Sie an einem Ort landen, an dem
Sie nicht sein wollen." Mit einem leisen Lachen tippte er an seinen abgetragenen Cowboyhut. "Dieser
Rat meines Großvaters, Ian Fletcher McGuiggan, kostet Sie nichts. Ich kann ihn auswendig, denn
diesen Satz hörte ich jedes Mal, wenn ich das Haus verließ."
Molly erkannte einen Flirtversuch genauso schnell wie eine Kakerlake an der Wand. Als Professorin
für romanische Sprachen schien sie eine Anziehungskraft auf Männer zu haben, die gern flirteten.
Aber das Verhalten dieses Mannes zeigte nicht die geringsten unlauteren Absichten. Ganz im
Gegenteil. Sein Tonfall klang ehrlich und offen und seine Aussprache verriet, dass er aus den
Südstaaten kam.
"Das klingt, als wäre Ihr Großvater ein sehr weiser Mann gewesen, Sir."
"Das war er. Starrköpfig wie ein Esel, aber auf der ganzen Erde findet man kaum einen
freundlicheren, einfühlsameren Menschen."
Molly brauchte eine Sekunde, bis sie merkte, dass sie jetzt lächelte. Und noch eine weitere Sekunde,
um sich bewusst zu werden, dass ihr Lächeln dieses Mal echt und nicht so mühsam und gekünstelt
war wie in den letzten Wochen, als sie sich dazu hatte zwingen müssen.
Aufgrund seines Akzents schätzte sie, dass der Fremde aus Tennessee stammte. Vielleicht auch aus
South Carolina. Eindeutig aus der Bildungsschicht. Sein Akzent war nicht mehr sehr stark ausgeprägt,
woraus sie schloss, dass er den Süden schon vor einer ganzen Weile verlassen hatte. Auch den
schottischen Akzent seines Großvaters hatte er erstaunlich gut nachgeahmt.
Sein Blick wurde wehmütig. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke."
"Und an dem Sie sich nicht wünschten, er wäre noch bei Ihnen", ergänzte Molly, die ahnte, was er
nicht sagte.
"Ja, Ma am." Er legte den Kopf schief. "Ich nehme an, Ihr Großvater war ein ähnlich guter Mensch?"
"Mein Vater. Aber er ist schon gestorben." Es verging kein Tag, an dem sie nicht wünschte, er wäre
noch bei ihr. Aber gleichzeitig hatte sie Gott in den letzten Wochen dafür gedankt, dass er nicht mehr
lebte. Ihre Bestrafung war schlimm genug, ohne dass sie auch noch ihrem Vater unter die Augen
treten musste.
"Mein Beileid, Ma am." Er nahm den Hut ab und seine Stimme wurde leiser. "Ist er erst vor Kurzem
gestorben?"
"Vor einem Jahr. Gestern war sein Todestag. Er war krank. Ich wusste also, dass seine Tage gezählt
waren. Wenigstens konnte ich mich von ihm verabschieden", flüsterte sie und staunte über dieses
sehr persönliche Gespräch mit einem völlig fremden Menschen. Und dann auch noch auf dem
Bahnhof einer abgelegenen Kleinstadt in Colorado. Ihr Vater hatte gesagt, dass ihr Abschied nicht für
immer wäre, sondern nur für eine Weile. Aber manchmal hatte sie das Gefühl, dass der Abschied
endgültig und nicht nur vorübergehend war.
Der Mann schaute sie an, ohne etwas zu sagen. Sie erwartete, dass durch das Schweigen eine
unangenehme Atmosphäre entstehen würde. Aber das geschah nicht. Eine unerklärliche
Unbefangenheit erfüllte sie. Etwas sagte ihr, dass Schweigen für ihn nichts Ungewohntes war, dass er
nicht jede Sekunde mit Worten füllen musste, obwohl er derjenige war, der sie angesprochen hatte.
So weit im Westen hatte sie eine solche Höflichkeit nicht erwartet, besonders nach der Begegnung
mit einigen sehr ungehobelten Männern, denen sie während ihrer zweiwöchigen Fahrt begegnet
war.
"Nun " Er setzte seinen Hut wieder auf. Bei dieser Bewegung klappte sein Mantel auf und ein
Sheriffstern, der an seiner Weste steckte, kam darunter zum Vorschein. "Entschuldigen Sie, wenn ich
Sie aufgehalten habe, Ma am. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffe, es gefällt Ihnen in
Sulfur Falls."
Ihr lag auf der Zunge, ihn zu fragen, was er über Timber Ridge wusste, aber als sie den Sheriffstern
sah, gab sie diesem Wunsch nicht nach. Mit einem Mann in einer einflussreichen Position wollte sie
nichts zu tun haben, auch wenn er noch so freundlich und aufrichtig wirkte. "Guten Tag, Sir. Und
noch einmal danke für Ihre Fürsorge."
Molly wich dem Matsch und den Hinterlassenschaften der Tiere so gut sie konnte aus und setzte
ihren Weg über die Straße fort. Sie widerstand dem Wunsch, sich noch einmal nach dem Sheriff
umzusehen. Ein Lieferwagen polterte viel zu schnell durch die Straße. Der Fahrer, dessen Wangen
und breite Koteletten sich aufblähten, sah nicht so aus, als wollte er anhalten. Molly schaute ihn
finster an, blieb aber mitten auf der Straße stehen, bis er vorbeigefahren war. Ungehobelter
Hinterwäldler!
Die Hauptstraße wies tiefe Fahrrillen und Schlaglöcher auf. Das Überqueren der Straße stellte eine
Herausforderung dar, besonders in ihren Stiefeln mit den hohen Absätzen.
Eine ziemlich große und stinkende Hinterlassenschaft eines Rindes lag vor ihr auf dem Weg. Sie wich
zur Seite, um nicht hineinzutreten. Aus der großen Menge derartiger Hinterlassenschaften schloss
sie, dass eine Viehherde mitten durch die Hauptstraße getrieben worden war. Unglaublich.
Sie war dankbar, als sie unbeschadet von Menschen und Tieren den Gehweg auf der anderen Seite
erreichte, stieg die Stufen hinauf und bahnte sich mit einem unguten Gefühl ihren Weg über den
ungleichmäßigen hölzernen Brettersteg. Vor der Ladentür blieb sie stehen und zog die Taschenuhr
ihres Vaters aus ihrer Handtasche. Die Postkutsche nach Timber Ridge würde in einer halben Stunde
abfahren, und sie müsste vorher noch ihren Gepäcktransport in die Wege leiten. Ihr blieb also nicht
viel Zeit.
Sie zwang ihre zitternden Nerven, sich zu beruhigen, und öffnete die Tür.
Ein Mann stand hinter der Verkaufstheke und suchte etwas in einer Schublade. Erst als Molly ihn sah,
wurde ihr bewusst, wie sehr sie sich gewünscht hatte, eine Frau würde sie bei diesem Kauf bedienen.
Vor ihr tauchte das Bild ihres Vaters auf, begleitet von einer mahnenden Stimme und einem unguten
Gefühl im Magen. "Gut gemacht, Dr. Whitcomb", hatte ihr Vater geflüstert, als sie mit ihrer Urkunde
in der Hand neben ihm gestanden hatte. "Ein Vater könnte nicht stolzer auf seine Tochter sein."
Das war vor vier Jahren gewesen. Seine Worte und die Erinnerung daran waren für sie immer noch
sehr lebendig, wenn auch im Moment aus einem völlig anderen Grund. Als sie daran dachte, was ihr
Vater von den Entscheidungen halten würde, die sie in letzter Zeit getroffen hatte, stellte sie infrage,
ob sie das, was sie jetzt vorhatte, wirklich tun sollte. Aber da sie wusste, wie ihre Zukunft aussehen
würde, wenn sie es nicht machte, ignorierte sie die warnende Stimme.
Der Verkäufer hob den Blick. "Guten Tag, Ma am. Was kann ich für Sie tun?"
Sie warf einen schnellen Blick auf die Uhr, die hinter ihm an der Wand hing. Sie wollte direkt zur
Sache kommen. "Ich möchte " Sie atmete tief ein. " einen Ring kaufen."
"Ah!" Die Miene des Mannes strahlte auf. "Dann sind Sie hier genau richtig, Ma am. Brentons
Juweliergeschäft hat die größte Auswahl an Ringen in ganz Sulfur Falls."
Molly bemühte sich, beeindruckt zu wirken.
Er schaute sie an. "Lassen Sie mich raten. Ihr Geschmack geht eher in Richtung Rubine."
Sie schüttelte den Kopf und suchte nach den richtigen Worten. Das zu verlangen, was sie wollte, fiel
ihr schwerer, als sie gedacht hatte. "Was ich möchte, ist "
"Nein, nein!", lächelte er. "Verraten Sie es mir nicht." Er rieb sich nachdenklich das Kinn. "Saphire",
sagte er mit hoffnungsvoller Miene.
Er schien ganz nett zu sein und sie wollte ihn nicht enttäuschen, aber ihr lief die Zeit davon. "Nein,
Sir. Diese Steine sind sehr hübsch. Aber mir schwebt etwas anderes vor. Und ich habe nicht viel Zeit.
Wenn ich Ihnen also einfach "
"Diamanten!", strahlte er. "Das hätte ich mir gleich denken können. Kommen Sie! Folgen Sie mir! Wir
haben hier drüben einige schöne Diamantringe."
Die abgestandene Luft in dem Laden wurde noch stickiger, als Molly ihren nächsten Satz formulierte.
"Ich suche keinen Ring mit einem Stein, Sir. Ich suche etwas viel " Sie schluckte und hörte das Klirren
seiner Schlüssel. "Einfacheres."
Er hatte sich gebückt, um einen Schrank aufzusperren, erstarrte jetzt aber in seinen Bewegungen und
richtete sich langsam auf. "Ah, ja. Ich verstehe." Er schmunzelte leise. "Dann sollten wir die Sache
vielleicht anders angehen, Ma am. Beschreiben Sie mir doch einfach, welche Art von Ring Sie
suchen. Dann zeige ich Ihnen, was wir für Sie haben."
Ihr Mund fühlte sich an, als wäre er mit frisch gepflückter Baumwolle ausgestopft. Sie biss sich
seitlich auf die Zunge, nur ein wenig, um ihren Mund zu einer natürlichen Reaktion zu bewegen.
Diesen Trick hatte ihr ein älterer Professor mit auf den Weg gegeben, bevor sie ihre erste Vorlesung
am College gehalten hatte. "Was ich suche, ist ein Ehe " Sie brach ab. Sie brachte das Wort nicht
über die Lippen. Aber sie musste es sagen.
Sie konnte sich nicht überwinden, dem Verkäufer in die Augen zu schauen. Herr, bitte vergib mir.
Wieder einmal. "Ich würde mir gern Ihre Eheringe ansehen, Sir. Nichts Ausgefallenes. Ihr
schlichtester Ring genügt."
Er starrte sie an. "Verstehe", flüsterte er, aber Zweifel traten in seine Miene. Er schaute hinter sie.
"Kommt Ihr Mann auch noch? Um den Ring mit Ihnen gemeinsam auszusuchen?" Er sagte das fast
hoffnungsvoll, als wollte er sie nicht vorschnell verurteilen.
"Nein", antwortete sie leise.
Der Verkäufer schaute sie prüfend an, bevor er zu einem Schrank im hinteren Teil des Ladens ging.
"Wir haben normalerweise verschiedene Silber- und Goldringe, aber die einzigen Silberringe, die wir
im Moment haben, sind mit Edelsteinen besetzt. Wenn ich Ihnen also die billigsten Ringe, die wir
haben, zeigen soll "
Bildete sie sich nur ein, dass er dieses Wort betonte?
" haben Sie zwei Möglichkeiten." Er legte ihr zwei Ringe hin, benahm sich dabei aber deutlich
barscher als am Anfang.
Sie konnte es nicht erwarten, das alles hinter sich zu bringen, und nahm den einen in die Hand. Er sah
hübsch aus. Glänzendes Gold mit zarten Gravierungen, die dem Ring ein gebürstetes Aussehen
verliehen. "Wie viel kostet dieser Ring bitte?"
Er nannte ihr den Preis, und sie versuchte, den Ring nicht zu schnell zurückzulegen. Dafür müsste sie
als Lehrerin drei Monate arbeiten! Sie griff nach dem anderen Ring. Auch er glänzte, aber ihm fehlten
die Kunstfertigkeit und die Farbtiefe. "Wie viel kostet dieser Ring?"
Er antwortete ihr nicht sofort. "Der hier kostet vier Dollar."
Das entsprach ihrem finanziellen Rahmen eindeutig besser. Sie hielt ihn in verschiedenen Winkeln ins
Licht. "Warum ist dieser Ring so viel billiger?"
"Weil er nicht aus reinem Gold ist. Er ist nur aus Messing mit einer dünnen Goldbeschichtung."
Sie betrachtete den Ring genauer, dann zog sie ihre Handschuhe aus und steckte ihn sich an den
Ringfinger ihrer linken Hand. Er passte perfekt, als wäre er eigens für sie angefertigt worden. Vor
ihrem inneren Auge ging sie ihre Optionen ein letztes Mal durch und kam zum gleichen Schluss wie
vorher. Sie wusste, dass ihr keine andere Wahl blieb. "Ich nehme ihn. Danke." Schnell zählte sie ihre
Scheine ab, legte sie auf die Theke und wandte sich zum Gehen.
"Ich möchte Sie nur noch einmal darauf hinweisen, Ma am: Ihnen ist klar, dass der Ring, den Sie
gekauft haben, nicht echt ist?"
Molly blieb an der Tür stehen und hatte schon die Hand auf dem Türgriff liegen, als seine Worte in
der Stille nachschwangen und ihr ihre tiefere Bedeutung bewusst wurde. Ohne sich noch einmal
umzudrehen, öffnete sie die Tür. "Ja, Sir. Das ist mir sehr wohl bewusst."
Alexander Tamera
Frauen in der Bibel, John MacArthur
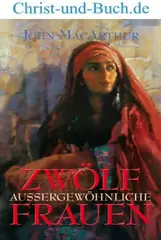
Eines der einzigartigen Merkmale der Bibel ist die Art und Weise, wie sie Frauen erhebt. Die Bibel ist weit davon entfernt, Frauen zu erniedrigen oder sie herabzusetzen – vielmehr erweist sie ihnen Ehrerbietung, adelt ihre Rolle in Familie und Gesellschaft, erkennt die Bedeutung ihres Einflusses an und preist die Tugenden der Frauen, die besonders gottesfürchtige
Vorbilder waren.
Vom allerersten Kapitel der Bibel an wird uns berichtet, dass Frauen, so wie auch Männer, den Stempel des Bildes Gottes tragen (1Mo 1,27; 5,1-2). Frauen spielen in vielen biblischen Erzählungen eine wichtige Rolle. Ehefrauen werden als verehrte Partnerinnen und geliebte Gefährtinnen ihrer Ehemänner angesehen, nicht als Sklaven oder Möbelstücke im Haushalt (1Mo 2,20-24; Spr 19,14; Pred 9,9). Am Berg Sinai gebot Gott den Kindern, sowohl den Vater als auch die Mutter zu ehren (2Mo 20,12).
Dies war eine revolutionäre Vorstellung in einer Zeit, als in den meisten heidnischen Kulturen Männer über ihren Haushalt herrschten, während Frauen im Allgemeinen als niedrigere Geschöpfe angesehen wurden, als bloße Dienerinnen der Männer. Natürlich erkennt die Bibel göttlich festgelegte Rollenunterschiede zwischen Männern und Frauen an – viele von ihnen
sind allein schon anhand der Schöpfungsumstände gut ersichtlich.
So haben Frauen beispielsweise die einzigartige und lebenswichtige Aufgabe, Kinder zur Welt zu bringen und sie zu pflegen und aufzuziehen. Frauen benötigen selbst ein besonderes
Maß an Unterstützung und Schutz, da sie in körperlicher Hinsicht »schwächere Gefäße« sind (1Petr 3,7). Dementsprechend kennzeichnet die Schrift die richtige Ordnung in Familie und
Gemeinde: Die Männer sind das Haupt ihres Hauses und müssen es beschützen (Eph 5,23), und in der Gemeinde sollen sie die Rolle von Lehrern und Führern übernehmen (1Tim 2,11-15).
Allerdings besitzen Frauen keineswegs eine Randfunktion oder einen zweitklassigen Status (Gal 3,28) – im Gegenteil:
Die Schrift scheint Frauen eine spezielle Ehre zukommen zu lassen (1Petr 3,7). Den Ehemännern wird gesagt, sie sollen ihre Frauen aufopfernd lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt – wenn nötig sogar auf Kosten ihres eigenen Lebens (Eph 5,25-31). Der Wert einer tüchtigen Frau wird von der Bibel anerkannt und hochgehalten (Spr 12,4; 31,10; 1Kor 11,7). Mit anderen Worten: Von der ersten bis zur letzten Seite stellt die Bibel Frauen als außergewöhnlich dar.
In der biblischen Beschreibung der Patriarchen nehmen ihre Frauen immer den ihnen gebührenden Platz ein. Sara, Rebekka und Rahel spielen im ersten Buch Mose eine große Rolle im Handeln Gottes mit ihren Ehemännern. Mirjam, die Schwester von Mose und Aaron, war eine Prophetin und Liederdichterin – und in Micha 6,4 ehrt Gott sie zusammen mit ihren Brüdern als
Führungsperson während des Auszugs aus Ägypten. Debora, ebenfalls eine Prophetin, richtete Israel vor der Zeit des Königtums (Ri 4,4). Biblische Berichte über das Familienleben stellen
Frauen oftmals als weise Ratgeber ihrer Ehemänner heraus (Ri 13,23; 2Kö 4,8-10).
Als Salomo König wurde, ehrte er öffentlich seine Mutter; als sie in seine Gegenwart trat, beugte er sich vor ihr nieder, bevor er sich auf seinen Thron setzte (1Kö 2,19). Sara und Rahab werden in Hebräer 11 ausdrücklich unter den Glaubenshelden aufgeführt. Auch Moses Mutter (Jochebed) findet sich in dieser Auflistung andeutungsweise wieder (V. 23). Im Buch der Sprüche wird die Weisheit als eine Frau personifiziert.
Die neutestamentliche Gemeinde wird ebenfalls als eine Frau dargestellt, als die Braut Christi.
Im sozialen und religiösen Leben Israels und der neutestamentlichen Gemeinde wurden Frauen niemals in den Hintergrund verbannt. Zusammen mit den Männern nahmen sie an allen Festen und öffentlichen Gottesdiensten in Israel teil (5Mo 16,14; Neh 8,2-3). Von Frauen wurde nicht verlangt, dass sie sich verschleiern oder sich auf öffentlichen Plätzen still verhalten sollen – so wie es in einigen Kulturen des Nahen Ostens heute der Fall ist (1Mo 12,14; 24,16; 1Sam 1,12).
Auch Müttern (nicht nur Vätern) oblag die Verantwortung und Autorität für die Belehrung ihrer Kinder (Spr 1,8; 6,20). In Israel durften Frauen sogar Land besitzen (4Mo 27,8; Spr 31,16). Von den Ehefrauen wurde geradezu erwartet, dass sie viele Angelegenheiten ihres eigenen Haushalts regelten (Spr 14,1; 1Tim 5,9-10.14).
All dies steht in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie andere alte Kulturen Frauen für gewöhnlich erniedrigten und entwürdigten. In biblischen Zeiten wurden Frauen in heidnischen Gesellschaften oftmals nur mit etwas mehr Würde als Tiere behandelt. Einige der bekanntesten griechischen Philosophen, die als die größten Geister ihrer Zeit angesehen wurden, lehrten, dass Frauen von Natur aus minderwertige Geschöpfe seien.
Selbst im Römischen Reich (möglicherweise der Höhepunkt der vorchristlichen Zivilisation) wurden Frauen normalerweise nur als beweglicher Besitz betrachtet (als persönliche
Habe ihrer Männer oder Väter) und genossen kaum eine höhere Stellung als Sklaven im Haushalt. Auch dies unterschied sich erheblich von den hebräischen (und biblischen) Vorstellungen von der Ehe als einem gemeinsamen Erbe und einer gemeinsamen Elternschaft, in der sowohl dem Vater als auch der Mutter von den Kindern Ehre und Gehorsam entgegengebracht werden sollten (3Mo 19,3).
Heidnische Religionen neigten dazu, die Abwertung von Frauen weiter zu unterstützen und zu verstärken. Natürlich hatte die griechische und römische Mythologie ihre Göttinnen (wie z.B. Diana und Aphrodite), doch sollte man keineswegs annehmen, dass die Anbetung von Göttinnen zu einer verbesserten gesellschaftlichen Stellung von Frauen führte. Das Gegenteil war der Fall. In den meisten Tempeln, die Göttinnen gewidmet wurden, dienten heilige Prostituierte – Priesterinnen, die sich selbst für Geld verkauften und dadurch angeblich ein religiöses Sakrament ausführten.
Sowohl die Mythologie als auch die Praxis heidnischer Religionen war für gewöhnlich äußerst erniedrigend für Frauen. Männliche heidnische Gottheiten waren launenhaft und manchmal schamlos frauenfeindlich. Religiöse Zeremonien waren häufig unverhohlen obszön – sie schlossen Dinge ein wie erotische Fruchtbarkeitsriten, Tempelorgien, pervertierte homosexuelle Praktiken und in ganz schlimmen Fällen sogar Menschenopfer.
In eine Welt hineingekommen, in der sich römische und hebräische Kulturen kreuzten, erhob das Christentum die Stellung der Frau auf eine noch nie da gewesene Ebene. Unter den
Jüngern Jesu befanden sich mehrere Frauen (Lk 8,1-3) – eine Praxis, die unter den Rabbinern seiner Zeit nahezu gänzlich unbekannt war. Doch dies war noch nicht alles, er unterstützte
ihre Jüngerschaft sogar, indem er sie als etwas darstellte, das wichtiger ist als häusliche Tätigkeiten (Lk 10,38-42). Als Christus sich das erste Mal als der wahre Messias zu erkennen gab,
tat er dies vor einer samaritischen Frau (Joh 4,25-26).
Er behandelte Frauen immer mit einem Höchstmaß an Würde – sogar die Frauen, die ansonsten als Ausgestoßene angesehen wurden (Mt 9,20-22; Lk 7,37-50; Joh 4,7-27). Er segnete ihre Kinder (Lk 18,15-16), weckte ihre toten Verwandten auf (Lk 7,12-15), vergab ihnen ihre Sünden (Lk 7,44-48) und stellte ihre Tugendhaftigkeit und Ehre wieder her (Joh 8,4-11). Auf diese Weise erhob er die Stellung der Frau an sich.
Somit überrascht es nicht, dass Frauen im Dienst der frühen Gemeinde eine bedeutende Rolle einnahmen (Apg 12,12-15; 1Kor 11,11-15). Als die neutestamentliche Gemeinde an Pfingsten geboren wurde, waren mit den wichtigsten Jüngern auch Frauen anwesend und beteten (Apg 1,12-14). Einige Frauen waren für ihre guten Werke bekannt (Apg 9,36), andere für ihre Gastfreundschaft (Apg 12,12; 16,14-15), wiederum andere für ihr gutes Verständnis von der gesunden Lehre und für ihre geistlichen Gaben (Apg 18,26; 21,8-9).
Johannes’ zweiter Brief war an eine führende Frau aus einer der Gemeinden unter seiner Aufsicht gerichtet. Selbst der Apostel Paulus, der von Bibelkritikern zu Unrecht als männlicher Chauvinist karikiert wurde, übte regelmäßig seinen Dienst zusammen mit Frauen aus (Phil 4,3). Er erkannte ihre Treue und ihre Begabungen an und ließ ihnen Grüße ausrichten (Röm 16,1-6; 2Tim 1,5).
Mit zunehmendem Einfluss des Christentums auf die westliche Gesellschaft begann sich auch die Stellung der Frau erheblich zu verbessern. Einer der frühen Kirchenväter, Tertullian, verfasste gegen Ende des 2. Jahrhunderts ein Werk mit dem Titel On the Apparel of Women (»Über die Kleidung der Frauen«).
Er sagte, dass heidnische Frauen, die kunstvolle Haarverzierungen, unanständige Kleidungsstücke und Körperschmuck trugen, von Gesellschaft und Mode gezwungen wurden, den wirklichen Glanz echter Weiblichkeit aufzugeben.
Als die Gemeinde zu wachsen begann und das Evangelium zunehmend Frucht trug – so stellte er als Gegensatz heraus –, kleideten sich Frauen bescheidener und gewannen gleichzeitig an
Stellung. Er erkannte an, dass heidnische Männer gemeinhin klagten: »Seit sie eine Christin ist, trägt sie nicht mehr so prächtige Gewänder!«
Christliche Frauen wurden als »Priesterinnen des Anstands«
bekannt. Aber, so Tertullian, als Gläubige, die unter der Herrschaft Christi lebten, waren Frauen in geistlicher Hinsicht reicher, reiner und somit herrlicher als die extravagantesten Frauen in der heidnischen Gesellschaft. Bekleidet »mit der Seide der Rechtschaffenheit, dem feinen Leinen der Heiligkeit, dem Purpur des Anstands« erhoben sie die weibliche
Tugendhaftigkeit in unvergleichliche Höhen.
Selbst die Heiden erkannten dies an. Chrysostomos, möglicherweise der wortgewandteste Prediger des 4. Jahrhunderts, berichtete, dass einer seiner Lehrer, ein heidnischer Philosoph
namens Libanius, einmal sagte: »Welch Frauen ihr Christen
habt!«4
Libanius wurde zu seinem Ausruf veranlasst, als er hörte, dass Chrysostomos’ Mutter mehr als zwei Jahrzehnte lang keusch blieb, nachdem sie im Alter von zwanzig Jahren
Witwe geworden war. Mit zunehmendem Einfluss des Christentums wurden Frauen immer weniger von Männern als Vergnügungsobjekte missbraucht. Vielmehr wurden sie für ihre
Tugend und ihren Glauben geehrt.
Christliche Frauen, die sich aus heidnischen Gesellschaften heraus bekehrten, wurden automatisch von vielen erniedrigenden Praktiken befreit. Frei von öffentlicher Ausschweifung
in Tempeln und auf Bühnen (wo Frauen systematisch entehrt und abgewertet wurden), erhielten sie zu Hause und in der Gemeinde eine herausragende Stellung, wo sie für ihre weiblichen Tugenden wie Gastfreundschaft, Dienst an Kranken, die Pflege ihrer eigenen Familien und die liebevolle Arbeit ihrer Hände geehrt und bewundert wurden (Apg 9,39).
Nachdem sich der römische Kaiser Konstantin im Jahr 312 n.Chr. bekehrt hatte, wurde das Christentum in Rom staatlich anerkannt und schon bald zur vorherrschenden Religion im
ganzen Reich. Eine der erkennbaren frühen Folgen dieser Veränderung war ein vollkommen neuer Rechtsstatus für Frauen.
Rom verabschiedete Gesetze, die die Besitzerrechte von Frauen anerkannten. Ehegesetze wurden überarbeitet, sodass die Ehe rechtlich als Partnerschaft angesehen wurde – anstatt einer
sklavenähnlichen Stellung der Ehefrau. In der vorchristlichen Ära hatten römische Männer die Macht, sich aus nahezu jedem Grund von ihrer Frau scheiden zu lassen oder sogar aus gar keinem bestimmten Grund. Neue Gesetze machten Scheidungen schwieriger, während sie der Frau gleichzeitig Rechte gegen ihren untreuen Ehemann in die Hand gaben. Untreue Ehemänner, die zuvor ein Teil der römischen Gesellschaft waren, konnten nicht länger ungestraft gegen ihre Frauen sündigen.
Dies war seitdem der übliche Verlauf. Wo sich das Evangelium ausbreitete, verbesserte sich in der Regel der soziale, rechtliche und geistliche Status von Frauen. Wo das Evangelium verdunkelt wurde (ob durch Unterdrückung, falsche Religionen, Weltlichkeit, humanistische Philosophie oder geistlichen Niedergang innerhalb der Gemeinde), nahm auch der Status der Frau entsprechend ab.
Selbst die Bemühungen säkularer Bewegungen, die sich für Frauenrechte einsetzten, wirkten sich im Allgemeinen nachteilig auf den Status der Frau aus. Hier ist beispielsweise die
feministische Bewegung unserer Generation anzuführen. Der Feminismus hat Weiblichkeit abgewertet und diffamiert. Natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden
üblicherweise heruntergespielt, aufgelöst, verachtet oder geleugnet. Das Ergebnis ist, dass Frauen heute an militärischen Einsätzen teilnehmen, körperlich anstrengende Arbeiten verrichten, allerlei Demütigungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind und von ihnen erwartet wird, wie Männer zu handeln und zu reden.
Moderne Feministinnen verachten Frauen, die Familie und Haushalt zu ihren obersten Prioritäten machen – sie werten die Mutterrolle ab, ausgerechnet die Berufung, die auf einzigartige Weise der Frau zugedacht ist. Die ganze Botschaft feministischer Gleichmacherei besteht darin, dass es an Frauen im Grunde nichts Außergewöhnliches gibt.
Dies ist gewiss nicht die Aussage der Schrift. Wie wir gesehen haben, ehrt die Schrift Frauen als Frauen und ermutigt sie, Ehre auf ausgesprochen weibliche Weise zu suchen (Spr 31,10-30).
Die Schrift übersieht an keiner Stelle den weiblichen Intellekt, spielt die Talente und Fähigkeiten von Frauen nicht herunter und hält sie nicht von der richtigen Ausübung ihrer geistlichen Gaben ab.
Doch wann immer die Bibel ausdrücklich über die Kennzeichen einer außergewöhnlichen Frau spricht, betont sie stets weibliche Tugenden. Die bedeutsamsten Frauen in der Schrift übten ihren Einfluss nicht durch eine Karriere aus, sondern durch ihren Charakter. Zusammen stehen diese Frauen nicht für die »Gleichheit der Geschlechter«, sondern vielmehr für echte weibliche Außergewöhnlichkeit – und diese zeigt sich immer in moralischen und geistlichen Qualitäten, nicht im sozialen Stand, in Reichtum oder in der äußerlichen Erscheinung.
Laut dem Apostel Petrus macht sich echte weibliche Schönheit nicht durch äußeren Schmuck bemerkbar, nicht »durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern«; vielmehr ist es »der verborgene Mensch des Herzens«, der wirkliche Schönheit zeigt, den »unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist« (1Petr 3,3-4).
Auch Paulus sagt, dass Gottesfurcht und gute Werke die wirklichen Merkmale weiblicher
Schönheit sind, nicht künstliche, äußerliche Verzierungen (1Tim 2,9-10). Diese Wahrheit wird in dem einen oder anderen Maße von jeder Frau veranschaulicht, deren Leben wir in diesem Buch betrachten werden.
Die Treue dieser Frauen ist ihr wahres, überdauerndes Vermächtnis. Wenn Sie ihnen in der Schrift begegnen und Sie ihr Leben kennenlernen, hoffe ich, dass sie Sie herausfordern, motivieren, ermutigen und inspirieren, den Gott mehr zu lieben, dem diese Frauen vertrauten und dienten. Ich wünsche Ihnen, dass derselbe Glaube auch in Ihrem Herzen entfacht, Ihr Leben von derselben Treue geprägt und Ihre Seele von der Liebe zu dem außergewöhnlichen Gott überwältigt wird, den diese Frauen anbeteten
Tertullian, On the Apparel of Women, Buch II, Kapitel 11.
2 Ebd., Kapitel 12.
3 Ebd., Kapitel 13.
4 Chrysostomos, Letter to a Young Widow, 2.
Der musikalische Müller Dr. E. Dönges
Der musikalische Müller und der sangesfrohe Kolportör
Eine folgenreiche Begegnung
von Dr. Emil Dönges
1. Das Lied vom Bach
»Es wohnte einst im Wiesengrund
ein Müller, froh, frisch und gesund,
der sang von morgens früh bis spat,
und lustig ging sein Mühlenrad;
er sang: Willst du, so tausch mit mir,
ich aber tausche nicht mit dir.«
»Es wohnte einst im Wiesengrund ein Müller, froh, frisch und gesund, der sang von morgens früh bis spat, und lustig ging sein Mühlenrad; er sang: Willst du, so tausch mit mir, ich aber tausche nicht mit dir.«
So lautete das fröhliche Lied des Müllers David Holzinger in der Aumühle*). Er stand auf der hohen Plattform mit weiß gestrichener Brüstung vor der Eingangstür zum Getreidespeicher. Behaglich schaute er, während er mit schöner, voller Stimme das Lied weithin ertönen ließ, in die reich gesegnete, liebliche Landschaft hinaus. Ganz still war es ringsum; nur das eintönige Rauschen des Mühlbachs begleitete die klare Tenorstimme des Müllers, und das Klappern der Räder erschien nicht störend, sondern eher angenehm, als treue Beifallsbezeugung zum Loblied des dankbaren Müllers.
Ein ausgezeichneter Sänger war David Holzinger und verstand es auch vortrefflich, ein Instrument zu spielen, so daß er seinem großen Namensbruder, dem König David, »dem Lieblichen in den Gesängen Israels«, alle Ehre machte Die Harfe spielte er zwar nicht, aber das Waldhorn konnte er blasen wie ein Meister. Wenn er so recht im Zuge war, spielte er so gut, daß die Bauern auf den benachbarten Feldern ihren müden Rücken aufrichteten, sich auf ihre Haue stützten und den schönen Melodien, wie »Des Sommers letzte Rose«, »Im schönsten Wiesengrunde« und anderen Volksliedern, andächtig lauschten. Aber heute ist es zu heiß, um zu blasen. Das Waldhorn ruht sorgsam eingepackt in einem samtbeschlagenen Mahagonikasten drinnen in der guten Stube. David muß sich damit begnügen, sein Lieblingslied vom »Müller am Bach« allein weiter zu singen: -
»Doch eines Tags der König kam. Als er des Müllers Lied vernahm, Sprach er: »Herr Müller, jeder Zeit Wär' ich zu einem Tausch bereit; Mit Sorgen ist mein Herz beschwert, Doch dich man immer singen hört.«
»Doch eines Tags der König kam.
Als er des Müllers Lied vernahm,
Sprach er: »Herr Müller, jeder Zeit
Wär' ich zu einem Tausch bereit;
Mit Sorgen ist mein Herz beschwert,
Doch dich man immer singen hört.«
»Mein froh' Gemüt«, der Müller sprach,
»Verdank' ich diesem Wiesenbach;
Er treibt mein Rad jahraus, jahrein,
Nährt mich, mein Weib, die Kinder klein;
Hab' schuldenfrei nun all mein Sach',
Drum klingt mein Lied und dankt dem Bach.«
2 Der unerwartete Besuch und neue Lieder
»Das ist aber einmal nett von dem Bach, Herr Müllermei-ster, daß er so ganz von selbst die Räder treibt, ohne daß es ihm jemand sagt«, ertönte es da plötzlich neben ihm David wandte sich um, um den Sprecher zu sehen, und erkannte einen schlichten, freundlich blickenden Mann, der eben den Weg zur Plattform heraufnahm. Ein heiteres Lächeln umspielte seine Züge, und in seinen Augen lag ein sonderbarer Glanz, so daß der musikalische Müller sich sofort zu ihm hingezogen fühlte. Einen Rucksack trug der Fremde auf dem Rücken, und einen festen Knotenstock hatte er in seiner Hand.
»So, so, Ihr dankt dem Wasser, daß es so freundlich ist und den weiten Weg zu Euch her macht, um Euer Rad zu treiben?« - »Ja, das tu ich!« erwiderte der Müller verärgert, »ich danke meinem Bach für alles Gute, das ich durch ihn bekomme. Ich bin keiner von der undankbaren Sorte von Menschen, die immer klagen; nein, Gott sei Dank!« - »Jetzt haben wir's!« rief der Fremde und legte seine Tasche ab; »jetzt haben wir's, es heißt: »Gott sei Dank!« »Mögen die Menschen den Herrn preisen wegen Seiner Güte und wegen Seiner Wundertaten an den Menschenkindern« (Ps. 107, 8).
»Ich bin nämlich auch ein großer Freund des Singens«, fuhr der Fremde fort, und die herrliche Landschaft betrachtend mit den obstbestandenen Abhängen, den wogenden Kornfeldern und dem Flüßchen dazwischen, rief er aus: »Wirklich, da kann man gut singen, wenn man alles sein eigen nennt. Wer wollte nicht loben?« Dabei hob er auch schon an, mit klarer, voller, sicherer Stimme, die von Herzen kam und zu Herzen ging, zu singen
»Die Bäume stehen voller Laub, Das Erdreich decket seinen Staub Mit einem grünen Kleide;
Narzissen und die Tulipan, Die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide.
Die Bächlein rauschen in dem Sand Und malen sich an ihrem Rand Mit schattenreichen Myrten; Die Wiesen liegen hart dabei
Und klingen ganz vom Lustgeschrei Der Schaf' und ihrer Hirten.
Der Weizen wächset mit Gewalt; Darüber jauchzet jung und alt Und rühmt die große Güte Des, der so überflüssig labt Und mit so manchem Gut begabt
Das menschliche Gemüte.
Ich selber kann und mag nicht ruhn;
Des großen Gottes großes Tun Erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt; Ich lasse, was dem Höchsten klingt, Aus meinem Herzen rinnen.«
»Seht, Müller! Das gefiel mir, als Ihr sagtet: 'Gott sei Dank!' Nur Einem ist zu danken: Gott. «
»Wer Ihr auch sein mögt, das muß ich sagen: Ihr habt eine ganz famose Stimme. Ihr gehört wohl einem Gesangverein an. Das Lied ist schwer zu singen.«
»Ganz recht, Herr Holzinger! Nebenbei gesagt, ist mein Name Christoph. Ja, ich hab' immer gern gesungen und manches Lied mit der Zeit gelernt. Einem Gesangverein, wie Ihr meint, gehöre ich gerade nicht an. So recht von Herzen lernte ich erst singen, als ich eines Tages hörte, daß Einer vom Himmel gekommen sei, um für arme Sünder wie mich zu sterben.
Am Schluß einer Predigt, die ich eines Sonntags hörte, sangen einige Leute von der Liebe Jesu und von dem sellgmachenden Glauben an Ihn. Ach! dachte ich, wenn diese Liebe so glücklich macht, will ich auch an Ihn glauben. Aber es war nicht so, daß ich gleich singen konnte. Ich fand keine Worte, und es war mir, wie wenn mir mein Herz brechen wollte.
Es überkam mich nämlich solch ein Schmerz und eine Trauer, daß ich den Heiland mit meinen Sünden ans Kreuz und in den Tod gebracht hatte, daß ich wohl weinen, aber nicht singen konnte. Aber als ich an die Liebe dachte, die der Heiland für mich am Kreuz bewies, und was Er für mich erworben hat, die ewige Seligkeit, da überkam mich plötzlich ein solches Gefühl von Glück, daß ich nicht mehr an mich halten konnte. Ich sang und sang und sing' es heute noch:
Unergründlich für und für Bleibet Deine Liebe mir!
Seit diesem Tag hab ich allerdings meine Stimme im Verein mit andern im Singen und Danken geschult!«
»Laßt mich noch ein Lied hören«, sagte der Müller, der die Worte seines Besuchers nicht ganz erfaßt hatte. »Von Herzen gern«, entgegnete dieser und sang:
»Ich singe Dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Lebens Lust;
Ich sing' und mach' auf Erden kund,
Was mir von Dir bewußt.
Ich weiß, daß Du der Brunn der Gnad'
Und ew'gen Quelle seist.
Daraus uns allen früh und spät
Viel Heil und Gutes fleußt.
Was sind wir doch, was haben wir
Auf dieser ganzen Erd',
Das uns, o Vater, nicht von Dir
Allein gegeben werd'?
Wohlauf, mein Herze, sing und spring
Und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding',
Ist selbst und bleibt dein Gut.
Er hat noch niemals was versehn
In Seinem Regiment;
Nein, was Er tut und läßt geschehn,
Das nimmt ein gutes End'.«
»Gott sei Dank«, rief er, als er das Lied beendet hatte, »das nimmt ein gutes End'. Ihr und ich können nicht auf dem Rhein und auf Eurem Mühlbach in den Himmel schwimmen, aber durch die Liebe Gottes, durch das Verdienst unseres Heilandes können wir auf dem ganzen Weg bis dorthin danken und singen. Was meint Ihr, Müller, geht's Euch nicht auch so?«
Unterdessen hatte Christoph seinen Rucksack geöffnet und kniete daneben. Er zeigte dem Müller zunächst mehrere Bibeln und Testamente. Und als der Müller nicht danach verlangte, zeigte er ihm auch unter andern ein hübsch gebundenes Buch mit schönen Bildern. »Dieses Buch, Müller, wird Euch interessieren. Hört mal zu, was ich Euch davon vorlesen will: '
Als ich durch die Wüste dieser Welt wandelte, kam ich an einen Ort, wo eine Höhle war; ich legte mich daselbst zum Schlafen nieder und hatte nun, als ich schlief, einen Traum. Ich sah an einem Ort einen Mann in einem schmutzigen zerrissenen Kleid, sein Gesicht vom eigenen Haus abgewandt, mit einem Buch in der Hand und einer großen Last auf seinen Schultern.' So geht's weiter; und Ihr erfahrt alles, was mit dem Mann weiter passiert. Teufeln und Riesen begegnet er, er betritt Burgen und Schlösser, bis er endlich, anstatt seiner zerrissenen Kleider, ein königliches Gewand erhält, und an Stelle des Reisebündels eine Krone von Gold Das könnt Ihr hier alles selbst lesen Es kostet nur eine Mark.
Kauft das Buch doch für Eure Frau. Ich hab' zwar noch mehr in meiner Tasche; darf ich Euch noch etwas zeigen?« - »Ich glaube, es ist besser, wenn Ihr ins Haus hereinkommt«, sagte David. »Marie, meine Frau, wird auch gern die Bücher ansehen; und Ihr seid sicher dankbar für einen Schluck Milch nach dem anstrengenden Marsch auf der heißen Landstraße.« -
»Das würde ich allerdings mit Dank annehmen«, sagte Christoph erfreut, »ich fühle mich schon etwas durstig und müde«, und seinen Büchersack aufnehmend, stieg er dem Müller nach die Treppe hinunter, die in das Reich der geschäftigen Hausfrau führte. Der Bibelbote freute sich über die Aussicht, bald einen labenden Trunk zu erhalten, aber noch mehr freute ihn der Gedanke, daß sich nun Gelegenheit bat, den Müllersleuten mehr von dem kostbaren Namen Jesus und Seinem Heil und Frieden zu sagen. Unwillkürlich kam ihm, dem Sangeslusti-gen, das Lied auf die Lippen:
»Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, Ob Stürme auch drohen von fern;
Mein Herze im Glauben doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn.«
Mächtig drangen diese mit lnbrünst gesungenen Worte in das Ohr und Herz des Müllers und lenkten seine Gedanken auf Dinge hin, an die er schon lange nicht mehr gedacht hatte.
David Holzinger tat es beinahe leid, daß die Küchentür so bald erreicht war und er nicht noch den zweiten Vers des Liedes hören konnte. »Marie«, rief er seiner Frau zu, »hier ist ein Mann mit schönen Büchern. Vielleicht siehst du sie dir an. Auch wäre der Mann für einen Schluck Milch recht dankbar; S ist heute schrecklich heiß.« - »Bücher?
Geh mir weg damit! Ich habe keine Zeit für Bücher. Ich habe den ganzen lieben Tag meine Hände voll Arbeit. Und Milch? - Ich kann keine hergeben. Die von gestern ist sauer geworden, und die heutige muß ich zum Abnehmen stehen lassen. Dort ist der Brunnen, hol' ihm doch einen Krug Wasser!«
Und ohne die Männer eines weiteren Blickes zu würdigen, fuhr sie fort, mit doppeltem Eifer an ihrem Butterfaß her-umzuscheuern. »Danke bestens, Frau Müller«, sagte der glückliche Bote des Herrn in einer so herzlichen Weise, wie wenn die ungnädige Frau Müller ihm weiß nicht was angeboten hätte. »Selbstverständlich hol' ich mir Brunnenwasser, es ist ja so herrlich frisch Ich habe sogar selbst Milch bei mir in meiner Tasche. Aber vielleicht interessiert es Sie, meine Bücher anzusehen.«
Der Müller sah den Sprecher erstaunt an und dachte, das mit der Milch hatte Christoph doch vorher sagen und ihm so die • schroffe Abweisung sparen können. Allerdings fand er es komisch, Milch in einem Bücherranzen mitzunehmen. Christoph hatte seine Täsche auf einen Stuhl gestellt und ging in der Richtung nach dem Brunnen, als Marie plötzlich einwandte: »Laßt's nur, es ist nicht gut, kaltes Wasser zu trinken, wenn man erhitzt ist. Vielleicht läßt sich doch noch etwas Milch auftreiben. David, führ den Gast in die vordere Stube!«
Und mit raschen Schritten ging sie in die Milchkammer, um kurz darauf mit einem Topf kühler Milch zu erscheinen. Maries scharfer Blick suchte beim Betreten des Zimmers sofort nach einer Milchflasche oder sonst einem Behälter unter den ausgebreiteten Büchern. Aber vergebens! »Das war nur eine Ausrede, um sich aus der Verlegenheit zu ziehen«, dachte sie und überreichte dem Bibelboten ein Glas frischer Milch. »Herzlichen Dank!« sagte dieser und tat einen kräftigen Schluck. »Frau Müller, eure Milch schmeckt wirklich herrlich, aufrichtig gesagt, aber sie ist doch nicht so gut wie die meine.« - »Ihr habt doch gar keine Milch bei Euch; was meint Ihr damit?« - »So, ich habe keine? Nur Geduld! « Christoph stellte das Glas auf den Tisch und nahm aus seinem Schatz eine kleine, hübsch gebundene Bibel mit Goldschnitt.
Er schlug das 55. Kapitel im Jesa-ja auf und las: »0 ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommet, kaufet und esset! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch!« Dann blätterte er weiter und las 1. Petr. 2, 2: »Wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes, auf daß ihr durch dieselbe wachset zur Errettung.« Die Bibel hochhaltend, rief er aus: »Seht, das ist die Milch, die Milch des Wortes, und beinahe dreißig Jahre trinke ich daraus und erfreue mich daran, und ich kann mit David davon sagen: »Es ist süßer als Honig und Honigseim« (Psalm 19, 10)— »Mit David?« rief Marie verwundert. »Seit wann? Ich hab's ihn noch nie sagen hören!«
Ohne es zu wollen, hatte Marie durch diese Worte ihrem Mann eine ernste Predigt gehalten, und der Müller errötete bei dem Gedanken, daß er in diesen Sachen so wenig Bescheid wußte. Der Bote hatte wohl bemerkt, daß hier ein Mißverständnis vorlag und sagte deshalb: »Nein, nein, ich meine nicht Euren Mann, sondern seinen Namensbruder in der Bibel; der liebte die Bibel und sang von ihr jeden Tag. Kein Wunder! Er dachte Tag und Nacht über das Wort Gottes nach.« Christoph strich wie zärtlich über das Bibelbuch, und während seine Augen voll Liebe darauf ruhten, sang er:
»Herr, Dein Wort, die edle Gabe!
Diesen Schatz erhalte mir,
Denn ich zieh' ihn aller Habe
Und dem größten Reichtum für.
Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten,
Worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist nicht um tausend Welten,
Aber um Dein Wort zu tun!«
Christoph ergriff die günstige Gelegenheit und fragte, ob er noch einige Worte lesen dürfe. Marie setzte sich auf den nächsten Stuhl und nickte bejahend, worauf der Evangelist anhob: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.« Mit langsamer, ausdrucksvoller Stimme las er den ganzen Psalm und hielt sich im stillen an Gottes Verheißung: »Das Wort wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe« (Jes. 55, 11).
Beim Lesen des letzten Verses schlug Christoph schnell die Stelle vorn guten Furten auf, der Sein Leben für die Schafe gab. Dann fragte er: »Wollen wir nicht zusammen beten?« Und ohne Antwort abzuwarten, kniete er nieder und betete inständig zum Herrn, Er möge doch der Hirte und Heiland dieser Seelen hier werden. Er möge sie beide dann als Seine Schafe auf die grünen Auen und zu den stillen Wassern Seiner Gnade und Liebe führen.
Die beiden Müllersleute wußten zuerst nicht recht, wie sie sich verhalten sollten. Seit ihrem Hochzeitstag in der Kirche waren sie nicht mehr miteinander niedergekniet. Doch nach kurzer Überlegung knieten sie neben dem Manne nieder.
Nach dem Gebet kauften die beiden ein. Sie nahmen zwei Bibeln, einen Band von Bunyans »Pilgerreise« und einige kleinere Bücher für die Jugend. Christoph packte seine Ware wieder zusammen und sagte: »So Gott will, werde ich in einigen Wochen wieder vorbeikommen. Ihr könnt dann die Bücher, falls sie Euch nicht gefallen haben, gegen andere eintauschen.« - »Da könnt Ihr ruhig sein«, sagte die Müllerin, »die Bücher werden uns schon gefallen. Aber es soll uns freuen, wenn Ihr uns bald wieder einen Besuch macht; nicht wahr, David?« - »Natürlich, je bälder, je besser, lieber Freund!« -
»Danke schön!« erwiderte Christoph, nahm seinen Sack auf den Rücken und seinen Stock in die Hand, »wenn Gott will, werden wir uns bald wieder hier treffen. Aber wie gesagt, alles ist in Seiner Hand.« Und mit einem Blick auf David fügte er hinzu: »Selbst der Mühlbach vom goldnen Augrund ist Seinem Willen unterworfen. Der Herr sei mit Euch! Auf Wiedersehen!«
Ehe Christoph das Haus verließ, gab er dem Müller ein kleines christliches Liederbuch. »Ich weiß, daß Ihr eine gute Stimme habt«, sagte er, »bitte, nehmt dies an Die Lieder darin können sich neben dem 'Müller am Bach' schon hören lassen. Wenn Euch eins besonders gefallen sollte, so will ich Euch das nächstemal die Melodie dazu vorsingen.« Damit verließ er frohen Herzens über die Aufnahme in der Au-mühle das Haus. Und den Gartenzaun entlang, den Wiesenpfad hinunter hörte man ihn singen:
»Mein Singen preiset Jesum, des Gnad mein Leben krönt, Die Fülle Seiner Liebe
Im Herzen wiedertönt.
Mein Singen preiset Jesum, das teure Gotteslamm,
Das mich mit Seinem Blute Erkauft am Kreuzesstamm!
Mein Singen preiset Jesum! Zu Seinen Füßen ruh
Ich voller Glück und höre Nur Seiner Rede zu.
Mein Singen preiset Jesum, Es komme, wie es will,
Ich preise Seiner Gnade Beschämend reiche Füll'.
Mein Singen preiset Jesum! Denn jeder neue Schritt Bringt ein Entgegeneilen
Der ew'gen Heimat mit.
Durchmißt mein Fuß die Tore Des Paradieses, dann
Beginnt das Lied von Jesus, Das nie mehr enden kann.«
3. Das Erwachen zum neuen Leben
David Holzinger war dem Sänger bis zum Gartentor gefolgt. Als der glückliche Mann hindurchgegangen war, stützte er sich darauf und verfolgte ihn mit den Blicken, immer auf die Töne und Worte des Liedes lauschend. »Das teure Gotteslamm, das mich mit Seinem Blut erkauft am Kreuzes-stamm.« »Darin lag wohl der Kern der Sache!«, dachte der Müller, den Kopf schüttelnd. Erst als er den Bibelboten ganz aus den Augen verloren hatte, kehrte David zur Mühle zurück. Er stieg wieder auf die Plattform und sah über das weiße Geländer in den rauschenden Mühlbach hinab. Der bekannte Reim kam ihm unwillkürlich in den Sinn: »Hab' schuldenfrei nun Haus und Sach! Drum klingt mein Lied und dankt dem Bach.« Aber über seine Lippen kam es nicht. Was! Dem Bach danken? - Er hob seine Augen auf und sah in das unendliche Blau des Himmels, sah die wandernden Wölkchen dort oben und fühlte sich mit einem Mal in der Gegenwart des lebendigen Gottes.
Beklommen, beunruhigt, durch eine geheime Last gedrückt, stieg David Holzinger wieder hinab und stellte sich unter die Tür, von wo aus er durch die Fliederbüsche hindurch den Mühlbach blinken sah, den einzigen Gott, den er bis jetzt des Dankes wert erachtet hatte. Er sah den Fußpfad entlang, der von duftenden wilden Rosen eingefaßt war, und hoffte halb, den glücklichen Boten wieder zu sehen. Aber Christoph war schon weit fort. Dennoch war es dem Müller, als sähe er die eigenartige Gestalt vor sich mit der Tasche auf der Schulter und hörte er wieder die Worte:
»Mein Singen preiset Jesum, Das teure Gotteslamm,
Das mich mit Seinem Blute Erkauft am Kreuzesstamm.«
Tränen kamen ihm in die Augen, als er die Strophe wiederholte. Es schien, als dämmerte ihm in etwa, was die ernsten
Worte sagen wollten. Wie sehnte er sich danach, mehr die Bedeutung zu verstehen! Er entschloß sich, ins Haus zu gehen, in der schwachen Hoffnung, daß vielleicht Marie Zeit finden würde, mit ihm über diese Angelegenheit zu sprechen. Er ging durch die Hintertür in die Küche, da stand das But-terfaß mit der Bürste und dem Putzeimer noch genau am gleichen Platz, wo es gestanden, als Marie in gesänftigter Stimmung nach der Milchkammer gegangen war. »Wo steckte seine Frau wohl?«
Marie nicht an der Arbeit zu finden war etwas ganz Außergewöhnliches. Er ging in die vordere Stube, und da saß sie ganz vertieft in eins der neuen Bücher. Erschrocken fuhr sie zusammen, als sie die Schritte ihres Mannes hörte und errötete bis zur Stirn, als sie seinen verwunderten Blicken begegnete. »Marie, liebe Frau«, sagte David, »was ist mit uns vorgegangen?« Maries Antwort war nur ein leises Schluchzen. Sie legte ihr Buch weg, wischte sich die Augen mit der Schürze. »Marie, was ist geschehen?« David hatte die Hand auf die Schulter seiner Frau gelegt und sah ihr in die Augen. Ein ihm fremder Ausdruck lag darin. »0 David«, sagte sie, »lies einmal dieses Lied, wie ernst ist das!«
David nahm das Buch und las mit lauter Stimme das Lied, das Marie so ergriffen und so nachdenklich gemacht hatte:
»Willst du nicht zu Jesus eilen, Eh' der Gnadentag sich neigt? Willst du länger draußen weilen, Bis dich ew'ger Tod erreicht? Jesus beut dir wahre Ruh, Drum zu Jesu eil auch du!
Heut noch ist der Herr in Gnaden Für dich da, o säume nicht:
Heut noch heilt Er allen Schaden, Führt aus Nacht zu ew'gem Licht. Jesus beut dir wahre Ruh,
Drum zu Jesu eil auch du!«
»Ich möchte so gern zu Ihm eilen, David«, sagte Marie bewegt. »Und ich auch«, erwiderte David leise, »wenn es uns so glücklich macht, wie den lieben Mann, den uns Gott heute ins Haus geschickt hat. - Wer weiß, was geschieht?« Da wurde die ernste Unterhaltung plötzlich durch die Ankunft des Fuhrwerks unterbrochen, das polternd über den gepflasterten Hof kam. Beide hatten jetzt vollauf zu tun. David mußte mit seinem Sohn und Knecht abrechnen, und Marie beeilte sich, das Abendessen zu bereiten. Der Müller trat an den Wagen und half die Säcke auf den Sackboden schaffen. Dann griff er nach dem Zaumzeug des Pferdes, schirrte es selbst ab und sagte ruhig: »Hör auf, Hannes! Fluch nicht! - Das bringt mir und dir keinen Segen; der Name Gottes darf von jetzt an bei uns nie mehr mißbraucht werden.«
Johann Dornbusch, der Knecht, blickte erstaunt auf. Sein Herr hatte sonst auch nicht mit leisen und lauten Schimpfworten zurückgehalten und mit manchem Fluch seinen Arger ausgedrückt, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Er zwinkerte zu Heinrich hinüber, als wollte er sagen: »Dein Vater hat, scheint's, heute einen Vogel im Kopf.«
Doch Dornbuschs Überraschung wuchs, als er schon bald entdeckte, daß es mit der Frau Meisterin auch nicht mehr ganz geheuer war. Doch bei ihr, mußte er sich gestehen, war es eine vorteilhafte Änderung, die Platz gegriffen hatte.
Als das Abendessen vorbei war, ging Johann in den Hof, stellte sich an den Torflügel und dachte über die neue unerwartete, jedoch nicht unwillkommene Wendung der Dinge nach. »Ich komm nicht d'raus«, sagte Johann, »etwas ist passiert, so viel ist sicher. Entweder stehe ich auf dem Kopf oder die Mühle. Der Meister ist weich wie Butter, und die Meisterin erst! Ich versteh's nicht. Ich hab' schon oft gesagt: Ich heiße Dornbusch, aber sie ist ein Dornbusch, aber heute hat sie scheint's alle ihre Damen auf einmal verloren. Wie ist das zugegangen?«
Inzwischen war Heinrich, der wie sein Vater musikalisch begabt war, in die vordere Stube gegangen und hatte dort die neuen Bücher entdeckt.
Nachdem er die Bibeln oberflächlich gemustert und ein wenig in den Schriften geblättert hatte, nahm er das Buch von Bunyans »Pilgerreise« zur Hand, und bald hatte dieses wunderbare Buch Heinrich in seinen Bann gezogen Er folgte mit wachsendem Interesse dem Pilger auf seinen Wanderungen. Nach einiger Zeit kam der Müller herein; er hatte sein Instrument mitgebracht, um einige der neuen Lieder zu probieren. »Nun, Heinrich, du hast schon entdeckt, was wir heute erstanden haben!« -
»Vater, Ihr habt hier ein großartiges Buch gekauft; wenn man erst drin zu lesen anfängt, weiß man nicht, wann man aufhören soll. Woher habt Ihr es?«
»Ein Kolporteur war heute da; ich sage dir, der hatte eine Stimme, ich habe noch nie so singen hören.« Kaum hatte der Müller ausgesprochen, als sich die Tür öffnete und Frau Holzinger hereintrat. »Mutter«, rief Heinrich, »es tut einem ganz wohl, dich einmal ohne Arbeit zu sehen, so kann man doch einmal mit dir plaudern.« Über das Gesicht der Müllerin huschte ein Freudenstrahl. Zugleich aber empfand sie, daß es eine Seite des Lebens geben müsse, die ihr bis jetzt noch fremd geblieben war. Das Licht, das von dem Buch Gottes ausgegangen war, fing an, in ihrer Seele ein Verlangen nach etwas Höherem, Himmlischen wachzurufen.
*) Wir haben die Namen der Personen und Orte usw. dieser aus dem Leben entnommenen Geschichte durch andere ersetzt.
Lazarus William Sanford LaSor
Lazarus
Was geschieht, wenn Jesus in ein Haus kommt? Lässt er den Christus-Geist frei, damit Sie nun jeder Schwierigkeit mit Gelassenheit gegenüberstehen? Garantiert er Gesundheit, Gluck und stete Freude? Lasst uns in ein Haus gehen, das Jesus oft besucht hat, und einige Menschen treffen, die Jesus liebten und die er liebte: die Familie von Martha, Maria und Lazarus
Schwierigkeit mit Gelassenheit gegenüberstehen? Garantiert er Gesundheit, Gluck und stete Freude? Lasst uns in ein Haus gehen, das Jesus oft besucht hat, und einige Menschen treffen, die Jesus liebten und die er liebte: die Familie von Martha, Maria und Lazarus
Vielleicht fragen Sie sich, was Lazarus getan hat, dass er in die Reihe bekannter Persönlichkeiten des Neuen Testamentes miteingeschlossen sein soll Es gibt Menschen, die werden nicht berühmt durch das, was sie tun, sondern durch das, was mit ihnen geschieht Viele Menschen kamen; um Lazarus und Jesus zu sehen- Wegen des Geschehens in seinem Haus und besonders mit Lazarus selbst, säumten Menschenmengen an jenem Tag, der als Palmsonntag bekannt wurde, den Weg nach Jerusalem. Wegen diesem plötzlichen Aufschwung seiner Popularität (und das in der Nahe Jerusalems?) beschlossen die Herrscher, Jesus sofort zu töten. Wegen des ungelegenen Beweises, zu dem Lazarus selbst plötzlich geworden war, beschlossen die Herrscher, ihn ebenfalls zu toten. Wer kann Lazarus mi Licht dieser folgenschweren Ereignisse einen prominenten und wichtigen Platz abstreiten?
Das Haus des Lazarus
Zwei Schwestern und ein Bruder wohnten dort. Die Schrift führt sie in dieser Reihenfolge auf: Martha, Maria und Lazarus (Job. 11, 5). In einer Welt, m der Frauen gewöhnlich zuletzt, wenn überhaupt, genannt werden, ist das an sich schon bemerkenswert (Wir erinnern daran, dass die Schwestern Jesu nicht mit Namen genannt werden.) Die Annahme ist vertretbar, dass Lazarus der jüngere Bruder und Martha das älteste Famihenmitghed war. Nach der Überlieferung - welchen Wert man ihr auch immer beinusst - war Lazarus dreissig
Jahre alt, als das Wunder geschah, und lebte danach noch dreissig Jahre Wenn dem so ist, können wir annehmen, dass Martha Ende dreissig oder Anfang vierzig war.
Es wird allgemein festgestellt dass der Bruder und die zwei Schwestern in Bethamen lebten Dieses Dorf befindet sich an der Ostseite des Ölbergs, etwa zwei Kilometer von Jerusalem entfernt, und dort begann die Palmsonntags-Prozession.
Jesus hatte eine enge hebevolle Beziehung zu dieser Familie Wir bekommen den Eindruck, dass Jesus die Familie nicht nur besucht hat sondern dass er die Freiheit hatte, jederzeit vorbeizukommen In der letzten Woche seines Lebens mag er Bethanien zu seinem Heim gemacht haben, da er kerne Nacht m Jerusalem verbrachte Auf seine Liebe für diese Familie wird dreimal besonders hingewiesen (Job. 11 3.5.36). Sie wird in der ganzen Geschichte vorausgesetzt. Jetzt wollen wir sehen, was in einem Haus geschieht, in dem Jesus ein oftgesehener Besucher und ein guter Freund ist.
Das Haus war ein Heim der Liebe, aber ohne Streitigkeiten ging es nicht Lukas erzählt uns von einer Mahlzeit, die Ihr Jesus bereitet wurde Dabei sind Martha und Maria die Hauptpersonen Die zwei Frauen haben an Johannesevanglium die gleichen Eigenschaften, wie sie uns von Lukas beschrieben werden Martha war der geschäftige Typ; Maria war ein wenig sorglos. Während sie die Gäste unterhielt, wollte Martha alles richtig machen.
Wir alle kennen Frauen wie sie das Wohnzimmer muss makellos sein die Vorhänge ebenfalls, die Blumen auf dem Tisch müssen mit dem Tafelservice übereinstimmen; das beste Porzellan und das Silberbesteck muss benutzt werden, und alles muss genau richtig sein Das Haus wird als das Haus Marthas bezeichnet (Luk 10 38) Dies bezieht sich wahrschemhch auf das Eigentumsrecht, aber wir bekommen das Gefühl, und wahrscheinlich hat jeder Besucher den gleichen Eindruck bekommen dass Martha das Haus führte, ob sie es besass oder nicht
Scheinbar sorgte sich Maria weniger um die Einzelheiten, sie hatte es lieber, wenn das Haus „bewohnt" aussah Spielzeug auf dem Fuss boden oder unordentliche Kissen auf dem Sofa regten sie nicht auf. Wenn sie interessanten Besuch hatten setzte sie sich lieber und horte zu, als dass sie in der Suppe rührte.
Uns wird flicht berichtet, ob diese Frauen verheiratet waren Wenn nicht dann vielleicht, weil Martha zu eifrig war und Maria es zu leicht nahm Maria und Martha! Was geschah als Jesus in ihr heim kam?, Losten sich plötzlich ihre Spannungen? Umarmten sie sich liebevoll? Stellte Martha ihre ständige Kritik ein? Begann Maria, mehr Zeit m der Küche zu verbringen? Wir wissen es besser. Maria sass zu Jesu Fussen, und Martha sagte zu Jesus „Herr, fragst du nicht danach dass mich meine Schwester lasst allein dienen?
Sage ihr doch, dass sie es auch angreife" (Luk 10 40) Wenn wir nur den Ton m Jesu Stimme hören konnten, als er antwortete „Martha, Martha, du hast viel Sorge und Muhe Eins aber ist not Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden" (Luk 10, 41-42)! An dieser Stelle gibt es ein kleineres textkritisches Problem wie es auch m den Übersetzungen angedeutet wird Jesus kann anstatt ‚ems ist not" auch „weniges ist not' gesagt haben Dies ist jedoch kern grosser Unterschied Wenn wir es übertragen, sagt er etwa folgendes ‚Nun, Martha, halten wir einmal ein und denken aber das Leben nach.
Es gibt wirklich nicht viele Dinge, die notwendig sind Du sorgst dich um viele Einzelheiten aber wenn du musstest, konntest du ohne sie leben Andererseits gibt es wenige Dinge, ohne die man nicht leben kann, und Maria hat eins davon entdeckt Das soll nicht von ihr genommen werden Jesus verurteilt Martha nicht oder doch' Und er lobt Maria nicht wegen ihrer Gleichgültigkeit im Haus. Was Jesus sagen will, ist folgendes: in der Geschäftigkeit des Lebens sollte es einen Ort der Besinnung zu Jesu Füssen geben.
Des Lazarus Krankheit und Tod
Eines Tages wurde Lazarus ernstlich krank, und man benachrichtigte Jesus ‚Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank' (Job. 11 3) Darauf folgt eine etwas befremdende Feststellung Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus Als er nun horte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, da er war 'Das kleine Wort ‚als' verbindet den nachfolgenden Salz mit dem vorhergehenden. Es bedeutet Als Jesus von Lazarus' Krankheit erfUhr,
blieb er auf Grund seiner Liebe für die Familie noch zwei Tage, bevor er auf

Schnepel Erich,Was kann uns Jesus heut sein?

Es war in der großen Wirtschaftskrise der zwanziger Jahre Durch die Straßen Berlins streifte ein einsamer Mann Er wußte eigentlich nicht, was er suchte Die Unruhe und Friedelosigkeit seines Lebens trieb ihn durch die Straßen der Millionenstadt Sein Elektrogeschäft war am Ende Er selbst verbittert gegen alle Menschen
Da fallt sein Blick auf ein großes Vortragsplakat „Was kann uns Jesus heute noch sein? Das Wort packt ihn Am Abend ist er zum ersten Mal nach vielen Jahren unter Christen Der große Saal ist überfüllt. Er steht hinten bei der Tur.
Der Vortrag ist eigentlich nicht für ihn bestimmt Er handelt über das Gebet und richtet sich an solche, die eine tiefe Erf ah-rung im Gebet haben Ihm selbst ist das Gebet so fremd Aber von Satz zu Satz wird er mehr gepackt Er stutzt und staunt diese Menschen glauben wirklich,
daß da jemand ist, der sie hört und ihnen antwortet. Er hatte nie gedacht, daß hinter dem Gebet etwas Wirkliches stecken konnte Er hatte es für fromme Selbsttäuschung harmloser Gemüter gehalten, für eine Art Autosuggestion, für frommen Schwindel Nun trat ihm eine ganz neue Welt entgegen
Er kannte die Menschen nicht, unter die er geraten war. Aber sie machten einen so natürlichen, vernünftigen, gesunden Eindruck Es waren Menschen wie er, die mitten im Leben standen Der Vortrag war klar und lebensnah Der da sprach, war offenbar ein Mensch, der ganz hinter dem stand, was er sagte Aus allem merkte der Elektro-Kaufmann für diese Menschen war das Gebet nicht blauer Dunst, sie machten nicht irgendwie Worte in die Luft, sie rechneten ganz eindeutig damit, daß da Einer sei, der sie höre.
Jesus war ihnen offenbar so lebendig nahe, daß sie mit Ihm reden konnten Über all dem ging ihm auf, daß nicht nur die Menschen um ihn da waren, sondern daß noch Einer da war, den er nicht sah An jenem Abend wurde ihm von Gott erschlossen, daß Jesus der Lebendige ist, das große Geschenk Gottes an uns Was war dieser Mann so einsam, so verbittert, so voll Haß gegen alle Menschen gewesen' Das Gespräch mit Jesus loste alle seine Verkrampfungen und Belastungen Er wurde ein fröhlicher, freier Mann mitten in der wirtschaftlichen Krise seines Geschäfts.
Jesus! Das ist Der, der da gesagt hat „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf ,Erden!" Alle, die ihr Leben in echter Weise mit Jesus verbunden haben, erfuhren voll Staunen, daß Er starker als alles ist Wie hat er jenen Berliner Kaufmann durch schwerste Krisen - des Geschäftslebens innerlich und äußerlich hindurch-gesteuert!
Ich kannte den Direktor einer großen Fabrik in Holland Ein prächtiger Mensch Es war eine Freude, mit ihm zusammenzutreffen Das Geheimnis waren die stillen Minuten am Anfang des Tages, in denen er alles mit Jesu, seinem HErrn besprach, was Privatleben und Geschäft anging Wie hat das gesamte Zusammenleben in der Fabrik sich dadurch verändert! Bis in die Wirtschaftsfragen seines Betriebes hinein erfuhr er, daß Jesus großer als alles ist Wir dürfen Ihm bedingungslos vertrauen, auch dort, wo Er nicht antwortet oder, anders, als wir dachten.
Die größte Hilfe aber bleibt es immer, wenn uns Jesus in den schweren Problemen unserer Lebensschuld zu Hilfe kommt Werden diese nicht gelost, bleiben alle anderen Hilfen umsonst Hier liegt die Wurzel unserer gesamten Lebensnot In allen anderen Fragen kann uns unter Umstanden auch von anderer Seite Hilfe zuteil werden In der Frage der Schuld kann uns kein Mensch helfen Keiner ist imstande, ein Stuck Lebensgeschichte zu loschen, weder bei sich selbst noch bei anderen Niemals wachst über eine Schuld Gras Plötzlich ist sie wieder da, bis in der Stunde, da wir vor Gott treten müssen, alles, was wir getan haben, wieder aufsteht.
Und nun wollen wir Jesus um die große Vergebung für unser Leben bitten Es ist eine Tat sondergleichen, wenn Jesus unsere Lebensgeschichte ausloscht und so vergibt, daß sie vor Gott nicht mehr existiert Dazu gehört eine Macht, wie sie niemand hat als Er allein!
Und wenn uns dann das Gnadengeschenk der Vergebung zuteil geworden ist, wollen wir ganz ehrlich unser Leben unter Seine Führung stellen Das wird nur möglich sein, wenn wir, so wie jener Fabrikdirektor in Holland, jeden Tag damit beginnen, daß wir still mit Jesus und der Bibel zusammen sind und uns von Ihm
durch Sein Wort alles geben lassen, was wir an Kraft, Freude und Wegweisung für den Tag brauchen Wir werden staunen, was Jesus uns sein kann.
Erich Schnepel Samenkörner
Aus einem alten Brief, Matthias Claudius
„Es geht mir eben so, Andres, wenn ich in der Bibel von einem alten und neuen Bunde, von einer Verbindung und einem Verkehr zwischen dem HOCHSTEN Wesen und unserem Geschlecht lese, ich mache auch oft das Buch zu und falte die Hände, daß die Menschen vor Gott so hoch geachtet und wert sind!
Und man kann und kann den Mittler zwischen beiden nicht genug ansehen und lieben und mochte Ihn für 'andere mitlieben, die es nicht besser wissen
Aber es macht Dir graue Haare, schreibst Du, unseren HErrn Christus verkannt und verachtet zu sehen
- Du liebe gerechte Seele, mag es doch! Wer sie um Ihn tragt, der tragt mit Ehren graues Haar.
Zwar Seinetwegn brauchst Du Dir keine wachsen zu lassen Er will wohl bleiben, was Er ist So viele ihrer die Wahrheit nicht erkennen und nutzen, die haben des freilich Schaden, aber was kann es ihr schaden, ob sie erkannt und genutzt wird oder nicht? Sie bedarf keines, und es ist die Große und Herrlichkeit ihrer Natur, daß sie immer bereit ist, von Undank nicht ermüdet wird und wie die aufgehende Sonne mit den Wolken und Dunsten ringt, um sie zu reinigen und zu vergolden
Laß sie denn ringen, Andres, und brich Dir auch, um was Du nicht ändern kannst, das Herz nicht.
Wer nicht an Christus glauben will, der muß sehen, wie er ohne Ihn raten kann Ich und Du können das nicht Wir brauchen jemand, der uns hebe und halte, weil wir leben, und uns die Hand unter den Kopf lege, wenn wir sterben sollen, und das kann Er überschwänglich, nach dem, was von Ihm geschrieben steht, und wir wissen keinen, von dem wir's lieber hatten Keiner hat uns so geliebt.
Und so etwas in sich Gutes und in sich Großes, als die Bibel von ihm saget und setzet, ist nie in eines Menschen Herz gekommen und über all sein Verdienst und Würdigkeit. Es ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgehet und sein innerstes Bedürfnis, sen geheimstes Ahnden und Wünschen erfüllt.
Wir wollen an Ihn glauben, Andres, und wenn auch niemand mehr an Ihn glaubt Wer nicht um der anderen willen an Ihn geglaubt hat, wie kann der um der anderen willen auch aufhören, an Ihn zu glauben'
Doch dem sei, wie ihm wolle, Andres, wir glauben der Bibel aufs Wort und halten uns schlecht und recht an das, was die Apostel von Christus sagen und setzen
Die Ihn selbst gesehen und gehört haben und an Seiner Brust gelegen sind, die sind Ihm doch naher gewesen als wir und die anderen Und was auch bisher unter den Gelehrten erfunden sein mag, und wie gut sie auch wissen und verstehen mögen, so scheint es doch die Wahrheit, zu sagen, daß die Apostel es besser wissen und verstehen müßten.
Lebe wohl, Andres, und schreibe bald wieder.
Dein Matthias Claudius'
Bin volles Heil für Jeden Schaden
für jedes Herz ein volles Heil!
Schöpf aus dem reichen Born der Gnaden
dein zugesagtes volles Teil!
Was mit dem höchsten Preis errungen,
mit Christi Leiden Christi Blut
das ist - o glaub es dankdurchdrungen -
ein unverkürzt vollkoninines Gut
H. J. Breiter
Samenkörner
Das malerische Ährenfeld. Lina Haug
Das goldene Korn der brennende Mohn, die blaue Kornblume, die rote Rade und die weiße Ackerwinde schmücken und zieren das Erntefeld. So schön und farbig diese leuchtenden Blumen sind, am großen Erntetag fallen sie mit unter das Unkraut, das in Bündeln gebunden und verbrannt wird.
Ackerwinde schmücken und zieren das Erntefeld. So schön und farbig diese leuchtenden Blumen sind, am großen Erntetag fallen sie mit unter das Unkraut, das in Bündeln gebunden und verbrannt wird.
Ach wie vieles in unserem Leben, das von Menschen angestaunt und 'bewundert wird, ist, nur ein Zierat; ein buntes Vielerlei, das in den Augen Gottes nichts anderes ist als Unkraut!
Gleicht nicht das Leben des reichen Kornbauern und des reichen Mannes in der Lazaruserzählung dem leuchtenden Mohn und der blauen Kornblume? Die Felder des reichen Kornbauern hatten gut getragen. Mit tiefer Befriedigung sieht er einer Rekordernte entgegen.
Gottes Güte krönte seine Arbeit und Mühe. Aber über dem reichen Erntese'gen und dem Planen, Scheunen abzubrechen und größere zu bauen, vergißt er, Gott allein die Ehre zu geben, und schreibt den Erfolg seiner Arbeit sich selbst und seiner Tüchtigkeit, zu. Darum 'hatte er auch seiner Seele nichts anderes zu sagen als:, Iß und trink und sei gutes Muts; du hast einen Vorrat für viele Jahre!" Doch unversehens brachte der Tod ihn in die Ewigkeit, leer von allem Erden-gut und beladen mit der Verantwortung: „Wes wird sein, das du bereitet hast?'
Anders Petrus, dem der 1-fErr einen reichen Fischfang schenkte. Uberwültigt sinkt er zu Jesu Füßen und ruft aus: „HErr, gehe von mir hinaus; ich bin ein sündiger Mensch!'
‚Auch der reiche Mann in der Erzählung Jesu von Lazarus, dem die 'Mühe und Arbeit, die Sorgen der Nahrung erspart blieben, der alle Tage herrlich und in Freuden lebte, vergißt über der Reihe von guten Tagen den Geber der guten Gaben. Was kümmert ihn der arme Lazarus' vor seiner Tür! „Wenn ich es' nur gut habe, was, gehen mich die
andern an?" -.
Und doch wird dieses 'genießerische und habsüchtige Leben von vielen Menschen als ein beneidenswertes Los und als ein Zustand des Glücks gepriesen. Der natürliche Mensch begehrt nichts anderes, als alle Tage herrlich und in Freuden zu leben, unter seinem eigenen Dache zu wohnen, von seinem eigenen Felde zu leben, einen reichen Erfolg zu haben, einen Vorrat auf viele Jahre zu sammeln und mit beruhigter Seele in die Zukunft zu blicken.
Gedenke: Das Leben des Diesseits ist nicht eine Zeit des Genusses, sondern die Zeit, in der wir zum Genuß der ewige'n Seligkeit tüchtig werden sollen; es ist eine Spanne Zeit, in der wir der Ewigkeit ent-gegenreifen. Wehe uns, wenn uns das Urteil Gottes trifft: „Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wes wird sein, das du bereitet hast?"
Aber auch die Disteln und Dornen reden zu uns. Disteln und Dornen stehen unter dem Gerichtsspruch Gottes, der nach dem Sündenfall über Adam ausgesprochen wurde'. „Dornen und Disteln soll dir der Acker tragen," Noch leiden wir unter dem Fluch, seufzen unter 'den
spitzen Dornen und Disteln, die uns viel Not und Kummer bereiten. Aber hat Gott sie nicht als Erziehungsmittel in unser Leben hineingeordnet?
Nimm sie willig hin! Auch sie müssen uns zum Besten dienen. Schau nicht auf die Dornen und Disteln und ihre ganze Sippe, die an uns zerrt und reißt. Laß dich immer wieder ergreifen von der großen Erntefreude: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen .Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
Das Ährenfeld, das unter den heißen Sonnengluten ausgereift ist, ruft den Schnitter herbei. In der Offenbarung wird uns der große Erntetag in dem Bild der Kornernte vor Augen gestellt (Offenbarung 14, 14— 16),
Der HErr der Ernte - der Menschensohn - erscheint auf einer weißen Wolke, auf Seinem Haupt eine goldene Krone und in Seiner Hand eine scharfe Sichel. Uni Ihn herum stehen die Schnitter, die Engel Gottes. Einer von ihnen ruft mit großer ‚Stimme zu Dem, der auf der Wolke sitzt.,, Schlag an mit Deiner Sichel und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen denn die Ernte der Erde ist überreif geworden!" Auf den Tag der Ernte ist unser ganzes Leben abgestellt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wie wird die Ernte sein?
Hörst du den Ernteruf: „Schlag an Deine Sichel mit Macht!"? Der
Schnitt der Sichel des HErrn Jesus Christus, der für die tauben Ähren den Gerichtstag einleitet, ist zugleich die Erfüllung der Sehnsucht der von Körnern schweren Ähren, nun eingesammelt zu werden in die himmlischen Scheunen. Und schmerzt auch uns der scharfe Schnitt der Sichel - er trifft, nur den Halm, der verwest, den Leib, der sterben muß. Die Körner, von denen die Ähre schwer ist, bleiben unberührt.
So ist der Tag des HErrn ein Tag der Freude für Seine Gläubigen,
die unter der Trübsalshitze ausgereift sind und heimgeholt werden als reife Garben. Aber die Kinder dieser Welt werden beim Anblick Seiner Sichel erschrecken; denn für sie bedeutet der Erntetag ewiges Gericht, das der HErr ausspricht mit den Worten. „Und sie werden in den Feuerofen geworfen; da wird sein Heulen und Zähneklappern." (Matth. 13,42)
Bis du Weizen oder Unkraut? Lebst du nur für das Diesseits oder für Gott und Seine Ewigkeit?
Laßt uns beten, wie es in' einem .
Sonntagsschullied heißt:
„Gib Deinen Segen allen,
gib Weisheit und Verstand,
und möcht' der Same fallen
auf lauter gutes Land!
Daß wir die Früchte tragen
so schön und vielerlei,
daß nach des Lebens Tagen
die Ernte herrlich Sei!'
Lina Haug Samenkörner Heft 787
Pooq Grönländer
Zum drittenmal war auf der Insel -der Hoffnung im sogenannten „Balls Revier" an der grönländischen Westküste Weihnachten gefeiert worden. Zum drittenmal hatte Pfarrer Hans Egede Norwegern, Dänen und Eskimos die Weihnachtsgeschichte und die prophetischen Weissagungen gelesen und mit ihnen die altbekannten Lieder zur Christnacht gesungen.
Nun war der dritte Weihnachtstag des Jahres 1723 angebrochen. Für Hans Egede bedeutete er keine Ruhepause, denn er predigte täglich - das war in der Monotonie des Grönlandwinters unumgänglich. Auf dem langen Gang vor den Stuben des Langhauses, das er nach seiner Ankunft auf Grönland im Jahr 1721 hatte erbauen lassen, war Stimmengewirr zu hören. -Die Leute drängten sich dort, denn das Wetter ließ es nicht zu, daß -sie ins Freie hinaustreten konnten. Hoher Schnee und wütender Sturm hatten das Haus und die Nebengebäude seit Tagen eingeschlossen.
Für die meisten Leute der Siedlung bestand das Pest in einem warnen Bad im Keller, einer dicken gesalzenen Fleischsuppe und reichlich Klippfisch. Dazu gab es eine doppelte Branntwein- und Bierration, von der jedoch niemand einen Rausch bekam. -
Egedes fünfzehnjähriger Sohn Poul trat in die Stube; ih folgte ein junger, gedrungener Eskimo mit einer lustigen Stupsnase und lebhaften, freundlichen Augen Es war kein Unbekannter, er hieß Pooq, was soviel wie Sack bedeutet, und hatte schon seit einiger Zeit den Weg zu Egedes Siedlung gefunden und sich dort für altes lebhaft interessiert - vor allem für die Bücher des „Palasi", des Pastors Egede, und die Erzeugnisse des Schmieds Ole Johannesen.
„Stören wir, Vater?" fragte Poul.
„Nein, gar nicht - gibt es etwas Besonderes?" „Ich glaube ja", erwiderte Poul. Und zu Pooq gewandt: Sag du es ihm!" Doch dem Eskimo schien es die Rede verschlagen zu haben, und so mußte denn Poul Egede sein Anliegen vortragen.
„Pooq hat mir gesagt, er würde sehr gern das Land kennenlernen, aus dem wir gekommen sind, Vater. Und natürlich wolle er nicht dableiben, sondern wieder nach Hause kommen und seinen Freunden berichten, was er dort sah. Du weißt ja, sie glauben, wir Kavlunakker hätten gar kein Heimatland, wir lebten in Schiffen auf dem Meer - darum müßten wir uns auch bei den Inuit niederlassen und ihnen die Fische und Seehunde wegfangen. Pooq möchte etwas Dänisch lernen - und er möchte von Jesus wissen."
„So!" sagte Egede, der den klugen jungen Eskimo gern kommen sah. Er glaubte jedoch, dessen Wunsch rühre vom Erlebnis der christlichen Weihnacht her, denn er war die Festtage über in der Siedlung gewesen. Solche Wünsche entstanden gern im Überschwang der Gefühle und klangen dann sehr schnell wieder ab.
„Darüber müssen wir in aller Ruhe reden", sagte er, „vielleicht morgen - wenn Pooq dann seinen Wunsch noch hegt."
Die beiden jungen Leute gingen hinaus. Pooq mochte etwa zehn Jahre älter sein' als Poul Egede, sein genaues Alter wußte er nicht.
Hans Egede klopfte dreimal an die Wand, das war ein Zeichen, daß Hartvig Jentoft zu ihm herüberkommen sollte,
der Cominissarius der .Bergener Grönlandcompagnie, dem der Handel oblag - dieser Handel und die' Tätigkeit des „Missionaires" Egede waren eng verbunden. Man kannte es nicht anders: das eine hängte sich an das andere.
Hartvig Jentoft trat ein Man konnte nicht sagen, daß die beiden Männer, den Theologen und den Geschäftsmann, Freundschaft verband; aber sie waren aufeinander angewiesen.
„Pooq war eben bei mir", begann Egede, „und was glaubt Ihr, Jentoft, was er im Sinn hat? Er will mit dem Schiff nach Dänemark reisen und dann zurückkehren, um hier zu erzählen, was er sah!"
„So!" sagte Jentoft ebenso kühl wie vor wenigen Minuten Egede; doch es blitzte in seinen Augen. Er schnippte mit den Fingern.
„Ehrwürden, wenn das bloß keine Marotte von ihm ist! Wenn er dabei bleibt, dann könnte ich mir keine bessere Werbung für den Grönlandhandel vorstellen. Ein Eskimo in Kopenhagen - der freiwillig von Grönland kam! Einer der fernsten und wildesten Untertanen Seiner Majestät, bedürftig der Zivilisation und der christlichen Lehre! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Er kann für den Grönlandhandel werben und für die Mission. Und. - erfreuen wir Majestät mit solch einem exotischen Untertan, dann ist uns wohl ein Erweis besonderer königlicher Gnade sicher. Wir konnten einen solchen brauchen. Unsere Schreiben landen gewöhnlich in den Archiven, aber einen Wilden von Grönland kann man nicht übersehen. Ganz Kopenhagen wird davon sprechen - wenn es bloß keine Inuit-Marotte ist!"
„Auch ich habe mir schon Gedanken gemacht", sagte Egede. „Doch das leidige ‚aap' und ‚naamik - ja und nein bei den Eskimos. Heute so und morgen so.
Dazu hat sie wohl, das Land und das Wettet erzogen; Wir müssen es geschickt anpacken. Am besten tun wir so, als wäre es ein großes Geschen für Pooq, wenn er mit Euch reiste."
„Verbleiben wir so und warten wir ab."
Pooq blieb dabei: im nächsten Frühjahr oder Sommer wollte er mit einem Schiff ins Land der Kavlunakkut reisen - bezahlen könne er die Reise natürlich nicht.
Das brauche er auch nicht, wollte Egede sagen; doch er sprach:
„Das werden andere tun, Pooq. Aber wenn du wirklich nach Dänemark reisen willst, dann mußt du auch einige Wörter und Sätze der dänischen Sprache lernen. Und den Glauben der Christen muß ich dir dann noch genauer erklären, als es bisher möglich war."
Poul Egede dolmetscht; und Pooq nickte - wie die Kav-lunakkut, wenn sie zu faul waren, ja zusagen.
Pooq wohnte in dem großen Haus der Siedlung, und er war nicht der erste Eskimo, der dort für einige Zeit Quartier bezogen hatte. An enges Beisammenleben war man hier gewöhnt, niemand konnte für sich allein sein - höchstens der Schmied in seiner Schmiede. Es sprach sich herum, warum Ehrwürden Egede sich solche Mühe mit dem Eskimo Pooq gab, und man nickte verstehend, wenn man unter sich war. Der Pastor kämpfte um sein Verbleiben auf Grönland. Er wollte die Eskimos zu Christen machen, nachdem sich sein ursprüngliches Vorhaben, die Nachkommen der alten Wikinger zu lehren und ihnen das Evangelium zu verkündigen, bisher als nicht durchführbar erwies, weil man einfach keine Wi-
kingernachkommen entdeckte. -
Hans Egede und sein Sohn Poul unterwiesen Pooq im Dänischen - mit norwegischem Akzent - und ließen sich dabei
gleirheitig von ihm im Grönländischen unterweisen. So hatten beide Seiten ihren Nutzen von diesen Stunden, und meist
saß auch noch der dreizehnjährige Niels Egede dabei, der schon weit fortgeschritten war und sich grönländisch mit Grönländern unterhalten konnte.
„Hoffentlich macht sich der Bursche nicht nur gute Tage bei Euch und springt ab, wenn es ernst wird, Ehrwürden",meinte etwas sarkastisch Jentoft. Er glaubte seine Erfahrungen mit Eskimos gemacht zu haben, die in ihren Entschlüssen sehr wankelmütig waren. Die meisten Norweger und Dänen, Kon-tinentler überhaupt, vermochten nicht zu begreifen, daß Grönland seine Menschen so geformt hatte. Es ließ nicht zu, daß sie sich festlegten.. Man lebte heute - und morgen würde man ja sehen.
Jentoff sollte recht behalten.
Als der Frühling gekommen war und auch er zur Rückkehr nach Bergen rüstete - er war 1721 inh Egede nach Grönland gekommen, und seine Zeit warum—, redete er mit Pooq. Und da sagte Pooq unter vielen Drehungen und Wendungen, er werde wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht zu den Kav-lunaklcut fahren - vielleicht im nächsten Sommer.
„Da habt Ihr's, Ehrwürden" sagte Jentoft, und Egede war verärgert. Er hatte sich solche Mühe mit dem Burschen gegeben. Gjertrud, seine Frau, tröstete ihn: vergebliche Mühe
sei es ja nicht - er, ihr Mann, suche doch Eskimos, die sich willig unterweisen ließen. Und einiges hatten er und die Jungen ja auch von Pooq gelernt.
Egede grübelte.
„Wenn man einen Eskimo fände, der ihn begleiten könnte?" Er sah seine Söhne an und fragte: „Hat er einen besonderen
Freund?"
„Pooq hat viele Freunde, er ist sehr beliebt, aber sein bester Freund ist bestimmt Qiperoq drüben auf den Koek-Inseln."
„Wenn ihr nun Pooq mal fragtet, ob er reisen würde, wenn Qiperoq mitkäme?"
„Qiperoq ist verheiratet, Vater, und er hat Kinder.
Er wird es wohl kaum tun. Aber er fährt ja auch sonst den ganzen Sommer über von seiner Familie weg auf Fang Wir versuchen es."
Sie hatten Glück. Qiperoq, eine stattliche Erscheinung, größer als .Pooq, schlanker und fast mit einem Norwegergesicht ausgestattet, das dem Poul Egedes etwas ähnelte, sagte - wenn auch zögernd - ja.
Die beiden Eskimos sonnten sich im Glanz ihres künftigen Rühmes und rüsteten zur weiten Reise, von ihren Familien und Sippen anfangs nur widerstrebend, doch schließlich bestens ausgestattet. Alles, was der Inuk auf Grönland braucht, der Fänger und Jäger, wurde ausgewählt, auch achteten- die Angehörigen darauf, daß beide Festgewänder mit auf die Reise bekamen, mit denen sie sich bei den Weißen sehen lassen konnten.
Jentoft sah und hörte es gern. Er wußte nicht, daß es zwischen Egede und seiner Frau ernste Gespräche gab.
„Es ist richtig, Hans", sagte Gjertrud Egede, „früher hat man Eskimos mit Gewalt und List aus ihrer Heimat entführt, um sie als Beweisstücke kühner Fahrten vorzuzeigen. Das haben unsere Eskimos ja nicht vergessen. Die armen Leute sind in der Ferne gestorben. So ist das ja bei Pooq und Qiperoq nicht - aber ich kann mir nicht helfen: ich werde ein ungutes Gefühl nicht los."
„Aber es ist doch nichts Schlechtes, wenn sie in Kopenhagen und Bergen sagen: ‚Kommt herauf und helft uns!' Denk an Paulus in Troas !"
„Du siehst es so. Nun, gebe Gott, daß dieses Abenteuer gut ausgeht Denn ein Abenteuer wird es für die beiden Ein Lob wird dir und Jentoft die Gesellschaft nicht vorenthalten können - die beiden sehen gut aus. Besser als mancher hier! Es sind wahrlich keine ‚Wilden', wie wir oft gedankenlos gesagt haben."
„Es ging ja nicht von uns aus, Frau! Pooq hat doch den Anfang gemacht, und Qiperoq, sein Freund, reist mit ihm. Wir werden die beiden mit unserer Fürbitte begleiten."
„Und Jentoft wird es mit seinen Berechnungen!"
„Meine Hoffnungen reichen weiter, Gjertrud. Die beiden werden unsere Kirchen sehen, unsere Städte und Häuser • - vielleicht den König und die Königin, was weiß man. Wenn sie als Freunde wiederkämen - als Eskimos, die gern Christen würden! Was wäre da für uns • gewonnen! Ihre Worte haben größeres Gewicht als meine Predigten."
„Da muß ich dir recht geben. 'Vielleicht würden wir dadurch mehr einheimische - Helfer • gewinnen; denn ohne sie wird es auf die Dauer nicht gehen. Nur darf sie ein anderer Jentoft, ein möglicher Nachfolger dieses nicht gerade königlichen Kaufmanns, nicht für seine Zwecke ausnutzen."
„Du kannst dich mit dem Kommerz nicht abfinden?"
„Nie, Hans. Doch ich habe einsehen müssen, daß er nicht zu entbehren ist."
Es war das erstemal, daß sie etwas in dieser Richtung sagte, und Egede war dankbar für ihre Einsicht.
Inzwischen war die Zeit gekommen, da man nach den Schiffen von Bergen Ausschau zu halten begann Es wardies, wenn es sich hinzog, ein die. Stimmung bedrückendes Warten. Bei den weniger Geduldigen und Starken in der Siedlung schlug es in Fluchen, Sarkasmus, Zügellosigkeit und Schwarzmalerei um - bis dann Kajakmänner aufgeregt schrien: „Umiaissuakut!" Und die des Dänisch-Norwegischen -etwas Kundigen-: „Ski-
-bene kominer -. die Schiffe kommen!" --
Das lästige Treib- und Packeis verzögerte in diesem Jahr die Ankunft der Schiffe, und Qiperoq sagte zu Pooq, dies sei wahrscheinlich ein Zeichen, daß man sich nicht auf die- weite Reise begeben solle. Doch Pooq redete ihm seine Bedenken aus. Um ehrlich zu sein: auch bei ihm ging es auf und ab, er
Manchmal wünschte ich mir Flügel, Noreen Riols
Manchmal wünschte ich mir Flügel, Noreen Riols
Ein Blitz aus heiterem Himmel
Das Telefon neben meinem Bett klingelte schrill und riß mich aus einem tiefen, unruhigen  Schlaf. Blinzelnd sah ich die wässrige Novembersonne durch den Vorhangspalt, doch ich wollte nicht aufwachen. Ich wollte mich dem neuen Tag nicht stellen. Aber das Telefon schrillte unerbittlich. Widerwillig streckte ich den Arm aus, um den Hörer abzunehmen. Dabei fiel mein Blick auf das Kinderbettchen neben mir. Das Baby war wach. Mit seinen dunkelblauen Augen sah es mich an, und mein Herz zerschmolz vor Liebe. „Kit", flüsterte ich, „Kit!" Es war ein Sonntagmorgen, und mein Sohn war erst drei Tage alt.
Schlaf. Blinzelnd sah ich die wässrige Novembersonne durch den Vorhangspalt, doch ich wollte nicht aufwachen. Ich wollte mich dem neuen Tag nicht stellen. Aber das Telefon schrillte unerbittlich. Widerwillig streckte ich den Arm aus, um den Hörer abzunehmen. Dabei fiel mein Blick auf das Kinderbettchen neben mir. Das Baby war wach. Mit seinen dunkelblauen Augen sah es mich an, und mein Herz zerschmolz vor Liebe. „Kit", flüsterte ich, „Kit!" Es war ein Sonntagmorgen, und mein Sohn war erst drei Tage alt.
Schlaftrunken hörte ich, wie auf der Straße ein Messerschleifer lauthals seine Dienste anbot, während er mit seinem Karren langsam weiterfuhr. Seine Stimme vermischte sich mit denen der Frauen, die mit prallgefüllten Einkaufstaschen vom Markt nach Hause eilten. Ein gewöhnlicher Sonntagmorgen, aber hier war alles so anders, als ich es aus meiner Kindheit kannte. Während mein Kopf allmählich klarer wurde, dachte ich wehmütig an die sonntägliche Stille einer englischen Vorortstraße.
„Hallo", sagte ich schläfrig in den Hörer. Es war mein Vater, der aus Essex anrief. „Geht es dir gut?" fragte er besorgt. „Ich kann dich kaum verstehen. Die Verbindung scheint ziemlich schlecht zu sein." Die Verbindung war ganz in Ordnung. Es lag an mir. Ich hatte einfach keine Lust zu reden. „Es tut mir leid", gähnte ich, „ich schlafe noch halb." „Wie geht es dem Kleinen?" Ich schaute noch einmal in das Kinderbett. Das sanfte, gleichmäßige Atmen verriet mir, daß mein Junge eingeschlafen war.
„Er ist so niedlich", murmelte ich. „Ich gebe dir mal Mutter." „Wie geht es dir?" vernahm ich die fürsorgliche Stimme meiner Mutter durchs Telefon. „Großartig", log ich. „Wie heißt er?" „Christopher Robert." Robert war der Name meines Großvaters, und ich wußte, daß für meine Mutter dieses Neugeborene etwas ganz Besonderes sein würde.
Ich legte auf und blickte aus dem Fenster. Die Bäume standen schwarz und kahl in dem kleinen Hof des Hertford British Hospital am Rande von Paris. Das fahle Sonnenlicht hatte es aufgegeben, sich einen Weg durch die Wolkendecke zu suchen; ein trübes Grau lag über allem. Genauso war meine Stimmung. Tränen rannen mir langsam über das Gesicht, und ich verstand nicht, warum es in mir so leer und düster aussah.
Anstatt mich über den Anfang dieses neuen Lebens zu freuen, fühlte ich mich, als sei alles Leben erloschen. Wie die Hyazinthenzwiebeln, die ich ein paar Tage zuvor eingepflanzt hatte, hätte ich mich am liebsten in die Erde vergraben, um erst im Frühjahr wieder zum Vorschein zu kommen. Ich konnte mich selbst nicht verstehen. Christopher war ein hübsches, neun Pfund schweres Baby. Wir hatten uns alle auf ihn gefreut und ihn bereits ins Herz geschlossen. Und doch war da diese Dunkelheit, diese Hoffnungslosigkeit, dieser Widerwille, der Zukunft ins Auge zu sehen.
Es klopfte, und ein zierlicher weißhaariger Mann trat ein. „Ich bin der katholische Priester", sagte er schüchtern. Dann lächelte er, und ein Strahlen ging über sein Gesicht. „Ich bin evangelisch", erwiderte ich. Ein Funken Hoffnung leuchtete auf. Vielleicht konnte dieser gütige alte Herr mir helfen und mir sagen, warum ich mich so niedergeschlagen fühlte. Ich lächelte zurück, aber er wandte sich bereits wieder zum Gehen.
„Ihr Pfarrer wird bald vorbeikommen", sagte er freundlich. „Übrigens findet heute nachmittag in der Kapelle ein anglikanischer Gottesdienst statt." Er blickte auf das schlafende Kind. „Gott segne sie beide", flüsterte er sanft und ging hinaus. Mir wurde das Herz wieder schwer. Der evangelische Pfarrer - oder vielmehr sein Vikar - hatte kurz hereingeschaut, um mir Guten Tag zu sagen und zu gratulieren. Aber er war jung und erst seit kurzem verheiratet. Ich hatte nicht das Gefühl, daß er verstehen könnte, was in mir vorging.
Um halb drei Uhr nachmittags saß ich allein in einer der hinteren Bankreihen der kleinen Krankenhauskapelle. Als der Gottesdienst begann, kamen mir wieder die Tränen. Ich senkte den Kopf, unfähig zu singen, unfähig, irgend etwas anderes zu tun als einfach dazusitzen und meinen Tränen freien Lauf zu lassen. Ich kann mich kaum noch an den Gottesdienst erinnern. Als er zu Ende war, ging ich rasch hinaus. Ich wollte mit niemandem sprechen, wollte nur so schnell wie möglich zurück auf mein Zimmer. Mein Gesicht sollte wieder in Ordnung sein bevor meine Familie eintraf. Aber sie waren schon da, zumindest die beiden ältesten Jungen. Sie standen verlegen im Raum und wußten nicht, was sie tun oder sagen sollten.
Mein Zimmer lag im Erdgeschoß; Jacques, mein Mann, stand draußen im Hof mit Yves und Bee, die nicht hereinkommen durften, weil sie noch zu klein waren. Als ich ans Fenster trat, hob Jacques den kleinen Yves hoch, damit er mit mir sprechen konnte. Aber der Dreijährige war ungnädig. „Ich will rein und meinen kleinen Bruder angucken"; maulte er. „Ich auch", stimmte die zehnjährige Bee ein. Ihre dünnen Zöpfe wippten auf und ab, während sie am Fenster hochsprang, um ins Zimmer zu sehen.
„Warum kann ich nicht rein?" jammerte Yves. Seine blauen Augen blickten zornig und verständnislos. „Wenn Olivier und Hervé ihn sehen dürfen, will ich das auch!" „Ich bringe das Baby ans Fenster", unterbrach ich ihn, nahm den Kleinen aus dem Bettchen und legte ihn Olivier in den Arm: „Halte ihn hoch, damit sie ihn sehen können", sagte ich.
Aber mit seinen fünfzehn Jahren war Olivier in einem Alter, in dem ihm alles peinlich war, und ein Baby auf dem Arm zu halten, war ihm ganz offensichtlich peinlicher als alles andere. „Hier", sagte er und gab das Bündel an seinenjüngeren Bruder weiter. „Nimm du ihn." Hervé ging zum Fenster und hielt Christopher hoch, damit ihn die jüngeren Geschwister sehen konnten.
Bee stand auf Zehenspitzen. Die braunen Augen leuchteten. „Ihre Haare müßten geschnitten werden" dachte ich. Der Pony hing ihr fast bis in die Augen. Yves zappelte aufJacques Arm herum. „Ich will Mami einen Kuß geben", jammerte er. „Ich bin bald wieder zu Hause, Schatz", tröstete ich ihn und preßte mein Gesicht gegen die Scheibe. „Ich will dich aber jetzt", heulte er und rieb sich mit seinen kleinen Fäustchen die Augen.
Bei diesem Anblick füllten sich auch meine Augen wieder mit Tränen, und ich wandte mich ab. Ich merkte, daß die Geduld meines Mannes langsam zu Ende ging. Olivier und Hervé sehnten sich offensichtlich auch danach fortzukommen, wußten aber nicht so recht, wie sie es anstellen sollten. „Ich denke, es ist besser, wenn ihr geht und Vati helft", sagte ich und nahme Hervé das Baby ab. „Er hat anscheinend Schwierigkeiten mit Yves." Erleichtert verabschiedeten sie sich mit einem flüchtigen Kuß und gingen hinaus. Ich blieb mit Christopher auf dem Arm auf dem Bett sitzen. Wieder begannen die Tränen zu fließen; es schien kein Mittel zu geben, sie aufzuhalten.
Der Tag schleppte sich langsam dahin. Im Krankenhaus begann die allabendliche Routine: Die Krankenschwester, eine kleine, etwas rundliche Schottin mit strahlend blauen Augen, kam in das Zimmer. Aber als sie sich zu mir aufs Bett setzte, sah sie mich besorgt an. „Wir hätten gerne, daß Sie noch mit einem Atzt sprechen, bevor Sie nach Hause gehen", begann sie. Ich sah sie erstaunt an: „Aber die Ärzte kommen doch jeden Tag vorbei." „Dieser nicht", entgegnete sie und holte tief Luft. „Ich glaube, er kann Ihnen helfen." „Ach, wenn ich erst wieder zu Hause bin, wird es mir bald wieder besser gehen", wandte ich ein. „Da wollen wir eben sichergehen", schloß sie. „Ich habe Dr. Dufour gebeten vorbeizuschauen. Morgen um drei wird er hier sein."
„Aber warum?" fragte ich. „Wer ist das?" Die Schwester holte noch einmal tief Luft. „Ein Psychiater." Ich sah sie bestürzt an. „0 nein", rief ich aus. „Ich brauche keinen Psychiater. Ich bin nur ein bißchen müde, das ist alles." „Es ist mehr als das", sagte sie ruhig. Sie streichelte meine Hand, stand auf und ging hinaus. Ich nahm den Handspiegel vom Nachttisch und blickte hinein. Sah so eine glückliche junge Mutter aus? „Du bist keine junge Mutter", sagte eine innere Stimme. „Du bist fast vierzig." „Das wird es wahrscheinlich sein", seufzte ich, während ich den Spiegel beiseite legte und mich ins Kissen zurücklehnte. Einen Augenblick lang fühlte ich mich beruhigt. Das war wenigstens, eine Erklärung.
Dr. Dufour sah aus wie ein Teddybär, klein und untersetzt, sogar aus seinen Ohren schauten Haare heraus. Er kam ins Zimmer, setzte sich an mein Bett, nahm meine Hand und grunzte etwas vor sich hin. Und ich weinte. Wir kamen nicht sehr weit. Ich kann mich nur noch daran erinnern, daß er sagte: „Ich bin bei Ihnen, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin doch bei Ihnen." Aber ich machte mir über alles mögliche Sorgen, und die Tatsache, daß er bei mir war, half mir überhaupt nicht. Vermutlich habe ich auch mit ihm geredet, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Jedenfalls schrieb er mir ein langes Rezept aus und sagte, er mich gern in einem Monat wiedersehen.
Wie froh war ich, als ich endlich die Treppen des Krankenhauses hinuntergehen konnte zum Ausgang! Mit einem Arm hatte ich mich bei Jacques eingehängt, die andere Hand hielt Yves fest umklammert. Er plapperte unaufhörlich. Der vierzehnjhrige Hervé trug behutsam und vorsichtig das Baby. Seinen dunklen Schopf hatte er ehrfurchtsvoll über das kleine Bündel gebeugt, das ihm später nicht nur äußerlich so ähnlich werden sollte. Mit seinen sieben Tagen war Christopher mit seinen weit auseinanderstehenden Augen und dem weichen, dunklen Haar, das so charakteristisch für Jacques Familie ist, so etwas wie ein kleiner rundlicher Eskimo. Während ich das Krankenhaus hinter mir ließ und in den feuchten Novembermorgen hinausging, dachte ich: "Jetzt wird alles wieder gut; es ist vorbei, und ich gehe nach Hause." Aber es war bei weitem nicht alles in Ordnung. Jacques kaufte die verschriebenen Tabletten, aber ich legte sie beiseite. Er erinnerte mich an meinen Termin bei Dr. Dufour, aber ich sagte ihn ab.
Nach meiner Rückkehr gab es zu Hause bisweilen Augenblicke, in denen mir das Leben schön erschien und ich mich an den Kindern freuen konnte. Meist jedoch wachte ich morgens mit einem Gefühl der Lustlosigkeit und Leere auf. Der Tag erschien mir wie eine endlose Wüste, die ich irgendwie durchqueren mußte, bis mir der Nachtschlaf ein paar Stunden des Vergessens schenkte. Mechanisch schleppte ich mich von Woche zu Woche, und mit jedem Tag zog ich mich mehr in mich selbst zurück. Ich war neununddreißig Jahre alt, und niemand hatte mich darauf vorbereitet, dass die Jahre allmählich ihren Tribut forderten.
Marianne, Glynn Mills
Glynn Mills MARIANNE 
Mariannes nächste Zukunft scheint klar: zusammen mit ihrer Freundin Gerda will ..sie studieren. Doch kurz bevor die beiden ihre Heimatstadt verlassen wollen, stirbt Mariannes Mutter. Da ihr Vater pflegebedürftig ist, stellt Marianne ihre Pläne zurück. Als sie nach Jahren des Wartens schließlich frei wird, tut sich ein völlig anderer Weg vor ihr auf: Sie besucht die Bibelschule in der Hoffnung, mit Daniel, dem sie sich versprochen hat, auf das Missionsfeld zu gehen. Doch wieder kommt alles anders. Von Marianne wird das Äußerste gefordert. Wird sie sich bewähren?
IN DER „HEILEN WELT'
mehr Erzählungen
„Die Kinder werden langsam erwachsen und flügge." Prediger Hans Lindenmeier sprach die Worte nachdenklich; seine Stimme klang ein wenig wehmütig.
Leise trat seine Frau zu ihm ans offene Fenster, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die weite Rasenfläche vor dem Haus hatte. Von drüben unter den hohen Bäumen erscholl lustiges Lachen und Stimmengewirr. Zwei etwa achtzehnjährige Mädchen ließen sich gerade erschöpft in ihre Liegestühle fallen, während ein junger Mann die liegenge-ldssenen Tennisschläger einsammelte und ein andbrer gekühlte Getränke herbeibrachte. Stolz beobachteten die Eltern Sohn und Tochter. Die beiden anderen waren Freunde.
„Wenn die beiden erst einmal an der Universität sind, wird sieh ihr Leben gewaltig ändern. Kein Wunder, daß Gerda und Marianne sich riesig darauf freuen." Die Stimme von Frau Lindenmeier klang hell und freundlich und entsprach ganz ihrer äußeren Erscheinung. Sie war eine freundliche, gut aussehende Frau mit braunem Haar und blitzenden braunen Augen.
„Die Umstellung wird ihnen gut tun! In diesem ländlichen, abgelegenen Nest rostet man ja ein!" ließ sich aus dem Hintergrund die spröde Stimme von Tante Mathilde vernehmen. Damit hatte sie ihr persönliches Urteil über das ehrbare Meine Landstädtchen Heiddorf gefällt,
wo sie nunmehr seit einem Jahr im ruhigen Haus ihres Bruders und ihrer
Schwägerin lebte. Die beiden tauschten belustigte Blicke. Ihr beider Sinn für Humor, verbunden mit Daniel Lindenmeie'rs zuvorkommender Höflichkeit und Gerdas Geduld gegenüber der manchmal etwas auf die Nerven gehenden Art ihrer Tante hatten verhindert, daß die Situation in den vergangenen zwölf Monaten für beide S&ten unangenehm geworden war.
Die kritische Stimme fuhr fort: „Ich verstehe einfach nicht, wie sich Daniel bei seinen hervorragenden Schulzeugnissen für das Studium an einer Bibelschule entscheiden konnte."
„Ich glaube schon, daß er genau weiß, was er tut. Er ist sehr für das Praktische, und der Stundenplan bietet reichlich Gelegenheit hierzu", gab ihr Bruder geduldig zur Antwort.
„Ein dummer Junge ist er! Wo bleibt bloß sein Ehrgeiz?'
Gemessen an Tante Mathildes materiellen Maßstäben besaß er wirklich keinen Ehrgeiz. Aber Daniel ging es in erster Linie um etwas anderes. Er war ein entschiedener Christ und wollte sein Leben Gott weihen, den er liebte und dem er dienen wollte.
„Außerdem.ist es eine Schande, daß Richard Thiele, auch ein Junge mit Grips, in der Gefahr steht zu verkümmern, weil er wegen der Züstände in seinem Elternhaus nicht studieren kann, sondern sich in Kursen weiterbilden mußt"
Jetzt konnte Frau Lindenmeier nicht länger schweigen. „Richards Entscheidung war bestimmt uneigennützig. Aber er faßt sie dennoch nicht als ‚Opfer' auf oder fühlt sich ihretwegen gar gehemmt. Ihm ist so wohl wie einem Fisch im Wasser - Gott sei Dank!" Sie blickte voller Sympathie zu Ri-:hard hinüber, der neben Gerda saß. Beide schienen sich gerade über einen Scherz zu amüsieren, den Richard gemacht hatte; sein Gesicht war vom Lachen gerötet und fast ;o rot wie sein Haar. Von Hemmung oder Behinderung konnte bei Richard Thiele keine Rede sein.
„Es ist trotzdem Blödsinn. Gerda absolviert ein Hochschulstudium, und Richard muß arbeiten und sich in seiner Freizeit mit dem Studium abplagen - das ist doch einfach nicht richtig. Da komme ich nicht mit!" Die Stricknadeln kapperten schneller.
„Gerda muß aber doch das Staatsexamen machen, wenn sie einmal in der Schule unterrichten will, Mathilde", erinnerte sie ihr Bruder freundlich.
„AÖh Quatsch! Das ist nur Geldverschwendung und sonst nichts! Wenn sie ein paar Jahre unterrichtet hat, wird sie heiraten. Vielleicht haltet ihr mich in meinen Ansichten für altmodisch; aber die alte Mathilde spürt genau, woher der Wind weht."
Frau Lindenmeier lachte leise. „Meine liebe Mathilde, wenn du etwa an Richard denken solltest, so laß dir gesagt sein, daß es sich bei den beiden bloß um eine harmlose Freundschaft handelt. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit, sind also sozusagen miteinander aufgewachsen, haben die gleichen Interessen, und außerdem verbindet sie, ähnlich wie bei Marianne Dorn und Daniel, das starke Band des Glaubens an Jesus Christus. Sie haben ihr junges Leben diesem Herrn geweiht, und alle vier sehen in ihrer geplanten beruflichen Laufbahn eine Berufung Gottes." Frau Lifidenmeier war ernst geworden. Liebevoll und etwas wehmütig sah sie ihre Schwägerin an. Wenn doch die liebe Mathilde auch etwas von der Freude und dem Frieden wüßte, die Jesus ihnen gegeben hatte! Aber sie hielt sich abseits, schien sich persönlich nicht festlegen zu wollen und sagte bei Gelegenheit jedem, der es hören wollte, Religion sei reine Privatsache und man solle sie bitte damit in Ruhe lassen.
Das entstandene Schweigen wurde von den vier hereinstürmenden jungen Leuten jäh unterbrochen. „Was gibt es zum Tee?' riefen sie durcheinander, und dann, nach einem anerkennenden Blick auf den reichlich gedeckten Abendbrottisch, stürmten sie wieder davon, um sich vor dem Abendbrot noch etwas zurechtzumachen.
„Wie weiß deine Mutter bloß immer, was wir am liebsten mögen, Gerda? Sie ahnt immer, wonach uns der Appetit steht. Wie wird wohl die Kost im Studentenheim sein? Ich kann mich noch gar nicht an den Gedanken gewöhnen, daß wir bereits in vier Wochen dort sein werden." Marianne wusch sich die Hände und ging dann auf ihre Freundin zu, die sich am Toilettentisch kämmte. „Deine Frisur hält immer so gut, mein Haar ist ständig durcheinander!" jammerte sie und machte sich daran, ihre dichten blonden Locken zu bändigen.
„Mein Haar sähe schrecklich aus, wenn ich es so lang trüge wie du", bemerkte Gerda.
„Flechte dir doch einfach Zöpfe!" bemerkte Marianne scherzhaft. „Bei deinen blonden Haaren sieht das sicher gut aus. Du kannst sie dir dann wie eine Krone um den Kopf legen." Scherzhaft gab sie ihrer Freundin einen Schubs und widmete sich dann wieder ihren eigenen widerspenstigen Locken. „Horch - der Gong!" Eilig rannten die beiden die Treppe hinunter.
„Schon wieder zu spät! Vom nächsten Monat an werdet ihr beiden euch etwas schneller bewegen müssen", bemerkte Daniel scherzhaft, als sie sich an den Tisch setzten.
„Ich glaube, dir liegt das spartanische Training auch mehr als uns, alter Junge", erwiderte Marianne prompt und sah ihn mit ihren braunen Augen streitlustig an.
„Ich glaube, man wird uns allen ein bißchen mehr Disziplin beibringen. Unser Richard hat es gut! Er ist sein eigener Herr!"
„Auf diese Ehre würde ich ganz gern verzichten. Tagsüber muß ich mich schwer abschinden, und abends soll ich noch das einpauken, wozu ihr den ganzen Tag über Zeit und Muße gehabt habt"
„Muße? Daß ich nicht lache!" ließ sich nun Gerda ver nehmen. „Anne Heizmann hat gerade ihr erstes Studienjahr hinter sich gebracht und ist das reinste Nervenbündel geworden. Eine Vorlesung jagte die andere, und in der Freizeit mußte sie riesige Mengen von Büchern durchackern."
„Ihr scheint ja schrecklichen Zeiten entgegenzugehen", neckte der Vater. Als er seine Tochter so über den Tisch hinüber ansah, wurde ihm ganz eigenartig ums Herz; plötzlich erfaßte ihn Sorge. Gerda hatte noch kaum etwas von der Welt gesehen; sie kannte nur die christliche Atmosphäre des Elternhauses und war stets von Liebe umgeben gewesen. Wie würde ihr das Neue bekommen? Von jetzt an war sie schließlich mehr oder weniger einer weltlichen Umgebung ausgesetzt.
Sein Blick wandte sich Marianne zu, und ihr Lächeln gab ihm wieder Mut. Er war froh, daß die beiden Mädchen zusammen ins Studium gingen. Marianne strahlte eine gewisse Festigkeit aus, obwohl sie noch sehr jung war. Sie hatte es manchmal zu Hause nicht ganz leicht, weil sich ihre Eltern ihrem offenen Bekenntnis zu Jesus entgegenstellten. Vielleicht war sie gerade deshalb so gefestigt. Frau Lindenmeier hatte in dieser Hinsicht keinerlei Befürchtungen. Die jungen Leute von heute waren ausgeglichen, voller Selbstvertrauen, mehr als sie besessen hatte, als sie bereits doppelflo alt war. Diese vier jungen Menschen waren glücklich und hoffnungsvoll; ihr Fundament stand fest. Man brauchte keine Angst um sie zu haben.
Tante Mathilde sah das Ganze mehr skeptisch und pessimistisch an. Wenn das Leben angenehm dahinfloß, war es ja keine Kunst, glücklich zu sein - aber das dauerte gewöhnlich nie lange. Ihr Leben jedenfalls war ein Auf und Ab gewesen - und es war öfter durch Täler als über Höhen gegangen. So war sie bitter geworden. Und auch diese jungen Leute da würden es früher oder später schon noch erfahren, wenn sich
erst einmal herausstellte, daß sich Lieblingspläne am Ende meistens zerschlugen.
Das Telefon klingelte. Daniel sprang auf, eilte in den Flur und hob den Hörer ab. Mit einem verwirrten Ausdruck auf seinem Gesicht kam er zurück
„Für dich, Mutter", sagte er: Frau Lindenmeier entschuldigte sich und verließ eilig das Zimmer.
„Was ist denn los?' wollte Gerda wissen, die den Blick ihres Bruders aufgefangen hatte. „Mutter wird doch oft ans Telefon gerufen - Frauenkreis und was sonst nicht alles."
„Wer hat denn gesagt, daß etwas los sei?" gab ihr Bruder zur Antwort, wobei er ihrem Blick sorgfältig auswich.
„Du brauchst gar nichts mehr zu sagen, mein lieber Bruder! Ich spüre immer in Bruchteilen von Sekunden, wenn dich etwas bewegt", neckte Gerda gutmütig.
„Wir wollen wissen, was los ist", scherzte Marianne.
„Laß dich auf nichts ein - die ewige Neugier der Frauen!" mahnte Richard seinen Freund.
Sie lachten und stritten sich, bis Frau Lindenmeier wieder hereinkam; jetzt merkten alle, daß etwas nicht stimmte. Sie war ganz bleich und offensichtlich außer Fassung.
„Ist etwas passiert, Liebste?' fragte ihr Mann besorgt
Ein flüchtiger Blick von Frau Lindenmeier genügte, und Marianne wußte;daß die Nachricht sie selbst betraf. Ihr Herz schien stillstehen zu wollen. Leise brachte sie heraus: „Ist es Mutter?'
Frau Lindenmeier war um den Tisch herumgekommen md legte ihr die Hand auf die Schulter.
„Ich muß gehen", flüsterte Marianne, ehe noch jemand Jazu kam, etwas zu sagen.
„Wir werden dich hinüberbringen. Hans - hol bitte den Wagen heraus!"
Daniel sprang auf. „Dann war es also Herr Dorn?" mur-ielte er.
‚ja, es war dein Vater, Marianne. Deine Mutter ist ins Krankenhaus gebracht worden, und du sollst auch hinkommen. Wir werden dich begleiten."
„Ein Unfall?' fragte Marianne und schob ihren Stuhl zurück
„Nein, Liebes, es muß ein Herzanfall gewesen sein. Gerda, lauf nach oben und hole Mariannes Sachen!"
„Nein, ich kann das schon selber r' rief Marianne, und beide verließen eilig den Raum.
„0 Marianne! Das ist ja schrecklich! Ich wollte, ich könnte mitkommen!" rief Gerda ganz erschüttert, als sie ihr Zimmer betraten.
„Das geht nicht, Gerda - aber du kannst etwas anderes für mich tun - beten", bat Marianne und suchte ihre Sachen zusammen.
„Das will ich tun. Vielleicht ist es nicht mehr so schlimm, wenn du hinkommst", tröstete Gerda.
Die beiden jungen Männer erwarteten die Mädchen schon unten an der Treppe. Sie sahen niedergeschlagen aus. Alles war zu überraschend gekommen. Der plötzliche Einbruch des Unerwarteten in ihre „heile Welt" hatte sie aus der Fassung gebracht. Daniel trat vor und drückte Marianne teilnahmsvoll die Hand; dann führte sie Frau Lindenmeier behutsam zum Wagen.
ZERBROCHENE PLÄNE
Etwa vierzehn Tage nach der Beerdigung ihrer Mutter suchte Marianne Dorn Prediger Lindenmeier zu einem persönlichen Gespräch auf. Er bat sie in sein Studierzimmer, setzte sich ihr gegenüber und sah sie prüfend an. Es war das erstemal seit dem traurigen Ereignis, daß sie allein miteinander reden konnten. Marianne kam ihm heute besonders jung vor; auch schien sie ziemlich erschöpft zu sein. Die übermäßige Anspannung der vergangenen Tage war ihr noch deutlich anzusehen. Richtig krank sah sie aus. Ihr Blick
war ratlos. -
„Es ist alles, so schrecklich verworren", bekannte sie. „Ich weiß, auch das Leid gehört mit zum menschlichen Leben - aber dies hat alle meine Pläne zunichte gemacht - das Studium und meine berufliche Laufbahn. Ich kann jetzt einfach nicht von zu Hause fort und Vater allein mit seinem Kummer zurückiasseh - ich habe Mutter versprochen, ihm beizustehen." Beim Gedanken daran bekam ihre Stimme wieder einen festen Klang, ihr Blick wurde selbstsicherer.
„Mein Liebes, du sprachst eben davon, alles sei verworren. Was hast du damit gemeint?'
„Gott scheint mir so ferngerückt. In mir ist alles kalt und empfindungslos. Mir scheint; Gott kümmert sich nicht um uns Menschen - als seien wir ihm irgendwie gleichgültig. Ich weiß; das stimmt nicht. Ich habe unrecht - aber das Gefühl weicht nicht."
Einige Minuten herrschte Schweigen. Nur das stete Ticken der Uhr und das Knistern brennender Holzscheite im Ofen war zu hören, denn die Septemberabende waren bereits recht kühl, und der Wind blies frisch vom Moor herüber. Dann stand der Prediger wortlos auf, trat um den Schreibtisch herum zu dem mutterlosen Mädchen und führte sie zu seinem eigenen Sessel. Nachdenklich lehnte er sich an den Bücherschrank und blickte in Mariannes erwartungsvolles Gesicht.
„Hier geht es nicht um recht oder unrecht, meine liebe Marianne. Gott führt dich augenblicklich einen Weg, den du nicht verstehst. Geh durch das Dunkel hindurch, und du wirst schließlich erkennen, was Gott von dir will. Halte aus im Glauben, vertraue Gott, liebe Marianne, wenn es auch im Augenblick so scheint, als sei dein himmlischer Vater kein liebender Vater. Laß dich nicht verwirren. Gottes Wege sind vollkommen, wenn wir sie auch oft nicht verstehen."
Die ruhige Bestimmtheit seiner Stimme wirkte wie Balsam auf das wunde Gemüt und ließ Marianne ruhiger werden.
„Aber ich habe doch darum gebetet, Gott möge mich den rechten Weg führen, und alles schien im rechten Gleis zu verlaufen", warf sie ein.
„Dies ist kein endgültiger Rückschlag, nur eine Verzögerung deiner Pläne, hoffe ich", tröstete Prediger Lindenmeier. „Ich denke, bis zum Sommersemester wird sich alles geklärt haben."
„Ich hätte aber so gern mit Gerda zusammen das Studium begonnen", seufzte Marianne, und Tränen traten ihr in die Augen.
„Das wäre mir auch lieb gewesen!"
Der grimmige Ton in der Stimme des Predigers schreckte Marianne aus ihrem Selbstmitleid auf. Auch sein Gesicht schien plötzlich düster geworden zu sein.
Cassie Sie sagte Ja, Bernall Misty
15 Dienstag
Der 20. April 1999 begann wie jeder andere Schultag in unserem Haus. Um Viertel vor sechs brach mein Mann Brad zur Arbeit auf, und wenig später stand ich auf, um die Kinder zu wecken. Teenager aus dem Bett zu bekommen ist immer ein kleiner Kampf, doch an jenem Dienstag war es besonders schwierig. Cassie war am Abend zuvor lange aufgeblieben, um überfällige Hausaufgaben zu erledigen, und ihre Bücher lagen über den ganzen Küchentisch verstreut. Die Streukiste ihrer Katze brauchte auch ein wenig Aufmerksamkeit, und es wurde spät mit dem Frühstück.
Ich weiß noch, wie ich mühsam versuchte, ihr nicht mit all den Dingen in den Ohren zu liegen, die noch zu tun waren, bevor sie in die Schule aufbrach Gegen zwanzig nach sieben gab mir Chris einen Abschiedskuss, oder zumindest hielt er mir seine Wange hin, was in letzter Zeit das Höchste der Gefühle ist (er ist fünfzehn), und stürmte die Treppe hinunter und aus dem Haus. Cassie blieb an der Tür stehen, um ihre Schuhe anzuziehen - ihre geliebten schwarzen Doc Martens, die sie bei Regen und Sonnenschein trug, sogar zu Kleidern -‚ schnappte sich ihren Rucksack und folgte ihrem Bruder. Als sie ging, beugte ich mich über das Geländer, um sie zu verabschieden, wie ich es immer tue: „Tschüs, Cass, ich hab' dich lieb."
„Ich dich auch, Mom", murmelte sie zurück. Dann war sie weg, durch den Garten, über den Zaun und dann quer über das Fußballfeld zur High School, die nur hundert Meter von uns entfernt liegt. Ich zog mich an, machte mir eine Tasse Kaffee, schloss das Haus ab und fuhr zur Arbeit.
Gegen Mittag bekam ich einen Anruf von Charlie, einem
Manchmal schießt ein Blitz aus heiterem Himmel herab; und manchmal bricht über eine friedliche Familie - ohne eine Vorwarnung drohender Wolken am Himmel oder des kleinsten Zitterns im Erdboden - ein schreckliches Ereignis herein, und von diesem Moment an ist alles verändert. Die Luft ist schwer von Wolken und kann sich schier nicht klar weinen. Doch es mag sein, dass ein prachtvoller Sonnenuntergang kämmt
GEORGE MACDONALD
16 Cassie
Freund. Er fragte mich, ob ich etwas von einer Schießerei an der Schule gehört hätte. Nein, sagte ich.
Ich kämpfte gegen eine dumpf aufkommende Panik: Zum einen sagte ich mir, dass Cassie oder Chris kaum in so etwas verwickelt sein könnten. Wahrscheinlich waren nur ein paar Jugendliche auf dem Parkplatz aneinandergeraten. Oder vielleicht hatte jemand auf der Pierce Street aus einem fahrenden Auto geschossen. Zum anderen hatten meine Pausengefährtin Val und ich uns eben auf dem Markt um die Ecke etwas zum Mittag geholt und wollten gerade essen. Außerdem hatte ich die Columbine High School schon immer für eine sichere Schule gehalten. War es nicht so? ... Ich rief Brad an, vielleicht hatte er etwas gehört.
Brad war bereits zu Hause, als ich anrief; krank war er vorzeitig von der Arbeit weggegangen. Als er den Hörer abnahm, erzählte ich ihm von Charlies Anruf. Er hatte gerade eine ganz ähnliche Nachricht von seiner Arbeitskollegin Kathy bekommen. Selbst hatte er mehrere Knallgeräusche und ein- oder zweimal ein lautes Krachen gehört, was er aber nicht weiter beachtet hatte. Es war Mittagszeit, und da rannten draußen immer Kinder herum. Also vermutete er, dass da nur irgendein Bengel ein paar Chinakracher gezündet hatte.
Nach dem doppelten Anruf jedoch zog Brad seine Schuhe an, ging hinaus in den Garten und spähte über den Zaun; Überall waren Polizisten. Zurück im Haus stellte er den Fernseher an und erwischte offenbar die ersten Nachrichtenmeldungen. Kurz darauf wurde der erste Live-Bericht gesendet. Plötzlich fügten sich die Puzzleteile zusammen, und ihm wurde klar, dass dies nicht nur ein dummer Streich war:
Ich konnte meine Augen nicht vom Fernseher abwenden, doch ich kniete an der Sofaecke nieder und bat Gott, sich um all diese Kinder zu kümmern.
Dienstag 17
Natürlich dachte ich vor allem an unsere Kinder, an Cassie und Chris, doch gleichzeitig war ich mir irgendwie sicher, dass mit ihnen alles in Ordnung war. Wenn jemandem, der einem so nahe stand, etwas passierte, würde man doch irgendetwas spüren, irgendetwas fühlen. Ich spürte nichts.
Die nächsten sechsunddreißig Stunden waren die reine Hölle. Bis ich zur Columbine High School kam, hatten sich bereits Hunderte von verzweifelten Eltern und Verwandten, Polizisten, Bombenspezialisten, Reportern und Schaulustigen rund um die Schule versammelt, und es herrschte das totale Chaos.
Inzwischen waren genügend Fakten bekannt, um uns den Ernst der Situation deutlich zu machen, doch die Einzelheiten waren zusammenhanglos, widersprüchlich und verwirrend. Sicher wussten wir nur, dass zwei nicht identifizierte Bewaffnete in der Schule Amok gelaufen waren, Schüler niedergemäht und sich mit ihrer Tat vor den Flüchtenden gebrüstet hatten. Jeder suchte hektisch nach irgendjemandem; Leute weinten, beteten, umarmten sich oder standen nur dumpf herum und starrten wie betäubt auf die ganze chaotische Szenerie, die sich vor ihnen abspielte.
Viele der Familien, die Kinder auf der Columbine iHigh hatten, wurden in die nahe gelegene Leawood-Grundschule gelotst, um auf Nachricht von der Polizei über den Verbleib ihrer Kinder zu warten; andere von uns saßen in einer öffentlichen Bibliothek fest, da die Leawood-Schule keine Menschen mehr aufnehmen konnte.
Es war wie auf einem Kriegsschauplatz; Bald wurden Listen der Verletzten und Unverletzten ausgedruckt und verteilt. Zwischen den Aktualisierungen, die ich fieberhaft überflog, rannte ich atemlos von einem Grüppchen Schülern zum nächsten, rief nach Cassie und Chris und fragte herum, ob jemand sie gesehen habe.
18 Cassie
Auf dem Schulgilände selbst zu suchen, kam natürlich nicht in Frage. Der ganze Campus war abgeriegelt und von einem unheimlich wirkenden Ring schwer bewaffneter Sondereinsatz-Kommandos umzingelt.
Chris tauchte am frühen Nachmittag auf: Er war ins Haus eines Nachbarn in der Nähe der High School geflohen und erreichte schließlich Brad, der zu Hause am Telefon Stellung bezogen hatte. Brad klingelte mich auf dem Handy an. Sofort wurde mir leichter ums Herz: Gott sei Dank; jetzt müssen wir nur noch nach einem Kind suchen. Doch die Erleichterung hielt nicht mehr als eine oder zwei Sekunden an, dann eilten meine Gedanken zurück zu Cassie. Wo war meine Tochter?
Während Hunderte fliehender Schüler unmittelbar nach der Schießerei in Busse verfrachtet und in Sicherheit gebracht worden waren, waren andere wie Chris dem Gemetzel zu Fuß entkommen, und in manchen Fällen dauerte es Stunden, bis ihr Verbleib geklärt war. Die Verletzten, viele davon unidentifiziert, waren in Krankenwagen fortgebracht worden, und Dutzende andere versteckten sich stundenlang in Schränken und Klassenzimmern überall im Gebäude. Einige lagen, wie wir später erfuhren, irgendwo ganz allein und verbluteten.
Gegen fünf Uhr sagte man allen, die immer noch in der öffentlichen Bibliothek auf Nachricht über unsere Kinder warteten, dass ein letzter Bus voller Schüler von der High School unterwegs sei. Wir sollten hinüber zur Leawood-Schule kommen, um ihn in Empfang zu nehmen.
Brad und .Chris waren im Lauf des Nachmittags zu mir gestoßen, und wir sprangen sofort in den Wagen und fuhren so schnell wir konnten zur Schule.
Obwohl unser Ziel nur ein paar Straßenzüge entfernt lag, war es eine schreckliche Fahrt. Fast jede Straße in der Nähe der High School war abgesperrt, und die wenigen, die noch für den Verkehr geöffnet waren, waren mit den Ü-Wagen und Transportern sämtlicher Fernsehstationen in Denver verstopft.
Dienstag 19
Über uns knatterten die TV-Helikopter, und vor und hinter uns heulten Sirenen. Mein Herz klopfte so hart, dass ich die Anspannung kaum ertragen konnte.
Endlich erreichten wir die Leawood-Schule. Ich sprang aus dem Wagen und schaute mich überall um. Kein Bus. Wir warteten. Minuten vergingen, während wir immer wieder auf der Straße nachsahen. Immer noch kein Bus. Schließlich dämmerte es uns: Es würde kein „letzter Bus' kommen. Ich war außer mir; wahnsinnig vor Angst. Bis zu diesem Augenblick haue ich immer noch das Beste gehofft, aber jetzt? Ich fühlte mich betrogen. Vielleicht nicht absichtlich, aber dennoch betrogen, und das machte mich so bitter, dass ich schier erstickte.
Wochen später erfuhren wir, dass die Polizei bereits um acht Uhr an jenem Abend wusste, dass alle Vermissten tot waren; dass der Verbleib aller Übrigen geklärt war. Doch da sie noch keine offizielle Bestätigung geben wollten, hatten sie nichts davon gesagt, und so klammerte ich mich immer noch an Strohhalme Vielleicht versteckt sich Cassie irgendwo, versuchte ich mir einzureden. Sie war schon immer einfallsreich gewesen und hatte vielleicht einen guten Platz gefunden. Ich hoffe nur, dass sie nicht verletzt ist. Oder: Besser, sie ist verletzt, als tot. Wenn sie verletzt ist, kann ihr wenigstens geholfen werden. Aber sie muss die Nacht überstehen, zumindest so lange, bis jemand sie findet ... Hoffnung ist wirklich das einzige, was einen in einer solchen Krise auf den Beinen hält, selbst wenn es nur ein dünner Faden ist.
Um halb zehn konnte ich die Spannung nicht länger ertragen. Da von der Polizei keine neuen Informationen kamen, beschlossen Brad und ich, nach Hause zu gehen. Unsere Hoffnung hatten wir noch nicht aufgegeben, das war ganz und gar nicht der Fall.
20 Cassie
Aber was für einen Sinn hatte es, den Rest der Nacht in der Leawood-Schule herumzustehen?
Als wir wieder zu Hause waren, kletterte Brad auf das Dach unseres Gartenhäuschens. Er wollte selbst sehen, was in der Schule vor sich ging:
Vom Dach der Hütte aus konnte ich die ganze Schule überblicken. Mit dem Fernglas konnte ich sogar direkt in die Fenster der Bibliothek sehen. Ich sah die gelben Buchstaben auf den blauen Jacken der Sondereinsatz-Kommandos; sie gingen mit gesenkten Köpfen da drinnen h'erum, als suchten sie etwas. Was sie da taten, konnte ich nicht richtig erkennen, aber ich nehme an, sie stiegen über Leichen hinweg und suchten nach Sprengkörpern. Später hörten wir, dass sie Dutzende von Bomben fanden
Gegen halb elf oder elf hörten wir eine Explosion aus der Richtung der High School. Wir rannten die Treppe hinauf in Cassies Zimmer. Vielleicht waren von ihrem Fenster aus Flammen oder Rauch oder dergleichen zu sehen. Aber wir konnten nichts erkennen. Nichts als Schwäne, und unten die roten und blauen Lichter der - Streifenwagen und Feuerwehr-Löschzüge auf der Pierce Street. Offenbar war eine Bombe detoniert. Ich zitterte vor Furcht und Grauen. Was, wenn Cassie noch am Leben war?
Allmählich überwältigte mich die Müdigkeit, und ich versuchte schlafen zu gehen. Doch es war unmöglich. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, riss mich ein neuer Alptraum wieder aus dem Schlaf. Immer wieder sah ich Cassie vor mir. Cassie, wie sie in irgendeinem finsteren Schrank kauerte und sich fragte, ob sie gefahrlos herauskommen konnte; Cassie, wie sie zitternd auf irgendeinem Flur lag und verblutete; Cassie, wie sie um Hilfe rief, ohne dass jemand kam, um sie zu trösten. Wie ich mich danach sehnte, sie in die Arme zu nehmen, ihren Kopf zu streicheln, sie zu umschlingen und zu umarmen und zu weinen und zu lachen und sie an mich zu drücken!
Dienstag 21
Ihre Abwesenheit und die Leere ihres Zimmers quälten mich mehr, als ich ertragen konnte.
Gegen halb vier Uhr morgens stand ich schließlich auf und zog mich an, und Brad ging mit mir die Polk Street hinunter bis zur Ecke, wo der erste Streifenwagen stand. In der Hoffnung, der Fahrer könnte uns etwas Neues sagen, stellten wir ihm mehrere ganz konkrete Fragen, doch er redete nur um den heißen Brei herum. Endlich sagte Brad: „Hören Sie, sagen Sie uns doch die Wahrheit. Nach allem, was wir wissen, muss unsere Tochter immer noch in der Schule sein. Ist irgendjemand da drinnen noch am Leben?"
Der Fahrer antwortete zögernd: „Okay, ich sage es Ihnen ohne Umschweife. Es ist niemand mehr am Leben."
Es hört sich verrückt an, aber ich wollte immer noch nicht aufgeben, nicht einmal jetzt. Es besteht immer noch die Chance, dass sie sich irgendwo in einem Schrank versteckt, sagte ich zu Brad, oder dass sie unter den Verletzten ist, die im Krankenhaus nicht identifiziert werden konnten. Man weiß nie. Die denken, sie wüssten über alles Bescheid, aber das heißt nicht, dass es wirklich so ist.
Erst zweiundzwanzig Stunden später, gegen zwei Uhr morgens am Donnerstag, brach meine Abwehr endlich zusammen. Das Telefon klingelte, und eine Frau aus dem gerichtsmedizinischen. Institut sagte uns, was wir zu hören gefürchtet haften, auch wenn wir damit rechnen mussten. Cassies Leiche war dort. Nun gab es keinen Ausweg mehr, als uns einzugestehen, dass unsere-'Tochter wirklich für immer fort war, dass sie nie wieder zu mir nach Hause kommen würde. Aber wie kann eine Mutter sich mit so etwas abfinden?
Ich weinte, wie ich noch nie zuvor geweint hafte.
22 Cassie
Nach dem, was mir seither berichtet wurde, muss es an jenem Vormittag etwa Viertel nach elf gewesen sein, als Cassie in die Bibliothek der High School trat, den Rucksack über die Schulter gehängt, um an ihrer neuen Hausaufgabe zu arbeiten - ein weiteres Stück aus Macbeth für den Englisch-Unterricht. Crystal, eine gute Freundin, war ebenfalls in der Bibliothek:
Sara, Seth und ich waren gerade in die Bibliothek gegangen, um wie jeden Tag zu lernen. Nach vielleicht fünf Minuten stürzte eine Lehrerin herein und schrie, es seien ein paar bewaffnete Männer auf dem Flur. Zuerst dachten wir: „Das ist nur ein Witz, die aus den oberen Klassen haben einen Streich ausgeheckt."
Seth meinte: „Keine Panik, das sind bloß Farbbeutel."
Dann hörten wir Schüsse, erst unten im Flur, dann näher und immer näher. Mrs. Nielsen rief uns zu, unter die Tische zu kriechen, aber keiner hörte auf sie. Dann kam ein Junge herein und stürzte zu Boden. Seine ganze. Schulter war voller Blut. Jetzt krochen wir so schnell wir konnten unter unseren Tisch. Mrs. Nielsen war inzwischen am Telefon und rief die Polizei an. Seth hielt mich in seinen Armen und hatte seine Hand auf meinen Kopf gelegt, weil ich so heftig zitterte, und Sara kauerte auch mit uns da unten und hielt meine Beine fest. Dann kamen Eric und Dylan in die Bibliothek, schossen um sieh und sagten Sachen wie: „Darauf haben wir unser Leben lang gewartet."
Nach jedem Schuss stießen sie einen Juchzer aus.
Ich haue keine Ahnung, wer sie waren - ihre Namen habe ich erst hinterher, erfahren - aber ihre Stimmen klangen furchteinflößend, bösartig. Gleichzeitig wirkten sie richtig fröhlich, als ob sie ein Spiel spielten, das ihnen mächtig Spaß machte. Dann kamen sie an unseren Tisch und stießen einen Stuhl um. Er traf erst mich am Arm und dann Sara am Kopf. Sie waren direkt über uns. Ich konnte kaum atmen, so große Angst haue ich.
Dienstag 23
Dann verließen sie plötzlich den Raum, wahrscheinlich um nachzuladen. Offenbar war ihnen die Munition ausgegangen. Da sind wir abgehauen. Wir rannten durch eine Seitentür der Bibliothek, einen Notausgang, hinaus - kurz bevor sie wieder hereinkamen.
Crystal verlor Cassie aus den Augen, nachdem die Mörder den Raum betreten hatten, und es gibt widersprüchliche Aussagen darüber, was sie in diesen Momenten tat. Ein Schüler erinnert sich, sie unter einem Tisch gesehen zu haben, die Hände zum Gebet gefaltet. Ein anderer sagt, sie sei einfach sitzen geblieben. Josh, ein jüngerer Schüler, mit dem ich mich einige Wochen nach dem Vorfall unterhielt, sah sie überhaupt nicht, aber er sagt, er werde nie vergessen, was er hörte, als er etwa acht Meter weit entfernt unter einem Schreibtisch kauerte.
Ich konnte nichts sehen, als die Kerle zu Cassie kamen, aber ich erkannte ihre Stimme. Ich konnte alles hören, als wäre es direkt neben mir. Einer von ihnen fragte sie, ob sie an Gott glaube. Sie zögerte, als überlegte sie, was sie antworten sollte, und dann sagte sie Ja. Sie muss Angst gehabt haben, aber ihre Stimme zitterte nicht. Dann fragten sie sie, warum, aber sie gaben ihr keine Zeit mehr zum Antworten. Sie schossen sie einfach nieder.
Josh sagt, dass die Art, wie die Jungen Cassie nach ihrem Glauben fragten, ihn auf den Gedanken brachten, ob sie sichtbar betete.
Ich wüsste nicht, warum sie sonst jemanden so etwas fragen sollten. Vielleicht redete sie auch mit ihnen, schwer zu sagen. Ich weiß, dass die beiden die ganze Zeit über redeten, während sie in der Bibliothek waren. Sie gingen hinüber zu Isaiah und verspotteten ihn.
24 Cassie
Sie nannten ihn Nigger, bevor sie ihn töteten. Dann fingen sie an zu lachen und zu juchzen. Für sie war das wie ein großartiges Spiel. Als sie dann den Raum verließen, stand ich auf, nahm meine Freundin Brittany an der Hand und rannte los. Als Nächstes weiß ich nur noch, wie ich sie durch die Tür stieß und hinter ihr hinausstürmte
Einer der ersten Beamten, die am nächsten Tag am Tatort waren, war Gary, ein Mitglied unserer Kirchengemeinde und Ermittler des Sheriff-Büros von Jefferson County:
Als wir in der Schule eintrafen, bildeten wir sieben Ermittler-Teams. Alle getöteten Opfer waren über Nacht am Tatort gelassen worden, weil die Ermittler sicherstellen wollten, dass alles dokumentiert wurde, bevor sie die Beweismittel sammelten.
Sobald ich die Bibliothek betrat, sah ich Cassie. Ich erkannte sie sofort. Sie lag unter einem Tisch, dicht neben einem anderen Mädchen. Cassie war aus sehr geringer Entfernung in den Kopf geschossen worden. Die Einschusswunde ließ sogar darauf schließen, dass der Lauf ihre Haut berührt hatte. Möglicherivei-se hatte sie eine Hand gehoben, um sich zu schützen, denn eine ihrer Fingerspitzen war weggeschossen, aber zu mehr kann sie keine Zeit mehr gehabt haben. Dieser Schuss tötete sie auf der Stelle.
Der Abstand zwischen dem 20. April und der Gegenwart wird mit jedem Tag ein wenig größer, doch die Einzelheiten verblassen keineswegs. Manchmal steigen die Bilder so lebhaft vor mir auf, dass es scheint, als wäre alles erst gestern passiert. Die Ärzte sagen, dass das Gehirn Schmerzen vergisst, und vielleicht haben sie recht. Ob aber das Herz vergisst, bezweifle ich.
Dienstag 25
Wenn in den Winkeln meiner Erinnerung irgendein Trost zu finden ist, dann vielleicht in jenen fröhlichen, einfachen Dingen, die uns als Familie während der letzten Woche in Cassies Leben zusammenhielten. Obwohl es an sich wenig bemerkenswerte Dinge waren, gibt es mir eine merkwürdige Befriedigung, daran festzuhalten, und die Erinnerungen trösten mich.
Ein paar Wochen zuvor waren Brad und ich während der Frühjahrsferien mit den Kindern hinauf in den nahe gelegenen Skiort Breckenridge gefahren. Weil wir noch gültige Skipässe hatten, beschlossen wir, Cassie und Chris einen Tag schulfrei nehmen zu lassen (etwas, das wir eigentlich „niemals" tun), um sie zu verbrauchen. Da zogen sie also an einem Donnerstag los nach Breck, und als ich sie mit ihren Snowboards aus dem Haus gehen sah, dachte ich daran, dass meine Brüder und ich so etwas nie getan hatten, und wie kostbar es war, dass meine Kinder sich nahe genug standen, um nicht nur miteinander auszukommen, sondern sogar das Zusammensein beim Lieblingssport genießen zu können.
Am Freitag waren beide wieder in der Schule, und am Samstag war Abschlussball. Cassie hatte keinen Begleiter, und ihre beste Freundin Amanda auch nicht, doch beide waren trotzdem entschlossen, einen schönen Abend zu verleben:
Wir konnten nicht zum Abschlussball gehen, weil wir keine Verabredungen hatten, weil wir „Loser" sind, doch die Firma, in der meine Mutter arbeitet, veranstaltete an dem Abend so ein riesiges Bankett im Marriott, und so beschlossen Cass und ich uns schick zu machen, uns zu frisieren und schön zu sein und statt dessen dorthin zu gehen. Wir hatten einen Riesenspaß.
Am späten Samstagabend rief Cassie mich aus dem Marriott an, um mir zu erzählen, wie herrlich sie sich mit Amanda und ihrer Mutter All amüsierte.
26 Cassie
Sie sagte mir ebenfalls, dass sie vorhatte, zu Hause vorbeizukommen und dann noch zur Nachfeier in die High School zu gehen. Wenig später raste sie mit Amanda durchs Haus, suchte in allen Schubladen nach neuen Klamotten und sagte mir, sie rechne damit, recht früh wieder da zu sein, da sie nicht sicher seien, wie die Stimmung dort sein würde. Wie sie herausstellte, kam sie erst um sechs Uhr früh wieder nach Hause
Montag war Montag. Cassie war mit den Hausaufgaben im Rückstand und hatte alle Hände voll zu tun, weil sie das ganze Wochenende blaugemacht hatte. Normalerweise ging sie montags zu Freunden von uns zum Babysitten, doch diese Woche wurde sie dort nicht gebraucht. So aßen wir alle zusammen zu Abend, was bei uns nichts Ungewöhnliches ist, aber auch nicht jeden Tag vorkommt. Nach dem Essen setzte sie sich wieder an ihre Hausaufgaben.
Wenn ich an jenen letzten Abend in Cassies Leben zurückdenke, sehe ich sie immer noch dort in der Küche sitzen. Sie hatte ihre Arbeiten im Haus noch nicht erledigt, und ich bin sicher, dass ich deswegen bei ihr nachbohrte. Jetzt, wo sie tot ist, schmerzt es mich, das zuzugeben. Dasselbe gilt für meine späte Erkenntnis; dass unsere Beziehung zwar im Großen und Ganzen gut war, aber nicht ideal - weder an jenem Abend noch an irgendeinem anderen. Aber es ist zu spät, dem Versäumten hinterher zu jammern.
Die grausamste Ironie, dass wir Cassie auf diese Weise verloren haben, ist vielleicht, dass sie an jenem Tag gar nicht erst in der Columbine High School gewesen wäre, wenn wir sie nicht von einer anderen Schule heruntergeholt hätten, an der sie vor nur zweieinhalb Jahren .die neunte Klasse begonnen hatte. Zu jener Zeit freilich war unsere Beziehung beinahe rettungslos zerrüttet gewesen, und es kam uns jedes Mal wie ein kleiner Sieg vor, wenn sie zu einigermaßen normalen Zeiten aus der Schule zurückkam oder sogar die Küche betrat, um etwas so Alltägliches zu tun, wie mit uns zu essen oder einen Abend mit Hausaufgaben zu verbringen. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Zion Die Rückkehr

PROLOG Jerusalem - Tempelberg Der neunte Tag des Ab, 70 n. Chr.
Anaias wußte genau, daß es keine Hoffnung mehr auf ein Entrinnen gab. Es war zwar noch Vormittag, aber der dichte Rauch, der den Himmel verdeckte, hüllte alles in Dunkelheit und verbarg die endgültige Zerstörung des Tempels von Zion vor den trauernden Augen des Himmels.
Der achtzehnjährige Anaias war, wie zahlreiche andere jüdische Pilger, die aus allen Teilen der Welt zusammengeströmt waren, nach Jerusalem gezogen, um in eben diesem Tempel das Passahfest zu feiern. Der junge Mann war zwar erst das zweite Mal in Jerusalem, aber er wußte, daß es das letzte Mal war. Es ging das Gerücht um, daß mehr als hunderttausend Menschen bei der Belagerung den Tod gefunden hätten.
Die Täler rings um die Stadt quollen über vor Toten, und der Gestank, der von den in der Sommerhitze verwesenden Leichen aufstieg, war unerträglich geworden. Und nun war selbst der Tempelplatz - die letzte Zuflucht der Juden vor Titus' Legionen -‚ übersät von Toten und Menschen, die ebenfalls bald den Tod finden würden.
Anaias lehnte sich gegen eine Säule im Vorhof der Priester und dachte daran, mit welcher Begeisterung er vor sechs Monaten den Tempel betrachtet hatte. In Weiß und Gold glitzernd, hatte er in der Morgendämmerung wie die Kuppe eines schneebedeckten Berges ausgesehen. Als ihn die Morgensonne dann in ihr erstes Licht getaucht hatte, da hatte Anaias seine Augen von der gleißenden Helligkeit dieses heiligen Gebäudes abwenden müssen. Mit geschorenem Kopf und beseelt von seinem Gelübde, war er klopfenden Herzens durch die großen korinthischen Tore gegangen, um sein Dankopfer darzubringen und sich auf das Passahfest vorzubereiten. Aber all das schien in unvordenklich fernen Zeiten gewesen zu sein.
Danach hatten sich die jüdischen Rebellen, von den Römern verfolgt, in die Stadt zurückgezogen und sich hinter den schweren Toren verbarrikadiert. Anaias schloß vor Grauen die Augen, als die Erinnerung daran in ihm wieder wach wurde. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, seinen Mantel zu holen, geschweige denn, sich in den umliegenden Hügeln zu verstecken. Dann war die Stadt langsam gestorben.
Die Kampfgruppen von Johannes und Simon waren nicht in der Lage gewesen, die tosende Flutwelle des römischen Zorns zurückzuhalten, und die Menschen, die aus der Stadt geflohen waren, um die Römer um Gnade zu bitten, waren gekreuzigt oder aufgeschlitzt worden, weil die Soldaten Goldstücke oder Juwelen in ihrem Inneren vermuteten.
Unter den Zurückgebliebenen hatte eine furchtbare Hungersnot gewütet und die Menschen solange zu Tausenden niedergemäht, bis schließlich die Stadtmauer der Wucht des feindlichen Ansturms nicht mehr standgehalten hatte. Und nun wußte Anaias, daß dies der letzte Tag war, daß nun auch der Tempel fallen würde. Vor sechs Tagen hatte er sich den letzten überlebenden angeschlossen, die sich im Vorhof der Priester verschanzt hatten. Acht starke Männer waren nötig gewesen, um die hölzernen Tore zu schließen, die den Hof schützten. Aber nun leckte das von den römischen Legionären gelegte Feuer an dem Gold, das Anaias noch vor einem halben Jahr geblendet hatte. Geschmolzenes Metall rann an den Toren hinunter und entzündete das darunter liegende Holz zu roter Glut. Und der Wind wirbelte die Funken so hoch in die Luft, daß nun auch der Tempel selbst bedroht war.
Die jüdischen Soldaten, die noch die Kraft hatten, ein Schwert zu tragen, gingen zwischen den Überlebenden einher, um deren Leben ein Ende zu setzen, bevor die Tore zu Asche zerfielen und die Römer den Hof stürmten. Immer wieder winkte jemand mit kraftloser Hand einen Soldaten herbei und bat ihn um einen schnellen Tod. Denn nicht nur Anaias wußte, daß die Römer die wenigen, die das Gemetzel überleben würden, verschleppen würden, um sie für ihre grausamen Spiele zu benutzen. Die letzten überlebenden ganzer Familien von frohen Pilgern boten daher nun ihren Hals dem Schwert dar und legten sich Seite an Seite zum Sterben nieder.
Ein tödliche Stille hatte sich über den Tempel gelegt.
Unter seinem Umhang trug Anaias ein kleines, silbernes Kästchen. Darin lag der Tallith, den ihm sein Vater vor der Reise geschenkt hatte. Ein bitterer Zug trat auf seine Lippen, als er an seine Eltern in Antiochia dachte. Würden auch sie durch die Hände der römischen Eroberer umkommen? Wie es auch kommen mag, dachte er schweren Herzens, wenn es so sein soll, dann werden wir zumindest gemeinsam vor unserem Heiland stehen. Und es geschieht hier nichts, was er nicht vorausgesagt hat. Aber ich hätte nie gedacht, daß ich selbst bei der Zerstörung des Tempels dabeisein würde.
„Es brennt!" schrie plötzlich ein Soldat vom Portikus her und deutete zum Dach des Tempels. „Der Tempel brennt!" Anaias folgte dem ausgestreckten Schwert des Soldaten mit den Augen und sah winzige Flammen auf dem Dach der heiligen Stätte züngeln. Eine der noch lebenden Frauen stieß einen hohen, schrillen Klageschrei aus, dem sich auch die anderen Sterbenden anschlossen, so daß es schien, als steige ein einziger Schrei mit dem Rauch gen Himmel.
„Mein Gott!" weinte Anaias, der das sichere Gefühl hatte, das Ende der Welt mitanzusehen. „Wir sind ja alle bereit zu sterben, aber laß unsere Heilige Stätte nicht untergehen! Komm und mach unserem Elend ein Ende, Herr!" flehte er so laut, daß er die Schreie und Rufe der anderen übertönte. Tatsächlich richteten einige ihren Blick zum rauchgeschwärzten Himmel, als erwarteten sie von dort das Erscheinen des Messias.
Aber der Himmel hüllte sich in Schweigen.
Das Inferno um sie herum loderte immer stärker, und der dicke Qualm, der sich auf sie herabsenkte, nahm selbst den Kräftigsten die Luft. Anaias fühlte, wie ihm die Sinne vor der Unausweichlichkeit des Todes zu schwinden begannen. „Vater!" rief er aus. „Ich habe noch nicht in meinem neuen Tailith gebetet. Er wird heute mein Leichentuch werden. Aber das wäre er auch geworden, wenn ich nach einem langen, erfüllten Leben gestorben wäre!" Das Kästchen fiel klappernd zu Boden, es sprang auf, und das feine, weiße Gebetstuch entfaltete sich zu seinen Füßen. Anaias hob es, sich mühsam an der Säule abstützend, wieder auf und hielt es hoch über seinen Kopf, so daß es im Winde flatterte. Hier war das letzte Reine in der Stadt. Sein strahlendes Weiß hob sich wie ein Banner der Hoffnung von der rauchgeschwärzten Umgebung ab. Seine Borte in hellem Davidsblau erinnerte ihn daran, daß es trotz allem einen Himmel über ihnen gab und Gott auf Seinem Thron regierte.
„Aber ich habe keinen Anteil daran!" schrie er, von Zweifeln gequält. „Und heute stirbt das Haus Israel zusammen mit mir!" Heftig weinend barg er sein Gesicht im Geschenk seines Vaters. Dann wurde er wieder teilnahmslos. Das Stöhnen der Sterbenden nahm er nur wie aus weiter Ferne wahr. Er legte sich das Gebetstuch sorgfältig über die linke Schulter. „Höre, o Israel, der Ewige, unser Gott, ist einzig." Dann schlang er es über seinen Rücken und verhüllte seinen Kopf mit dem Rest des Talliths.
Die Augen fest auf die großen Tore gerichtet, die zum Allerheiligsten und zum Altar selbst führten, bahnte er sich Schritt für Schritt, mit wehendem Tallith, wie eine weiße Engelsgestalt, seinen Weg über die Leichen hinweg. Die Sterbenden schrien bei seinem Anblick auf. Als Anaias die vierzehn Stufen zu dem Tisch der Schaubrote und zu der goldenen Menorah hinaufstieg, rief ihn ein Soldat an und wollte ihn, ein bluttriefendes Schwert in der Hand, zur Rede stellen: „Halt! Wo willst du hin?"
Doch Anaias ging wortlos weiter, während hinter ihm die Flammen röhrend ihren Sieg über das korinthische Tor verkündeten. Dann sackten die riesigen Balken in sich zusammen, Funken stoben auf und wurden vom Wind davongetragen. Über die gepflasterten Straßen rannen Ströme flüssigen Metalls. Mühsam schleppte sich Anaias bis zur obersten Stufe. Dort sah er sich um. In der glühenden Hitze, die von dem brennenden Tor ausströmte, standen römische Soldaten - in Rüstung, mit Schwertern und stoßbereiten Lanzen - und warteten auf das letzte Gemetzel. „Wie schnell waren diese Tore geschlossen, und die römischen Legionen haben sechs Monate gebraucht, um sie wieder zu öffnen", murmelte Anaias vor sich hin.
Er starrte die Männer, die sein Schicksal besiegeln würden, noch einen Moment lang an. Dann ging er auf das Tor zum Allerheiligsten zu. Als er den Raum betrat, verriet sein Gang, daß er an innerer Sicherheit gewonnen hatte. Er sah die Gruppen goldener Trauben, die in Mannesgröße von der Decke hingen, und Schleier aus Gold, Purpur und Azurblau, deren miteinander verschmelzende Farben Himmel, Erde und Meer symbolisierten.
Anaias zog seinen Tallith enger um sein Kinn und ging, während der Lärm der letzten Schlacht vom Hof hereinschallte, um den ersten Schleier herum. Zu seiner Rechten befand sich der goldene Tisch, auf dem das Schaubrot gestanden hatte, nicht weit davon entfernt die riesige Menorah, der Leuchter, der vor dem Allerheiligsten brannte. Genau gegenüber stand ein Tisch, auf dem die Rauchopfer dargebracht worden waren. Anaias atmete tief den Zimtgeruch ein, der hier viele Jahre lang aufgestiegen war. Und vor ihm befand sich der Altar, der durch den purpurnen Schleier vom Allerheiligsten getrennt war.
Ein Gefühl der Ehrfurcht durchrieselte Anaias. Er lächelte trotz der Schreie, die von draußen hereinschollen. Hier - im Herzen des Tempels - war Frieden. Anaias wußte allerdings sehr wohl, daß Gott nicht mehr an diesem Ort weilte, aber er wußte auch, daß er hier früher einmal seine Heimstatt gehabt hatte.
Während der junge Mann sich langsam um sich selbst drehte und die Schönheit des verbotenen Raumes in sich aufnahm, vernahm er klirrende Schritte auf der Außentreppe und rauhe, fremdländische Stimmen im Vestibül auf der anderen Seite des Schleiers. Er atmete heftig. Sein junges Herz schrie danach zu leben, obwohl schon so lange keine Hoffnung mehr bestand.
Er umklammerte heftig den Rand seines Talliths und wünschte, daß er noch seine Gebetsriemen besäße, die er sonst immer zum Beten um Arme und Stirn gewunden hatte. Aber diese hatte er bereits vor Monaten verkauft, um sich Lebensmittel zu verschaffen. Er trat an den Altar heran und legte seine Hände darauf. „Oh, Herr!" schrie er. „Ich kann dir kein anderes Opfer darbringen als den Dank für den Einen, den du für mich hingegeben hast! Nimm mein Leben! Nimm meine Seele! Ich flehe dich an!"
»Wer ist da hinten?" rief eine harte Stimme. „Da ist ein Jude drin! Los, den holen wir uns!"
Anaias neigte den Kopf und sank vor dem Altar auf die Knie, während sich der Schleier hinter ihm teilte und römische Schwerter sichtbar wurden. Er war nach Zion gekommen, um zu beten und zu danken. Zu guter Letzt war seine Reise also doch nicht vergeblich gewesen. Während er die Kühle des Altars und die Weichheit seines Talliths spürte, wurde dieser ihm zum Leichentuch.
Inhaltsverzeichnis
Prolog 7
Teil 1 Das Geheimnis 12
1. Kontrollpunkt 13
2. Das Geschenk 25
3. Die Einladung 40
4. Vorbereitungen 53
5. Die Trauung 67
6. Hochzeitsnacht 78
7. An der Palestine Post 98
8. Nachrichten 108
9. Wo ist Gott> 122
Teil 2 Der Traum 129
10. Pläne 130
11. Angela 145
12. »Auch wenn die Zeit vergeht« 155
13. Abschied vonJerusalem 163
14. Vergebung 176
15. Totenwache 195
16. Die Rettung
17. Die Enthüllung 225
18. Der armenische Bäcker 236
19. Korn und Kugeln 246
20. Verrat 263
21. Schabbatopfer 275
Teil 3 Die Tat 286
22. Für den Frieden Jerusalenis 287
23. Eine Zeit, etwas zu wagen . 301
24. Hoffnung in der Bedrängnis 312
25. Die Informanten 322
26. Purim . 330
27. Unerwartete Hilfe 342
28. Die Bombe 352
29. Der Schatten 364
16. Die Rettung
30. Die Entführung 372
31. Die Flucht 379
32. Jehudits Plan 386
33. Aus dem Grab erstanden 394
34. Montgomery 405
35. Warten 417
36. Der Flug des Storchs 424
37. Das Wunder 432
Epilog 442 Erläuterungen und ergänzende Informationen 444
Verzeichnis der Bibelstellen und religiösen Zitate 465
