B Schriftsteller
Baldry Cherith + Barclay William + Bäumer U. + Bellett, John Gifford + Benda Andreas + Bensen Bettina + Bergmann Gerhard + Berthold Helene + Bettex Frederic + Bezzel Hermann von + Bibra O.S.v. + Binde Fritz + Birkenfeld Margret + Birkigt Marion + Blomberg Anna von + Blum Angelika + Blumhardt Johann Christoph + Blyton Enid 1897-1968 + Boddenberg Dieter + Böhm Heinz + Bonhoeffer Dietrich + Bönig Manfred + Boom Corrie ten + Boor Werner de + Bormuth Lotte + Bovet Theodor + Brandenburg Hans + Brandes Erwin + Bremicker E.A + Briem Christian + Bright Bill + Brockhaus Rudolf + Brouwer Sigmund + Bruins Cor + Bruns Hans + Brunstetter + Wanda E + Büchle Elisabeth + Buchwald Willi + Buckingham Marjorie + Bühne Wolfgang + Bunyan, John + Bürki Hans + Busch Albrecht + Busch Wilhelm + Buschmann Michael + weitere Schriftsteller B
Glaube ist kein Gefühl, Ney Bailey
Unsere Gefühle und Gottes Wort stimmen nicht immer überein. Ney Bailey versucht aufzudecken, warum das so ist und wie sich der Konflikt lösen lässt. Sie bietet sehr praktische Hilfe an, ganz gleich, an welchem Abschnitt des Weges mit Gott sich jemand befindet.
Dies ist ein sehr persönliches, interessantes und flüssig geschriebenes Buch. Es verbindet
Tragisches, Humorvolles und Dramatisches auf eine Weise, dass der Leser gefesselt bleibt.
Dieses Buch kann man immer wieder lesen und auch andere darauf aufmerksam machen.
Wenn Sie ein "echtes" Buch bevorzugen oder diesen Artikel verschenken möchten, können Sie
diesen Download-Artikel ggf. auch käuflich erwerben, solange verfügbar.
Artikel ansehen auf clv.de
Ney Bailey Glaube ist kein Gefühl
Die Bibelzitate sind, wenn nicht anders angegeben,
der Revidierten Elberfelder Übersetzung (1985) entnommen.
Überarbeitete Neuauflage 2007
Originaltitel: Faith Is Not a Feeling
Originalverlag: Here’s Life Publishers, Inc.
© der deutschen Ausgabe
Campus für Christus, Gießen
Übersetzung: Litera/Günsch
Umschlaggestaltung: OttENDESIGN.de
Satz: CLV
Druck: Ebner & Spiegel, Ulm
ISBN 978-3-88404-021-8 (CfC)
ISBN 978-3-89397-571-6 (CLV)
5
Inhalt
Einleitung 7
Die Flut 9
Albtraum Arizona 23
Aber dein Wort sagt … 37
Gewissensfragen 45
Ein verändertes Herz 57
Ein Stein nach dem anderen 71
Der Feind wird entlarvt 95
»Fünfundsiebzig Prozent« des Lebens 115
Versagen und Vergebung 129
Worauf gebaut? 141
7
Einleitung
»Was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch ein Jahr zu leben hätt et?«, fragte mein Teamleiter, Paul Eshleman, einige von uns bei einer Mitarbeiterbesprechung. Ich dachte: »Ich würde einige meiner Ansprachen in Buchform herausbringen wollen, weil sie im Leben vieler Menschen so positive Auswirkungen zu haben scheinen.« Bald darauf sagte Judy Downs Douglass aus der Verlagsabteilung von Campus für Christus zu mir: »Ney, wir hätt en gern ein Buch von dir über den Inhalt deiner Vorträge.«
Etwas später meinte Sharon Fischer, ebenfalls aus unserer Verlagsabteilung, zu einer gemeinsamen Freundin:
»Ich habe einige von Neys Tonbändern gehört. Das, worüber sie spricht, geht uns alle an, ob Mann oder Frau, ob verheiratet oder unverheiratet. Wenn sie jemals ein Buch schreiben sollte, würde ich sehr gern mit ihr daran arbeiten.«
Und so fi ng Gott an, alles zusammenzufügen.
Jeder von uns hat Gefühle. Sie können uns zu Freunden oder zu Feinden werden, je nachdem, wie wir mit ihnen umgehen. Ich möchte Ihnen von einigen Kämpfen und Prüfungen berichten, die ich bestehen musste, bis ich lernte, meine Gefühle zu bändigen und zu meistern.
Ich möchte Ihnen erzählen, wie ich es lernte, sie als einen Zugang zu Gott es Wort zu gebrauchen. Hunderte von Menschen, die gehört haben, was auf den folgenden Seiten berichtet wird, haben angerufen, geschrieben oder sind zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass ihr Leben dadurch anders geworden ist. Es ist mein Wunsch, dass jeder, der dieses Buch liest, ermutigt und herausgefordert wird. Ich bete, dass Gott in unseren Herzen »ein Feuer anzünde«, dass Menschenleben
8
verändert werden und dass jeder, der dieses Buch gelesen hat, sagen kann: »Jetzt verstehe ich, was es heißt, aus Glauben zu leben und Gott beim Wort zu nehmen. Jetzt verstehe ich, dass Glaube kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung.«
Ney Bailey, Lake Arrowhead, Kalifornien
9
Die Flut
»Alarm! Flutkatastrophe! Alarm! Flutkatastrophe!« Die Schreckensworte der letzten Nacht dröhnten mir noch in den Ohren, während ich gespannt die Fernsehnachrichten verfolgte.
»31. Juli 1976. Der Big Thompson führt Hochwasser.
Alles überfl utet. Einhundert Menschen wurden getötet, achthundert werden noch vermisst; der Sachschaden geht in die Millionen; die größte Katastrophe in der Geschichte des Staates Colorado. Wolkenbruchartige Regenfälle am Osthang der Wasserscheide des Kontinents
brachten innerhalb von sechs Stunden fünfunddreißig Zentimeter Regen mit sich und überschwemmten das Gebiet zwischen Estes Park und Loveland, genau nördlich von Denver. Eine Wasserwand wurde von einem heulenden, peitschenden Sturmwind den Canyon hinuntergetrieben.
Bäume wurden entwurzelt, Häuser verwüstet und Autos zerstört. Alle Bergungsaktionen scheinen unmöglich. Rett ungsfl ugzeuge suchen verzweifelt nach Vermissten. Die Lutt selbst ist erfüllt von einer Mischung aus Abwasser- und Dieselölgeruch und menschlichen Hilfeschreien.
Am 1. August ist alles vorüber, nur die Suche geht weiter … Die Flut, von Experten für unmöglich gehalten, kam dennoch: Reißende Wasser verwandelten eine friedliche Landschatt in ein Schreckensbild.
Was bleibt, sind die Dankgebete für die Überlebenden und die Erinnerung an jene, die nicht mehr unter uns sind …«
Meine Gedanken wanderten von der Stimme des Fern sehsprechers zurück zu dem schrecklichen Erlebnis.
Wenige Stunden zuvor hatt e ich selbst noch zu den Vermissten gehört. Bald darauf sollte ich erfahren, dass 10
sie ben Menschen, die mir sehr viel bedeuteten, unter den Toten waren. Wir – das waren fünfunddreißig langjährige Mitarbeiterinnen von Campus für Christus – hatt en uns auf
das Freizeitwochenende auf der Sylvan-Dale-Ranch riesig gefreut. Wir wollten Zeit zusammen verbringen und einander erzählen, was wir inzwischen erlebt hatt en, ehe wir zu unserer alljährlichen Mitarbeiterkonferenz an der staatlichen Universität von Colorado nach Fort
Collins fuhren.
Es war wie ein Familientreff en. Unsere verschiedenen Aufgaben hatt en uns im Lauf des vergangenen Jahres überall in die Vereinigten Staaten geführt, und einige von uns kamen aus dem Ausland zurück. Wir trafen am 31. Juli mitt ags auf der Ranch ein; am Eingang begrüßte
uns ein Schild: »Erholsame, kühle Übernachtungen weit weg von lauten Autostraßen.«
Das Wett er war unvergleichlich schön. Ein herber Tannendutt erfüllte die Lutt der Berge. Die warme Sonne strahlte aus dem tiett lauen Himmel über die Rocky Mountains auf die Ranch, die sich in etwa 1500 Metern Höhe harmonisch in das Tal einfügte. Durch die Narrows, eine Felsenschlucht gleich oberhalb der Ranch, floss reißend der Big Thompson.
Nach einem gemütlichen Mitt agessen im Speiseraum mit Blick auf den Fluss gingen wir reiten und schwimmen. Wir klett erten auf einen beladenen Heuwagen und sangen, lachten und unterhielten uns, während der Wagen uns einen schmalen Weg durch den Canyon hinauf zu einem Wasserfall brachte und dann wieder zurück zur Ranch zum Abendessen.
Während des Abendessens fesselte eine silberhaarige Dame meine Aufmerksamkeit; durchs Fenster beobachtete ich sie beim Angeln. Sie stand auf ein paar Steinen im Flussbett und hatt e die Hosenbeine hochgekrempelt.
Ihre Freunde standen in der Nähe und ermunterten sie. Ich fragte mich, wie sie erwarten konnte, in einem so reißenden und fl achen Wasserlauf überhaupt etwas zu fangen.
Nachdem wir unser Hähnchen nach Hausfrauenart verspeist hatt en, sammelte sich unsere Gruppe beim Kamin in dem geräumigen Aufenthaltsraum der »People’s Barn«, einem alten Gebäude mit Blick auf den Fluss, das an den Außenwänden mit vielen alten Wagenrädern
verziert war.
Freude erfüllte den Raum, als wir unsere Erinnerungen an all das miteinander austauschten, was Gott im vergangenen Jahr für uns getan hatt e. Dann bat ich Carol Rhoad, uns zu erzählen, wie sie den Nachmittag verbracht hatte. Sie war nämlich müde gewesen und hatte sich schlafen gelegt und deshalb die Fahrt auf dem Heuwagen nicht mitgemacht. Nach ihrem Mitt agsschlaf
war sie mit dem Besitzer der Ranch ins Gespräch gekommen.
»Wir haben ständig Leute hier, aber noch nie habe ich eine so fröhliche und harmonische Gruppe gesehen«, meinte er. »Wer seid ihr?«
Carol nahm die Gelegenheit wahr, ihm etwas über die Quelle unserer Freude zu sagen und dass auch er Jesus Christus als seinen Erlöser finden könne. Carol konnte an jenem Abend, als sie uns von diesem Gespräch berichtete,nicht ahnen, dass sie schon Stunden später bei Jesus Christus sein würde – für immer.
Marilyn Henderson besprach mit uns ihre Hoff nungen und Erwartungen in Bezug auf die kommende Mitarbeitertagung.
Sie sagte, sie habe dafür gebetet, dass keine von uns von dort so wieder weggehen würde, wie
sie gekommen sei. Wir wussten nicht, dass die nächs
12
ten Stunden und Tage unser Leben unwiderrufl ich verändern sollten.
Kurz nach 21 Uhr machten wir eine kleine Erfrischungspause.
Kaum waren wir wieder zusammen, als ich in weiter Ferne eine Sirene hörte. Gleich darauf
waren durch Lautsprecher verzerrte Stimmen zu hören. Als sie näher kamen, konnte ich allmählich die Warnungen verstehen. Wir wurden aufgerufen, sofort das Gebiet zu verlassen – der Fluss stieg, eine Flut welle nahte.
»Das kann nur ein Scherz sein«, dachte ich.
Jemand sagte: »Während der Pause war ich draußen, und der Fluss sah wirklich etwas sonderbar aus …«
Alles schien so unverständlich. Es war ein ruhiger, sonniger Tag gewesen – bis auf einen Wolkenschleier, der aber keineswegs bedrohlich wirkte, und einen leichten Schauer gegen Mitt ag.
Die Polizei dröhnte ihre Befehle in dringlichen Wiederholungen immer wieder hinaus.
»Sofort das Gebiet verlassen! Hochwasser kommt!
Nichts mitnehmen …! Höher gelegene Plätze aufsuchen!« Unser Raum war plötzlich voller Hochspannung und Aktivität. In weniger als einer Minute verließen wir die »People’s Barn«, rannten in die Dunkelheit hinaus und drängten uns in acht Autos.
Wir alle kannten die Umgebung nicht; niemand wusste genau, wohin wir uns wenden sollten. In dem Durcheinander wurden wir voneinander getrennt. Vier Autos blieben in der Nähe der Ranch und fuhren in verschiedene Richtungen. Die anderen vier Autos, darunter auch meines, folgten dem Polizeiwagen über eine Brücke hinauf zu dem Parkplatz eines Geschäfts an der Bundesstraße 34.
13
Als ich auf den Parkplatz kam, sprang eine meiner Mitfahrerinnen hinaus, um sich umzusehen. In dem Augenblick
rief jemand in der Nähe: »Die Brücke, über die wir eben gefahren sind, ist nicht mehr da!«
Ein Polizist in gelbem Ölzeug, nur von den Autoscheinwerfern beleuchtet, wiederholte durch sein Megaphon
immer wieder die Anweisung, höheres Gelände aufzusuchen. Ich versuchte, den unglaublichen Lärm
laufender Motoren, schreiender Menschen und explodierender Propangasflaschen, die der Fluss mitriss, zu
übertönen: »Wo ist höheres Gelände?«
Keine Antwort, nur immer wieder der Ruf des Polizisten:
»Hört doch die Explosionen! Weg hier …! Raus aus den Autos und höher hinauf!«
Ich sprang aus dem Auto und schrie wieder meine Frage: »Wohin?« Wieder keine Antwort.
Ich wusste, dass irgendwo auf der anderen Seite der Straße das Gelände anstieg, aber wo? Acht von uns waren
auf dem Parkplatz aus den Autos gestiegen und suchten nun in der Finsternis einen Weg den steilen Abhang
hinauf, eine hinter der anderen. Die Lutt war erfüllt von Propangasdunst. Ich spürte förmlich den Geschmack im Mund, als wir uns in Dunkelheit, Regen und dem ganzen Durcheinander gemeinsam den Berg hinaufschleppten, wobei wir über Stacheldraht klett ern mussten und immer wieder im Schlamm ausrutschten.
Winky Leinster und ich bewegten uns Hand in Hand vorwärts, geleitet nur von den Blitzen, die hin und wieder die sturmgepeitschte Finsternis durchdrangen. Wir schauten uns um und sahen, wie Jackie Hudson sich bückte, um einer älteren Frau zu helfen, die im nassen Lehm immer wieder ausrutschte und sich mühte, irgendwie durch den gefährlichen Stacheldraht zu kommen.
14
Nie hatt e ich mich dem Tod so nah gefühlt. Es schien,
als hätt e das reißende Wasser bereits unsere Fersen erreicht,
als folgte es uns den Berg hinauf, als könnte es
uns jeden Augenblick verschlingen.
Als wir oben auf dem Berg angekommen waren,
drängten wir acht uns dicht aneinander. Wir wussten
nicht, wo die anderen geblieben sein mochten, und wir
hatt en keine Ahnung, was eigentlich um uns herum vor
sich ging. Die Berglutt war kalt, und ein scharfer Wind
ließ sie noch kälter wirken; dazu kam der prasselnde
Regen. Frieren war mir immer besonders zuwider gewesen,
doch verbot ich mir jetzt, daran zu denken. Da
ich auf einem Felsbrocken direkt hinter einer der Frauen
saß, versuchte ich, sie vor dem Ansturm der Elemente
zu schützen.
Als wir so dicht aneinandergedrängt dasaßen, schlug
ich vor: »Lasst uns beten.«
Worte der Bibel kamen mir in den Sinn, und so begann
ich: »Herr, dein Wort sagt: ›Sagt in allem Dank!
Denn dies ist der Wille Gott es in Christus Jesus für euch‹
(1. Thessalonicher 5,18). Da wir nun in dieser Lage sind,
entscheiden wir uns ganz bewusst dafür, dir Dank zu
sagen. Herr, dein Wort sagt auch, dass ›denen, die Gott
lieben‹, und das tun wir, ›alle Dinge‹, also auch dies,
›zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz
berufen sind‹, also auch uns (Römer 8,28). Du hast
auch gesagt: ›Der Himmel und die Erde werden vergehen,
meine Worte aber sollen nicht vergehen‹ (Matt häus
24,35). Demnach ist dein Wort verlässlicher als alles,
was wir jetzt fühlen und erleben.«
Unsere Ängste zerstreuten sich, unsere Herzen wurden
getröstet und seltsamerweise von Frieden erfüllt,
als wir so auf dem windumtosten Berggipfel beteten.
Unsere Gebete wurden zum Lobgesang: Vater, wir dan
15
ken dir, Vater, wir danken dir, Vater im Himmel, wir danken
dir. Bald darauf klett erten wir ein Stück den Berg hinunter
und gesellten uns zu einer anderen Gruppe von
Touristen, die unter hohen Felsbrocken besseren Schutz
gefunden hatt e.
Die ältere Dame, der Jackie Hudson durch den Zaun
geholfen hatt e, lehnte sich gegen einen dicken Felsblock.
Von unserem erhöhten Platz auf den Felsen aus konnten
wir sehen, wie noch immer Propangasfl aschen explodierten
und zu plötzlich leuchtenden Feuerbällen wurden.
Und wir sahen die ziellos wandernden Scheinwerfer
von Autos, die vom Fluss mitgerissen wurden.
Bald gab uns die Polizei Zeichen, dass wir herunterkommen
sollten. Wir wurden angewiesen, unsere Autos
zu suchen, und bald folgten wir einem Streifenwagen
über einen Feldweg nach Loveland.
Vor Loveland wiesen uns die roten Blinklichter einer
Polizeisperre weiter nach Fort Collins; in Loveland
durtt en keine Autos halten.
Wir kamen nach Mitt ernacht in Fort Collins an. Dort
meldeten wir uns bei der zuständigen Polizeidienststelle,
um zu erfahren, wer von unserer Gruppe noch gerettet
worden war. Man versicherte uns, dass auf der Sylvan-
Dale-Ranch keiner zurückgeblieben sei. Wir wollten
umkehren und nach unseren Freunden suchen, aber aus
dem Radio kam die Durchsage: »Bitt e nicht nach Loveland
fahren … Sie vergrößern nur den Andrang dort und
behindern die Rett ungsarbeiten!« Da wir off enbar nichts
weiter tun konnten, gingen wir alle nach Hause.
Sobald ich allein in meiner Wohnung war, nicht weit
entfernt von dem Gelände der staatlichen Universität
von Colorado, dachte ich noch einmal über die verwirrende
Abfolge von Ereignissen an diesem Abend nach.
Vor allem machte ich mir Sorgen, weil Marilyn Hender
16
son noch nicht zu Hause war. Marilyn wohnte in jenem
Jahr mit mir zusammen; wir waren Kolleginnen und
sehr gute Freundinnen. Ich steckte einen Zett el an ihre
Tür und ging ins Bett . Es war drei Uhr morgens.
Sechs Stunden später erhielt ich die schreckliche
Nach richt. Ich erfuhr, dass bei der morgendlichen
Zu sammenkuntt auf unserer Mitarbeitertagung bekannt
gegeben worden war, dass einige unserer Mitarbeiterinnen
vermisst wurden. Minuten später war
ich angezogen, hatt e meine Familie angerufen, damit
sie wusste, dass ich in Sicherheit war, und nun hastete
ich zum Büro von Bill Bright, dem Leiter unserer Bewegung.
Die Leute, die sich vor seiner Tür versammelt hatt en,
umarmten mich vor lauter Freude, dass ich noch lebte.
Jetzt erst, fast zwölf Stunden nachdem die Sirenen erstmals
am Flussufer entlang aufgeheult hatt en, kamen
mir die Tränen.
Dr. Bright begrüßte mich herzlich in seinem Büro.
Die Stimmung dort war ernst, aber friedvoll.
»Ney, wie freue ich mich, dich in Sicherheit zu wissen!
Wie bist du davongekommen?«, fragte er.
»Die Polizei leitete uns über einen Feldweg heraus.«
Ich schilderte ihm die Erlebnisse unserer Gruppe.
»Marilyn rief etwa gegen Mitt ernacht an, um uns zu
sagen, sie sei im Krankenhaus«, sagte er sachlich. »Später
wurde dann noch Melanie Ahlquist eingeliefert.«
Ich verstand das nicht. »Was soll das heißen, sie sind
im Krankenhaus?«
»Ihr Auto geriet ins Wasser. Sie glauben nicht, dass
die anderen Insassen davongekommen sind. Marilyn
und Melanie konnten sich an Bäumen festhalten und
wurden gerett et.«
»Ihr Auto geriet ins Wasser?«
17
Dr. Bright sprach ruhig weiter. »Sie wurden angewiesen,
nach Osten, Richtung Loveland, zu fahren.«
»Nach Osten, Richtung Loveland!«, wiederholte
ich.
Ich saß regungslos und mit vor Entsetzen off enem
Mund da. Dr. Bright wurde ans Telefon gerufen. Er hörte
aufmerksam zu und legte dann die Hand über die
Sprechmuschel. Er wandte sich um und sah mich an.
»Sie haben mit Sicherheit die Leichen von Carol
Rhoad und Cathie Loomis identifi ziert.«
Ich sackte im Stuhl zusammen, als hätt e ich einen
Schlag mit dem Holzhammer bekommen. All das Unglaubliche
des gestrigen Abends drang nun auch in diesen
Sonntagmorgen vor.
Ich blieb noch ein paar Minuten bei Dr. Bright und
eilte dann ins Krankenhaus zu Marilyn.
Sie lächelte schwach, als ich ins Zimmer trat. Ich weiß
noch, dass mir ein Lied durch den Kopf ging, als ich sie
sah, das wir am Anfang des Sommers einmal gehört
hatt en: Geht man so mit ’ner Dame um …? Wir begrüßten
uns herzlich. Sie war zerschunden und erschöptt und
erbrach Schlamm und Geröll aus dem reißenden Fluss,
der versucht hatt e, ihr Leben zu vernichten.
Der verfi nsterte Himmel sah fast aus, als trauerte
Gott es Herz – es goss in Strömen, als ich an jenem
Spätnachmitt ag das Krankenhaus verließ, um Mary
Graham, eine weitere Mitarbeiterin und gute Freundin
von mir, am Flughafen von Denver abzuholen. Mary
hatt e wegen einer wichtigen Verpfl ichtung nicht zu
unserem Treff en auf der Ranch kommen können, und
wir hatt en vereinbart, dass entweder Carol Rhoad oder
ich Mary vom Flughafen abholen sollte. Ich wollte sie
direkt wissen lassen, warum Carol nicht da sein
konnte.
18
Wie benommen ging ich durch den Flughafen. Ich
war schon ott und überall im Land auf Flughäfen gewesen,
aber diesmal war es anders. Ich dachte über all
die Leute nach, die zu den Flugzeugen gingen oder von
ihnen kamen und keine Ahnung hatt en, dass ich am
Abend zuvor knapp der Flut entgangen war, dass ich
Kummer hatt e, dass meine Freundinnen entweder tot
oder verletzt oder vermisst waren. Niemand ahnte, wie
entsetzlich elend ich mich fühlte.
Ich fragte mich, wie ott ich auf Flughäfen an Menschen
vorübergegangen war, die eben erst einen lieben
Verwandten oder Freund verloren hatt en – und ich hatte
nichts davon gewusst.
Im Lauf der nächsten Tage wurde das, was geschehen
war, nach und nach klarer. Off enbar hatt e im Lärm
und Durcheinander der herankommenden Flutwelle
niemand gewusst, welchen Weg man hätt e einschlagen
sollen, um höheres Gelände zu erreichen. Jeder hörte
sich in eine andere Richtung gewiesen. Siebzehn unserer
Mitarbeiterinnen hatt en sich auf der Ranch wiedergefunden.
Sie verbrachten die Nacht im Freizeitraum
der Sylvan-Dale-Ranch und gelangten von da aus am
folgenden Nachmitt ag per Anhalter in Sicherheit. Der
Raum in der »People’s Barn«, in dem unser Treff en statt -
gefunden hatt e, war wenige Minuten nachdem wir ihn
verlassen hatt en, bis zur Decke voll mit Schlamm und
Wasser gewesen.
Vier Autos hatt en es über die Brücke geschatt . Die
Insassen zweier unserer Autos verließen auf Anweisung
der Polizei die Wagen und versuchten zu Fuß, weiter
nach oben zu kommen.
Die anderen Autos folgten der Anweisung eines Polizisten,
nach Osten in Richtung Loveland weiterzufahren.
Als sie an eine tiefere Stelle der Straße kamen, don
19
nerte eine Wasserwand über sie hinweg und spülte sie
in den Fluss. In Sekundenschnelle waren die Autos versunken.
Von den neun Frauen in diesen zwei Autos kamen
sieben ums Leben. Die beiden Überlebenden, Marilyn
und Melanie, kämptt en einen verzweifelten Kampf.
Sie klammerten sich an Bäume, bis die Rett ungsmannschatt
en sie bergen konnten.
In den folgenden Tagen, während wir viele Stunden
im Krankenhaus verbrachten, um uns um Marilyn
und Melanie zu kümmern, und unseren Aufgaben bei
der Mitarbeitertagung nachkamen, dachte ich ott daran,
dass ich einmal gelesen hatt e: »Was uns die größte
Freude schenkt, bringt auch den größten Kummer mit
sich.« Jetzt erfuhr ich die Wahrheit dieser Worte, als ich
über den Tod meiner Freundinnen weinte. Ich weinte
herzzerreißend. Der Verlust brach mir fast das Herz; ich
hatt e sie sehr lieb gehabt.
Beim Gedanken an jede einzelne von ihnen brachen
lebhatt e Erinnerungen hervor.
Rae Arm Johnston … am Morgen unseres Treff ens
auf der Ranch hatt e ich ihr einen Zett el zugeschoben,
auf dem stand, sie solle mit mir ein Zimmer teilen …
Der Zett el steckte nun in meiner Bibel mit ihrer Antwort:
»Mach ich liebend gern …«
Carol Rhoad … wie fröhlich war sie als unsere Sekretärin
gewesen …! Sie hatt e unseren regelmäßigen Treffen
etwas Häusliches gegeben – kleine Überraschungen
wie Obst, Käse, Blumen … Am Anfang des Sommers
hatt e ich eine vierwöchige Vortragsreihe gehalten …
Carol brachte Freunde mit und saß jedes Mal in der vordersten
Reihe, um mir Mut zu machen …
Cathie Loomis … Cathie saß während der Kaff eepau
se bei mir in der »People’s Barn« …, ich weiß noch,
20
wie ich dachte: »Cathie hat noch nie so strahlend schön
aus ge sehen.« … Ein Leuchten schien von ihr auszu gehen
…
June Fujiwara … ihre Augen verschwanden, wenn
sie ihr strahlendes Hawaiilächeln zeigte … Sie besuchte
mich einmal im Dezember zu Hause in Kalifornien – ich
machte ein Foto von June, wie sie zum ersten Mal in ihrem
Leben auf Skiern stand …
Precy Manongdo … sie war im Reisedienst auf den
Philippinen gewesen … Den Nachmitt ag hatt en wir
noch zusammen verbracht, hatt en auf einem Zaun gehockt,
miteinander geplaudert und den Fluss betrachtet
und darauf gewartet, dass unsere Pferde gesatt elt
wurden …
Barbie Leyden … sie hatt e mich von unserer ersten
Begegnung an hell begeistert … Barbie hatt e ein unsichtbares
Wesen mit Namen »Edith« erfunden: Wenn
das Geschirr nicht gespült worden war, war Edith dafür
zuständig; wenn die Autoschlüssel nicht aufzufi nden
waren, hatt e Edith die Schuld … Eines Sommers
veranstalteten wir eine Party für Barbies unsichtbare
Freundin und versprachen allen geladenen Gästen, sie
werde wirklich erscheinen … Wir sorgten dafür, dass
nach dem Essen ein Telegramm kam, das mit den Worten
endete: »Man kann nicht alles haben – entweder Kuchen
oder Edith!«
Terri Bissing … während einer schwierigen Phase
in meinem Leben schickte sie mir vierzehn Tage lang
jeden Tag eine Karte mit einem besonderen Wort für
mich … Während unserer Mitarbeitertagung wollten wir
uns einmal Zeit nehmen für ein langes Gespräch …
Nun waren sie nicht mehr am Leben. Sie würden mir
entsetzlich fehlen, und was in meinem Herzen vorging,
lässt sich nicht mit Worten sagen. Ich wollte jede ih
21
rer Familien besuchen und ihnen sagen, wie nahe sie
meinem Herzen gestanden hatt en.
Ich wusste auch, dass ich in der Gefahr stand, bitt er
und zynisch zu werden, wenn ich weiter über den Verlust
und das ganze Unglück nachdachte und all die Fragen
nach dem »Warum« zu beantworten suchte, auf die
es doch keine rechten Antworten gab.
Aber aus früheren Erfahrungen hatt e ich gelernt, dass
wir in dem Maße bitt er werden, wie wir Gott nicht Dank
sagen, und so begann ich unter Tränen, ›Gott [durch
Jesus] ein Opfer des Lobes dar[zu]bringen! Das ist:
Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen‹ (Hebräer
13,15). Ich richtete mein Herz auf die Dankbarkeit
Gott gegenüber aus. Ich zwang mich, auf das zu sehen,
was er gegeben hatt e, und nicht so sehr auf das, was er
genommen hatt e.
Auf einmal sah ich: Mein Leben hätt e auch anders
verlaufen können, ohne dass ich je diese mir so wertvollen
Menschen kennen und lieben gelernt hätt e, doch
Gott hatt e sie mir über den Weg geschickt. Er hatt e mir
die Zeit, die ich mit jeder von ihnen verbracht hatt e, als
ein Geschenk gegeben.
Willentlich, nicht aus meinem Gefühl heraus, entschloss
ich mich dazu, immer wieder zu danken. Gott
hatt e in seinem Wort verheißen, er werde denen, die
ihn lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind,
alle Dinge (auch die allerschlimmsten) zum Besten dienen
lassen.
Etwa einen Monat nach der Flut schrieb mir eine
Freundin aus Europa: »Ney, wenn ich jene Flut mit erlebt
hätt e, ich weiß nicht, ob ich ebenso wie du darauf reagiert
hätt e …«
Mir war zutiefst bewusst, dass dies keine natürliche
Reaktion meinerseits war, sondern eine übernatürliche
22
aus dem Glauben heraus, dass Gott es Wort wahrer ist,
als ich es empfand. Ich war mir außerdem darüber klar,
dass dies das Ergebnis langer Jahre war, in denen ich
durch eine harte Schule gegangen war und aus meinen
Fehlern gelernt hatt e.
23
Albtraum Arizona
Mein dunkelblauer VW-Käfer war bis oben hin vollgepackt.
Ich hatt e so ziemlich all mein Hab und Gut in
meinem Auto und einem kleinen Anhänger verstaut.
Vor mir lag die über 2500 Kilometer lange einsame Fahrt
von meinem Heimatort New Orleans quer durch den
Westen von Texas und New Mexico nach Arizona. Ich
sollte nach Tucson kommen, um meinen Dienst als Mitarbeiterin
bei Campus für Christus an der Universität
von Arizona zu beginnen.
Vieles ging mir durch den Kopf während der einsamen
Stunden unterwegs. Es ging einem neuen Abenteuer
entgegen. Die 25 Jahre meines bisherigen Lebens
waren mit mancherlei Erfolgen, mit großen Freuden und
wenigen Entt äuschungen angefüllt gewesen. Und obwohl
ich Jesus Christus schon mit 15 Jahren als meinen
Erlöser angenommen hatt e, gab ich erst nach meinem
Hochschulabschluss, als ich Sozialarbeiterin in New Orleans
war, mein Leben ganz Christus hin. Und das war
erst eineinhalb Jahre her. Ich war jung, voller Selbstvertrauen,
Hoff nung und Begeisterung und von Herzen
bereit, »große Dinge« für Gott zu tun.
Bei der Mitarbeiterkonferenz einen Monat zuvor
hatt e mir einer der Konferenzleiter einige Fragen gestellt.
»Was brauchst du deiner Meinung nach am nötigsten,
wenn du an deine neue Aufgabe denkst?«, war eine
der Fragen.
Ohne zu zögern, hatt e ich geantwortet: »Eine Schulung
für meinen Dienst als Campus-Mitarbeiterin, weil
ich noch nichts darüber weiß.« Der Glaube der Männer
und Frauen auf der Konferenz hatt e mich sehr beeindruckt,
darum wollte ich im Glauben wachsen, um
24
tun zu können, was sie taten, um zu wissen, was sie
wussten.
Den Straßenschildern nach zu urteilen, ging meine
Reise nun bald zu Ende. Ich hatt e schon viel gehört über
diese Wüstengegend, über den Sonnenschein das ganze
Jahr hindurch, über die prachtvollen Sonnenuntergänge.
Eine Unmenge großer Säulenkakteen in den verschiedensten
Formen schmückte die Täler, von fernen
Hügeln und Bergen eingerahmt. Ich hatt e Arizona bereits
ins Herz geschlossen.
Ein freundliches Ehepaar hatt e mir gleich neben dem
größten Studentenwohnheim ein Einzimmerappartement
besorgt. Damals wusste ich nicht mehr über die
Hochschule in Tucson, als dass sie in einer zweifelhatt en
Zeitschritt als »Party«-Universität Nr. 1 bezeichnet wurde.
Als ich nun auf dem Weg zu meiner neuen Wohnung
an der Universität vorbeifuhr, fi el mein Blick auf ein sehr
schönes Universitätsgelände: auf hohe Palmbäume und
weiße Gebäude mit leuchtend roten Ziegeldächern.
Ich kam mit großen Erwartungen dort an, sah mit Begeisterung
der Schulung entgegen, die ich bekommen
sollte, und wollte eifrig alles lernen, was wissenswert
war. Zusammen mit Paul Schipper, ebenfalls Mitarbeiter
bei Campus für Christus, sollte ich im Universitätsbereich
arbeiten. Ich war auch gespannt darauf, den
Studenten kennenzulernen, der die Arbeit an der Uni
angefangen hatt e. Von ihm hieß es, er könne mir jede
nur denkbare Information geben und habe viel »Knowhow«.
Doch plötzlich wendete sich das Blatt . Der Student,
der bisher die Arbeit geleitet hatt e, musste sich von jeder
zusätzlichen Verantwortung freimachen und übergab
darum Paul und mir die gesamte Arbeit, um sich
ganz seinen Examensvorbereitungen widmen zu kön
25
nen. Und nur wenige Tage nach meiner Ankuntt wurde
Paul 180 Kilometer weiter nach Norden an die staatliche
Universität von Arizona geschickt, um eine Mitarbeiterschulung
durch den Leiter der Arbeit an der Uni
dort, Elmer Lappen, zu erhalten.
Sehr zu meinem Leidwesen blieb ich an der Universität
von Arizona in dem mir fremden Tucson zurück
– allein!
Bei dieser Entscheidung war off ensichtlich mein persönlicher
Hintergrund in Betracht gezogen worden, und
man hatt e angenommen, dass ich der Situation gewachsen
wäre. Jetzt – ich war kaum angekommen – lag alles
allein in meinen Händen. So hatt e ich mir das überhaupt
nicht vorgestellt.
Meistens war ich sehr dazu bereit, alles auszuprobieren.
Ich weiß noch, wie ich auf der Fahrt nach Arizona
dachte: »Ich bin Studentensprecherin gewesen, Herr;
wenn ich also an die Uni komme, werde ich mit allen
Studentensprechern über dich reden. Ich bin Wohnheimsprecherin
gewesen, also werde ich mit den Wohnheimsprechern
reden. Ich bin Vorsitzende einer Studentenvereinigung
gewesen, also werde ich mit all diesen
Leuten sprechen. Ich war Klassensprecherin, also werde
ich Termine mit allen Klassensprechern ansetzen.«
Nun aber, nachdem ich angekommen war, gab mir
das Wissen um diese früheren Ämter keinerlei Selbstvertrauen
für die Arbeit. Wo war meine frühere Kühnheit,
meine Begeisterung? Als ich noch in Louisiana war,
kamen einige Leute zum Glauben, nachdem ich mit ihnen
über das Evangelium gesprochen hatt e. Ich nutzte
damals alle Möglichkeiten, um mit anderen Menschen
über Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Aber hier
in Arizona musste ich mich täglich zwingen, zur Universität
zu gehen. Ja, ich war sehr froh, wenn ein Termin
26
mit einem Studenten nicht zustande kam – dann hatt e
ich reichlich Zeit, mich in einer nahen Buchhandlung
umzusehen, oder ich konnte mich anderer bewährter
Methoden bedienen, um bis zum Mitt ag- oder Abendessen
die Zeit totzuschlagen.
Ich fühlte mich auch durch gewisse Verhaltensformen
unter Druck gesetzt. Einige kamen von außen; bei
Campus für Christus gibt es Richtlinien, die für jeden
Mitarbeiter verbindlich sind. Ich wollte mich unbedingt
an diese Richtlinien halten, merkte jedoch, dass ich es
nicht konnte. Und meistens tat ich es auch nicht.
Außerdem setzte ich mich auch selbst unter Druck.
Obwohl ich noch immer nicht genau wusste, wie ich
meine Arbeit tun sollte, erwartete ich von mir, dass ich
sie ebenso gut tat, wie ich bisher alles gemacht hatt e.
Nicht nur das, sondern ich verglich mich auch mit anderen
Mitarbeitern und kam dabei zu dem Schluss,
dass ich ihnen – jedenfalls aus meiner Sicht – um einiges
nachstand.
Diane Ross zum Beispiel war mein Ideal. Diane war
damals im Reisedienst unserer Bewegung tätig. Sie hatte
in ihrer Arbeit viel Erfolg und schien immer über den
Dingen zu stehen. Off ensichtlich kannte sich Diane in
Gott es Wort aus, und sie schien ihren Glauben an Christus
frei und mühelos anderen weiterzusagen. Sie war in
jeder Hinsicht eine anziehende Persönlichkeit. In meiner
Vergleichsskala rangierte Diane ganz oben – und ich
bildete das Schlusslicht.
Aber größer als alle Ängste und Empfi ndungen bezüglich
meiner Unzulänglichkeit war meine Entt äuschung
über Gott . Ich meinte, er hätt e mich im Stich
gelassen.
Hatt e ich denn nicht in Louisiana meine Familie,
meine Freunde und meine Geborgenheit zurückgelas
27
sen? Hatt e ich nicht »alles verlassen«, um Jesus Christus
nachzufolgen? Jetzt schien mir der Boden unter den
Füßen weggezogen. Hieß das, ihm zu dienen?
Ich fragte mich, wie ich in eine solche Zwangslage
hatt e kommen können. Und noch mehr beschätt igte
mich die Frage, wie ich da wieder herauskommen
könn te. Jetzt war ich noch nicht einmal einen Monat
in Ari zona, und schon hätt e ich am liebsten alles hingeworfen.
Noch nie in meinem bisherigen Leben hatt e ich versagt
– jedenfalls hatt e ich es noch nie vor anderen zugeben
müssen. Natürlich kamen mir Gelegenheiten in
den Sinn, bei denen ich versagt hatt e, aber dafür gab es
Gründe. Einmal hatt e ich im Gymnasium in Mathematik
versagt, aber nur, »weil der Lehrer so streng war«.
Ich wiederholte den Kurs bei einem anderen Lehrer und
brachte ihn erfolgreich zum Abschluss.
Mir fi el ein weiteres Erlebnis aus meiner Studienzeit
ein. Unser Schulchor war sehr bekannt und geschätzt;
er stand im ganzen Staat Louisiana in hohem Ansehen.
Nach dem Vorsingen wurde ich aus unerfi ndlichen
Gründen angenommen, vermutlich, weil ich ein paar
tiefe Töne traf und der Chor Altstimmen brauchte. Während
unserer Chorproben vor der Konzertsaison hielt
ich mich eng an die anderen Altstimmen und konnte
mich so, was Tonhöhe und Einsätze betraf, immer an
ihnen orientieren.
Nach seiner Gewohnheit trennte der Chorleiter bald
die verschiedenen Stimmen, so dass Alt, Sopran, Tenor
und Bass durcheinanderstanden. Und plötzlich gab es
um mich herum keine Altstimmen mehr, auf die ich
mich stützen konnte. Da ich keine Noten lesen und auch
nicht nach Gehör singen konnte, fi ng ich bei den Proben
an, nur die Worte zu formen, und sang nie so laut, dass
28
jemand in der Nähe hören konnte, wenn ich bei einem
Ton nicht ganz sicher war.
Aber der wirkliche Schrecken kam, als der Konzertplan
des Chores für das Jahr bekannt gegeben wurde.
Neben den üblichen Konzertreisen waren wir für eine
wöchentliche Fernsehsendung vorgesehen und sollten
möglicherweise von der Regierung für eine Tournee zu
den Militärstandorten in Asien ausgewählt werden.
Also traf ich meine Entscheidung: Ich konnte nicht
einfach im Chor bleiben und so tun als ob – nicht bei
einem derartigen Konzertreiseplan. Es musste etwas
geschehen.
Doch anstatt mein Versagen gleich einzugestehen,
begann ich, nach einem anderen Ausweg zu suchen.
Schließlich, nachdem ich hin und her überlegt hatte,
wie ich mich aus dem Chor zurückziehen könnte,
ohne das Gesicht zu verlieren, fi el mir eine Lösung ein.
Das würde mich wirklich von dieser Verpfl ichtung
be freien!
Eines Tages war ich allein im Haus unserer Studen
ten vereinigung. Ich holte mir einen Hocker von
etwa einem Meter Höhe, stellte ihn mitt en in den Raum
und fi ng an, immer wieder von diesem Hocker auf den
Boden hinunterzuspringen – in der verzweifelten Hoff -
nung, mir den Knöchel zu brechen, denn mit einem
Knöchelbruch konnte ich ja kein Konzert durch stehen.
Ein paar Jahre zuvor hatt e ich mir einmal bei einer
Wanderung den Knöchel verletzt, und nun dachte ich,
das müsste wieder geschehen.
Mein Fuß wurde tatsächlich sehr in Mitleidenschatt
gezogen – und damit hatt e ich eine ausreichende Entschuldigung,
nicht mehr an den Chorproben teilnehmen
zu müssen. Ich war ein wenig traurig, als der Chor
ohne mich nach Asien reiste, aber ich wusste auch, dass
29
niemand mir die Möglichkeit zum Mitfahren verbaut
hatt e.
Auch jetzt mochte ich mein Versagen nicht zugeben.
Was würden die Leute denken? Wie konnte ich
Bill Bright schreiben und ihm sagen, dass ich meinen
Dienst in Arizona schon leid war? Zu Hause gab es Leute,
die für mich beteten und mich fi nanziell unterstützten.
Wie konnte ich ihnen schreiben, dass ich alles hinwerfen
wollte?
An einem Spätnachmitt ag legte ich mich in meiner
kleinen Wohnung auf den Teppich, den Kopf auf die
Arme gestützt. Wie ich so dalag, sah ich in der Wand
die Ritzen, die anzeigten, wo mein Klappbett eingebaut
war. Dann wanderten meine Augen weiter zur Gasheizung
an der anderen Wand.
»Ich dreh’ einfach den Gashahn auf, und das ganze
Elend ist vorbei.«
Aber dann dachte ich: »Nein, das geht auf keinen
Fall, denn dann würde in der Zeitung von Tucson zu lesen
sein: ›Mitarbeiterin der missionarischen Bewegung
Campus für Christus begeht Selbstmord!‹ Und das wäre
kein gutes Zeugnis, weder für Christus noch für unsere
Bewegung, noch für mich!«
Meine Gedanken wanderten zu der Gebirgskett e unweit
von Tucson. »Ich fahre einfach mit meinem Wagen
den Mount Lemon hinauf, und wenn ich dann wieder
herunterfahre, komme ich ganz zufällig von der Straße
ab … und es sieht dann wie ein Unfall aus! Und jeder
wird sagen: ›Arme Ney, sie wollte eine kleine Spazierfahrt
in die Berge machen und hat irgendwie die Kontrolle
über den Wagen verloren …‹«
Das ging! Weder auf mich noch auf Campus für Christus,
noch auf Gott würde ein schlechtes Licht fallen! Das
schien ein ehrbarer Ausweg.
30
Trotz all dieser Gedanken, wie ich »mit allem Schluss«
machen könnte, dachte ich doch viel häufi ger: »Herr,
wenn ich hier je wieder wegkomme, bringt mich nichts
mehr hierher zurück.«
Als der 1. November kam und ich für einige Zeit
zu einer Mitarbeiterschulung an die staatliche Uni versi
tät von Arizona fl iegen sollte, ergriff ich die Chance
mit beiden Händen. »Wenn ich nur dorthin gehen
kann«, sagte ich mir, »dann wird alles gut werden.« Aber
bald stellte ich fest, dass eine Ortsveränderung nicht
die Lö sung für mein Problem war. Wenn man einen
faulen Apfel nimmt und ihn mit dem Flugzeug von
Tucson nach Phoenix transportiert, ist er, wenn er dort
ankommt, immer noch faul. Und ich nahm meinen »faulen
Apfel« mit. Auch an der staatlichen Uni gefi el es mir
nicht – ich war dort ebenso deprimiert, fürchtete mich
und hielt mich für einen Versager.
Eines Tages, als ich eigentlich an die Uni gehen sollte,
um Gespräche über den Glauben zu führen, stieg ich
widerspenstig in meinen VW, fuhr nach Phoenix und
suchte mir ein Café. Dort bestellte ich den größten Eisbecher,
den die Speisekarte zu bieten hatt e.
»Hier sitze ich und esse Eis mit heißer Schokolade«,
sagte ich fi nster. »Niemand weiß, dass ich hier bin, und
mir ist alles egal!«
Ich war eingeladen worden, während der Weihnachtszeit
an der Hochzeit von Bev, einer Freundin aus meiner
Kindheit, teilzunehmen. Sie sollte in Corpus Christi,
Texas, statt fi nden. Ich erwähnte die Einladung gegenüber
meinem Leiter, Elmer Lappen, als wir unsere wöchent
liche Besprechung in der Bibliothek hatt en.
»Elmer, wenn ich vor Weihnachten nach Hause fahre,
um zu Bevs Hochzeit zu gehen, ich glaube, dann komme
ich nicht mehr zurück.«
31
Er sah mich traurig an. »Ney, wenn du das tust,
machst du mir wirklich das Herz schwer.«
Doch ich blieb hart. Mir ging es darum, von hier wegzukommen,
und es kümmerte mich nicht, ob es Elmer
das Herz schwer machen würde.
Schließlich kam der 15. Dezember, der Tag meiner Abreise
zu Bevs Hochzeit und in die Weihnachts ferien. In
meinem Leben war ich noch nie so gern von irgendwo
weg gefahren. Ich sprang in meinen VW, hielt am Stadtrand
von Tucson noch einmal an, um mir voller Trotz
Zigarett en zu kaufen, und rauchte dann auf der ganzen
Fahrt bis Corpus Christi!
Ich hatt e in meinem Leben nur selten geraucht, und
wenn, dann war es immer symptomatisch dafür gewesen,
dass irgendetwas nicht stimmte. Als ich zu Bevs
Hochzeitsfeier kam, roch ich bereits wie ein ganzer Tabak
laden.
Als wir alle beim Festessen saßen, schlug jemand vor,
jeder von uns sollte kurz sagen, was Bev ihm bedeutete.
Ich hatt e sie sehr gern, aber an jenem Abend bekam ich
den Mund nicht auf. Bevs Einfl uss war es hauptsächlich
zuzuschreiben, dass ich mich Campus für Christus
angeschlossen hatt e. Ich war unglücklich und der Ansicht,
dass sie zu dieser Gemütsverfassung beigetragen
hatt e. Ich sagte also keinen Ton und war darüber nur
noch unglücklicher!
Nach der Hochzeit fuhr ich nach Hause, nach Shreveport
in Louisiana. Die Weihnachtstage machten mir
wenig Freude, und zwei Wochen lang hing ich so zu
Hause herum. Eines Tages, kurz vor Ende meiner Ferien,
saß ich auf der Couch im Wohnzimmer und sah
ab und zu durch das große Fenster hinaus. Ich tat mir
selbst leid und mochte gar nicht an meine Rückkehr
nach Arizona denken.
32
An den Fingern zählte ich ab: »September, Oktober,
November, Dezember … mal sehen, vier Monate habe
ich durchgehalten.« Ich zählte weiter: »Januar, Februar,
März, April, Mai … Wenn ich es vier Monate lang
geschatt habe, kann ich es auch noch fünf weitere Monate
aushalten. Aber im Mai ist Schluss.«
Die Rückfahrt nach Arizona fi el mir so schwer wie
noch selten etwas in meinem Leben. Als ich ankam, fand
ich in meinem Zimmer einen Brief von einem Bekannten
aus Hawaii vor. Er schrieb: »Ney, neulich hat hier ein
Mann einen Vortrag gehalten, der mir ungeheuer geholfen
hat. Er heißt Merv Rosell, und für mich war es Gottes
Mann mit der richtigen Botschatt zur richtigen Zeit.
Er kommt nach Phoenix, und ich möchte dich bitt en, zu
der Veranstaltung zu gehen.«
Ich dachte: »Wenn ich etwas nötig habe, dann ist es
ein Mann Gott es mit der richtigen Botschatt – und jetzt
kommt er off enbar zur richtigen Zeit.«
Eine knappe Woche später machte ich mich auf den
Weg, um Merv Rosell zu hören. Ich weiß noch, wie ich
im Auto saß und dachte: »Ob ich nun Missionarin bin
oder nicht, Herr, wenn ich heute Abend nach vorne gehen
muss, ich werd’s tun, um mit dir ins Reine zu kommen.
Ich bin bereit zu tun, was du von mir verlangst.«
Als ich in die Veranstaltung kam, traute ich meinen
Ohren kaum, denn das Thema hieß: »Christen in der
Niederlage«.
Rosell begann mit den Worten: »Wenn Sie je in Ihrem
Leben als Christ total niedergeschlagen waren, dann ist
die heutige Botschatt für Sie.« Ich hörte zu, als sei ich der
einzige Zuhörer im Raum. Er sprach davon, wie wir ott
versuchen, aus eigener Kratt und durch eigenes Bemühen
unser Leben als Christen zu führen, und wie Gott
uns dann ott versagen lässt, um uns auf eine entschei
33
dende Wahrheit hinzuweisen: dass wir das christliche
Leben nicht aus eigener Kratt führen können.
Zusammenfassend sagte er: »Wer heute und sein ganzes
weiteres Leben für Jesus Christus leben will und wer
möchte, dass Jesus Christus von jetzt an durch ihn lebt,
der möge bitt e aufstehen.«
Ich war schon in anderen Veranstaltungen gewesen,
wo derartige Einladungen gemacht wurden. Meistens
sah ich mich dann verschämt um, weil ich sehen wollte,
ob auch sonst noch jemand darauf reagierte.
Aber an diesem Abend war mir das gleichgültig. Mir
ging jetzt allmählich auf, dass ich versucht hatt e, aus
meiner eigenen Kratt ein christliches Leben zu führen –
ich verließ mich auf mein eigenes Bemühen. Verzweifelt
wünschte ich mir, Christus möge durch mich zu leben
beginnen. Ich stand auf und übergab in jenem Augenblick
meinen Willen und mein ganzes Sein der Herrschatt
Jesu Christi. Er wurde mir wieder so gegen wärtig
wie seinerzeit, als ich mich ihm erstmals als meinem
Heiland anvertraute.
All die lange Zeit hindurch schien Gott mir so fern gewesen
zu sein. Mich bedrückte der Gedanke, dass er sich
wiederum entfernen könnte, obwohl er mir nun so viel
näher schien. Als ich die Versammlung verließ, dachte
ich: »Herr, jetzt habe ich zehn Minuten lang deine Gegenwart
gespürt. Bitt e, verlass mich nicht mehr!«
Ich fuhr nach Hause, und als ich aus dem Auto stieg,
betete ich: »Herr, jetzt haben wir dreißig Minuten lang
in ununterbrochener Gemeinschatt gelebt. Bitt e, verlass
mich nicht!« Bevor ich mich schlafen legte, kniete ich neben
meinem Bett . »Bitt e, sei morgen früh, wenn ich aufwache,
noch bei mir, Herr.«
Am nächsten Morgen war er noch da. Und wir bewältigten
gemeinsam den Tag. Und den nächsten Tag.
34
Und den folgenden. Eine ganze Woche. Den ganzen
Monat.
Mir war, als sei ich ganz allein gewesen in jenen ersten
Monaten in Tucson. Aber der, der versprochen hatte,
allezeit bei mir zu sein, war bei mir gewesen, auch
als ich seine Gegenwart nicht spürte. Gott wunderte sich
gar nicht darüber, dass ich in der »Wüste« gewesen war.
Er selbst hatt e mich dorthin geführt.
Obwohl ich mit den besten Absichten nach Arizona
gegangen war und Gott hatt e folgen wollen, so gut ich
es verstand, begriff ich jetzt, dass ich doch aus eigener
Kratt , auf der Grundlage meiner eigenen Erfolge, mit
meinen eigenen Wünschen und Erwartungen dorthin
gegangen war. Und Gott hatt e mich elendig versagen
lassen, bis ich am liebsten gestorben wäre. Er ließ mich
ganz in die Tiefe sinken.
Aber dann rief ich aus der Tiefe der Verzweifl ung
nach ihm. Und er hörte mich und ließ mich erkennen,
dass es nur einen gab, der ein vollkommenes christliches
Leben führen konnte: Jesus Christus selbst. Als ich
anfi ng, Christus zu bitt en, er möge sein Leben durch
mich leben, begann er in der Kratt des Heiligen Geistes
durch mich das zu tun, was ich selbst nicht hätt e
tun können.
Wenn durch mich irgendetwas erreicht werden sollte,
das Ewigkeitswert hatt e, musste Christus es tun.
Ich glaube, wenn wir Gott unseren Dienst anbieten,
sieht er uns, die wir voller Stolz und Selbstbewusstsein
sind, an und sagt:
Ich habe dich lieb, aber ich muss zuerst an dir abtragen,
was nicht aus meinem Geist ist, damit ich neu autt auen
kann.
Ich muss dir wehtun, damit ich dich heilen kann. Ich sehe,
wie du dich auf deine eigene Kratt verlässt. Ich sehe, wie du
35
dich auf dich selbst stützt. Ich muss dich versagen lassen
– damit du zu mir rufst und dich mit deinem Leben und deiner
Kratt auf mich verlässt.
Ich dachte natürlich, dass Campus für Christus einen
schlimmen Fehler begangen hatt e, als ich ganz allein
nach Tucson geschickt worden war. Doch jetzt wusste
ich, dass Gott mich dorthin geführt hatt e. Mein »Feuerofen«
von Arizona war Gott es Spezialbehandlung, um
meinen Charakter zu läutern. Er wollte mich lehren,
ein Leben aus dem Glauben zu führen. Doch das war
nur der Anfang.
36
37
Aber dein Wort sagt …
Ich goss mir ein Glas eiskalte Limonade ein, holte meinen
Schreibblock hervor, spitzte den Bleistitt an und
setzte mich an mein Bibelstudium. Einige Stunden zuvor
hatt e mir der Lehrer unseres Sommerbibelkurses
ein Thema zur Bearbeitung gegeben.
»Schreiben Sie einen Bericht über alles, was Sie im
Römerbrief über das Thema Glauben fi nden«, hatt e er
mir gesagt. Das klang recht vielversprechend und schien
ziemlich einfach.
Doch ich sollte mich noch wundern.
Als ich durch die Kapitel des Römerbriefes blätt erte,
tauchte das Wort »Glaube« so häufi g auf, dass es fast
nicht zu zählen war. Während ich über das Wort nachdachte,
begann ich mich zu fragen: »Was heißt das überhaupt?
Glaube ist vermutlich das Wichtigste in meinem
Leben, doch wie soll ich erklären, was das ist?«
Meine Gedanken wanderten um acht Jahre zurück
in die Zeit in Tucson, als ich so wenig von dem Leben
aus Glauben verstanden hatt e. »Ich habe so viel dazugelernt«,
dachte ich. Und doch hatt e ich keine klare Antwort
auf die Frage: »Was ist Glauben?«
Ich wusste, dass es unzählige Schritt stellen zum Thema
Glauben gab, zum Beispiel: »Der Gerechte aber wird
aus Glauben leben« (Römer 1,17), oder: »Dies ist der
Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube« (1.
Johannes 5,4). Ich war erstaunt, dass ich keine einfache,
persönliche Defi nition zustande brachte; nie hatt e ich
den Satz zu Ende führen können: »Für mich bedeutet
Glaube …«
Ich dachte: »Herr, wie würdest du ihn defi nieren?«
Mir kam die Geschichte in den Sinn, in der Jesus zu
seinen Jüngern sagte: »Selbst nicht in Israel habe ich so
38
großen Glauben gefunden.« Jetzt wurde ich neugierig.
Was war das, was Jesus selbst als »so großen Glauben«
bezeichnete?
Schnell schlug ich Lukas 7 auf.
Dort fand ich die Geschichte von jenem römischen
Hauptmann, der bereit war zu glauben, dass Jesus seinen
Diener, der im Sterben lag, heilen konnte. Er sagte zu
Jesus: »Sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund
werden« (Lukas 7,7). Dann gebrauchte der Hauptmann
selbst ein Beispiel, um zu zeigen, dass er verstand, was es
bedeutete, wenn jemand beim Wort genommen wird.
Jesus reagierte auf die Worte des Hauptmanns damit,
dass er sich an die ihm nachfolgende Menge wandte und
sprach: »Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so
großen Glauben gefunden« (Lukas 7,9). Mir schien, dass
Jesus mit einem »so großen Glauben« einfach meinte,
man solle ihn beim Wort nehmen.
Ich fragte mich, ob diese »Defi nition« noch irgendwo
anders in der Bibel bestätigt wurde. Weil Hebräer 11
ott als »das Hohelied des Glaubens« bezeichnet wird,
schlug ich dort nach.
Nachdem ich mehrmals alle Abschnitt e gelesen hatt e,
in denen es immer wieder heißt: »Durch Glauben …«,
fand ich schließlich das Gemeinsame all dieser Beispiele
heraus. Ganz gleich, von welchem Menschen der Schreiber
des Hebräerbriefes auch sprach: Jeder hatt e Gott
einfach beim Wort genommen und seinem Gebot gehorcht.
Und wegen ihres Glaubens werden sie in diesem
Kapitel erwähnt.
Da war zum Beispiel Noah, dem Gott sagte, er sollte
die Arche bauen.
Noah nahm Gott beim Wort und baute die Arche.
Darum beginnt Hebräer 11,7 mit den Worten: »Durch
Glauben baute Noah … eine Arche …« Das ganze Ka
39
pitel hindurch scheint es, dass jeder der dort erwähnten
Menschen Gott und seinem Wort glaubte und bereit war,
ihm zu gehorchen, ganz gleich, in welcher Lebenssituation
er sich befand, wie unlogisch Gott es Forderung aussehen
mochte, welche Gründe es dagegen gab – ganz
egal, wie der Mensch sich fühlte.
Nun war meine Hausaufgabe noch viel lohnender
geworden, als ich am Anfang erwartet hatt e. Jetzt fragte
ich mich: »Wenn Lukas 7 und Hebräer 11 Beispiele für
einen großen Glauben sind, wie sieht dann ein Beispiel
für Mangel an Glauben aus?«
Ich erinnerte mich an ein Ereignis in Markus 4, als Jesus
gerade einen ganzen Tag lang an den Ufern des Sees
Genezareth gepredigt und das Volk gelehrt hatt e. Nun
wies er die Jünger an, auf die andere Seite des Sees zu
fahren. Zunächst nahmen sie ihn beim Wort, bestiegen
mit ihm ein Boot und wollten ans andere Ufer fahren.
Aber als ein Sturm autt am, ver loren sie das Vertrauen
in seine Zusage, dass sie wirklich ans andere Ufer gelangen
würden. Als Jesus sie fragte: »Warum seid ihr
furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« (Markus
4,40), hätt e er ebenso gut fragen können: »Warum nehmt
ihr mich nicht beim Wort?«
Sein Wort erwies sich als wahr. Ich bin immer so froh,
wenn ich in Markus 5 die erste Zeile lese: »Und sie kamen
an das jenseitige Ufer des Sees …«
Alles, was ich in diesen Abschnitt en gefunden hatte,
verhalf mir zu einer einfachen, brauchbaren Defi nition
für Glauben. Ich wusste nicht genau, ob ich je einen
Bericht zustande bringen konnte über all das, was
im Römerbrief über den Glauben gesagt wird, aber in
meinem Inneren wusste ich, dass ich etwas gelernt hatte,
was sich für meinen Weg mit Gott als sehr wichtig
erweisen würde.
40
Doch ich hatt e noch eine Frage. Wenn Glauben »Gott
beim Wort nehmen« bedeutet, was sagt dann Gott selbst
über sein Wort? Wieder fand ich die Antwort in der Bibel:
»Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine
Worte aber sollen nicht vergehen« (Matt häus 24,35).
»Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit« (1. Petrus
1,25). »Das Gras ist verdorrt, die Blume ist ver welkt.
Aber das Wort unseres Gott es besteht in Ewigkeit« (Jesaja
40,8).
Aus diesen Versen entnahm ich, dass alles im Leben
sich ändern kann, aber Gott es Wort bleibt bestehen! Seine
Wahrheit ändert sich nie. Ich bekam einen ersten Anfl
ug von Verständnis davon, wie sich dies auf mich und
mein weiteres Leben auswirken könnte.
Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die alles
sehr tief empfi nden. Manchmal bin ich so glücklich,
dass ich meine, ich könnte nie mehr traurig sein. Dann
wieder kommen Zeiten, wo ich so traurig bin, dass ich
meine, ich könnte nie mehr froh werden.
Aber so stark meine Gefühle auch sind, ich war froh,
als ich erkannte:
Gott es Wort ist wahrer als alle meine Gefühle.
Gott es Wort ist wahrer als alle meine Erfahrungen.
Gott es Wort ist wahrer als alle Lebensumstände,
in die ich geraten mag.
Gott es Wort ist wahrer als alles in der Welt.
Warum?
Weil Himmel und Erde vergehen werden, ehe Gottes
Wort vergeht. Das hieß, dass ich – ganz gleich, was
ich fühlte oder erlebte – mich dafür entscheiden konnte,
auf Gott es Wort als der unveränderlichen Wirklichkeit
in meinem Leben zu vertrauen.
Rückblickend wird mir bewusst, dass jener Sommerabend
und jenes »einfache« Studienprojekt ein Wende
41
punkt in meinem Leben waren. Immer und immer wieder
habe ich mich seitdem, wenn die Umstände und
meine Gefühle realer schienen als das Leben selbst, dafür
entschieden zu glauben, dass Gott es Wort wahrer
ist als alles andere. Ich habe mich sozusagen für ein Leben
aus Glauben entschieden. Manchmal war das eine
schwierige Entscheidung.
Zum Beispiel gab es danach Zeiten, in denen ich sagen
konnte: »Ich fühle mich ungeliebt.« Dann hatt e ich
die Wahl, mich auf dieses Gefühl einzulassen und mich
in einen Zustand des Selbstmitleids gleiten zu lassen,
oder ich konnte sagen: »Herr, ich fühle mich ungeliebt.
Das ist wahr. So empfi nde ich im Augenblick. Aber dein
Wort, Herr, sagt, dass du mich liebst. Ja, es sagt: ›Ja, mit
ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dir
meine Güte bewahrt‹ (Jeremia 31,3). Du hörst nie auf,
mich zu lieben. Deine Liebe zu mir bleibt auch dann
bestehen, wenn alles andere zerbricht. Dein Wort sagt,
›dass Gott die Person nicht ansieht‹ (Apostelgeschichte
10,34). Das heißt, du liebst niemanden in der Welt mehr
als mich. Und darum, Herr, danke ich dir jetzt, dass ich
geliebt werde. Und ich entscheide mich dafür weiterzuleben,
weil ich weiß, dass du mich liebst. Dein Wort ist
wahrer als mein augenblickliches Gefühl.«
Allmählich merkte ich, was das Wichtigste daran war,
wenn ich so reagierte: Ich gewann Freiheit. Ich konnte
frei mit Gott reden, ich hatt e die Freiheit, mich zu meinen
Gefühlen zu bekennen, und ich konnte gleichzeitig
an Gott es Wort glauben.
Es gab auch Zeiten, in denen ich mich verlassen, geängstigt
oder niedergeschlagen fühlte. In solchen Zeiten
löste die Qual über die Lebensumstände buchstäblich
Herzschmerzen bei mir aus, und in jenen Augenblicken
war ich am meisten versucht, an der Wahrheit von
42
Gott es Wort zu zweifeln. Doch waren das auch die Situationen,
in denen ich mich mit meinem Willen für den
Glauben an sein Wort entscheiden musste. Tausende
meiner Gebete begannen so: »Herr, ich fühle mich …,
aber, Herr, dein Wort sagt …«
Und ich habe erfahren, dass er meine Gefühle mit
seinem Wort in Einklang bringt, zu seiner Zeit und auf
seine Weise.
Die Bibel verheißt uns, dass alles, was uns, die wir
Gott wirklich lieben, geschieht, sich so auswirken wird,
dass wir »dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein«
werden (Römer 8,29). Einige von uns haben bestimmt
schon das folgende Gebet oder ein ähnliches gesprochen:
»Herr, ich bitt e dich, mach mich dir ähnlicher. Ich
bitt e dich, dass du mich dem Ebenbild Christi gleich
gestaltest.« Ott wünschen wir uns damit von Gott eine
»Narkose«, aus der wir dann eines Tages als ein völlig
in das Ebenbild Christi umgewandelter Charakter erwachen
möchten.
Aber so macht Gott das nicht. Er lässt die Prüfungen,
Versuchungen und Belastungen in unserem Leben zu,
damit wir Gelegenheit haben, auf sie zu reagieren, entweder
nach unserem Gefühl oder indem wir ihn beim
Wort nehmen.
Der Herr sorgt sich um das, was wir durchmachen,
aber ich glaube, er sorgt sich noch viel mehr darum, wie
wir auf das reagieren, was wir durchmachen. Unsere Reaktion
darauf ist Willenssache.
Ich habe gelernt, es mir zur Gewohnheit zu machen,
dass ich Gott beim Wort nehme – und es ist wirklich
eine Gewohnheit! Wir können uns entweder angewöhnen,
auf unsere Gefühle, unsere Überlegungen und die
Lebensumstände zu achten und uns von ihnen beherrschen
zu lassen, oder wir können uns angewöhnen, Gott
43
beim Wort zu nehmen. Wir müssen uns willentlich dafür
entscheiden zu glauben, dass sein Wort wahrer ist
als unsere Gefühle.
Ich habe für mich die Entscheidung getroff en, dass
ich mein Leben auf Gott es Wort gründen will – und Gott
achtet und schätzt diese Entscheidung. Aber dennoch
hat es Zeiten gegeben seit jener Entscheidung, in denen
es viel einfacher schien, sie zurückzunehmen, weil ich
glaubte, nichts könnte realer sein als das, was ich gerade
durchmachte; in solchen Zeiten schrien meine Gefühle
geradezu nach einer Kehrtwendung um 180 Grad
weg von Gott es Wort.
Um ehrlich zu sein: Das kommt sehr häufi g vor …
44
45
Gewissensfragen
An einem strahlenden Morgen im August 1969 machte
ich mich für die Arbeit fertig und hatt e die Nachrichten
eingeschaltet. Zunächst hörte ich nicht richtig zu, dann
aber fesselte die Stimme des Nachrichtensprechers meine
Aufmerksamkeit.
»Gestern kam es im Sinaigebiet zu Kämpfen zwischen
Arabern und Israelis«, gab er bekannt.
Im nächsten Atemzug sagte er: »Der Evangelist Billy
Graham erklärte gestern Abend, seiner Meinung nach
stehe die Wiederkuntt Christi kurz bevor.«
Ich war verblütt . Es schien mir unglaublich, diese
beiden Nachrichten so unmitt elbar nacheinander aus
dem Lautsprecher zu hören. Der Nachrichtensprecher
brachte die beiden Ereignisse nicht miteinander in Verbindung,
aber ich tat es.
Die Worte Jesu aus Matt häus 24 kamen mir in den
Sinn, wo er von den letzten Tagen vor seiner Wiederkuntt
spricht. Er verheißt Krieg und Kriegsgeschrei,
Hungersnöte und Erdbeben und falsche Propheten, die
viele Menschen irreführen werden. Dann sagt er: »Weil
die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der
meisten erkalten« (Matt häus 24,12).
Ich stand da, mitt en im Zimmer, und betete: »Herr,
lass meine Liebe zu dir nicht erkalten! Schenke unserem
Land und unserer Welt eine Erweckung.«
Mir fi el ein alter Studentenspruch ein: »Am Anfang
sind alle Feuer gleich groß.« Und ich betete weiter: »Du
musst irgendwo anfangen, Herr. Fang doch bei mir an.
Schenke meinem Herzen eine Erweckung.«
Noch in derselben Woche wurden dieser Wunsch
und dieses Gebet auf die Probe gestellt.
Während unserer Mitarbeiterkonferenz im Sommer
46
in Arrowhead Springs, der internationalen Zen trale unserer
Bewegung, sprach ein Gastredner. Als Thema hatte
er gewählt: »Wie wichtig es ist, sich ein reines Gewissen
zu bewahren«.
Er sagte, wir müssten so leben, dass weder Gott noch
Menschen Grund hätt en, mit dem Finger auf uns zu zeigen
und uns anzuklagen: »Du hast mich gekränkt und
nie versucht, die Sache in Ordnung zu bringen.« Er zitierte
das Wort des Apostels Paulus: »Darum übe ich mich
auch, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor
Gott und den Menschen« (Apostelgeschichte 24,16).
Und, sagte er weiter, Paulus warne Timotheus in
seinem ersten Brief an ihn: »… damit du … den guten
Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und
ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und
so im Hinblick auf den Glauben Schitt ruch erlitt en haben«
(1. Timotheus 1,18b-19).
Unser Gastredner ermahnte uns, bei der Prüfung unseres
Gewissens unsere Gedanken nicht zu sehr auf unser
Inneres zu richten. Denn wenn in unserer Beziehung
zu Gott und Menschen etwas zu berichtigen sei, komme
es in unseren Gedanken mühelos an die Oberfl äche.
Bis zu dieser Ansprache hatt e ich darüber nie weiter
nachgedacht. Aber jetzt kamen mir auf Anhieb drei Dinge
klar und unmissverständlich in den Sinn.
Ich schluckte.
»Nein, Herr. Das nicht! Und das …, und das auch
nicht! Du kannst doch unmöglich meinen, dass ich das
in Angriff nehmen soll!?«
Sogleich hörte ich die Mahnung einer inneren Stimme.
»Ney, war es dir ernst, als du sagtest, die Erweckung
solle bei dir beginnen?«
»Ja.«
47
»Ist dir wichtiger, was die Leute von dir denken oder
was ich von dir denke?«
»Mir ist wichtiger, was du von mir denkst.«
»Ney, bist du bereit, diese Dinge in Ordnung zu bringen?«
»Ja, Herr, ich bin bereit.«
Die erste Sache, an die ich mich erinnerte, hatt e mit
meiner Kratt fahrzeugversicherung zu tun. Ich war 1963
von Tucson nach Arrowhead Springs umgezogen, um
die Personalabteilung von Campus für Christus aufzubauen.
Ich hatt e auf dem Gelände von Arrowhead
Springs, unserer Zentrale, gewohnt und dorthin auch
all meine Post erhalten.
Jedes Mal, wenn meine Autoversicherung fällig war,
bekam ich eine Zahlungsauff orderung und ein Schreiben,
auf dem ich durch meine Unterschritt bestätigen
musste, dass die Informationen, die bei der Versicherung
über mich vorlagen, noch stimmten. Die letzte Zeile
über der Unterschritt lautete: »Ich fahre wöchentlich
nicht mehr als sechzig Kilometer zur Arbeit.« Das traf
auf mich zu – bis ich in die Berge, etwa dreißig Kilometer
oberhalb von Arrowhead Springs, hinaufgezogen
war. Damit fuhr ich wöchentlich rund dreihundert Kilometer
zur Arbeit und zurück.
Nach meinem Umzug war das Schreiben noch einmal
an mein Büro in Arrowhead Springs geschickt worden.
Ich wollte gerade unterschreiben und alle Daten als richtig
bestätigen, als ich den Satz über die sechzig Kilometer
las. Ich las ihn noch einmal: »Ich fahre wöchentlich
nicht mehr als sechzig Kilometer zur Arbeit.«
Mein Verstand arbeitete schnell.
»Meine Post kommt immer noch hierher nach Arrowhead
Springs«, sagte ich mir. »Schließlich weiß die
Versicherung nicht, dass ich umgezogen bin, und wenn
48
sie es erfährt, wird sie wahrscheinlich meine Prämie erhöhen
… Ich glaube, ich unterschreibe den Wisch einfach
und schicke ihn zurück.«
Ein halbes Jahr später war wieder eine Rechnung gekommen
und wieder so ein Schreiben. Wieder hatt e ich
unterschrieben.
Jetzt, nachdem ich diese Ansprache gehört hatt e,
wuss te ich, was ich zu tun hatt e. Mir wurde mulmig in
der Magengegend bei dem Gedanken, dass ich den Versicherungsbeamten
vor Ort aufzusuchen hatt e, um ihm
mein Vergehen einzugestehen. Aber tags darauf war ich
doch unterwegs.
Noch nie zuvor hatt e ich etwas Derartiges getan. Meine
Hände waren kalt und feucht, als ich mein Auto vor
dem renovierten Gebäude aus den 1920er Jahren parkte,
in dem sich das Versicherungsbüro befand. Langsam
und zögernd ging ich hinein.
Ein paar Leute standen schon da und warteten, als ich
durch die Tür kam. Der zuständige Beamte, Herr Blevins,
sah auf und sagte freundlich und lächelnd: »Was
kann ich für Sie tun?« Mir sank der Mut. Ich wollte doch
nicht vor aller Welt meine Geschichte erzählen.
»Schon gut«, meinte ich zögernd. »Ich kann warten.
Ich möchte Sie gern allein sprechen.«
Als alle gegangen waren, winkte er mir, ihm in sein
Büro zu folgen.
Ich setzte mich und schluckte. Mir stand der Schweiß
auf der Stirn.
»Also, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
»Herr Blevins, Sie werden meinen Besuch vermutlich
recht ungewöhnlich fi nden.« Ich erklärte ihm, was
ich getan hatt e, dass ich meinen Fehler einsah und gekommen
war, um die Sache in Ordnung zu bringen und
nachzuzahlen, was ich schuldete.
49
Er hörte mir aufmerksam zu. Als ich fertig war,
schimmerte es feucht in seinen Augen.
»Danke, dass Sie mir das alles gesagt haben«, meinte
er. »Doch wir gehen davon aus, dass manche Leute
zu viel, andere zu wenig zahlen, darum dürfen Sie die
Sache als erledigt betrachten.«
Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte.
»Wirklich?«, fragte ich. »Ich bin wirklich gern bereit
zu bezahlen, was ich schulde.«
»Nein«, antwortete er. »Das ist ganz und gar nicht nötig.
Sie müssen nichts zahlen. Aber ich freue mich sehr,
dass Sie gekommen sind. Übrigens, sind Sie nicht Mitarbeiterin
bei Campus für Christus?«
»Doch, das bin ich.«
Anteil nehmend fragte er: »Wie geht’s Ken Verven?
Ich habe ihn lange nicht gesehen.«
»Es geht ihm gut.« Wir sprachen noch eine Weile
über Christus und unseren gemeinsamen Glauben an
ihn. Dann verabschiedete ich mich und bedankte mich
für sein Verständnis und die Zeit, die er sich für mich
genommen hatt e.
Eine Woge von Gefühlen überkam mich, als ich in
die Nachmitt agssonne hinaustrat; es waren Gefühle der
Freude und der Erleichterung, verbunden mit einer tiefen
inneren Zufriedenheit. Ich hatt e eine Sache in Ordnung
gebracht, hatt e Falsches richtiggestellt. Ich hatt e
überhaupt keine Ahnung gehabt, wie Gott alles »richtig«
machen würde. »Herr, ich danke dir«, betete ich.
»Danke, dass du vor mir hergegangen bist und alles
vorbereitet hast.«
Die zweite Sache, um die es ging, war ein Darlehen,
über das ich vor kurzem mit der Bank verhandelt hatte.
Ich wollte Aktien kaufen, die gerade günstig waren.
Der Vater eines Freundes hatt e eine neue Gesellschatt
50
gegründet, die ein Riesenerfolg zu werden versprach,
und ich hielt es für ein Vorrecht, dass ich gleich zu Beginn
an diesem Unternehmen teilhaben sollte.
Dies war eine unwahrscheinlich gute Gelegenheit,
sich einen »Sparstrumpf« für die Zukuntt anzulegen,
dachte ich. Ich träumte von vielen Dingen, die ich für
mich und für andere würde kaufen können, wenn die
Aktien einen Riesengewinn abwarfen. Bestimmt war
dies das Geschätt des Jahrhunderts!
Da ich jedoch kein Geld hatt e, um Aktien zu kaufen,
beschloss ich, tausend Dollar von meiner Bank zu leihen.
Mein Auto war fast abbezahlt, und ich wusste, dass es
als Sicherheit für das Darlehen gelten konnte.
Als ich die Formulare bei der Bank ausfüllte, erwähnte
ich nicht, dass ich das Geld für den Kauf von Wertpapieren
haben wollte. Ich meinte nämlich, gehört zu
haben, dass die Banken es nicht gern sahen, wenn man
Geld lieh, um damit in Aktien zu spekulieren. Also gab
ich als Begründung für den Antrag an: »Kleidung, Urlaub
und Verschiedenes«.
Kaum war das Darlehen genehmigt, eilte ich in die
Stadt zu einem bekannten Maklerbüro, um meine Papiere
zu kaufen. Sie hatt en die Aktien nicht in ihren
Lis ten. Ein Anlageberater, mit dem ich dort sprach,
riet mir vom Kauf ab und machte mir Alternativvorschläge.
Aber ich war entschlossen, die Aktien zu kaufen. Ich
hatt e den Prospekt gelesen, und bald musste die ganze
Welt von dieser erfolgreichen Organisation erfahren.
Ich rief einen Anlageberater in der Stadt an, in der die
Gesellschatt ihren Sitz hatt e, und er verkautt e mir die
Aktien für 1,75 Dollar das Stück. Bald stiegen sie auf
2,50 Dollar an, dann auf 3,00 Dollar und sogar bis auf
4,00 Dollar das Stück. Ich war begeistert.
51
Eineinhalb Wochen später erhielt ich die Mitt eilung
von meiner Gesellschatt , dass sie durch die Behörde für
Vermögens- und Anlagenkontrolle überprütt worden
war. Die Behörde hatt e angeordnet, dass die Aktien sofort
aus dem Verkehr gezogen werden mussten. In der
Mitt eilung wurde mir versichert, dies sei nur vorübergehend,
und die Gesellschatt werde sehr bald wieder wett -
bewerbsfähig sein. Doch sie erholte sich nie mehr.
Nun musste ich nicht nur ein Darlehen zurückzahlen,
das sich als fi nanzieller Verlust für mich erwies, sondern
ich erfuhr auch, dass es tatsächlich ungesetzlich
war, Geld zum Ankauf von Aktien zu leihen.
Wiederum hatt e ich einen Fehler in Ordnung zu bringen.
Ich suchte bei meiner Bank die Darlehensberaterin
auf und erzählte ihr meine Geschichte. Obwohl meine
Aktien bereits vor sechs Monaten wertlos geworden
waren, zeigte sie sich, ebenso wie vorher Herr Blevins
bei der Sache mit meiner Autoversicherung, erstaunlich
mitfühlend und verständnisvoll. Sie meinte, ich hätt e
wahrscheinlich eine heilsame, wenn auch kostspie lige
Lektion erhalten – und wollte mir keinerlei Strafen auferlegen.
Und als sie erfuhr, dass ich vorhatt e, bald nach
Texas zu ziehen, gab sie mir ihre Visitenkarte und meinte,
sie könnte mir nützlich sein, wenn ich dort ein Konto
eröff nen wollte. Sie bot mir jede nur mögliche Hilfe
an und wollte sogar als Referenz für weitere fi nan zielle
Geschätt e für mich fungieren.
Als ich ihr Büro verließ, war ich froh gestimmt und
voller Dank gegenüber Gott für alles, was er getan hatte.
Einige Zeit später erst stieß ich auf die Verse in den
Sprüchen: »…aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel.
Erwerb von Schätzen durch eine lügnerische Zun
52
ge ist wie verwehter Dunst, eine Falle des Todes« (Sprüche
21,5-6).
Das dritt e »Geständnis« war für mich wohl das
schwie rigste.
Campus für Christus begann 1962 damit, für die Mitarbeiter
Bibelstudienkonferenzen abzuhalten, um ihnen
ein gutes Bibelwissen zu ermöglichen. In jenem Jahr hatte
ich einen Kurs über das Johannesevangelium belegt.
Als Abschlussprüfung des Kurses bekamen wir einen
Fragebogen mit nach Hause, den wir, ohne in der Bibel
nachzuschlagen, ausfüllen sollten. Man vertraute auf
unsere Ehrlichkeit.
Ich erinnere mich noch deutlich an den Nachmitt ag,
als ich den Test machte. Ich saß auf einem der oberen
Bett en in meinem kleinen Zimmer und ging die Fragen
durch. Ich stieß auf eine Frage, die eigentlich ganz einfach
klang, aber ich kam einfach nicht auf die Antwort.
Ich war überzeugt, die Antwort zu wissen, aber in dem
Augenblick wäre sie mir um alles in der Welt nicht eingefallen.
Ich überlegte: »Ich brauche nur einen kleinen Tipp,
nur einen Anstoß, damit mein Gehirn wieder funktioniert.«
Als ich alle anderen Fragen beantwortet hatt e,
wandte ich mich noch einmal der ungelösten Frage zu.
Die Antwort fi el mir noch immer nicht ein.
Nun begann ein innerer Kampf. Sollte ich …, oder
sollte ich nicht? Ich überlegte hin und her. Schließlich
gab ich nach. Ich schlug ganz schnell meine Bibel auf
und ebenso schnell wieder zu. Aber es hatt e genügt, um
mir den notwendigen Hinweis auf die Antwort zu der
Frage zu geben.
Ich hatt e nicht wirklich betrogen, dachte ich, als ich
den Test abgab. Im Grunde wusste ich die Antwort und
brauchte nur eine kleine Hilfe, um mich zu erinnern.
53
Aber ganz allmählich legte sich an jenem Tag eine Last
auf mich, die auch in den folgenden Tagen nicht von
mir wich. Immer wieder bekannte ich Gott meine Sünde,
aber mein Schuldgefühl verschwand nicht. Es wurde
mir schwer, überhaupt im Johannesevangelium zu
lesen, und die Seite, von der ich mir den Tipp gestohlen
hatt e, konnte ich schon gar nicht aufschlagen.
Im Lauf der Zeit vergingen meine Schuldgefühle …,
bis auf seltene Gelegenheiten, wenn ich durch irgendetwas
daran erinnert wurde. Jetzt, nach sieben Jahren,
kam die Erinnerung wieder hoch; meine Schuld kam
laut und deutlich zum Vorschein wie das Dröhnen einer
Glocke.
Ich wusste: Diesmal ging es wirklich um meinen guten
Ruf bei Menschen. Es war schon schlimm genug,
überhaupt bei einem Test zu betrügen. Aber auch noch
bei einem Bibeltest! Es war ekelhatt , nur daran zu denken!
Wieder stellte sich mir die Frage: Ist mir mein Ruf
bei den Leuten wichtiger als mein Ruf bei Gott ? War ich
wirklich gewillt, das Rechte zu tun?
Ich wusste, dass es mir diesmal schwerer fallen würde,
meine Schuld zu bekennen, als die beiden anderen
Male. Ob ich den Versicherungsbeamten oder die
Bankangestellte je wiedersah, war ziemlich ungewiss.
Aber jetzt musste ich meinem Bibellehrer von damals,
einem Mitarbeiter unserer Bewegung, meinen Betrug
eingestehen …
In jenem Sommer kamen wir Mitarbeiter zu einem
Picknick in einem sehr schönen Park in Riverside, Kalifornien,
zusammen. Es war ein herrlicher Tag, und
es herrschte eine festliche Stimmung, als ich ankam.
Aber ich hatt e überhaupt keine Lust, mich an den Spielen
zu beteiligen, die überall statt fanden. Ich dachte an
den Test.
54
Ich nahm mir vor, falls ich mit Ted Martin, dem Leiter
unserer Bibelstudienkonferenzen, zusammentreff en
würde, ihm die ganze Sache zu erzählen. Doch bald war
ich in entgegengesetzter Richtung unterwegs zum anderen
Ende des Parks, weg von allen anderen, und als
ich ein stilles Fleckchen an einem Bach fand, setzte ich
mich dort an einen Holztisch. Minutenlang starrte ich
auf die Tischplatt e, dann auf die Bäume.
In dem Augenblick hörte ich Schritt e über die nur
wenige Meter von mir entfernte hölzerne Brücke kommen.
Ich wandte mich um. Sah ich Gespenster, oder war
es Wirklichkeit? Dr. Martin, seine Frau Gwen und ihre
vier Kinder kamen über die Brücke und steuerten auf
mich zu. Ich sah keine Gespenster.
Die Familie kam zu mir an den Tisch und begrüßte
mich: »Guten Tag, Ney!« Dr. Martin lächelte. »Was
machst du denn so weit hier hinten?«
»Ich denke ein wenig nach. Seid ihr auf dem Weg
zum Picknick?«
Dr. Martin antwortete: »Ja, wir haben einen Rundgang
gemacht, und jetzt gehen wir zurück.«
Die Familie wollte wieder gehen, aber ich wusste,
jetzt hatt e ich meine Sache zu bereinigen.
»Ted«, sagte ich zögernd, »könnte ich dich ein paar
Minuten sprechen, bevor du zurückgehst?«
»Aber sicher«, sagte er, während die übrige Familie
schon zum Picknickplatz vorausging.
Mit zitt ernder Stimme begann ich: »Ted, vor sieben
Jahren hat sich etwas zugetragen, was ich dir berichten
muss.« Ich erzählte ihm, was geschehen war, und
sagte zum Schluss, dass ich wüsste, was ich verkehrt
gemacht hätt e und bereit sei, mit dem Lehrer zu sprechen,
der damals den Kurs gehalten hatt e, um alles in
Ordnung zu bringen.
55
»Nein«, antwortete Dr. Martin verständnisvoll, »es
genügt, dass du mit mir gesprochen hast.«
Dann meinte er: »Ney, wir wissen, dass solche Dinge
von Zeit zu Zeit vorkommen. Aber du bist die Erste,
die es jemals zugegeben hat. Ich denke, du hast genug
darunter gelitt en. Du darfst es nun auf sich beruhen
lassen.«
Ich war sehr dankbar für seine Freundlichkeit, und
als er wegging, kam ich mir vor, als könnte ich mich mit
Leichtigkeit den Vögeln in den Zweigen über mir anschließen.
Mir war eine solche Last abgenommen, dass
ich am liebsten mit Lob- und Dankliedern auf den Lippen
zu dem Picknick hinübergehüptt wäre.
Rückblickend scheint es mir, dass ich unerhörtes
Glück hatt e, weil alle, denen ich Schuld einzugestehen
hatt e, mir so viel Verständnis entgegenbrachten. Allerdings
konnte ich vorher nicht wissen, wie die Leute reagieren
würden. Mein Versicherungsmann hätt e sagen
können: »Sie schulden mir einige hundert Dollar
plus Strafgebühren und Verzugszinsen.« Oder die Bankangestellte
hätt e antworten können: »Tut mir leid, aber
wir müssen gerichtliche Schritt e gegen Sie einleiten und
Anklage erheben. Sie werden mit einer beträchtlichen
Geldstrafe und möglicherweise einer Gefängnisstrafe
rechnen müssen.«
Und Dr. Martin hätt e durchaus antworten können:
»Tut mir leid, aber du musst den Kurs noch einmal machen.«
Doch ganz gleich, wie sie reagierten, ich hatt e
den Entschluss fassen müssen, alles in Ordnung zu bringen.
Die Frage, ob Vergehen in Ordnung gebracht werden
müssen, hat nichts mit ihrem Ausmaß zu tun. Die
Anlässe mögen anderen vielleicht geringfügig erscheinen.
Hätt e ich eine Bank ausgeraubt, einen Diebstahl be
56
gangen oder jemanden mit der Pistole bedroht, hätt e ich
mich zweifellos irgendwann für mein Tun rechtfertigen
müssen. Aber auch wenn meine Vergehen vergleichsweise
geringfügig waren, musste ich mich bemühen, die
Dinge wieder ins Reine zu bringen.
Die Erneuerung in mir hatt e begonnen. Mein Gewissen
war in jeder Beziehung rein, soweit ich es beurteilen
konnte …, oder etwa nicht?
Es gab noch etwas, das ich vergessen hatt e.
57
Ein verändertes Herz
Gestern klingelte das Telefon. Meine Mutt er rief an.
»Liebling, diese Woche habe ich mich mit deinem Vater
unterhalten, und er sagte, wie stolz er auf jedes unserer
Kinder sei. ›Ich kann ihnen das nicht selbst sagen‹,
meinte er, ›aber ich möchte, dass du sie alle anrufst und
ihnen sagst, wie stolz ich auf sie bin.‹«
Dieses Telefongespräch war ungeheuer wichtig für
mich.
»Mutt er, hat er das wirklich gesagt?«
»Ja, das hat er.«
»Wiederholst du mir bitt e genau, was er gesagt hat?
Lass auch kein Wort aus.«
»Dein Vater hat mich gebeten, dich anzurufen und
dir zu sagen, wie stolz er auf dich ist.«
»Mutt er, sagst du das bitt e noch einmal?«
»Dein Vater hat mich gebeten, dich anzurufen und
dir zu sagen, wie stolz er auf dich ist.«
»Sag ihm bitt e meinen herzlichen Dank, und dass er
mir damit das schönste Geschenk gemacht hat, das ich
je bekommen habe.«
Mein Herz jubelte, als ich den Hörer aufl egte. Und
dazu hatt e es begründeten Anlass, denn die Dinge standen
nicht immer so.
Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich sechs Jahre alt
war. Ich war kaum einen Meter groß und stand im städtischen
Schwimmbad am Rand des Beckens.
»Spring, Ney Ann!«, rief mir mein Vater zu und
streckte die Arme aus. »Ich fang dich auf!«
Dort, wo er im Becken stand, ging mir das Wasser bis
über den Kopf. Ich hatt e schreckliche Angst. Zitt ernd
rief ich: »Nein, das kann ich nicht!«
58
»Natürlich kannst du’s«, rief er. »Spring, und ich fange
dich auf!«
Schließlich sprang ich. Aber mein Vater war nicht da.
Das Wasser schlug über meinem Kopf zusammen, und
ich kam prustend und wild um mich schlagend wieder
an die Oberfl äche. Mein Vater war im Wasser etwas zurückgegangen
in der Hoff nung, ich werde auf ihn zuschwimmen.
Ich fi ng an zu weinen.
»Vati, du bist nicht stehen geblieben! Du hast doch
versprochen, du fängst mich auf!«
Er lachte. »Ney Ann, du regst dich unnötig auf. Du
weißt doch, ich lasse dir nichts zustoßen. Ich wollte dir
nur das Schwimmen beibringen.«
Dieses Erlebnis hatt e eine vernichtende Wirkung auf
mein kindliches Gemüt. Ich hatt e meinem Vater so viel
Ver trauen entgegengebracht, wie mein kleines Herz nur
autt ringen konnte. Vati hatt e gesagt, er würde mich auffangen,
aber er hatt e es nicht getan. Er hatt e mich betrogen.
Diese Erfahrung prägte maßgeblich meine Gefühle
ihm gegenüber, als ich älter wurde. Ich begann zu erfassen,
dass uns diejenigen am meisten verletzen können,
die wir am meisten lieben, was ott gestörte Beziehungen
innerhalb unserer Familien zur Folge hat. Und
ott gibt es nichts Schwierigeres, als diese gestörten Beziehungen
wieder zu heilen.
Es gab noch andere Erlebnisse, die meine negativen
Ge fühle und meine Verbitt erung gegen meinen Vater
schürten. Sie schlugen immer tiefere Wurzeln und
waren schließlich voll ausgewachsen, als ich zur Universität
ging.
Erst nachdem ich von Arizona nach Kalifornien
um gezogen war, um die Personalabteilung von Campus
für Christus aufzubauen, kam ich innerlich an
59
einen Wendepunkt, von dem ich nicht einmal wusste,
dass ich ihn nötig hatt e.
Ich war bei einer Veranstaltung, in der jemand aus
unserer Mitarbeiterschatt Dinge sagte, die ich noch nie
gehört hatt e. Ich wusste, dass die Bibel sagt: »Gott ist Liebe«
(1. Johannes 4,16). Ich wusste auch, dass 1. Korinther
13 ausführlich beschreibt, was Liebe ist. Der Redner aber
sagte etwas, das für mich wie ein Sonnenstrahl in einen
lange verschlossenen Kerker fi el: »Wenn Gott Liebe ist
und 1. Korinther 13 uns sagt, wie diese Liebe ist, dann
liebt Gott Sie und mich mit ebendieser Liebe.«
Das war mir ganz neu.
Ich hatt e immer gehört, dass ich andere Leute so lieben
sollte, wie es in 1. Korinther 13 stand. Mir war sogar
vorgeschlagen worden, ich sollte meine Liebe zu anderen
dadurch überprüfen, dass ich immer an die Stelle
des Wortes »Liebe« meinen Namen setzte. Diese Überprüfung
fi el immer schlecht für mich aus! Aber anstelle
des Wortes »Liebe« den Namen Gott es einzusetzen,
war mir nie in den Sinn gekommen.
Nun entdeckte ich:
Gott es Liebe zu mir ist langmütig,
Gott es Liebe zu mir ist gütig,
Gott es Liebe zu mir lässt sich nicht erbitt ern,
Gott es Liebe zu mir rechnet Böses nicht zu,
Gott es Liebe zu mir erträgt alles,
sie glaubt alles,
sie hott alles,
sie erduldet alles.
Gott es Liebe zu mir vergeht niemals.
Ich war überwältigt, als ich mir vor Augen hielt, dass
Gott mich mit einer solchen Liebe liebt.
Als ich an jenem Abend nach Hause fuhr, fi ng ich
an, über meinen Vater nachzudenken. Ich dachte dar
60
an, wie schlecht wir uns meistens verstanden hatt en
während meiner Kinder- und Jugendzeit. Ich wusste
zwar, dass es für einen Teenager nicht ungewöhnlich
war, Konfl ikte mit den Eltern zu haben. Das war ganz
normal. Aber die Schwierigkeiten, die es zwischen mir
und meinem Vater gab, schienen viel gravierender zu
sein als die üblichen.
Ich dachte zurück an die ersten Jahre meines Lebens,
als mein Vater sich noch mit seinem Jurastudium abgerackert
hatt e. Es waren die Jahre nach der Wirtschatt skrise;
er studierte täglich viele Stunden lang und arbeitete
noch nebenher, damit wir genug zum Leben hatt en.
Er konnte sich für mich nur sehr wenig Zeit nehmen,
und als ich in die Schule kam, hatt en wir kaum eine Beziehung
zueinander. Folglich hatt e meine Mutt er einen
weitaus größeren Einfl uss auf mein Leben, und ich hing
außerordentlich stark an ihr.
Im Lauf der Jahre begann ich, mich vor meinem Vater
zu fürchten. Wenn er gegen meine Mutt er oder gegen
mich die Stimme erhob, fi ng etwas in mir an zu zittern.
Diese Furcht schlug während meiner Teenagerzeit
in Feindseligkeit um. Die Väter meiner Freunde schienen
sich für ihre Kinder zu interessieren und für die
Zeugnisse, die sie bekamen, aber mein eigener Vater
war, wie ich meinte, so sehr mit seinen eigenen Interessen
beschätt igt, dass es ihm ganz egal war, was aus mir
wurde. Ich wusste, dass er seine Arbeit liebte, aber ich
hatt e off enbar keine Bedeutung für ihn.
In späteren Jahren wurde aus meiner Feindseligkeit
eine unterschwellige Aufl ehnung. Ich dachte: »Geh du
deinen Weg, und ich gehe meinen. Lässt du mich in
Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe.« Wenn mein
Vater mich anbrüllte, hätt e ich am liebsten zurückgeschrien.
Wenn er mich nicht beachtete, ließ ich ihn auch
61
links liegen. Wenn er mir wehtat, versuchte ich, ihn auch
zu verletzen. Ich wollte ihm geben, was er meiner Meinung
nach verdiente.
Ich musste daran denken, wie schlecht wir uns verständigen
konnten, und es schien, dass er seine Liebe
mir gegenüber nur durch materielle Dinge ausdrücken
konnte. Ich spürte seine Liebe nicht und fragte mich, ob
sie überhaupt vorhanden war.
All die Jahre hindurch wartete ich darauf, dass er
mich so liebte, wie ich geliebt werden wollte. Das war
nie geschehen, und es hatt e meinen Hass und meine Ablehnung
nur vergrößert.
Dann hörte ich die Botschatt von Gott es Liebe. Wenn
Gott Liebe ist und 1. Korinther 13 Gott es Liebe beschreibt,
dann bedeutet das:
Gott es Liebe zu meinem Vater ist langmütig,
Gott es Liebe zu meinem Vater ist gütig,
Gott es Liebe zu meinem Vater lässt sich nicht
erbitt ern,
Gott es Liebe zu meinem Vater rechnet Böses
nicht zu,
Gott es Liebe zu meinem Vater erträgt alles,
sie glaubt alles,
sie hott alles,
sie erduldet alles.
Gott es Liebe zu meinem Vater vergeht niemals.
Ich überlegte: »Wenn Gott meinen Vater genau so
liebt, wie er ist, wie komme ich dann dazu, ihn nicht
auch so zu lieben?« Ich hatt e meine Liebe zu ihm an
Bedingungen geknüptt , hatt e sie von seinem Verhalten
abhängig gemacht. Ich hatt e darauf gewartet, dass
er sich ändern würde. Tat er es, wollte ich anfangen,
ihn zu lieben.
Ich in meiner Liebe hatt e gesagt: »Vati, ich will dich
62
lieben, wenn du dies und wenn du jenes tust.« Aber Gott
in seiner Liebe sagte einfach: »Ich liebe dich – Punkt.«
Bei ihm gab es kein »Wenn« und »Aber«. Mir war, als
sagte Gott zu mir:
»Ich liebe dich so, wie du bist …
Ich liebe ihn so, wie er ist …
Ich möchte, dass du ihn auch so liebst, wie er ist …«
Tränen liefen mir über das Gesicht, als ich die Straße
zu meiner Wohnung in den Bergen hinauff uhr. Zum
ersten Mal in meinem Leben beschloss ich, meinen Vater
so zu nehmen, wie er war. Als ich über seine Herkuntt
und seine Kindheit nachdachte, wurde mir klar,
dass er mir nur das hatt e geben können, was er selbst
mitbekommen hatt e.
Mein Vater war ein Einzelkind und wuchs in einer
kleinen Stadt nördlich von Shreveport in Louisiana auf.
Schon als er noch sehr klein war, hatt en seine Eltern Eheprobleme,
und bald trennten sie sich und ließen sich
scheiden. Er blieb bei seiner Mutt er. Sie starb, als er dreizehn
Jahre alt war. Das war ein großer Verlust für einen
kleinen Jungen.
Mein Vater lebte von da an bei einer Tante und einem
Onkel. In jener Zeit war sein Vater fast ständig unterwegs;
er spekulierte in Öl und Aktien, und manchmal
verdiente, manchmal verlor er Summen, die in die Tausende
gingen. Sehr selten bestand die Liebe, die er seinem
Sohn gegenüber äußerte, in Worten oder in Gefühlen.
Meistens versuchte er dem Sohn seine Fürsorge
dadurch zu zeigen, dass er ihm Geschenke kautt e und
ihn gelegentlich auf eine Reise mitnahm. Ich konnte sehen,
wie sich Jahre später dieses Verhalten bei meinem
Vater seiner eigenen Familie gegenüber wiederholte.
Meine Mutt er dagegen war die jüngste von vier
Schwestern und wuchs auf einer Farm in der kleinen
63
Ortschatt Jet im äußersten Zipfel von Oklahoma auf,
wo ihre Eltern das Land urbar gemacht hatt en. Ihre Familie
zeichnete sich durch Liebe und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl
aus. Sie unternahmen alles
gemeinsam: die tägliche Arbeit auf der Farm, die
Gestaltung ihrer Freizeit, die Erntearbeit und auch den
Gang zur Kirche.
In der Familie meiner Mutt er fehlte es nicht an gegenseitigen
Liebesbezeigungen; sie waren alle sehr zärtlich
miteinander und umarmten und küssten sich gern.
Und Mutt er setzte dieses Verhalten in ihrer eigenen Familie
fort. Sie führte genau Tagebuch über meine ersten
drei Lebensjahre, bis mein Bruder und meine Schwester,
die Zwillinge, geboren wurden. Sie schrieb auf, was
ich tat, was ich aß, kleine Aussprüche von mir und wie
viel ich wog. Überallhin begleitete sie mich, immer hatte
sie aufmunternde Worte bereit für alles, was ich tat,
und war es auch noch so geringfügig.
Als Kind erklärte ich mir all diese Unterschiede zwischen
meinen Eltern so, dass ich meinte: »Mutt er liebt
mich, aber Vater nicht.« Doch nun erkannte ich, dass sie
mich beide nach bestem Vermögen liebten, jeder entsprechend
seiner Herkuntt und seinen Möglichkeiten.
Als ich mein Auto vor dem Haus abstellte, war ich
dankbar, dass ich dieses neue Verständnis gewinnen
durtt e. Mir war, als hätt e Gott in meinem Leben etwas
erneuert. Aber ich wusste, dass die wirkliche Prüfung
noch ausstand.
Zwei Monate später fl og ich in die Ferien zu meiner
Familie nach Louisiana, und noch immer erfüllten mich
Liebe und Aufgeschlossenheit gegenüber meinem Vater.
Ich war nun wirklich frei davon, ihn kritisieren oder direkt
oder indirekt mein Missfallen ihm gegenüber äußern
zu müssen.
64
Ganz besonders an einen Tag erinnere ich mich
noch. Wir saßen zusammen im Wohnzimmer, ich auf
der Couch und Vater in seinem Liegesessel vor dem
Fernseher. Bald schlief er ein. Ich sah zu ihm hinüber
und betrachtete ihn lange, wie er so in seinem Sessel
lag, und dann fl üsterte ich sehr leise: »Vati, ich liebe
dich und nehme dich so, wie du bist …, wie du da im
Sessel sitzt.«
Im Lauf der nächsten Tage ereignete sich etwas Seltsames.
Als er spürte, dass ich ihn akzeptierte, begann
er mit Herzlichkeit darauf zu reagieren. Er schien auf
einmal mehr Wert darauf zu legen, diese und jene Kleinigkeit
für mich zu tun. Zum Beispiel ging er mit mir
zum Arzt, als ich mich einer kleinen Operation unterziehen
musste. Er wartete auf mich und kautt e dann in
der nächsten Apotheke die Medizin, die ich verschrieben
bekam. In der Nähe seiner Anwaltskanzlei war ein
Modegeschätt ; er ließ sich drei Kleider mitgeben, von
denen ich mir aussuchen konnte, was mir gefi el.
Gott hatt e begonnen, unsere Beziehung zu heilen!
Bald stieß ich in der Bibel auf Verse, in denen von
den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern die Rede
war.
»Er erwählte für uns unser Erbe« (Psalm 47,5), und
er erschuf uns: »Denn du bildetest meine Nieren. Du
wobst mich in meiner Mutt er Leib« (Psalm 139,13).
Und: »Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,
von dem jede Vaterschatt in den Himmeln und
auf Erden benannt wird« (Epheser 3,14-15). Gott hatte
mir meine Eltern ausgewählt! Er war nicht erstaunt
darüber, dass ich gerade in diese Familie hineingeboren
wurde. Als mir dies klar wurde, konnte ich
Gott zum ersten Mal in meinem Leben für meine
Eltern danken.
65
Erst einige Jahre später stieß ich auf den folgenden
Vers aus dem Epheserbrief: »›Ehre deinen Vater und deine
Mutt er!‹ – das ist das erste Gebot mit Verheißung –
›damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde‹«
(Epheser 6,2-3). Ich stellte fest, dass das Wort »ehren«
»kostbar erachten, rühmen, schätzen« bedeutet.
Ich betete: »Herr, zeigst du mir bitt e, wie ich meine
Eltern ehren kann? Ich möchte es wirklich tun. Schenkst
du mir Ideen und zeigst du mir, was ich tun kann?« Gott
erhörte mein Gebet auf ganz konkrete Weise.
Wenn ich zu Besuch nach Hause kam, war ich normalerweise
ständig unterwegs, um alle meine Freunde
wiederzusehen, und verbrachte nur wenig Zeit zu
Hause. Als Antwort auf mein Gebet war einer meiner
ersten Gedanken, dass ich bei meinem nächsten Besuch
auch einige Zeit zu Hause verbringen und mich auf
irgendeine Weise meinen Eltern widmen wollte, bevor
ich daranging, meine Freunde zu besuchen.
Bei einem meiner Besuche fi el mir, kurz nachdem
ich angekommen war, auf, dass die Schlafzimmermöbel
meiner Eltern, die an sich noch sehr gut waren, Spuren
von zwanzig Jahren täglichen Gebrauchs zeigten.
»Wäre es nicht großartig, wenn ich die Möbel neu streichen
würde?«, überlegte ich.
Sie gaben mir die Erlaubnis dazu. Ich schliff die Betten,
die Kommoden, die Nachtschränkchen und das Regal
mit Sandpapier ab. Dann strich ich alle Möbel in
einem dunklen Grün. Mutt er und ich fanden einen sehr
schönen Stoff , und gemeinsam bezogen wir die Rückwand
der Bett en damit und machten noch ein paar passende
Kissen dazu. Alles sah sehr schön aus, und sie waren
total erfreut, dass ich vier oder fünf Tage für eine
Sache aufgewendet hatt e, die nur für sie war.
Weiter fragte ich mich: »Wann habe ich meinen
66
Eltern das letzte Mal ein Geschenk gemacht, einfach nur
so …, um ihnen zu zeigen: ›Ich liebe euch und denke
an euch‹?« Ich konnte mich nicht erinnern. Meistens
beschenkten wir einander an den Geburtstagen und zu
Weihnachten. Aber nun bekam ich immer mehr Lust, ihnen
so ganz ohne Grund Geschenke zu machen.
Meine Eltern kochen sehr gern. Da ich sie nun überraschen
wollte, hielt ich unterwegs an einem Gemüsestand
und kautt e eine riesige Tüte einer besonderen
Erbsensorte. Dann sahen mir Mutt er und Vater voller
Staunen zu, wie ich stundenlang im Wohnzimmer saß
und Erbsen schälte. Sie freuten sich unheimlich über
das Geschenk, und mein Vater, der ein ausgezeichneter
Koch ist, gab sich besondere Mühe, sie für uns zuzubereiten.
Ein anderes Mal, als ich die Universität von Missouri
in Columbia besuchte, kam ich eines Morgens auf
dem Weg zum Haus der Studentenvereinigung an einigen
Geschätt en vorbei. Im Schaufenster eines Schmuckladens
stach mir etwas in die Augen. Es war eine Silberkett
e mit dem Namen »Alberta« eingraviert. Der Name
meiner Mutt er!
Ich ging in den Laden hinein.
»Was kostet die Halskett e im Fenster – die silberne
ganz rechts?« fragte ich. Die Verkäuferin meinte: »Es
kostet einen bestimmten Betrag pro Buchstaben, und
die Anfertigung dauert sechs Wochen.«
»Ich möchte keine Kett e bestellen«, antwortete ich.
»Ich möchte gerne die aus dem Fenster – meine Mutter
heißt Alberta.«
Die Verkäuferin schien etwas erstaunt. »Ich heiße
auch Alberta! Die Firma wollte ein Muster herstellen,
also nannte ich meinen Namen. Aber ich denke, ich kann
sie Ihnen verkaufen.« Ich muss wohl nicht besonders er
67
wähnen, wie sehr sich meine Mutt er über dieses persönliche
Geschenk gefreut hat.
Das Hobby meines Vaters ist Fischen, und unsere Familie
ist immer gern zum Fischfang an die in der Nähe
gelegenen Seen gefahren. Einmal, als ich mit ihm zum
Fischen fuhr, machte ich ein Foto von ihm, wie er mit
einem breiten Filmstarlächeln einen sehr kleinen Fisch
hochhielt, den er gefangen hatt e. Ich ließ das Bild vergrößern,
kautt e einen schönen Rahmen und schickte es
als Überraschung in seine Kanzlei. Vater freute sich so
darüber, dass er es mit zum Gericht nahm, um es einigen
seiner Freunde zu zeigen. Noch heute hat es einen
Ehrenplatz in seinem Büro.
Einige Zeit später hatt e ich eine wichtige berufl iche
Entscheidung zu treff en. Da kam mir der Gedanke:
»Wäre ich bereit, mir bei meinem Vater Rat zu holen?«
Ich wollte ihn auch um Vergebung bitt en wegen einiger
Dinge, die ich in den vergangenen Jahren getan hatte
und bei denen ich mich ihm gegenüber nicht richtig
verhalten hatt e. Über persönliche Dinge hatt en wir nie
viel gesprochen, darum fürchtete ich mich nun ein wenig
davor.
Eines Sonntagnachmitt ags, als ich wieder einmal zu
Hause zu Besuch war, schauten Vater und ich allein ein
Footballspiel an. Ich nahm all meinen Mut zusammen.
Dann fragte ich ihn wegen der berufl ichen Sache um
Rat. Was er sagte, war mir eine große Hilfe, und es ging
viel leichter, als ich erwartet hatt e.
Dann sagte ich: »Vati, da ist noch etwas, worüber ich
nachgedacht habe. In den Jahren, als ich heranwuchs,
hatt e ich alles Mögliche gegen dich, ich war undankbar
und lieblos. Jetzt sehe ich ein, dass das nicht richtig war,
und ich möchte dich um Vergebung bitt en. Kannst du
mir bitt e vergeben?«
68
Er drehte sich in seinem dicken Liegesessel zu mir
um und zwinkerte ein wenig mit den Augen.
»Nein.« Dann machte er eine Pause. »An all das
kann ich mich nicht mehr erinnern …, außer an das eine
Mal …« Er nannte die Gelegenheit und lachte.
Ich überlegte kurz und sagte dann: »Schön, vergibst
du mir dann all das, woran du dich erinnern
kannst?«
»Ja«, antwortete er.
Das Footballspiel ging weiter.
Ich besprach mit ihm noch die Einladung, die ich erhalten
hatt e, Hal Lindsey auf seiner ersten Israelreise zu
begleiten. Was hielt er davon?
In Showmastermanier sagte er: »Ich persönlich hab ja
für die Klagemauer nicht viel übrig, aber wenn du hinwillst,
meinetwegen.«
Dann sagte ich: »Vati, ich glaube, ich fahre zurück
nach Dallas und höre mir unterwegs den Rest des Spiels
im Radio an.«
»Gut«, sagte er. »Gute Idee. Dann bist du schon unterwegs,
ehe der dickste Verkehr losgeht.«
Wir standen beide auf. »Und wohin geht deine nächste
Tour?« Noch nie hatt e er mich das gefragt.
»Nach Houston und Nacogdoches«, antwortete ich.
»Mach dir doch einen Cheeseburger von gestern
Abend warm und nimm ihn mit für die Heimfahrt«,
schlug er vor.
Große Lust auf einen alten Cheeseburger vom Vorabend
hatt e ich zwar nicht, aber ich wollte auch nicht
ablehnen. »Keine schlechte Idee!«, meinte ich.
Ich suchte meine Sachen zusammen und wollte gehen.
Unter der Tür gab mir Vater den Cheeseburger und
fragte: »Wann kommst du wieder?« Auch das hatt e er
mich noch nie vorher gefragt.
69
»Vielleicht am 21. oder 22.«
Lächelnd meinte er: »Na, dann bis zum 21.!«
Einige Tage später telefonierte ich mit meiner Mutt er.
»Hat Vater etwas über unser Gespräch zu dir gesagt?«,
wollte ich wissen.
»Ja, er hat gesagt: ›Ney muss verrückt geworden sein!
Sie hat mich um Rat gefragt.‹«
Einige Zeit später fand ich in den Sprüchen einen Abschnitt
, über den ich mir lange Gedanken machte.
»Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und
verwirf nicht die Weisung deiner Mutt er! Denn ein anmutiger
Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kett e
für deinen Hals« (Sprüche 1,8-9).
Meine Eltern hatt en mir nie Belehrungen erteilt oder
Vorschritt en gemacht. Und doch erkannte ich, als ich
über diesen Abschnitt nachdachte, dass sie mich unterwiesen
hatt en, einfach indem ich beobachten konnte,
was sie taten, indem sie vor meinen Augen ihr Leben
lebten und mir dadurch alles Mögliche zeigten. Ich holte
mir einen Schreibblock und begann zu notieren, was
ich von meinen Eltern alles gelernt hatt e, was ich an ihnen
besonders schätzte und welche Eigenschatt en und
Fähigkeiten ich in meinem Leben mit ihrer Hilfe hatt e
entwickeln können.
Aus meinen Gedanken wurde ein fünf Seiten langer
Brief, den ich meinen Eltern zum Hochzeitstag schickte.
Bestimmt bin ich später einmal froh darüber, dass
ich ihnen diese Dinge gesagt habe.
Als Vater und Mutt er meinen Brief erhielten, wa ren
sie so gerührt, dass sie sich hinsetzten und weinten.
Eltern sollten und möchten erfahren, dass wir, ihre
Kinder, zu schätzen wissen, was sie im Lauf der Jahre
für uns getan haben. Sie sollten wissen, dass ihre Kinder
ihnen dankbar sind, dass sie die Eltern schätzen, dass sie
70
ihren Rat beachten und sie so annehmen, wie sie sind,
auch wenn sie ganz anders sind als wir.
Ich bin überzeugt, dass Gott zerstörte oder gespannte
Beziehungen heilen möchte, dass er eingreifen möchte,
wo immer es Spannungen gibt und Liebe fehlt. Obwohl
mein Vater mich nie für etwas um Vergebung bat, hat
Gott von mir verlangt, es zu tun. Heute schätze und liebe
ich meinen Vater von ganzem Herzen.
Und nachdem nun die Feindseligkeit in meinem eigenen
Herzen beseitigt ist, kann ich in ihm all die vielen
Qualitäten sehen, für die ich vorher blind war. Er
ist liebevoll, lustig und fürsorglich. Meine Freunde haben
ihn sehr gern und fi nden, dass er wunderbar Geschichten
erzählen kann.
Er ist außerdem ein tüchtiger Rechtsanwalt – und
in meinen Augen ein großartiger Mensch. Ich bin sehr
stolz auf ihn.
Kürzlich fi el mir auf, dass mein Vater sich eigentlich
in vieler Hinsicht gar nicht geändert hat. Aber ich bin anders
geworden. Darin besteht der ganze Unterschied.
71
Ein Stein nach dem anderen
Menschliche Beziehungen sind Bewährungsproben im
Leben. Sie können schmerzlich sein oder segensreich.
Und ott sind sie eine Mischung aus beidem, aus Höhen
und Tiefen; einmal eine Quelle höchster Freude, dann
wieder eine Quelle tiefsten Kummers.
1969 begann für mich eine Beziehung, die zu einer
der bedeutsamsten in meinem bisherigen Leben werden
sollte.
Nachdem ich sechs Jahre lang die Personalabteilung
von Campus für Christus geleitet hatt e, trat ich in den
Reisedienst unserer Bewegung und war für die Betreuung
unserer Mitarbeiterinnen an allen Universitäten der
mitt leren Südstaaten der USA verantwortlich.
Meine Aufgabe war es, die einzelnen Mitarbeiterinnen
in ihren persönlichen Fragen zu unterstützen
und sie geistlich weiterzuführen. Normalerweise war
man im Reisedienst allein unterwegs, doch ich bat darum,
mit jemand anderem zusammen meine Reisen unternehmen
zu dürfen. Meine Bitt e wurde erfüllt, und
Jean Pietsch wurde meine Partnerin.
Da wir nun so eng zusammenarbeiten würden, beschlossen
Jean und ich, uns eine gemeinsame Wohnung
zu nehmen. Das Zusammenleben fi ng zunächst sehr
schön an.
Wir setzten uns hin und sprachen darüber, was wir
mochten, was wir nicht so sehr mochten und worauf wir
jeweils besonderen Wert legten – ich möchte das »Vorsorgeinspektion«
nennen.
Meine Autofi rma hat ein Programm aufgestellt, das
sich so nennt. Sie rutt die Autobesitzer dazu auf, in
regelmäßigen Abständen ihre Autos überprüfen zu
lassen, um eventuelle Schäden so frühzeitig feststel
72
len zu können, dass keine größeren Probleme daraus
werden.
Grundsätzlich hatt e ich dieses Prinzip in jeder neuen
Wohnsituation für sehr nützlich gehalten. Ich erfuhr
zum Beispiel, dass Jean im Haushalt auf peinliche Sauberkeit
Wert legte und alles so aufgeräumt und sauber
wie möglich haben wollte. Und Jean fand heraus, dass
ich nichts im Leben so sehr verabscheue wie das Platzen
einer Kaugummiblase. Es hat auf mich eine ähnliche
Wirkung, wie wenn Kreide auf einer Tafel kratzt.
Es tat mir leid, dass platzende Kaugummiblasen mir so
sehr zusetzten, aber Jean versprach, darauf Rücksicht zu
nehmen, wie auch ich mich dazu verpfl ichtete, auf ihre
Wünsche einzugehen.
Aus früheren Erfahrungen dieser Art hatt e ich mir
als Wahlspruch gemerkt: »Wenn du Stein für Stein jede
Kleinigkeit beachtest und ernst nimmst, baust du nie
zwischen dir und dem anderen eine Wand auf.« Auch
das Gegenteil hatt e ich schon als wahr erkannt: Wenn
zwei Menschen sich nicht Stein für Stein mit den vorhandenen
Problemen auseinandersetzen, bauen sie eine
Wand zwischen sich auf. Und die Wand bleibt dann
entweder für immer bestehen, oder sie stürzt in einem
schmerzlichen Augenblick mit einem lauten Krachen
ein. Beide Möglichkeiten können gleich viel Leid verursachen.
Also verpfl ichteten Jean und ich uns dazu, eine offene
und ehrliche Beziehung zueinander zu haben. Wir
beschlossen, vor Gott und voreinander »im Licht zu leben«,
und wir wollten über alles miteinander reden, ob
uns danach zumute war oder nicht.
Außerdem verpfl ichteten wir uns zum Gebet – sowohl
miteinander als auch füreinander. Unser Zuhause
war in Dallas, Texas, und gleich, als wir beide dort an
73
kamen, knieten wir nieder und beteten: »Herr, wir gehören
dir. Wir vertrauen uns dir und einander an, damit
du in uns und durch uns all das tun kannst, was du
tun willst. Was auch geschieht, Vater, bewahre uns davor,
an der Fülle, die du von deinen Zielen her für uns
bereithältst, vorbeizuleben.«
Wir baten Gott darum, in unserer Beziehung sichtbar
werden zu lassen, was Jesus in seinem Gebet in Johannes
17 ausgedrückt hat: Er bat den Vater, er möge
uns, die Gläubigen, vollkommen machen in der Einheit,
damit wir eins würden, wie Christus und der Vater
eins sind.
Nach meinem Verständnis heißt Einheit oder Einssein
nicht, dass wir ganz gleiche Personen sein sollten,
vergleichbar in jeder Hinsicht. Es bedeutete vielmehr,
dass wir keine Konfl ikte, keine Feindseligkeiten und keinen
Groll gegeneinander dulden wollten, die als Bausteine
für einen »Mauerbau« dienen konnten. Wir waren
verschieden, aber unsere Beziehung sollte harmonisch
sein, wie Musikinstrumente zusammenklingen, obwohl
sie sehr verschieden sind.
So begannen wir unsere Beziehung auf der festen
Grundlage von Gott es Wort, Gebet und der Verpfl ichtung
zum Gespräch miteinander. Doch wir wussten sehr
wenig über unsere unterschiedliche Herkuntt und unsere
emotionalen Eigenheiten.
Schon nach ein paar Tagen fühlte ich mich in Jeans Gegenwart
immer unbehaglicher. Ihre Art schien sehr kühl
und abweisend, eine Kombination von Feind seligkeit
und Gleichgültigkeit. Sie äußerte dies nicht so sehr in
Worten, sondern vielmehr in ihrem Verhalten, das von
innen her, aus ihrem Naturell, zu kommen schien.
Ich wusste, dass Jean ein sehr begabter Mensch und
nach ihrer eigenen Beschreibung fast ihr ganzes Leben
74
lang ein »Einzelgänger« war. Off enbar rückte sie wegen
ihrer Fähigkeiten und Talente immer zu schnell nach
oben an die Spitze, um auf gleicher Basis Beziehungen
mit den Menschen um sie herum anknüpfen zu können;
sie war ihnen gegenüber immer in der Führungsposition.
Später fand ich heraus, dass Jean in unserer Freundschatt
zum ersten Mal Gelegenheit zu einer partnerschatt lichen
Beziehung hatt e, bei der sie persönliche Probleme mit
jemandem auf gleicher Basis bewältigen musste.
Ich versuchte, Jeans Verhalten im Licht ihrer Vorgeschichte
zu verstehen, war aber trotzdem ratlos, wie
ich auf diese Situation reagieren sollte. Ich war immer
ein »Gruppenmensch« gewesen. In der Oberschule wie
auch an der Uni hatt e ich mehr Erfolg im Umgang mit
den Menschen als mit meinen Studien. Ich hatt e immer
jede Gelegenheit genutzt, um alle möglichen Leute kennenzulernen
und Spaß mit ihnen zu haben. Nun aber
schien es, als würde eine Mauer entstehen, die wir nicht
hatt en bauen wollen.
Wegen der Unterschiede in Bezug auf unsere Herkuntt
und Persönlichkeit schien unsere größte Schwierig
keit dadurch zu entstehen, wie wir das Gespräch
mit ein ander suchten. Obwohl wir uns beide zu einem bestimmten
Umgang miteinander verpfl ichtet hatt en und
off ensichtlich Fortschritt e im gegenseitigen Verständnis
machten, belasteten uns diese Unterschiede im Lauf der
Zeit immer mehr. Jean schien sich durch meine Off enheit
in meinen Gefühlsäußerungen und Reaktionen ständig
bedroht zu fühlen, und ott war ihre Gegenmaßnahme,
dass sie sich einfach zurückzog. Ich meinerseits war dadurch
manchmal verletzt und entmutigt.
An manchen Tagen, wenn die Atmosphäre in unserer
Wohnung in Dallas buchstäblich geladen zu sein
schien, verschatt e ich mir eine kleine Verschnaufpause
75
in einem nahe gelegenen Café. Ott saß ich – so schien es
mir – sehr lange da und starrte aus dem Fenster.
»Wie bin ich nur in all das hineingeraten?«, dachte
ich dann. »Warum wohne ich mit jemandem zusammen,
der so feindselig, so kalt, so zurückhaltend und
gefühllos ist?«
Meine häufi gen Rückzüge ins Café halfen mir, alles
wieder aus der richtigen Perspektive zu sehen. Unsere
Schwierigkeiten brachten mich dazu, Gott es Weisheit
und Führung anzuzweifeln, die Jean und mich zusammengeführt
hatt e. Ich war versucht, mich dem Gedanken
hinzugeben: »Wir können eben nicht miteinander
auskommen, weil wir so verschieden sind.«
Aber wenn ich von zu Hause wegkommen und nachdenken
konnte, erinnerte ich mich immer wieder daran,
dass das, was Gott in seinem Wort über seine Liebe sagt
und darüber, wie er mich und Jean angenommen hat,
mein Maßstab sein sollte – und nicht die Erfahrung, die
ich zu Hause machte.
Ich dachte an die Worte Jesu, als er Satan anprangerte
als den, der nur kommt, »um zu stehlen, zu schlachten
und zu vernichten« (Johannes 10,10a), und zwar das Leben
im Überfl uss, das Christus für uns vorgesehen hat.
Wenn ich so im Café saß, füllte Gott es Sicht der Dinge
meine Gedanken. Er hatt e Jean und mich füreinander
berufen. Es war sein Tun. Und da Jesus für unsere Einheit
gebetet hatt e, konnte nur Satan es darauf abgesehen
haben, sie zu zerstören. Ich musste weiter blicken
als nur auf Jean – auf Gott selbst.
Dann trank ich meinen Kaff ee aus, ging wieder in die
Wohnung und fühlte mich etwas besser.
Einmal, als ich zur Tür hereinkam, sah Jean auf. »Wie
war dein Spaziergang?«, fragte sie. »Schön«, antwortete
ich. »Ich habe einige Besorgungen gemacht und
76
bin dann ins Café gegangen.« »Du gehst gern dorthin,
nicht wahr?«
Ich zögerte: »Ja. Ich kann dort sehr gut nachdenken.«
Dann fragte ich: »Jean, hast du auch gespürt, was für
eine Spannung in der Lutt lag, als ich wegging?« »Ja«,
erwiderte sie.
»Weißt du, woher sie kam?«
Diesmal zögerte Jean, nachdenklich und überlegend.
»Nein. Ney, ich weiß nicht genau, woher meine Gefühle
kommen. Könnten wir darüber beten …, noch mal?«
Und so übten wir erneut eine Gewohnheit, durch
die unsere Beziehung während der nächsten drei erfüllten
und wichtigen Jahre zusammengehalten wurde.
Wir knieten uns vor der Couch im Wohnzimmer
hin und beteten.
»Herr, uns ist nicht besonders nach Beten zumute,
aber da sind wir. Dein Wort sagt, wir sollen Gott unermüdlich
um alles bitt en (Lukas 18,1). Und uns ist nach
Autt ören zumute, darum beten wir lieber. Dein Wort
sagt auch: ›Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille
Gott es in Christus Jesus für euch‹ (1. Thessalonicher
5,18). Während wir also in dieser Sache drinstecken,
entschließen wir uns ganz bewusst dazu, dir für das
zu danken, was wir gemeinsam durchzustehen haben,
auch wenn wir nicht ganz verstehen, warum es solche
Kämpfe sind.
Danke für deine Verheißung, dass ›alle Dinge‹, also
auch diese, ›zum Guten mitwirken‹ ›denen, die [dich]
lieben‹, und das tun wir. Dies gilt für alle, ›die nach [deinem]
Vorsatz berufen sind‹, also auch für uns (Römer
8,28). Du hast auch gesagt, dass in dir keine Finsternis
ist (1. Johannes 1,5), und darum bitt en wir dich: Sende
Licht auf unsere Wege, und gib uns Weisheit und Verständnis.
77
Wir berufen uns auf deinen Sieg über Satan in unserem
Leben. Wir beten darum, dass wir eins sein können,
wie du es uns zugedacht hast. Und, Gott , dein Wort
sagt, dass wir dazu bestimmt sind, deinem Sohn ähnlich
zu werden (Römer 8,29). Wir bitt en dich jetzt, höre nicht
auf mit uns, bis dein Werk vollendet ist. Auch wenn es
uns Schmerzen bringt, wollen wir dein Werk in unserem
Leben weiterführen, um dein Ziel zu erreichen.«
Wie bei anderen Gelegenheiten löste sich die Spannung,
und ein Geist der Einheit kehrte zurück, wenn wir
gemeinsam laut beteten. Jean und ich wussten, wie verschieden
wir in unseren Emotionen waren. Aber wenn
wir uns auf keiner anderen Ebene mehr treff en konnten,
wussten wir: In Jesus Christus würden wir immer
wieder zueinander fi nden. Wir konnten uns unter dem
Kreuz begegnen. Wir konnten uns im Gebet auf einer
geistlichen Ebene fi nden, und das taten wir unzählige
Male, während wir zusammenlebten.
Manchmal kamen unsere Verschiedenheiten in den
einfachen, praktischen Alltagserfahrungen zum Vorschein.
Zum Beispiel bringt mein Vater seit fünfundvierzig
Jahren meiner Mutt er den Kaff ee ans Bett – eine
kleine Aufmerksamkeit, um ihr den Tagesbeginn zu erleichtern.
Und wenn ich zu Hause zu Besuch bin, bringen
mir meine Eltern meistens auch morgens den Kaffee
ans Bett .
So fi ng ich an, Jean jeden Morgen den Kaff ee ans
Bett zu bringen. Doch eines Morgens merkte ich, dass
sie sich gar nicht zu freuen schien, sondern äußerst gereizt
darauf reagierte.
Verwundert überlegte ich. »Vielleicht ist das verkehrt«,
dachte ich für mich. Ich spürte in meinem Magen
etwas wie einen Stein. Ich wusste: Wir mussten darüber
sprechen.
78
Später fragte ich: »Jean, wäre es dir lieber, wenn ich
dir morgens nicht den Kaff ee ans Bett bringen würde?«
Als wir darüber sprachen, sagte Jean: »Ney, ich glaube,
es ist mir deshalb peinlich und unangenehm, weil es mir
nicht zuerst eingefallen ist! Ich komme mir vor, als sei
ich nicht würdig, dass du mir diese Freundlichkeit entgegenbringst
– und weil ich nicht daran gedacht habe,
es für dich zu tun, darum kann ich dir auch nicht dafür
dankbar sein.«
Jahre später sagte Jean im Rückblick auf unser »Kaffee-
Erlebnis«: »Deine schlichte Geste war nur der Anfang
zahlloser Geschehnisse, die mir zeigten, wie unsicher
und stolz ich war. Ich hatt e die irrige Idee, dass ich
alles wissen, an alles denken und alles tun müsste, sonst
kam ich mir unwürdig vor. Ich habe mich ganz schön
unter Druck gesetzt, nicht wahr?«
Unsere erste gemeinsame Fahrt als Mitarbeiterinnen
im Reisedienst führte uns nach Lubbock in Texas. Dort
gingen wir eines Morgens in ein Lebensmitt elgeschätt ,
um uns etwas fürs Frühstück zu kaufen. Als wir die Auswahl
an tief gefrorenen Orangensätt en ansahen, fragte
ich: »Welchen möchtest du?«
Jean war sofort reserviert und schien nicht mehr in
der Lage, meine Frage direkt zu beantworten. In meinem
Magen bemerkte ich den vertrauten Stein. Ich spürte
förmlich, wie da wieder ein Stein aufgeschichtet wurde,
wie wieder eine Mauer entstand. Später fragte ich
Jean, ob wir uns unterhalten könnten über das, was im
Lebensmitt elladen geschehen war.
Jean antwortete: »Na ja, ich habe mich mal wieder
über dein Entgegenkommen geärgert. Ich erwartete,
dass du den Satt wählst, ohne mich zu fragen. Ich bin
es einfach nicht gewöhnt, dass man sich so liebevoll um
mich kümmert.«
79
»Jean, ich möchte keine Belastung für dich sein, aber
es ist mir nicht egal, wie du empfi ndest und was du
gern hast.«
Sie antwortete: »Gott weiß darum, wenn wir für andere
eine Belastung sind, Ney. Und er wird die Belastung
dann von uns nehmen, wenn er es für richtig hält.
In der Zwischenzeit müssen wir sie aushalten und werden
hoff entlich dadurch geformt, also sei bitt e auch weiterhin
liebevoll zu mir. Es hiltt mir, ein paar innere Barrieren
zu überwinden.«
Bei anderer Gelegenheit musste ich lernen, die Nehmende
zu sein. Wegen des Umzugs und der Einrichtungskosten
war ich fi nanziell ziemlich schlecht dran.
Wenn mein Gehalt kam, war es bereits so gut wie aufgeteilt,
und es blieb kaum genug für das Allernotwendigste.
Noch nie zuvor hatt e ich mir von jemandem Dinge
wie Shampoo, Haarspray oder Klebestreifen borgen
müssen. Ich lieh gar nicht gern etwas von Jean aus, aber
wie ich meinte, blieb mir keine andere Wahl.
Ich spürte jedoch, dass es ihr ebenso schwerfi el,
mir etwas zu geben, wie es mir schwer wurde zu borgen,
und das machte die Situation für uns beide schwierig.
Eines Tages sagte ich: »Jean, es ist mir wirklich zuwider,
dich um all diese Dinge bitt en zu müssen, aber
ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Und meine
Bitt en gehen dir off enbar auch auf die Nerven.«
Aus ihrer Antwort erfuhr ich, dass sie mit drei Schwestern
groß geworden war, von denen jede ihre eigenen
Sachen hatt e. So hatt e sie selten persönliche Dinge mit
anderen teilen müssen – und diese Einstellung hatt e
sich auch nicht geändert, als sie mit anderen zusammenwohnte.
80
»Ich weiß, dass ich selbstsüchtig bin. Ich glaube, der
Herr will mich lehren, freigebiger zu sein«, sagte sie.
»Weißt du«, antwortete ich, »mir fällt zwar das Geben
leicht, aber das Nehmen macht mir Schwierigkeiten!
Gott will mich off enbar das Nehmen lehren.«
Wir mussten beide lachen, als wir erkannten, dass
Gott uns gegensätzliche Prinzipien durch dieselbe
Situation lehren wollte.
Ganz gleich unter welchen Umständen, wir fanden
ständig Gelegenheiten, bei denen sich Steine zu einer
Mauer zwischen uns hätt en stapeln können, wenn wir
uns nicht täglich Stein für Stein mit diesen Hindernissen
auseinandergesetzt hätt en.
Besonders wirksam fanden wir die Methode, jede
einzelne Angelegenheit, jeden »Stein«, wie auf einen
Tisch vor uns zu legen, um objektiv darüber zu reden.
Jean äußerte dann ihre Ansicht zu einem bestimmten
Geschehen, und ich sagte ihr meine Meinung dazu.
Wir stellten fest, dass wir normalerweise an dieselbe
Sache von ganz verschiedenen Seiten herangingen, aber
je häufi ger wir unsere Ansichten besprachen, desto größer
wurde unser Verständnis füreinander.
Manchmal konnten wir einfach dadurch, dass wir
über die Sache sprachen, zu einem gegenseitigen Verständnis
kommen.
Manchmal war es auch nötig, dass wir einander um
Vergebung baten. Es kam auch vor, dass wir uns nicht
verständigen konnten; dann kamen wir einfach überein,
die Sache auf dem »Tisch« zu lassen.
Ott half es uns, eine Sache objektiv zu betrachten,
wenn sich jeder von uns fragte: »Lässt sich dieser Konfl ikt
mit anderen vergleichen, die ich vorher schon hatt e?«
Manche Reaktionen entspringen ähnlichen Erfahrungen
in der Vergangenheit und weniger der augenblicklichen
81
Situation. Ob das der Fall ist, können wir dar an erkennen,
dass wir dann weitaus stärker reagieren, als es der
augenblicklichen Situation angemessen ist.
Einmal, als wir diese Frage diskutierten, fanden wir
heraus, dass ich Jean in vieler Hinsicht an andere Leute
aus ihrem Bekanntenkreis erinnerte, die sie wegen ihrer
freien Art, beispielsweise ihre Gefühle zu äußern,
abgelehnt hatt e. So verhalfen auch einige unserer Einsichten
dazu, dass jene anderen Beziehungen verändert
und geheilt wurden.
Wir fanden heraus, dass es einen »Stein« gab, den
ich als »Lutt blase der Einbildung« bezeichnete. Eine
Einbildung liegt dann vor, wenn, erstens, ich denke, der
andere denkt etwas Negatives über mich, oder, zweitens,
der andere denkt, ich denke etwas Negatives über
ihn. Gewöhnlich entbehrt eine solche Einbildung jeder
Grundlage in der Wirklichkeit – mit anderen Worten:
Der Gedanke wurde nie ausgesprochen, er entspricht
also keiner bekannten Tatsache. Zum Beispiel könnte
jemand denken:
»Ich glaube, sie mag mich nicht.« »Er möchte bestimmt,
dass ich gehe.« »Ihr gefällt mein Haar nicht.«
»Er denkt, ich bin unpassend angezogen.«
Wir bilden uns ein, diese Gedanken seien richtig, und
folglich »blasen« wir sie auf und lassen ihnen freien
Lauf, sodass dadurch unsere Beziehungen zu anderen
belastet werden.
Einbildungen können etwas sehr Zerstörerisches
sein. Viele Beziehungen sind völlig in die Brüche gegangen,
einfach weil Menschen an ihre Einbildungen
glaubten, ohne jemals zu überprüfen, ob sie auch mit
der Wirklichkeit übereinstimmten.
Jean und ich beschlossen, solche Gedanken off en zu
besprechen, wenn sie zwischen uns autt amen, und das
82
war häufi g der Fall. Weil wir über diese Einbildungen
off en miteinander sprachen, konnten wir sie wie aufgeblasene
Ballons mit Nadeln anstechen – sofort waren
sie verschwunden!
Ein solcher Ballon platzte während eines Besuchs an
der Universität von Kansas. An einem Nachmitt ag waren
wir dabei, uns für ein evangelistisches Treff en im
Haus einer Studentenvereinigung vorzubereiten. Mir
war das Herz sehr schwer, denn aus Jeans Benehmen
schien mir deutlich erkennbar, dass sie an jenem Tag
mit niemandem zusammen sein wollte, und schon gar
nicht mit mir. Ich dachte: »Ich kann einfach nicht zu diesem
Treff en gehen, bevor ich mich nicht mit ihr ausgesprochen
habe.«
Kurz bevor es Zeit zum Autt ruch war, nahm ich allen
Mut zusammen, um ihr zu sagen, was für einen Eindruck
ich hatt e.
»Jean«, bat ich, »können wir miteinander reden, bevor
wir gehen?«
Sie sah von ihrem Buch auf und sagte: »Natürlich.«
Ich fuhr fort: »Ich habe den deutlichen Eindruck, dass
du heute Abend nicht mit mir zu diesem Treff en gehen
willst.«
Sie rief: »O nein, Ney! Das stimmt überhaupt nicht.
Aber ich dachte die ganze Zeit, du wolltest nicht mit
mir gehen!«
»Jean, ganz ehrlich, nichts liegt mir ferner als das!«
Wir waren nun beide erleichtert, weil wir wussten: Da
war wieder einmal Satan am Werk gewesen, um unsere
Einheit zu untergraben, zu rauben und zu zerstören, gerade
jetzt, als wir drauf und dran waren, diesen Abend
gemeinsam als Rednerinnen zu gestalten.
Ein weiteres Problem, das bei zwischenmenschlichen
Beziehungen ott autt aucht, sind falsche Erwartungen.
83
Manchmal verlangen wir von anderen Menschen mehr,
als sie geben können, oder wir betrachten das, was sie
geben, als selbstverständlich.
Ich hörte einmal eine Geschichte von einem Mann,
der einen Monat lang ein Experiment machen wollte. Er
wollte in einem bestimmten Wohnviertel jedem Haushalt
einen Fünfzig-Euro-Schein schenken, ohne jede Verpfl
ichtung.
Am ersten Tag seines Experiments, als er von Haus
zu Haus ging, hatt en die Bewohner erhebliche Zweifel
– und zwar an seinem Verstand. Sie streckten zögernd
die Hand durch den Türspalt und nahmen hastig den
Geldschein an sich. Am zweiten Tag, als er wieder mit
einem Fünfzig-Euro-Schein an jede Tür kam, war die
Reaktion ähnlich.
Bis zum dritt en und vierten Tag hatt en viele Leute
die Geldscheine zur Bank gebracht und festgestellt, dass
sie echt waren, und in der ganzen Nachbarschatt sprach
man von diesen geschenkten Fünfzig-Euro-Scheinen.
In der zweiten Woche standen die Leute schon an den
Haustüren, sahen die Straße hinunter und warteten darauf,
dass der Mann kam. Sie fi ngen an, einander zu besuchen
und unterhielten sich von Tür zu Tür und über
die Straße.
In der dritt en Woche aber schien sich der Reiz des
Neuen zu verlieren. Die Bewohner nahmen das tägliche
Geschenk bereits als etwas Gewohntes an. Die Gaben
wurden »ein alter Hut«. Und in der vierten Woche wurden
sie, da die Besuche des Mannes zur Routine geworden
waren, als fester Bestandteil des Lebens hingenommen.
Am allerletzten Tag versuchte der Mann noch etwas
Neues. Er ging wieder die Straße entlang, aber diesmal
gab er keine Geldscheine aus. Da geschah etwas
84
ganz Seltsames. Die Bewohner rissen die Tür auf, kamen
an die Gartenpforte und riefen ärgerlich: »Wo ist
unser Geld?« und: »Sie, wie kommen Sie dazu, mir meine
fünfzig Euro heute nicht zu geben?«
Was war geschehen? Die Leute hatt en etwas gefordert
und erwartet, was sie ursprünglich als Geschenk
und unverdientermaßen erhalten hatt en. Sie hatt en nach
und nach die Haltung entwickelt, der Mann »schulde«
ihnen die Fünfzig-Euro-Scheine.
Das ist ein Beispiel dafür, wie wir manchmal mit anderen
Menschen und auch mit Gott umgehen. Alles im
Leben ist eigentlich ein Geschenk – unsere Familien, unsere
Freunde, unser materieller Besitz, unsere Gesundheit.
Im Lauf unseres Lebens können wir dazu kommen,
diese Gaben als selbstverständlich anzusehen und sogar
bestimmte Erwartungen zu haben, wie die Dinge
sein »sollten«. Wenn und sobald sie uns einmal genommen
werden, werden wir ott verärgert und fordernd,
weil wir glauben, wir hätt en ein »Recht« auf sie. Doch
wäre es viel besser für uns, wenn wir uns dazu entschließen
würden, dankbar zu sein für das, was uns geschenkt
wird.
Paulus beschreibt im Römerbrief wunderschön dieses
Prinzip, wie wir andere annehmen sollten: »Des halb
nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen
hat, zu Gott es Herrlichkeit« (Römer 15,7).
Es dient dem Lob Gott es, wenn wir einander annehmen,
und es macht Gott Unehre, wenn wir es nicht tun.
Wenn wir uns nicht willentlich dafür entscheiden,
andere anzunehmen, dann setzen wir unsere ganzen
Erwartungen darauf, dass sie sich genau nach unseren
Vorstellungen verhalten. Wenn andere unseren Erwartungen
entsprechen, haben wir in der Regel kaum Probleme
mit ihnen. Aber wenn sie sich nicht nach unse
85
rem »Geschmack« verhalten, geben wir ihnen gern eins
drauf, schwingen uns zum Richter über sie auf und lassen
sie auf verschiedene Arten wissen, dass sie unseren
Maßstäben ganz und gar nicht genügen. Und dann bekommen
sie das Gefühl, dass sie in unseren Augen Versager
sind.
David schreibt in Psalm 62, dass nur Gott allein sein
Fels und seine Festung ist. Warum? Weil Gott die einzige
»Konstante« in unserem Leben ist, alles andere ist
veränderlich. Wenn wir unsere Hoff nung auf das Veränderliche
setzen, werden wir unweigerlich entt äuscht.
Sehr ott musste ich mich fragen: »Worauf habe ich
meine Hoff nungen gesetzt? Auf Jeans Verhalten oder
auf Gott ?« Wenn wir unsere Hoff nungen auf das Verhalten
eines anderen Menschen setzen oder auch nur
auf unser eigenes, wird unser Leben zu einer Fahrt in
der Achterbahn, einfach weil es im menschlichen Verhalten
ein ständiges Auf und Ab gibt.
Obwohl all diese Dinge – individuelle Verschiedenheiten,
Einbildungen und falsche Erwartungen – unsere
Beziehungen erheblich belasten können, geht doch
wohl von einer Kränkung der zerstörerischste Einfl uss
aus. Es gab Zeiten, in denen Diff erenzen zwischen Jean
und mir tiefe Kränkungen verursachten.
Ich erinnere mich noch lebhatt an einen Abend, an
dem Jean nicht zu Hause war. Ich kniete neben meinem
Bett nieder und rief im Gebet laut aus: »Herr, ich habe
nicht das Gefühl, dass Jean mich liebt, und ich empfi nde
auch keine Liebe für Jean. Nach all diesen Jahren dachte
ich, ich wüsste etwas über Liebe, aber jetzt bin ich mir
nicht sicher, ob ich überhaupt eine Ahnung habe!
Ich bete darum, dass du mich deine Liebe lehrst. Meine
ist völlig verbraucht. Ich gebe mich dir hin als ein
Werkzeug deiner Gerechtigkeit. Ich bete, dass ich für
86
Jean das sein kann, was sie in dir braucht, und nur du
weißt, was das ist. Ich bitt e dich: Tu durch deinen Geist
an mir und durch mich, was ich selbst nicht für mich
tun kann.«
Ich wusste, dass wir beide von Herzen das Richtige
wollten und dass wir beide Gott liebten. Wir waren verschieden,
aber verschieden hieß ja nicht »verkehrt«.
Aber wenn diese Verschiedenheiten Kränkungen mit
sich brachten, reagierte ich unterschiedlich darauf.
Zuerst war ich immer geneigt, alles auf Jean zu schieben
und den Fehler bei ihr zu suchen. Dann dachte ich:
»Ohne Jean wäre alles in bester Ordnung.« Doch dann
packte ich diese Gedanken beim Schopf und entschied
mich mit meiner ganzen Willenskratt dafür, Jean nicht
anzuklagen. Ich musste selbst die Verantwortung für
mein Verhalten übernehmen und für die negativen Gedanken,
die aus meinem Herzen hervorkamen.
Zum Beispiel betete ich: »Herr, welche Fähigkeiten
willst du durch diese Erfahrung in meinem Leben zur
Entfaltung bringen?« Da mir das Lieben so schwer fi el,
war die Antwort, die in mir autt auchte: »Liebe«.
Als ich anfi ng, über 1. Korinther 13 nachzudenken,
wurde ich wieder wie damals, als es um die Beziehung
zu meinem Vater ging, daran erinnert, dass Gott es Liebe
sehr viel mehr mit dem Willen zu tun hat als mit Gefühlen
und Empfi ndungen.
Wenn wir an anderen Menschen etwas entdecken, was
wir nicht leiden können, neigen wir dazu, sie zu verurteilen,
und wir konzentrieren uns genau auf das, was uns
an ihnen nicht gefällt, und machen ihnen Vorhaltungen,
dass sie so sind, wie sie sind. Aber Gott möchte nicht,
dass wir andere verurteilen. Er sieht Anfang und Ende. Er
weiß, wo jeder Einzelne von uns herkommt, und er weiß
um allen Kummer, den wir durchgemacht haben.
87
Ein kleiner Junge saß einmal mit seinem Vater im
Zug. Den ganzen Tag schluchzte, weinte und wimmerte
der Junge mit nur kurzen Unterbrechungen. Als es
Nacht wurde, legten Vater und Sohn sich in eine der
Schlatt ojen im Zug. Aber durch die Vorhänge konnte
man den Jungen weiterschluchzen hören.
Ein Mitreisender, der sich das Weinen des kleinen
Jungen nun schon seit Stunden angehört hatt e, wurde
ungeduldig und ärgerlich. Aufgebracht sprang er aus
seiner Koje und riss die Vorhänge zurück, hinter denen
Vater und Sohn sich für die Nacht hingelegt hatt en.
In scharfem Ton sagte er: »Sie, wenn Sie den Jungen
nicht dazu bringen können, dass er autt ört zu heulen,
dann sollten Sie ihn besser seiner Mutt er überlassen.«
Der Vater antwortete leise: »Seine Mutt er ist gerade gestorben.
Wir bringen ihren Leichnam zur Beerdigung
nach Hause.«
Der Mitreisende hatt e nur einen Teil der Wahrheit gesehen
und darauf sein Urteil gegründet. Erst als er noch
weitere Informationen erhalten hatt e, konnte er das Verhalten
richtig einordnen.
Ebenso wurde auch ich in dem Maße frei davon, Jean
zu verurteilen, wie mir die Augen aufgingen über ihr
gesamtes bisheriges Leben und ihre Herkuntt .
Ott reagieren wir auf Kränkungen, die uns zugefügt
werden, auch so, dass wir den anderen ebenfalls verletzen
wollen. Ein solches »Rache-Denken« kann jede
Beziehung zerstören. Doch in 1. Petrus 3,8-9 heißt es:
»Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll
brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, und vergeltet
nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort,
sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden
seid, dass ihr Segen erbt!« Wir müssen uns darin
üben zu segnen, wenn wir gekränkt worden sind.
88
Eine Möglichkeit zu segnen ist, im Leben eines Menschen,
der uns verletzt hat, einen »guten Samen zu säen«.
Ich hatt e einmal einen Garten, und ich entdeckte, dass,
wenn ich zum Beispiel einen Gurkensamen säte, daraus
nicht nur eine Gurke wurde, sondern dass viele Gurken
aus dem einen Samen entstanden. Und nicht nur das,
sondern wenn ich Gurkensamen pfl anzte, erntete ich
Gurken und keine Karott en. Ich bekam genau das, was
ich gesät hatt e, und eine weit größere Menge davon, als
ich gesät hatt e.
Ott habe ich den Ausspruch »Man erntet, was man
sät« in dem Sinne gehört, dass man, wenn man böse
Dinge tut, auch böse Folgen zu tragen hat. Doch der
Satz gilt auch, wenn man gute Dinge tut, die dann gute
Folgen haben.
Wenn wir Böses säen, können Schwierigkeiten erwachsen,
aber wenn wir guten Samen säen, kann daraus
Liebe und Harmonie entstehen. In Galater 6,7-9 heißt es:
»Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspott en! Denn
was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf
sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer
aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Lasst uns aber im Gutestun nicht müde werden! Denn
zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatt
en« (Hervorhebungen von der Verfasserin).
Und in Jakobus 3,18 wird darauf hingewiesen, dass
wir die Frucht der Gerechtigkeit säen müssen, wenn wir
Frieden ernten wollen. Was ist mit Frucht der Gerechtigkeit
gemeint? Es ist die Frucht des Geistes; es ist ein
von Christus geprägtes Verhalten und Reagieren in jeder
Situation.
Die Frucht des Geistes wird im Galaterbrief beschrieben:
»Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Santt mut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist
89
das Gesetz nicht gerichtet« (Galater 5,22-23). Das bedeutet:
Wir können so liebevoll, freundlich, geduldig
und gütig sein, wie wir wollen, denn dagegen gibt es
keine Gesetze!
Wenn in mein Leben jemand einen »Samen des Hasses«
sät, kann ich ihn Wurzeln schlagen lassen, eine
große »Hass-Ernte« heranziehen und den Ertrag dann
dem anderen wieder in sein Leben werfen, wo er als
neuer Same des Hasses autt eimt und Abneigung und
Bitt erkeit entstehen lässt. Oder aber ich kann einen Samen
des Hasses, den jemand in mein Leben sät, als solchen
erkennen und entschlossen aus dem Teufelskreis
ausbrechen, indem ich dem anderen Menschen vergebe
und ihm Gutes erweise.
Jean und ich bemühten uns nach Krätt en, guten Samen
im Leben des anderen zu säen. Das erste Jahr unseres
Zusammenlebens war weitaus das schwierigste,
voll von Missverständnissen. Doch in diesem Jahr hatt e
ich heimlich Erinnerungsstücke von allen unseren Reisen
gesammelt. Ich hatt e Postkarten, Souvenirs und Bilder
zusammengetragen und ein Tagebuch über unseren
Dienst geführt. Am Ende des Jahres klebte ich alles in
ein großes Hett und überraschte Jean damit.
Andererseits war es Jean, die ott unsere Flugtickets
besorgte, wunderbare Mahlzeiten für uns kochte und
schritt lich oder telefonisch alles veranlasste, was für unsere
Reisen notwendig war. Rein gefühlsmäßig hatt e
jede von uns Zeiten, in denen sie nicht bereit war, der anderen
einen Liebesdienst zu erweisen. Aber wir wollten
uns nicht an unseren Gefühlen orientieren, sondern hatten
uns ganz bewusst dazu entschlossen, durch solche
Dinge guten Samen in das Leben des anderen zu säen.
Die beste und heilsamste Reaktion auf eine Kränkung
ist jedoch die Vergebung. Ich hatt e mir fest vor
90
genommen, Jean zu vergeben, wann immer ich mich
gekränkt fühlte. Ich musste immer und immer wieder
Vergebung üben. Dabei half es mir, das Wort »vergeben«
in »für den anderen geben« umzuformen und
mich zu fragen:
Suche ich nach einer Möglichkeit, für Jean zu geben?
Oder: Halte ich etwas fest?
Wenn ich im Herzen etwas festhielt (nämlich die
Kränkung), war ich auch nicht bereit zu vergeben, und
ich suchte nicht nach Möglichkeiten zu geben.
Eine andere Frage, die ich mir stellte, lautete:
Ist mein Gott größer als die Kränkung, die mir zugefügt
wurde?
Es hängt ganz von meiner Entscheidung ab, ob ich
Gott größer sein lasse als die Kränkung, die ich erfahren
habe. Wenn ich es aber zulasse, dass die Kränkung
ganz meine Gedanken beherrscht, dann wird es mir unmöglich,
Gott in dieser Situation zu sehen. Ott fällt es
mir schwer, mich bewusst dafür zu entscheiden, Gott
größer sein zu lassen als meine Kränkung, aber letztlich
ist das die richtige Entscheidung, das erlebte ich in meiner
Beziehung zu Jean immer wieder.
Während unserer drei gemeinsamen Jahre reisten
wir zusammen nach Texas, Louisiana, Oklahoma, Kansas,
Missouri, Nebraska, Colorado und Wyoming. Wir
sprachen viele hundert Male gemeinsam bei Zusammenküntt
en, erlebten, wie Menschen Christus als ihren
Erlöser annahmen, und durtt en sehen, wie Menschen
verändert wurden. Ich glaube, weil wir uns dafür entschieden
hatt en, Gott und einander zu ehren, gebrauchte
er uns gemeinsam in vielerlei Hinsicht.
Jean und ich wohnten, aßen, feierten gemeinsam,
taten unseren Dienst zusammen und standen viele Probleme
miteinander durch. Im Lauf der Zeit wurde es
91
uns geschenkt, dass wir kurze Augenblicke wirklicher
und echter Einheit erlebten.
In den Psalmen lesen wir: »Siehe, wie gut und wie
lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen«
(Psalm 133,1). Gegen Ende unseres dritt en Jahres
wurde es immer häufi ger »gut und lieblich«. Wir fanden
tatsächlich Gefallen aneinander! Gott hatt e unsere
Herzenshaltung, unsere Gebete, unser Reden miteinander
und unsere Bereitschatt , Dinge zu klären, belohnt.
Er hatt e ein Wunder getan.
Es kam sogar so weit, dass wir einander vermissten,
wenn wir getrennt waren, und wir empfanden Zeiten
der Trennung nicht mehr als Befreiung von einem
Druck.
Im Sommer unseres dritt en Jahres kam Jean von
einem Besuch bei ihrer Familie in Houston zurück und
sagte zu mir: »Ney, erinnerst du dich, dass ich einmal
von einem jungen Mann namens Doug gesprochen
habe? Ich kenne ihn seit vier Jahren – und mochte ihn
nie besonders.«
»Ja«, sagte ich, »du hast von ihm erzählt, ich erinnere
mich.«
»Stell dir vor, als ich zu Hause war, traf ich ihn zufällig,
und er lud mich zum Essen ein. Nach dem Essen
fuhren wir zusammen nach Galveston und verbrachten
einen wunderschönen Abend am Meer. Er hat sich
sehr verändert im Vergleich zu früher. Ich habe das Zusammensein
mit ihm richtig genossen – das hätt e ich
nie erwartet!«
Zwei Monate später rief Doug Jean von Illinois aus an
und sagte ihr, er komme zu einer Konferenz nach Dallas.
Sie nahmen jeden Tag gemeinsam an der Konferenz teil.
Wenn keine Sitzungen waren, unterhielten sie sich, gingen
zusammen einkaufen oder etwas besichtigen.
92
Als Doug wieder nach Hause fuhr, sagte Jean: »Ney,
ich komme mir vor, als sei ein Teil von mir weg.« Dann
fi ngen sie an, sich zu schreiben, sich anzurufen und
sich gegenseitig zu besuchen. Ich war keineswegs überrascht,
als sie sich im November verlobten.
Eines Abends bekam ich völlig unerwartet einen Anruf
von Doug. »Ney, Jean und ich haben uns unterhalten,
und es ist uns klar geworden, dass wir nicht heiraten
könnten, wenn ihr beide in den drei Jahren zusammen
nicht so vieles gelernt und durchgearbeitet hätt et. Ich
möchte dir von Herzen danken für das, was du in Jeans
Leben bewirkt hast.«
Der Anruf bewegte mich sehr, und ich weinte an jenem
Abend Tränen der Freude und der Dankbarkeit
über alles, was Gott getan hatt e. Im letzten Monat vor
Jeans Hochzeit konnte ich ihren Namen nicht nennen,
ohne dass mir die Tränen kamen. Wir hatt en so vieles
in jenen Jahren miteinander geteilt, und ich wusste, ich
würde sie sehr vermissen.
Ich erkannte nun deutlich, dass die Empfi ndsamkeit,
von der ich geglaubt hatt e, Jean besäße sie nicht, immer
vorhanden gewesen war. Ja, ich staunte über die Tiefe
ihres Mitgefühls und ihrer Liebe. Aber all unsere gemeinsamen
Erfahrungen waren nötig gewesen, um das
deutlich zu machen.
Jean schrieb mir kürzlich: »Die Erfahrungen, die wir
miteinander gemacht haben, waren ganz ent scheidend
für meine jetzige glückliche Ehe. Weil du mir ständig
Liebe entgegenbrachtest, begannen die Mauern
der Furcht und der Feindseligkeit nach und nach abzubröckeln.
Nachdem ich gelernt hatt e, mein eigenes
Versagen, meine Angst und Niedergeschlagenheit zu
akzeptieren, konnte ich auch mit Doug geduldig und
verständnisvoll sein.«
93
»Freundschatt en mit Männern«, schrieb sie weiter,
»hätt en mich nicht auf die Ehe vorbereiten können. Ich
hielt mit meinen wahren Gefühlen zu sehr hinterm Berg.
Ich musste mit jemandem zusammenleben, der mich
mit der Wahrheit über mich selbst und über sich selbst
konfrontierte.«
Durch meine Erfahrungen im Umgang mit anderen
Menschen ist mir bewusst geworden, dass es zwar ziemlich
einfach ist, Gott zu lieben, weil er vollkommen ist,
dass es aber gar nicht so einfach ist, einander zu lieben
– weil wir nicht vollkommen sind. Das muss Jesus gemeint
haben, als er sagte, die Welt werde erkennen, dass
er Gott ist, wenn wir Liebe untereinander haben. Es ist
nicht natürlich, sondern übernatürlich für uns, einander
mit jener Hingabe zu lieben, die aushält, auch wenn
unsere Gefühle sagen: »Ich will da raus!« Für Jean und
mich wurde das »Aushalten« zum Segen, nicht das »Davonlaufen«.
Während der Zeit, in der ich mit Jean zusammen war,
lernte ich, dass man, wenn man einen Mitarbeiter, einen
Mitbewohner oder einen Ehepartner ablehnt, eigentlich
Gott ablehnt, weil er einen in diese Gemeinschatt hineingestellt
hat. Ich lernte nicht nur, Dinge in Ordnung zu
bringen, »immer einen Stein nach dem anderen«, sondern
auch zu beten, wenn mir gar nicht danach zumute
war, und mit dem anderen zu sprechen, wenn ich
lieber geschwiegen hätt e. Und ich lernte wertvolle Lektionen
darüber, wie man mit Einbildungen und Kränkungen
umgeht.
Wenn zwischen Jean Pietsch und mir sich all die Mauern
aufgetürmt hätt en, die entstehen wollten, hätt en wir
einander letztendlich gehasst, und Gott hätt e unseren
Dienst nicht so segnen können, wie er es getan hat. Obwohl
wir in vieler Hinsicht krasse Gegensätze waren,
94
erlebten wir, wie uns Gott zu einer Einheit und Harmonie
zusammenbrachte. Die Liebe, Hingabe, Dankbarkeit
und Zuneigung, die wir füreinander empfi nden, haben
bis zum heutigen Tag nicht nachgelassen.
95
Der Feind wird entlarvt
Als Jean und ich Jackie Hudson zum ersten Mal trafen,
arbeitete sie in einem Büro in Dallas, Texas, um bei den
Vorbereitungen für »Explo ’72« zu helfen. »Explo ’72«
war ein Kongress, zu dem achtzigtausend Christen kamen,
um eine Grundausbildung in Evangelisation und
Jüngerschatt zu erhalten.
Jackie stand erst seit kurzem in einer vollzeitlichen
christlichen Arbeit und wollte von ganzem Herzen Gott
dienen und ihm nachfolgen. Sie war lebhatt und fröhlich
und machte einen zufriedenen Eindruck.
Als ich sie drei Monate später wiedersah, erschien sie
mir völlig verändert. Ich wollte gerade aus dem Klassenzimmer
gehen, um mit einer Freundin zu Mitt ag zu
essen, als ich ganz hinten im Raum Jackie entdeckte. Es
schien, als sei sie in einer anderen Welt. Als ich auf sie
zuging und sie aus der Nähe betrachtete, sah ich die
dunk len Ringe unter ihren Augen und erkannte, wie
blass sie war. Ich fragte mich, ob sie krank sei.
»Jackie, du siehst elend aus.« Meine Direktheit überraschte
mich selbst. »Fehlt dir etwas?«
»Ja.« Ihre Lippen begannen zu zitt ern, und sie war
kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Ich fasste sie an der Schulter. »Hast du ein paar Minuten
Zeit, dass wir miteinander reden können?«
Jackie nickte, und nun liefen ihr die Tränen übers
Gesicht.
Wir gingen nach draußen, suchten uns ein Plätzchen
auf dem Rasen und setzten uns. »Kannst du mir sagen,
was los ist?«, fragte ich.
»Ney«, begann sie, »es klingt vielleicht seltsam, aber
während ich bei ›Explo ’72‹ in der ›Cott on Bowl‹ (einer
Arena, in der die Abendveranstaltungen gehalten
96
wurden) saß und auf die achtzigtausend Leute blickte,
die da waren, gingen mir allerlei Gedanken durch den
Kopf. Wie etwa: ›Woher weiß ich denn, dass es wirklich
einen Gott gibt? Woher weiß ich denn, dass sich all
diese Leute da nicht nur etwas vormachen?‹« Sie hielt
inne und holte tief Lutt .
»Ich schob die Gedanken weg, aber in den folgenden
Tagen tauchten sie immer wieder auf. Je mehr Fragen
ich mir stellte, desto größer wurden meine Zweifel. Jetzt
bin ich so weit, dass ich mir mit gar nichts mehr sicher
bin.«
Jackie setzte sich auf dem Rasen anders hin, sah vor
sich auf den Boden und dann wieder zu mir. »Ein Teil
von mir weiß, dass alles wirklich wahr ist, aber meine
Zweifel bedrücken mich so sehr, dass ich meine, ich könne
nicht glauben. Ich kann einfach nicht glauben.«
Ihre Stimme wurde lauter. »Meine Zweifel scheinen
berechtigt, und nun bin ich mir nicht einmal mehr sicher,
ob ich überhaupt Christ bin. Ich kann nicht mehr
schlafen und nicht mehr essen. Ich habe schon neun
Pfund abgenommen. Manchmal frage ich mich, ob Satan
da seine Hand im Spiel hat. Ich kann nicht glauben,
aber ich möchte es doch … ich kann nicht …« Ihre
Stimme wurde von Schluchzen erstickt. »… ich möchte.
Aber mir ist, als würde ich mir etwas vormachen.« Gemeinsam
schlugen wir einige Bibelstellen über Glauben
nach und besprachen sie. Ich fragte: »Was ist Glauben,
Jackie?«
»Ich denke, nach dem, was du gesagt hast, bedeutet
es ›Gott beim Wort nehmen‹. Aber, Ney, ich weiß nicht
einmal, ob es wirklich einen Gott gibt; wie kann ich ihn
also beim Wort nehmen?«
Nun erklärte ich Jackie, dass in ihr ein geistlicher
Kampf tobte und dass Satan sie in ihrem Verständnis für
97
biblische Wahrheiten blind gemacht hatt e. Es schien angebracht,
an dieser Stelle aufzuhören und zu beten. Ich
betete, Gott möge sie aus der Macht Satans befreien und
ihr die Gnade schenken, wieder an ihn zu glauben. Am
Ende unseres Gesprächs gab ich ihr ein Päckchen mit
Bibelversen und ermutigte sie, über diese Verse nachzudenken.
Wir wollten in Verbindung bleiben.
Am nächsten Tag besuchte mich Jackie im Haus einer
Freundin.
»Ney, seit wir gestern zusammen waren, konnte ich
immer noch nicht schlafen oder essen. Ich weiß nicht,
was ich tun soll.«
»Hast du eine Bibel bei dir?«, fragte ich.
»Ja.«
»Gut, dann schlag 1. Petrus auf. Ich weiß, du sagst,
dass du der Bibel im Augenblick nicht glaubst, aber lass
uns ein paar Minuten lang einfach so tun, als glaubtest
du.«
Ich bat sie, im 5. Kapitel die Verse 6 bis 10 vorzulesen.
Sie begann: »Demütigt euch nun unter die mächtige
Hand Gott es, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit.«
»Was sollst du also tun?«, fragte ich. »Mich unter die
mächtige Hand Gott es demütigen.«
»Wie machst du das?«
Sie las weiter: »indem ihr alle eure Sorge auf ihn
wertt ! Denn er ist besorgt für euch.«
»Wie viele Sorgen?«
»Alle.«
»Und warum sollst du das tun?«
Jackies Stimme klang ein ganz klein wenig hoff nungsvoll:
»Weil er für mich sorgt.«
»Ja«, antwortete ich. »Er sorgt für dich. Lies jetzt die
nächste Zeile.«
98
»Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann.«
»Also, Jackie, wie lautet Gott es Warnung an dich?«
»Ich soll wachsam sein.« »Warum?«
»Weil der Teufel darauf aus ist, mich fertigzumachen.«
»Wer ist der Teufel?« »Er ist mein Widersacher.«
»Gut, lies den nächsten Vers.« »Dem widersteht standhatt
durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden
sich an eurer Bruderschatt in der Welt vollziehen!«
»Was befi ehlt dir Gott hier, Jackie?« »Ich soll Satan widerstehen.«
»Wie sollst du ihm widerstehen?« »Durch
den Glauben.« »Was ist Glauben?« »Gott beim Wort nehmen.«
»Und was sagt der Vers weiter?« »… da ihr wisst,
dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschatt in der
Welt vollziehen!« »Jackie, das bedeutet, dass du nicht
allein dastehst. Andere Menschen machen das Gleiche
durch wie du. Es ist einer von Satans Tricks, dass er dich
denken lässt, du seist ganz allein.
Im nächsten Vers verspricht Gott : ›Der Gott aller Gnade
aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit
in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine
kurze Zeit gelitt en habt, vollkommen machen, stärken,
krätt igen, gründen.‹ Was du durchmachst, dauert nicht
ewig.«
Und weiter sagte ich: »Ich möchte dich bitt en, diese
Verse auswendig zu lernen. Und weil es in diesem
ganzen Abschnitt darum geht, dass wir uns für Gott es
Wahrheit anstatt für die Lügen Satans entscheiden sollen,
möchte ich, dass du in deiner Bibel an den Rand
schreibst:
›Entscheide dich für Glauben.‹«
Wir verabschiedeten uns und vereinbarten, uns bald
wieder zu treff en. Einige Tage später trafen wir uns in
99
einem Restaurant, und wieder sagte sie: »Ich möchte von
Herzen gerne glauben, aber ich kann nicht.«
»Jackie, dir ist es zur Gewohnheit geworden, die falschen
Dinge zu glauben, nun musst du dich daran gewöhnen,
die richtigen Dinge zu glauben. Du denkst von
dir, du hätt est keinen Glauben, aber du solltest denken:
›Ich fange an, eine neue Gewohnheit zu entwickeln –
nämlich aus Glauben zu leben.‹«
Als wir uns noch einige Male trafen, hatt e ich den
Eindruck, dass wir vorwärts kamen, aber ich war doch
noch sehr besorgt um sie. Als sie ihren Dienst als Mitarbeiterin
von Campus für Christus an der staatlichen
Universität von Oregon antrat, war sie noch immer sehr
schwach im Glauben.
In der darauf folgenden Zeit betete ich weiter für sie
und hielt die Verbindung zu ihr über eine gemeinsame
Freundin aufrecht.
Als ich Jackie dann ein Jahr später wiedersah, war
sie erneut ein Bild sieghatt en Glaubens. Sie teilte mir
einiges von dem mit, was sie gelernt hatt e.
»Was mich schließlich frei machte, war die Erkenntnis,
dass ich in einem geistlichen Kampf stand. Ich erkannte
nach und nach, dass ich eine alte Natur habe,
die Gott feindlich gesinnt und für Zweifel anfällig ist.
Aber ich habe auch eine neue Natur, die auf Gott reagieren
kann.
Ich erkannte auch, dass die Entscheidung ganz bei mir
lag. Mit meinem Willen konnte ich mich dafür entscheiden,
Gott zu glauben und ihn beim Wort zu nehmen,
ganz gleich, was für Gefühle ich hatt e oder was meine
alte Natur mir einreden wollte. Als ich mir angewöhnte,
Gott zu vertrauen, schwanden meine Zweifel.«
Es ist fünf Jahre her, seit ich Jackie zum ersten Mal
traf. Heute tut sie einen Dienst für Gott , wie ich ihn mir
100
für eine junge Frau nicht positiver und fruchtbarer vorstellen
kann. Der erste Satz eines Artikels, der kürzlich
über sie geschrieben wurde, lautete: »Wenn Jackie Hudson
ihre eigene Medienkampagne durchführen würde,
hätt e sie als Autt leber an ihrem Auto: ›Glaubt an Gott ,
und er wird alles für euch tun.‹«
Mitt en in dem geistlichen Kampf um ihr Denken und
ihren Willen kam die Wende, als sie sich für das Vertrauen
in Gott es Wort entschied. Sie vertraute der Verheißung
Gott es, dass der Geist Gott es, der in uns ist, stärker
ist als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht
wird (vgl. 1. Johannes 4,4).
Ich war froh, dass sich Jackie den Rat, den sie bekam,
zu Herzen genommen hatt e. Hätt e sie mich aber
ein Jahr früher um Rat gefragt, hätt e ich ihr vielleicht
gar nicht helfen können. Nicht etwa, weil ich nie etwas
von einem »geistlichen Kampf« gehört hatt e, sondern
weil ich die Macht und den Einfl ussbereich Satans stark
unterschätzte.
C.S. Lewis schrieb in einem seiner Bücher: »Wenn Satan
uns dazu bringen kann, dass wir nicht mehr an sein
Vorhandensein glauben, hat er eine wichtige Schlacht
gewonnen, weil sein Wirken dann unerkannt bleibt.«
Obwohl ich an die Existenz Satans glaubte, tat ich
doch ott so, als rechnete ich nicht mit ihm. Es kam mir
total unnötig und fast geschmacklos vor, über ihn zu
reden.
Aber das änderte sich in jenem Sommer, als ich von
Arrowhead Springs nach Dallas zog. Eines Tages war
ich in meinem Schlafzimmer und sprach laut mit Gott .
Ich bat ihn: »Lehre mich beten.« Als ich meine eigenen
Worte hörte, merkte ich, wie vertraut sie klangen.
Ich erinnerte mich, dass vor langer Zeit die Jünger Jesu
ebenso gebetet hatt en. Dann betete ich das Vaterun
101
ser, das ja die Antwort Jesu auf die Bitt e der Jünger gewesen
war.
Ein Satz in dem Gebet – »Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern errett e uns von dem Bösen (von der
Person des Bösen)« (Matt häus 6,9-13) – strahlte wie mit
Leuchtschritt vor mir auf. Ich erinnerte mich an ein anderes
Gebet Christi, das in Johannes 17 steht. Jesus betete
zum Vater für die Gläubigen, die nach seiner Himmelfahrt
auf der Erde zurückbleiben sollten.
»Ich bitt e nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst,
sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen!« (Johannes
17,15).
Ich dachte: »Das ist doch interessant, dass diese beiden
Gebete Jesu eins gemeinsam haben: die Bitt e um Errett
ung oder Bewahrung vor dem Bösen, dem Satan.«
Von da an betete ich fast täglich, dass ich vor Satans
Macht bewahrt werden möge. Ich wusste, dass mein Gebet
mit dem Gebet Jesu Christi übereinstimmte, denn er
trat gleichermaßen für mich im Himmel ein.
Als ich mehr und mehr von Satan und seinem Wirken
verstehen lernte, bat ich Gott , mich zu lehren, was
ich über geistlichen Kampf wissen musste. Er wies mich
auf Epheser 6 hin.
»Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht
seiner Stärke! Zieht die ganze Waff enrüstung Gott es an,
damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreitt
die ganze Waff enrüstung Gott es, damit ihr an dem
bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet
habt, stehen bleiben könnt! So steht nun, eure Lenden
umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brust
102
panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen
mit der Bereitschatt zur Verkündigung des Evangeliums
des Friedens! Bei alledem ergreitt den Schild des Glaubens,
mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen
könnt! Nehmt auch den Helm des Heils und
das Schwert des Geistes, das ist Gott es Wort!« (Epheser
6,10-17).
Dieser Abschnitt off enbart einiges über Satan, und
eine der wichtigsten Informationen über ihn ist, dass
er ein Betrüger ist. Wenn jemand betrügt, lässt er etwas
als Wahrheit erscheinen, was keine Wahrheit ist. Gute
Zauberer zum Beispiel beherrschen die Kunst der Täuschung.
Satan wird in diesem Abschnitt als listiger Täuscher
bloßgestellt – verschlagen, geschickt und betrügerisch.
Jesus nannte ihn den »Vater der Lüge« (vgl. Johannes
8,44). Seine Täuschungen nehmen viele Formen
an, und seine Strategien sind von unendlicher Vielfalt.
Manchmal greitt er ganz direkt an; bei anderen Gelegenheiten
geht er listig und verschlagen vor. Aber Paulus
schreibt auch, dass wir mit dem Schild des Glaubens
seine Angriff e abwehren können. Damit können wir all
die »feurigen Pfeile« Satans auslöschen. Was sind das
für »feurige Pfeile«? Und wie können wir »den Schild
des Glaubens ergreifen«, um sie auszulöschen? Wie in
einem Krieg der Gegner im Vorteil ist, wenn er sich tarnen
kann, so ist auch Satan in unserem Leben im Vorteil,
wenn seine Taktiken verborgen bleiben.
Satan rechnet den Zweifel zu seinen mächtigsten
Waff en. Es gibt Tausende von Christen in der Welt, die
– genauso, wie es bei Jackie der Fall war – in Niederlage
und Hoff nungslosigkeit leben. Ihre Kämpfe sind
lediglich darauf zurückzuführen, dass sie aufgehört haben,
Gott zu vertrauen. Sie entscheiden sich lieber dafür,
103
ihren Zweifeln Glauben zu schenken, als Gott es Wort
zu glauben.
Die listigen Täuschungen Satans sind so alt wie die
Welt, aber noch immer wirksam. Im Garten Eden näherte
er sich Eva mit den Worten: »Hat Gott wirklich gesagt
…?« (1. Mose 3,1). Satans Bestreben war es, Evas
Vertrauen, Zuversicht und Glauben an Gott und sein
Wort zu untergraben. Er macht es heute noch genauso.
Und er trägt jedes Mal den Sieg davon, wenn sein »Opfer«
sich nicht dafür entscheidet, an Gott zu glauben, so
wie Jackie es tat.
Eine weitere Taktik Satans ist es, in uns ein Gefühl des
Verdammtseins autt ommen zu lassen. Es hat Zeiten gegeben,
in denen ich mir aus heiterem Himmel plötzlich
verdammt vorkam, ohne wirklichen Grund.
Satan wird in der Schritt »der Verkläger unserer Brüder«
(Off enbarung 12,10) genannt. Wenn er mich mit
dem Gefühl des Verdammtseins überfällt, kann ich seine
Angriff e mit den machtvollen Zusagen Gott es in Römer
8 abwehren.
»Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in
Christus Jesus sind. … Was sollen wir nun hierzu sagen?
Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen
eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns
alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch
alles schenken? Wer wird gegen Gott es Auserwählte
Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist,
der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja
noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes
ist, der sich auch für uns verwendet« (Römer 8,1.31-
34; Hervorhebung von der Verfasserin).
Wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe, bete ich:
»Herr, ich fühle mich verurteilungswürdig, aber ich
entscheide mich dafür zu glauben, was dein Wort sagt.
104
Danke, dass ich von dir nicht verurteilt werde.« Mein
wirksamster Gegenangriff ist immer, wenn ich einfach
bekrätt ige, dass ich an Gott es Wort glaube.
Den zerstörerischsten Einfl uss übt Satan auf uns aus,
wenn er uns das Gefühl gibt, von Gott verlassen zu sein.
Manchmal gab es Zeiten, in denen ich mich sehr verloren
und allein fühlte. Es schien, als kümmerte sich niemand
darum, was ich durchmachte, und als hätt e sogar
Gott mich vergessen. Ott entstand dieses Gefühl, wenn
ich mich in einer Situation befand, die eine große emotionale
Belastung mit sich brachte, und war eine ganz
natürliche Reaktion darauf.
Die Taktik des »Bösen« ist es dann, dieses Gefühl
noch einen Schritt weiterzutreiben – bis ich wirklich anfange
zu glauben, dass sich nicht nur kein Mensch um
mich kümmert, sondern dass mir auch Gott seine Liebe
und Fürsorge entzogen hat bis zu dem Punkt, dass
er mich ganz und gar aufgegeben hat.
Solche Gefühle haben viele Menschen, die das Gleiche
erlebt haben, in verzweifelte, manchmal selbstmörderische
Gedanken getrieben. Wenn ich merke, dass
meine Gedanken in eine solche Richtung umschwenken,
halte ich mich gern an die ermutigenden Worte
aus Römer 8:
»Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis
oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot
oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrie ben
steht: ›Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen
Tag; wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden.‹ Aber
in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den,
der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder
Tod noch Leben, weder Engel noch Gewal ten, weder
Gegenwärtiges noch Zuküntt iges, noch Mäch te, weder
Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns
105
wird scheiden können von der Liebe Gott es, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn« (Römer 8,35-39).
Paulus sagt damit, dass uns nichts von Gott es Liebe
trennen kann. Ja, Jesus hat versprochen: »Ich will dich
nicht aufgeben und dich nicht verlassen« (Hebräer 13,5).
Das Wort »nicht« ist zu schwach, um deutlich zu machen,
wie kratt voll diese Zusage ist. Im Original steht
hier ein Wort mit einer dreifachen Verneinung, das man
mit »nie-nie-niemals« übersetzen müsste. Jesus sagte
also eigentlich: »Ich will dich niemals, nein, niemals,
nein, niemals aufgeben oder dich verlassen.«
Ein anderer von Satans »feurigen Pfeilen«, der mit
dem Gefühl, Gott könne einen verlassen haben, eng verwandt
ist, ist ein Gefühl der Wertlosigkeit. Ich hörte einmal
jemanden sagen, Säuglingen würde, solange sie
noch auf dem Arm ihrer Mutt er sind, beständig Liebe
und Aufmerksamkeit entgegengebracht. Man sagt zu
ihnen: »Mein süßer kleiner Schatz, ich hab dich lieb!«
Aber wenn das Kind dann heranwächst, überdecken ott
zahlreiche Erlebnisse der Ablehnung – durch die Familie
und die Welt ringsum – teilweise oder ganz diese positive
Grunderfahrung des Kindes. Das kann zur Folge
haben, dass ein Mensch sich schließlich als Erwachsener
völlig wertlos fühlt.
Ich bin überzeugt, dass Satan alles und jedes Mitt el
nutzt, um unser persönliches Wertgefühl zu untergraben,
wann immer er kann. Er hasst uns, und wenn er uns
dazu bringen kann, dass wir uns selbst auch hassen und
glauben, wir seien wertlos, vor allem für Gott , dann hat
er uns mit Erfolg dahin gebracht, genau das Gegenteil
von dem zu glauben, was Gott es Wort uns sagt.
Manchmal greitt er uns mit diesem »Minderwertigkeitsgefühl«
sofort, nachdem wir gesündigt haben, an.
Gott liebt uns, wie wir sind, aber er ist nicht immer ein
106
verstanden mit dem, was wir tun. Ihm geht es darum,
unser Verhalten zu korrigieren, während Satans Taktik
dar auf zielt, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, zu
zer stören.
Nehmen wir einmal an, Sie hätt en gelogen. Dann
kann Satan sagen: »Du Lügner! Du bist ein elender Lügner,
und das weißt du auch. Du bist überhaupt nichts
wert.« Gott reagiert jedoch so: »Ich liebe dich, aber du
hast nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe dich viel zu
lieb, um dich das weiterhin tun zu lassen, darum will
ich dein Verhalten korrigieren.«
Gott liebt uns. Wir sind »teuer und wertvoll« (vgl.
Jesaja 43,4). So unbegreifl ich und schwer verständlich
es auch für uns sein mag, wir sind Gott wirklich ebenso
viel wert wie sein Sohn. Wie eine Ware in einem Geschätt
das wert ist, was dafür bezahlt wird, so sind wir
das wert, was für uns bezahlt wurde. Und wenn wir Gott
so viel wert sind, kann es doch nur der Widersacher sein,
der uns einreden will, wir seien wertlos.
Wenn Satan mich auf diese Weise angreitt , bete ich:
»Herr, ich fühle mich wertlos. Aber ich danke dir, dass
ich dir ebenso viel wert bin wie dein eigener Sohn, der
dir teuer ist.«
Wenn Satan seine Angriff e gegen uns als Einzelne
richtet, ist das nur ein kleiner Teil seines großen Feldzugs,
der zum Ziel hat, das wirksame Funktionieren
des ganzen Leibes Christi lahmzulegen. Und manchmal
merken wir gar nicht, wie uns der »Verkläger unserer
Brüder« einspannt, um für ihn zu arbeiten.
Einer seiner »feurigen Pfeile«, der sich auf die Einheit
unter Christen höchst zerstörerisch auswirkt, ist die negative
Kritik. Da Jesus für unsere Einheit betete, wissen
wir: Wenn Zwietracht zwischen uns gesät wird, kann sie
nicht von Gott kommen, sondern vom Bösen.
107
Wenn wir uns je verletzt fühlten durch Worte, die
andere hinter unserem Rücken über uns gesprochen
haben, wissen wir, wie sehr das wehtun kann. Dieser
Schmerz kann uns aber empfi ndsam machen und davon
abhalten, verletzende Worte über andere zu sagen.
Auch als wir tief in unseren gemeinsamen Schwierigkeiten
steckten, verpfl ichteten Jean und ich uns dazu,
im Gespräch mit anderen nur gut voneinander zu reden.
Es kam vor, dass wir uns wegen unserer Beziehung
zu einander bei anderen Rat holten, aber nur, wenn wir
uns vorher darauf geeinigt hatt en, es zu tun.
In seinem Buch Mein Äußerstes für sein Höchstes
schreibt Oswald Chambers, dass Gott uns Urteilskratt
gegeben hat, damit wir beten können, nicht, damit wir
die Fehler der anderen aufdecken. Weil niemand von
uns vollkommen ist, ist es unvermeidlich, dass wir im
Leben anderer Menschen auf Dinge stoßen, die uns nicht
gefallen oder mit denen wir nicht übereinstimmen. Solche
Feststellungen können richtig sein, aber wenn wir
anfangen, diese Dinge negativ zu betrachten und zu verurteilen,
kann das eine Glaubensniederlage bewirken
und zu Kummer und Verzweifl ung führen.
Wenn wir aber die Dinge, die wir am anderen nur
schwer ertragen können, im Gebet vor Gott bringen,
arbeiten wir mit Gott zusammen und nicht mit Satan.
Wir drücken damit aus, dass wir ihm zutrauen, im Leben
eines Menschen und in schwierigen Situationen das
zu bewirken, was er tun will.
Dann gibt es einen Angriff des Bösen, den ich als
den »feurigen Pfeil des ›Wenn nicht‹« bezeichne. Auch
diese Technik setzte Satan bei Eva im Garten Eden ein,
um sie dazu zu bringen, Gott ungehorsam zu sein und
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu
essen (vgl. 1. Mose 3,1-5).
108
Sinngemäß sagte er: »Eva, dieser Baum schränkt dich
ein. Wenn dieser Baum nicht wäre, könntest du all das
wissen, was Gott weiß.«
Bis heute benutzt Satan die Taktik, uns einzureden,
wir seien eingeengt – mal von dem einen, mal von dem
anderen. Er geht ganz geschickt vor und fl üstert uns
ein: »Dieser Mensch (Frau, Mann, Kind, Mitbewohner,
Arbeitskollege, Angehöriger, Elternteil usw.) schränkt
dich ein. Wenn er oder sie nicht in deinem Leben wäre,
könnte alles vollkommen sein.«
Als Jean und ich zusammenwohnten, fl üsterte Sa -
tan ott : »Ney, Jean engt dich ein. Wenn sie nicht wäre,
könntest du sehr viel glücklicher sein, und dein Leben
wäre viel schöner.« Hätt e ich Satan geglaubt, dann
hätt e ich angefangen, nach meiner Überzeugung zu handeln,
und ich hätt e auf den Tag hin gelebt, an dem unsere
Wohngemeinschatt zu Ende gegangen wäre.
Doch ich wusste, dass ich über Jean hinweg sehen
und meine Hoff nung auf Gott und sein Wort setzen
muss te. Ein Freund von mir, Don Meredith, sagte
ein mal: »Wir müssen lernen, die Menschen um uns herum
nicht als eine persönliche Einengung zu sehen.«
Im Alten Testament lesen wir, dass Josef von seinen
Brüdern gehasst wurde. Sie warfen ihn in einen Brunnen
und verkautt en ihn in die Sklaverei. Dem äußeren
Anschein nach war er in seinen Lebensmöglichkeiten
erheblich eingeschränkt. Josef hätt e denken können:
»Wenn meine Brüder mir dies nicht angetan hätt en,
wäre ich frei!«
Statt dessen setzte er seine ganze Hoff nung auf Gott ,
der ihm alles zum Besten dienen ließ. Später konnte
Josef sagen, dass seine Brüder ihm zwar Böses hatt en
tun wollen, »Gott aber hatt e beabsichtigt, es zum Guten
zu wenden« (1. Mose 50,20).
109
Nachdem Lazarus gestorben war, kamen seine
Schwes tern Maria und Marta zu Jesus gelaufen. Maria
sagte: »Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre
mein Bruder nicht gestorben« (Johannes 11,32).
Jesus spricht zu ihr: »Habe ich dir nicht gesagt, wenn
du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gott es sehen?«
(Johannes 11,40).
Jesus setzte ihrem »Wenn« sein »Wenn« entgegen. Er
antwortete: »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest,
so würdest du die Herrlichkeit Gott es sehen?« (Johannes
11,40; Hervorhebung von der Verfasserin). Wenig später
wurde Lazarus von den Toten auferweckt.
Wir müssen jedes »Wenn nicht« in unserem Leben
Gott anvertrauen, ebenso all die Menschen und Lebensumstände,
durch die wir uns eingeschränkt fühlen, weil
er aus allem »Herrlichkeit Gott es« machen kann.
Zweifel, negative Kritik, das Gefühl der Wertlosigkeit,
das »Wenn nicht«, das Gefühl des Verdammtseins
– sie sind nur eine Auswahl aus den zahllosen fi nsteren,
hinterhältigen Anschlägen des Bösen. Satan geht in der
Tat umher »wie ein brüllender Löwe«. Er will uns alle
verschlingen, und ott tut er es, indem er immer wieder
einen »feurigen Pfeil« auf uns abschießt. Wer nicht den
Schild des Glaubens nimmt und gegen ihn hochhält,
wird von der geballten Ladung seiner Angriff e schnell
außer Gefecht gesetzt.
So war es auch bei einem jungen Mädchen, das ich
vor einigen Jahren traf. Ich war an die Ostküste der
USA gefl ogen, um dort mit einigen Mitarbeiterinnen
unserer Bewegung zusammen zu sein. Barbie Leyden,
die mich am Flughafen abholte, kam mir mit den
Worten entgegen: »Ney, ich mache mir wegen Marti
große Sorgen. Sie hat sich sehr verändert. Sie ist total
niedergeschlagen und scheint vom Leben nichts
110
mehr zu erwarten. Könntest du dir für sie etwas Zeit
nehmen?«
Gleich bei der ersten Begegnung mit ihr merkte ich,
dass ihr Wille vollkommen passiv geworden war und
dass sie Gott überhaupt nicht mehr glaubte. Sie erzählte
mir, dass sich ein junger Mann in sie verliebt hätt e, und
sie sei ihm auch von ganzem Herzen zugetan gewesen.
Als sie die Frage, ob sie heiraten sollten, vor Gott brachte,
meinte sie, er hätt e ihr durch bestimmte Bibelstellen
bestätigt, dass sie heiraten würden. Sie hatt e sich auf
diese Bibelverse berufen und ihre Hoff nung, dass sie zusammenkommen
würden, darauf gegründet.
Als sich ihre Beziehung nicht so entwickelte, wie sie
gehott hatt e, verlor sie allen Glauben und alles Vertrauen
in Gott und gab auf. Sie wollte nichts mehr davon
hören. Sie weigerte sich, sich auch nur irgend etwas von
dem zu Herzen zu nehmen, was ich sagte, und im Verlauf
unseres Gesprächs fi ng sie an, sich zu winden wie
ein Aal und machte Bemerkungen, die überhaupt nicht
zum Thema gehörten.
Als unser Gespräch zu Ende war, wusste ich, dass
das, was ich gesagt hatt e, überhaupt nicht zu ihr durchgedrungen
war. Schwer bedrückt begann ich, intensiv
für unser nächstes Zusammensein zu beten. Mir kamen
die Worte aus 2. Timotheus in den Sinn: »Ein Knecht des
Herrn aber soll … gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam,
und die Widersacher in Santt mut zurechtweisen
und hoff en, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis
der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick
des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von
ihm gefangen worden sind für seinen Willen« (2. Timotheus
2,24-26). Diese Verse schienen mir etwas zu dieser
Situation zu sagen.
Ich betete: »Vater, ich bitt e dich, dass du Marti Buße
111
schenkst, dass du sie zur Erkenntnis der Wahrheit führst,
und ich bitt e dich, dass sie zur Vernuntt kommt und den
Schlingen des Teufels entgeht, der sie ge fangen hält, damit
sie seinen Willen tut. Vater, schenke doch, dass sie
ihren Willen wieder dir überlässt, dann wird es für sie
neues Licht und neue Hoff nung geben.«
Am nächsten Tag trafen wir uns wieder. Ich sagte ihr,
ich hätt e über sie nachgedacht, seit wir das letzte Mal
miteinander gesprochen hatt en.
»Als du gebetet hast, dass du den jungen Mann heiraten
wolltest«, sagte ich, »und als du Bibelstellen gefunden
hast, die dich darin bestätigten, und es dann doch
nichts wurde, hast du dein Vertrauen zu Gott und zu
seinem Wort verloren, nicht wahr?«
»Das stimmt«, gab sie zu. »Ich glaube, Gott hat mich
im Stich gelassen.«
»Du weißt, Marti, dass es nirgends in der Bibel ei nen
Vers gibt, der sagt: ›Der und der wird mein Mann.‹ Gott
hat dich nicht im Stich gelassen. Du wolltest, dass die
Bibel das sagt, und du hast es aus einigen Versen herausgelesen,
stimmt’s?«
Sie gab es zu.
»Du solltest nicht an Gott und seinem Wort zweifeln,
sondern an manchen Dingen, die du aus seinem Wort
herausliest, die aber gar nicht drinstehen.« Sie meinte,
daran habe sie bisher noch nicht gedacht.
Dann sagte ich ihr, wie gefährlich es sei, wenn unser
Wille passiv wird. »Marti, ich möchte dich sagen hören:
›Ich will aus dieser Sache heraus.‹« Aber wieder schien
sie mir zu entgleiten, als sie anfi ng, unklar und ausweichend
zu sprechen.
Ich las mit ihr den Abschnitt aus 2. Timotheus, an
den Gott mich erinnert hatt e. Während ich die Verse las,
schien sie mir zum ersten Mal richtig zuzuhören und
112
ein klein wenig zu erfassen, wie wichtig das war, was
da mit ihr vor sich ging.
»Ich dachte, Gott würde alles tun, um mich aus diesem
Zustand herauszuholen, aber nun sehe ich, dass
mein Wille aktiv werden muss. Ich dachte, Gott sei dafür
verantwortlich, mich aus meinen negativen Gedanken
und Depressionen herauszuholen, aber ich habe nicht
gewusst, dass ich auch etwas dazu beitragen muss.«
Ich sagte ihr, sie müsse ihr »Sentt orn« an Glauben (Matthäus
17,20) dazu beitragen und sich dafür entscheiden,
auf Gott es Wort zu vertrauen. Da alle ihre Gedanken
sich in eine ganz hoff nungslose Richtung bewegten
und stets damit endeten, dass sie Gott in Frage stellte,
schlug ich vor, sie sollte anfangen, ein Tagebuch zu führen.
Ich ermunterte sie dazu, alle ihre negativen, zweifelnden
Gedanken in diesem Tagebuch zu Papier zu
bringen und dann im Anschluss an ihre Gedankengänge
etwas aus Gott es Wort aufzuschreiben, das direkt etwas
zu den Gefühlen zu sagen hatt e, die sie vorher geäußert
hatt e. Wenn ihre Gedanken sie zum Beispiel zu
der Annahme verleiteten, Gott habe sie verlassen, sollte
sie ihre Tagebuchseite mit den Worten Jesu beschließen:
»Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«
(Hebräer 13,5).
Ich sagte ihr, ich wüsste, dass sie im tiefsten Grunde
ihres Herzens gern herauskäme aus ihrer Verzweifl ung,
dass sie aber ihren Willen üben müsste. Dann schlug ich
vor, zusammen zu beten.
»Ich habe so ott gebetet, aber es bringt nichts«, sagte
sie.
»Aber ich möchte mich gern an deine Seite stellen«,
gab ich zurück, »und ich möchte deine Last mitt ragen,
indem ich mit dir bete. Du denkst von dir, du hast keinen
Glauben und kannst nicht vertrauen. Ich möchte,
113
dass du jetzt denkst: ›Ich nehme eine neue Gewohnheit
an, ich nehme Gott beim Wort.‹ Lass dir Zeit, diese
neue Gewohnheit zu entwickeln. Ich verspreche dir,
dass ich in den nächsten zwei Monaten jeden Tag für
dich beten werde.«
Dann beteten wir zusammen. Sie sagte Gott , dass
sie ihren Willen ganz dem Unglauben überlassen hatt e
und dass sie ihm nun ihren Willen zurückgeben wollte,
um ihm und seinem Wort zu vertrauen. Ich betete
für sie und ermutigte sie, auch noch andere zu fragen,
ob sie für sie beten würden, denn bis jetzt hatt e sie mit
niemandem über das gesprochen, was sie durchmachte.
Am Abend jenes Tages schrieb ich in mein Tagebuch:
»Ich glaube, dies kann ein Wendepunkt in Martis Leben
werden. Ich bete, dass es einer wird.«
Zwei Tage später rief ich sie an. Sie hatt e gerade über
drei Stunden in der Bibel gelesen, und sie erkannte nach
und nach, wie sie sich in vieler Hinsicht hatt e täuschen
lassen. »Zum Beispiel hatt e ich geglaubt, dass es mit
meinem Leben bergab ginge«, sagte sie, »aber in 2. Korinther
3,18 steht, dass wir ›verwandelt werden in dasselbe
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom
Herrn, dem Geist, geschieht‹. Vor allem aber sehe ich
nun, welche Rolle mein Wille dabei spielt, Gott die Möglichkeit
zu geben, mich zu verändern.«
Marti schien dankbar für meinen Anruf, und ich freute
mich, denn ich merkte, wie sie dabei war, es sich zur
Gewohnheit zu machen, Gott zu vertrauen.
Seit unserer Begegnung sind nun vier Jahre vergangen,
und Marti hat nicht nur völlig aus ihrer Verzweiflung
herausgefunden, sondern sie hat auch in den letzten
beiden Jahren im Ausland einen fruchtbaren Dienst
für Gott getan.
114
Marti hatt e entdeckt, wie lebenswichtig es ist, dass
wir unseren Willen im aktiven Gehorsam gegen über
der Wahrheit der Schritt üben, denn Satan schießt immer
wieder feurige Pfeile auf uns ab, um unseren Glauben
zu untergraben. Er kommt immer wieder in unterschiedlichster
Gestalt und sät Zweifel und Unglauben
in unser Herz und unsere Sinne, wo er nur kann.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er ein überwundener
Feind ist. Christus hat Satan am Kreuz besiegt,
und wenn wir daran denken, dass wir in Christus
sind, können wir vom Sieg her kämpfen.
Der Apostel Paulus wusste um unsere Siegesposi tion.
Er schrieb:
»Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr
wisst, was die Hoff nung seiner Berufung, was der Reichtum
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und
was die überragende Größe seiner Kratt an uns, den
Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner
Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen,
indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner
Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über
jede Gewalt und Macht und Kratt und Herrschatt und
jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern
auch in dem zuküntt igen genannt werden wird.
Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als
Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib
ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt« (Epheser
1,18-23).
Auf unserem Weg durch das Leben und in den vielen
Glaubenskämpfen, die es zu bestehen gilt, sollten
wir uns auf unsere rechtmäßige Stellung in Christus berufen.
Vor allem aber müssen wir den Schild des Glaubens
ergreifen, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen
auslöschen können.
115
»Fünfundsiebzig Prozent« des Lebens
Es gibt Zeiten im Leben, in denen wir sehr entmutigt
sind, weil wir so viele Prüfungen und Kämpfe zu bestehen
haben. Don Meredith, einer meiner Freunde und
Gründer der Organisation »Christliches Familienleben«,
eines christlichen Seelsorgedienstes in den USA, hat hinsichtlich
solcher Zeiten eine interessante Theorie.
Kürzlich schütt ete ihm seine Sekretärin, Carol Wierman,
ihr Herz aus und brachte all die Probleme und
Schwierigkeiten, denen sie sich ausgesetzt sah, zur Sprache.
Als sie fertig war, meinte Don: »Carol, was Sie mir
da sagen, ist nicht ungewöhnlich. Fünfundsiebzig Prozent
unseres Lebens bestehen aus Kämpfen, Sorgen, Enttäuschungen
und Prüfungen. Mit diesen fünfundsiebzig
Prozent sind wir immer konfrontiert. Sie müssen nur
eines tun: Sie müssen dafür sorgen, dass diese fünfundsiebzig
Prozent Ihres Lebens nicht von Unglauben gekennzeichnet
sind, sondern von Glauben, vom Vertrauen
auf Gott und vom Hoff en auf ihn.«
Dann fügte er fast schelmisch hinzu: »Während der
restlichen fünfundzwanzig Prozent vertrauen Sie Gott
und genießen Sie das Leben!«
Als Carol mir von diesem Gespräch erzählte, dachte
ich, welch große Weisheit Dons Rat doch enthielt. Jesus
selbst sagte, wir müssten in dieser Welt mit Schwierigkeiten
rechnen. Wir lassen uns aber ott dazu verleiten
zu glauben, dass wir keine Probleme haben dürtt en und
dass hinter der nächsten Ecke das Glück wartet.
Ott beherrscht eine »Wenn-dann«-Vorstellung unser
Denken. »Wenn ich erst aus der Schule bin, dann wird
alles gut.«
»Wenn ich verheiratet bin, dann werde ich glücklich
sein.«
116
»Wenn ich diese Schwierigkeit hinter mich bringe,
dann ist alles in Ordnung.« Und so geht es weiter. Aber
meistens kommt alles ganz anders.
Wie Don sagte, ist es nichts Ungewöhnliches für uns,
wenn wir Schwierigkeiten und Kummer zu bestehen haben.
Wir empfi nden den Schmerz, aber wir wissen ott
nicht, wie wir unsere Erfahrung von einem objektiven
Standpunkt aus betrachten sollen. Es ist verständlich,
dass wir zu persönlichen Schwierigkeiten ott nicht den
nötigen Abstand haben können, dass wir es nicht schaffen,
einen Schritt zurückzutreten und von dem neuen
Standpunkt aus zu bewerten, was da vor sich geht. Die
Folge davon ist, dass wir überhaupt keinen Nutzen aus
der Erfahrung ziehen.
Ich habe erkannt, dass es ein ganz realer Bestandteil
des täglichen Glaubenslebens ist zu lernen, die Lebenserfahrung
zu »objektivieren«. Ich habe eine einfache Tabelle
entworfen, mit deren Hilfe ich mir über meine persönlichen
»fünfundsiebzig Prozent« klar werde.
Wenn ich eine bestimmte Situation durchdenken will,
nehme ich mir zuerst einmal ein Blatt Papier und teile
es in vier Abschnitt e ein.
In den ersten Abschnitt schreibe ich alles Gute und Positive,
das ich zu dieser Situation sagen kann. Wenn mein
Problem zum Beispiel mit einem bestimmten Menschen
zusammenhängt, schreibe ich alles auf, was ich an diesem
Menschen schätze.
In den zweiten Abschnitt schreibe ich alle negativen Dinge,
die mir zu der Angelegenheit einfallen; ich führe alles
auf, was mir nicht gefällt. Meistens sind das Dinge,
mit denen ich mich nur schwer einverstanden erklären
kann.
Jemand hat einmal gesagt, schwierige Verhältnisse
und Menschen würden in unserem Herzen die nega
117
tiven Reaktionen nicht hervorbringen, sondern nur enthüllen,
was dort schon vorher vorhanden war. Der Ausspruch:
»Er bringt meine schlimmsten Seiten ans Licht«,
ist gar nicht so verkehrt; »er« lässt diese »schlimmsten
Seiten« in uns nicht erst entstehen, sondern er bringt
sie ans Licht! Ott bin ich mir dieser »schlimmen Seiten«
in meinem Herzen gar nicht bewusst, bis dann etwas
in meinem Leben geschieht, durch das sie off enbar
werden.
In Abschnitt drei schreibe ich meine Reaktionen auf die
Dinge, die ich in Abschnitt zwei erwähnt habe. Ich habe
festgestellt, dass es äußerst wichtig ist, in Bezug auf meine
inneren Reaktionen und äußeren Verhaltensweisen
sehr ehrlich zu sein. In diesem Abschnitt tauchen dann
immer wieder verschiedene Verhaltensmuster auf wie
Hass, Empfi ndlichkeit, Mangel an Vergebungsbereitschatt
oder Ungeduld.
Mein nächster Schritt ist dann, dass ich Gott all das
bekenne, was ich in diesem Abschnitt aufgeschrieben
habe. Ott kommen da Haltungen zutage, die das genaue
Gegenteil zur Frucht des Geistes – Liebe, Freude,
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Santt mut,
Enthaltsamkeit (Galater 5,22-23) – sind. Dann sage ich:
»Herr, ich stimme dir zu, dass ich im Unrecht bin und
du im Recht bist.«
In Abschnitt vier schreibe ich, was Gott mich off enbar
durch diese Situation lehren will. Zum Beispiel, wenn
ich Hass in meinem Herzen entdecke, wird Gott mich
lehren wollen zu lieben. Wenn ich Ungeduld vorfi nde,
möchte er mich wahrscheinlich Geduld lehren.
Dann nehme ich mir eine biblische Handkonkordanz
oder ein gutes Begriff slexikon zur Bibel her und
suche Bibelverse heraus, die in meine Situation hineinsprechen.
118
Hier ein Muster der Tabelle:
Was mir an … gefällt
Was mir an … nicht gefällt
Meine Empfi ndungen und Reaktionen
Was Gott mich lehren möchte oder Bibelstellen
zu meinem Problem
Wenn ich alle meine Gedanken und Gefühle zu Papier
gebracht habe, danke ich Gott noch einmal für alles,
was ich in Abschnitt zwei und drei aufgeschrieben
habe. Ich tue das, weil ich weiß, dass er mir auch diese
Dinge in meinem Leben zum Besten dienen lässt.
Obwohl ich an meinen Reaktionen, die ich in den dritten
Abschnitt eintrage, immer wieder erkenne, wie weit
ich noch hinter den biblischen Forderungen zurückbleibe,
habe ich doch gelernt, nicht über mich selbst entmutigt
zu sein oder über mich zu Gericht zu sitzen. Auch
wenn mich die Sünde betrübt, die sich in meinem Herzen
fi ndet, verdamme ich mich nicht, weil auch Gott
mich nicht verdammt.
Im Gegenteil: Ich bin frei geworden, meine Sündhaftigkeit
einzugestehen, weil ich weiß: Wenn ich Gott gegenüber
ehrlich bin in Bezug auf das, was in meinem
Herzen ist, habe ich schon den ersten Schritt zu meiner
Sinnesänderung getan.
Dazu hat mich das Büchlein The Practice of the Presence
of God (»Praxis der Gegenwart Gott es«) von Bruder
Lawrence, einem Christen aus dem 17. Jahrhundert,
ermutigt.
Bruder Lawrence hatt e sehr engen Umgang mit Gott .
Wenn er sündigte, hob er seine Hände zum Himmel
empor und sagte zu Gott : »Ich werde mich nie ändern,
wenn du mich mir selbst überlässt.«
1
Er vertraute ganz
1 Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God, Fleming H. Revell Co.,
Old Tappan, New Jersey, 1958, S. 16
119
und gar auf Gott , weil er erkannte, dass er Gott es Kratt
brauchte, um ein christliches Leben führen zu können.
Ich habe diese Worte von Bruder Lawrence Gott ott
vorgetragen und zusätzlich gebetet: »Vater, tu du für
mich durch deinen Heiligen Geist, was ich für mich
selbst nicht tun kann.«
Die Bibel war für mich lange Zeit wie ein Gesetz oder
eine Drohung, die über meinem Haupt schwebte und
mich verdammte, weil ich den Maßstäben nicht genügte.
Ich weiß heute, dass Gott es Wort keine Drohung ist,
sondern die Verheißung all dessen, was er durch seinen
Geist in meinem Leben tun will.
Ott habe ich Menschen zu mir sagen hören: »Ney, ich
habe eine bestimmte Sünde immer und immer wieder
bekannt, aber ich habe in dem Bereich keine Fortschritt e
gemacht.« Dann nennen sie meist eine bestimmte Handlung
oder Haltung, wie sie in Abschnitt drei unserer Tabelle
aufgeführt sein könnte.
In der Regel frage ich dann: »Erneuerst du auch deinen
Geist mit einer Bibelstelle, die etwas zu dem zu sagen
hat, was du bekannt hast?« Sehr häufi g sagen mir
die Gesprächspartner dann, sie hätt en noch nie daran
gedacht, das zu tun. Mit anderen Worten: Sie haben
Gott vielleicht ihre »Ungeduld« bekannt, aber sie sind
nicht weitergegangen und haben nicht über einen Bibelabschnitt
, in dem es um Geduld geht, nachgedacht,
um sich in diesem Punkt Gott es Perspektive zu eigen
zu machen.
Da Gott uns bestimmte Sünden in unserem Leben
klar werden lässt, wie etwa die Ungeduld, müssen wir
ihm diese Sünden auch jeweils gesondert bekennen.
Dann müssen wir unsere Gedanken mit einem Abschnitt
aus Gott es Wort füllen, der speziell etwas zu der Sünde
zu sagen hat, die wir Gott bekannt haben. Der Heili
120
ge Geist kann durch diesen Schritt abschnitt in uns wirken
und anfangen, unser Denken so zu erneuern, wie
es Gott gefällt.
Einer der Vorteile der Tabelle ist, dass wir, obwohl wir
uns in Abschnitt zwei auf das konzentrieren, was uns
an einem Menschen oder einer Situation nicht gefällt,
in Abschnitt vier damit abschließen, dass wir selbst die
Verantwortung für unser Verhalten übernehmen und
einen Bibelabschnitt fi nden, der uns unsere Not bewältigen
hiltt . Die Person oder die Situation, die anfangs
wie ein Mühlstein an unserem Hals zu hängen schien,
wird nun zu einem Segen, den Gott gibt, um uns mehr
über sein Wesen zu lehren.
Eine solche Situation erlebte ich im Januar 1977.
Es fi ng damit an, dass Robert Pitt enger, ein enger
Mitarbeiter von Bill Bright, zu uns zum Essen kam und
mich mit den Worten begrüßte: »Ney, ich habe mir
überlegt, dass es gut wäre, wenn du zur Amtseinführung
des Präsidenten nach Washington fahren würdest.
Carol Lawrence (eine bekannte Sängerin und Schauspielerin)
ist von Jimmy Carter gebeten worden zu singen,
und da wir dort als ihre Gastgeber fungieren, wäre es
schön, wenn du hinfahren könntest, um dich um sie zu
kümmern. Ich werde Dr. Bright ein Te lex nach Afrika
schicken und ihn fragen, was er dazu meint.«
Die Sache klang fantastisch, war aber doch ein wenig
weit hergeholt für mich.
»Es ist wirklich lieb von dir, dass du mich da hinschicken
willst, Robert, aber ich weiß nicht … Gott hätte
schon eine Menge zu tun, wenn alle Einzelheiten in
so kurzer Zeit zusammenpassen sollten. In ein paar Tagen
werde ich verreisen, also gehe ich einfach davon
aus, dass ich nicht nach Washington fahre, es sei denn,
ich höre von dir.«
121
Zwei Tage später fl og ich nach Seatt le, um auf einer
Mitarbeiterkonferenz von Campus für Christus zu sprechen,
dann nach Litt le Rock, Arkansas, zu einer weiteren
Konferenz. Ich kam am Spätnachmitt ag in Litt le Rock an
und meldete mich zunächst in meinem Hotel. An der Rezeption
lag eine Mitt eilung für mich, dass ich Dr. Brights
Büro in Arrowhead Springs anrufen sollte.
Ich wählte die Nummer, und Jim Pratt , ebenfalls ein
enger Mitarbeiter von Bill Bright, war am Apparat. »Ney,
Dr. Bright möchte unbedingt, dass du zur Amtseinführung
des Präsidenten fährst.«
»Tatsächlich, Jim?«
»Ja, alles ist geregelt. Du wirst dort erwartet.«
Ich legte den Hörer auf und war wie benommen. Laut
sagte ich zu mir: »Ist das wirklich wahr? Herr, was soll
ich dann anziehen?« Ich hatt e nichts, was für ein so feierliches
Ereignis passend gewesen wäre, und ich hatt e
auch nicht genug Geld, um mir etwas zu kaufen.
Als ich auf der Konferenz an jenem Abend die einleitenden
Worte sprach, gab ich meine Neuigkeit weiter.
Denn normalerweise war ich bei einer Konferenz während
der ganzen Zeit anwesend, dieses Mal aber musste
ich früher weg, zurück nach Dallas und dann weiter
zur Amtseinführung des Präsidenten. Die Konferenzteilnehmer
freuten sich riesig für mich.
Als ich an jenem Abend nach der Versammlung wieder
in mein Hotelzimmer kam, überfi elen mich sorgenvolle
Gedanken darüber, was ich in Washington anziehen
sollte. Als ich im Bett war, setzte ich mich aufrecht
hin, schob mir die Kissen in den Rücken und nahm meine
Bibel zur Hand. Ich war schon so sehr daran gewöhnt,
meine Tabelle zu verwenden, dass ich mich gleich daranmachte.
In Gedanken ging ich die Schritt e durch und
analysierte die Situation mit aller Sorgfalt.
122
Mir gefi el der Gedanke, nach Washington zu gehen.
Mir gefi el nicht, dass ich nicht die richtige Kleidung hatte
und auch kein Geld, sie mir zu kaufen. Meine Reaktion
war, dass ich mir Sorgen machte. Es war mir nicht
bewusst gewesen, in welchem Ausmaß Sorgen und Unglauben
in meinem Herzen schlummerten, bis sie durch
diese Situation enthüllt wurden. Ich bekannte Gott meine
Befürchtungen, und es wurde mir klar, dass Gott
mich Glauben lehren wollte.
Dann fi el mir die Stelle aus der Bergpredigt ein, wo
Jesus über die Sorgen wegen Nahrung und Kleidung
spricht. Ich schlug sie schnell auf und begann zu lesen:
»Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt für euer
Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch
für euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das
Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung?
… Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet
die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen
sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber,
dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet
war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras
des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen
wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch
tun, ihr Kleingläubigen?« (Matt häus 6,25.28-30).
»Herr, ich bekenne, dass ich mir Sorgen darüber mache,
was ich anziehen soll. Aber du sagst hier, dass du
die Lilien und das Gras kleidest und dass du mich nicht
vergessen willst. Ich bekenne meinen Kleinglauben! Ich
möchte dir glauben!«
»So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen
wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was
sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten
die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß,
dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach
123
dem Reich Gott es und nach seiner Gerechtigkeit! Und
dies alles wird euch hinzugefügt werden« (Matt häus
6,31-33).
»Herr, nach meinem besten Wissen sorge ich mich
vor allem um deine neue Welt und lebe nach deinem
Willen. Aber ich bin so froh, dass du meine Bedürfnisse
kennst und für mich sorgen willst. Du wirst mich mit
allem anderen versorgen. Ich glaube, dass dein Wort
wahrer ist, als ich es im Augenblick empfi nde, und ich
bitt e um deine Versorgung – und ich danke dir für die
Art und Weise, auf der du für mich sorgen wirst.«
Ich machte das Licht aus und kuschelte mich unter
die Decke. Kurz vor dem Einschlafen sang ich Teile aus
einem Lied vor mich hin: »Suchet, so werdet ihr fi nden,
klopfet an, so wird euch aufgetan …« Mir fi el dabei ein,
dass ich anfangen könnte, »zu suchen« und »anzuklopfen«,
wenn ich nach Kleidung fragte, die ich mir vielleicht
leihen konnte.
Am nächsten Morgen merkte ich, dass ich noch über
eine kleine Summe einen Scheck einlösen musste, um
meine Heimreise bezahlen zu können. Meine Freundin
Carol Wierman war Kassenwart auf der Konferenz und
bot mir an, den Scheck für mich einzulösen.
Als ich gerade hinten in einem Raum saß, um einem
Vortrag zuzuhören, brachte sie mir das Geld. Sie hockte
sich neben meinen Stuhl hin, gab mir außer meinem
Geld noch zwei Zehndollarscheine und fl üsterte mir
zu: »Hier, Ney, für irgendwas, was du für deine Reise
brauchen kannst.«
Ich gab ihr die zwei Scheine zurück und protestierte:
»Carol, das ist sehr lieb von dir, aber ich kann es nicht
annehmen!«
Sofort drückte sie mir das Geld wieder in die Hand.
»Ney, ich möchte, dass du es annimmst. Ich glaube, Gott
124
will, dass ich es dir gebe.« Carol ging weg, und ich saß
da, mit einem Kloß im Hals und zwei Zehn-Dollar-Scheinen
im Schoß.
Am gleichen Tag gab mir Ann Parkinson, eine andere
Freundin, die an der Konferenz teilnahm, ein Briefchen.
Mir blieb der Mund off en stehen, als beim Auff alten
des Blatt es dreißig Dollar herausfi elen.
Ich hatt e den Brief noch in der Hand, als Don Meredith,
der Konferenzredner, auf mich zukam und sagte:
»Na, hast du schon deine Einkäufe gemacht für die Amtseinführung
des Präsidenten?«
»Nein, Don, ich wollte mir eigentlich nichts kaufen.
Ich dachte, ich könnte mir etwas leihen.«
Er war schockiert. »Ich will nicht, dass du dir etwas
leihst. Du sollst dich für diesen Anlass ganz neu einkleiden.
Darf dir die Organisation ›Christliches Familienleben‹
150 Dollar schenken?« Ehe ich noch antworten
konnte, hatt e er sein Scheckbuch herausgezogen und
stellte mir über diese Summe einen Scheck aus. Ich war
sprachlos!
Spät am Abend saß ich in meinem Hotelzimmer, hatt e
den Kopf in die Hände gestützt und blickte auf die drei
Zehn-Dollar-Scheine, den Zwanzig-Dollar-Schein und
den Scheck über 150 Dollar, die vor mir lagen. Ich lobte
Gott angesichts dieses Geldes, das er mir als direkte
Antwort auf meine Bedürfnisse geschenkt hatt e, keine
vierundzwanzig Stunden nach meinem Gebet. Ich war
ganz überwältigt vor Freude.
Sofort rief ich eine Freundin an, um ihr mitzuteilen,
was Gott für mich getan hatt e, damit sie sich mit mir
freuen konnte. Nachdem ich alles erzählt hatt e, sagte
sie: »Ich möchte zu dem, was Gott dir gegeben hat, noch
fünfundzwanzig Dollar dazugeben.«
Und es sollte noch mehr werden.
125
Ich verließ Litt le Rock am Sonntag und wollte in Dallas
Station machen. Meine Mitbewohnerin Mary Graham
und ich waren für den Abend zur Einweihungsfeier
einer Gemeinde eingeladen.
Ich traf mich mit Mary am Flugplatz. Als wir bei der
Gemeinde ankamen, entdeckte uns eine meiner Freundinnen,
Ann West, und kam auf uns zugestürzt.
»Ney, was machst du denn in Dallas?«
»Annie, du wirst es nicht glauben, aber ich bin auf
dem Weg zur Amtseinführung des Präsidenten.«
»Tatsächlich? Das ist ja großartig. Was ziehst du denn
an?«
»Wie komisch, dass du danach fragst. Ich will mir
morgen was kaufen. Und Ann Parkinson hat mir vorgeschlagen,
ich sollte eine ihrer Freundinnen anrufen und
mir von ihr ein paar lange Kleider leihen.«
»Das brauchst du nicht! Ich habe einige Sachen, die
kannst du bestimmt tragen. Komm doch heute Abend
mit zu mir.«
Um Mitt ernacht war ich damit beschätt igt, Anns
Schrank durchzusehen und schwarze Samtröcke und
zau berhatt e Abendkleider anzuprobieren. Als Mary
und ich etwas später Anns Wohnung verließen, hatt e
ich zwei elegante Roben, die für jede Abendveranstaltung
in Washington geeignet waren.
Am nächsten Tag kautt e ich von dem Geld, das ich
wäh rend der Konferenz in Litt le Rock erhalten hatt e, eine
wunderschöne füntt eilige Kombination mit Rock und
Hose in einem exklusiven Konfektionshaus in Dallas.
Die Dame, die mir die Hose absteckte, staunte, als
ich sagte: »Wissen Sie, das ist das Teuerste, was ich mir
je an Kleidung gekautt habe.«
»Is ja wohl nich möglich«, meinte sie stark dialektgefärbt
und sah verwundert auf.
126
»Doch, wirklich!«
»Ja, und, wie kommt’s?«, fragte sie. »Wohin soll’s
denn gehen?«
»Wollen Sie das wirklich genau wissen?« »Klar, sagen
Sie schon!«
Ich erzählte ihr von meiner Einladung, dass ich erst
nichts anzuziehen hatt e und wie Gott dann so wunderbar
für mich gesorgt hatt e. Mit Ehrfurcht in der Stimme
sagte sie: »Seit sieben Jahren bin ich hier Abteilungsleiterin;
ich hab das noch nie getan, und ich tu’s auch nie
wieder, aber weil Sie mir diese Geschichte erzählt haben,
mach ich die Änderung umsonst.« Und sie machte
die Änderung nicht nur umsonst, sie machte sie auch
innerhalb von zwei Stunden, obwohl man normalerweise
einige Tage darauf warten muss.
Als ich an jenem Abend für Washington packte, betrachtete
ich meine Kleidung: zwei wunderschöne lange
Kleider, die neue Kombination, eine neue Hand tasche,
neue Schuhe und neuer Modeschmuck. Gott hatt e überreichlich
geschenkt, »mehr, als wir erbitt en oder erdenken«
können (Epheser 3,20).
Am nächsten Morgen brachte mich Mary zum Flughafen
von Dallas. Als ich auf den Aufruf für meine Maschine
wartete, war ich ein wenig besorgt wegen der
neuen und ganz anderen Situation, mit der ich in den
nächsten Tagen konfrontiert sein würde. Ich holte meine
Bibel heraus und schlug Matt häus 6 auf. Der letzte
Vers des Kapitels sprach mich besonders an:
»So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag!
Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder
Tag hat an seinem Übel genug« (Matt häus 6,34).
Ich betete still für mich: »Herr, ich danke dir noch
einmal dafür, dass du so wunderbar für mich gesorgt
hast. Danke für diese Gelegenheit, nach Washington
127
zu gehen. Jetzt will ich mich dafür entscheiden zu
glauben, dass der morgige Tag für sich selber sorgen
wird …, dass du für mich sorgen wirst …, ich weiß
noch nicht, was morgen sein wird, aber ich danke dir,
dass deine Gnade genügen wird, wenn der morgige
Tag kommt.«
Die Passagiere wurden aufgerufen. Im Flugzeug setzte
sich ein vornehmes Ehepaar neben mich, das ebenfalls
zur Amtseinführung fl og. Der Mann hatt e viele
Amtsbezeichnungen, unter anderem war er der ehemalige
Leiter des Amts für indianische Angelegenheiten.
Als das Flugzeug landete, hatt e ich eine Einladung, als
Gast des Paares den Amtseinführungsball der Indianer
Amerikas zu besuchen!
Robert Pitt enger, der als Erster von der Möglichkeit
gesprochen hatt e, dass ich zur Amtseinführung des Präsidenten
fahren sollte, holte mich in Washington am National
Airport ab.
»Ney, der Manager von Carol Lawrence hat gerade
angerufen und gesagt, sie sei krank und könne nicht
kommen.«
»Macht nichts, Robert. Gott hat sich bei dieser Reise
schon selbst übertroff en. Ich weiß, dass mein Hiersein
einen Grund hat.«
Der Segen Gott es zeigte sich auf dieser Reise auf vielfältige
Weise. Ich fand viele neue Freunde, besich tigte
das Weiße Haus und das Parlamentsgebäude, ging zum
Ball der Indianer und sah die Hauptstadt im festlichen
Glanz.
Und ich hatt e einige wichtige Glaubenslektionen neu
gelernt während jener aufregenden Vorbereitungstage.
Ich glaube, meine Einstellung der Amtseinführung gegenüber
wurde in dem Moment anders, als ich meine
Angst erkannte und mich bewusst darauf konzentrierte,
128
einen Bibelabschnitt zu fi nden, der mir in meiner Not
etwas zu sagen hatt e.
Ich war besorgt und brauchte etwas anzuziehen. Ich
hätt e dabei stehen bleiben und mir weiterhin Sorgen
machen können – in der Vergangenheit war das ott der
Fall gewesen. Aber weil ich gelernt hatt e, die Umstände
in meinem Leben objektiv zu betrachten, konnte ich
meine Lage so sehen, wie Gott sie sah.
Als ich Matt häus 6 las, erneuerte ich mein Denken
durch Gott es Wort und war deshalb in der Lage, die Situation
aus seinem Blickwinkel zu sehen. Ich sprach
ehrlich mit ihm über meine Gefühle, aber ich entschied
mich dafür, nicht meinen Gefühlen, sondern seinem
Wort zu glauben. Ich hielt mich an seine Verheißungen,
dass er sich um meine Bedürfnisse kümmern würde, als
ich noch längst nicht das Gefühl hatt e, für meine Bedürfnisse
würde gesorgt werden.
Die Schwierigkeiten, die wir immer wieder zu bestehen
haben, sind unterschiedlicher Art und reichen
von den kleinen Nöten des Alltags bis hin zu großen
Konfl ikten. Ob wir es mit dem normalen »Auf und Ab«
des Lebens zu tun haben oder mit dem Schwersten, das
uns je begegnet ist, wir sollten nicht vergessen, dass
uns unsere »fünfundsiebzig Prozent« das ganze Leben
hindurch erhalten bleiben. Aber diese Schwierigkeiten
können sich als die größten Segnungen Gott es für uns
erweisen, wenn wir unsere Erfahrungen objektiv betrachten
lernen und mitt en in ihnen Gott vertrauen.
129
Versagen und Vergebung
Es gibt Zeiten, in denen ich so eng mit Gott lebe und so
zufrieden bin, dass ich denke: »Jetzt will ich mein ganzes
Leben lang nichts anderes mehr tun, als ihn zu lieben,
ihm zu dienen und ihm zu gefallen. Endlich führe
ich ein richtiges Christenleben, endlich lebe ich sieghatt .
Von jetzt an wird alles gut gehen.«
Aber kaum denke ich, dass ich es jetzt geschatt habe
und nie mehr versagen werde, überrasche ich mich
selbst. Ich versage.
Und weil ich überrascht bin, neige ich dann wohl zu
der Ansicht, Gott müsste auch überrascht sein.
Ich weiß noch, dass ich einmal in einer Weise versagte,
wie ich nie wieder versagen möchte. Ich war danach
schrecklich deprimiert und verzweifelt und fragte mich,
wie ein so sündiger Mensch wie ich überhaupt in den
hauptamtlichen christlichen Dienst geraten konnte.
Damals wohnten Jean und ich zusammen, und sie
merkte, dass ich sehr verzweifelt war.
Mitfühlend sagte sie: »Ney, Gott ist nicht überrascht,
dass du versagt hast.«
Ich konnte das kaum glauben und rief: »Wirklich
nicht?«
Als wollte sie mir diese Wahrheit einhämmern, wiederholte
Jean: »Nein, Gott ist nicht überrascht, dass du
versagt hast.«
»Ja, Jean, aber manchmal wünschte ich, ich könnte
vollkommen sein. Ich möchte nicht sündigen, aber ich
kann mein Maß der Vollkommenheit einfach nicht erreichen.
Ich bin sehr entmutigt, weil ich wieder versagt
habe.«
»Ich verstehe schon, was du empfi ndest, Ney. Weißt
du, es ist interessant, aber zu dem Zeitpunkt, in dem wir
130
Christus annehmen, wissen wir, dass wir vollkommen
geliebt werden und dass er uns ganz vergeben hat. Aber
wenn wir dann in unserem Leben als Christen wachsen,
kann sich das ändern.
Vielleicht fangen wir an, uns mit Leuten zu vergleichen,
die geistlich reifer sind; oder wir messen uns an
den Maßstäben einer Organisation, der wir angehören;
oder aber am Maßstab der Bibel. Und wenn wir dann
einem dieser Maßstäbe nicht entsprechen, fangen wir
an, uns selbst zu verdammen.
Wenn wir das tun, haben wir ganz vergessen, dass
es Gott ist, der unseren Glauben wachsen lässt (vgl. 1.
Korinther 3,6-7).
Ganz gleich, an welchem Punkt des Wachstums wir
uns als Christen befi nden, wir sind noch immer in Gottes
Zeitplan. Gott liebt und akzeptiert uns noch immer
vollkommen. Er ist gar nicht überrascht darüber, dass
wir dort sind, wo wir sind.«
Ich hörte sehr interessiert zu, als sie weitersprach.
»Nun kann sich eine große Klutt autt un zwischen
dem Punkt, an dem wir sind, und dem, an dem wir sein
möchten; zwischen der Wunschvorstellung, die wir davon
haben, wo wir im Glauben sein sollten, und dem
Punkt, an dem wir uns tatsächlich befi nden. Und nun
fangen wir an, diese Klutt aus eigener Kratt zu überbrücken.
Wir versuchen durch eigene Anstrengung, also auf
fl eischliche Weise, Wachstum zustande zu bringen, und
wir vergessen ganz, dass wir Gott und seine Wege suchen
sollen und dass es sein Geist ist, der dann das
Wachstum in uns wirkt.«
Ich hatt e angefangen, mir einzureden, dass Gott mich
annahm, wenn ich gehorsam war und in meinem Christenleben
alles gut ging. Aber ich konnte nicht einsehen,
131
dass Gott mich auch liebte und akzeptierte, wenn ich
Fehler machte und versagte, wenn ich eine geistliche
Bauchlandung hinlegte und das Leben wegen meiner
Fehler düster und problematisch aussah.
Während Jean mit mir redete, spürte ich zum ersten
Mal seit vielen Tagen eine innere Erleichterung. Was
sie sagte, hatt e Hand und Fuß, und es half mir, alles
mit Gott es Augen zu sehen. Mir wurde langsam klar,
dass ich zwar versagt hatt e, dass aber Gott mich deshalb
nicht aufgab.
Es wurde mir wieder bewusst, dass Gott mich liebt
und akzeptiert, ganz gleich, wie ich mich verhalte, und
das ermutigte mich über alle Maßen, mein Leben wieder
in jeder Hinsicht nach seinem Wort auszurichten.
Und obwohl Vergebung heißt, eine Schuld so auszulöschen,
als sei sie nie geschehen, wusste ich, dass das nicht
bedeutete, einen Freibrief zu haben, um absichtlich zu
sündigen und eigenen Wegen nachzugehen. Vielmehr
wurde ich dadurch nur darin bestärkt, Gott in allen Bereichen
meines Lebens noch mehr zu gefallen.
Ich erkannte, dass ich Frieden und Rechtfertigung in
meinem Inneren nicht fi nden konnte, wenn ich nur auf
mein Verhalten und meine Verdienste achtete. Aber ich
konnte auf das sehen, was Gott über mich sagte, auf meine
Vergebung, meine Stellung und mein Angenommensein
in Christus. Ich konnte mich willentlich entscheiden,
daran zu glauben, und so Frieden fi nden.
Paulus schrieb: »Da wir nun gerechtfertigt worden
sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch
unseren Herrn Jesus Christus« (Römer 5,1). Meine Stellung
in Christus blieb unverändert; mein täglicher Zustand,
mein Verhalten und mein Tun, war das, was sich
änderte.
Die, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, sind nicht
132
auf Probe angenommen. Gott weiß, dass wir nicht Christen
sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Menschen
wurden, sondern dass wir Menschen sind, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt Christen wurden. Schon bevor er
seine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade so reichlich über
uns ausgoss, kannte er unsere Schwächen und Fehler.
Mir wurde klar, dass ich gar nichts tun konnte, um
mein »Image« vor Gott zu verbessern, damit er mich
mehr liebte. Christus war ja für mich gestorben, als ich
noch ein hilfl oser, gott loser, sündhatt er Feind war. Er
liebte mich damals ebenso sehr, wie er mich immer geliebt
hat und immer lieben wird (vgl. Römer 5,6-10).
Jesus sagte: »Wie der Vater mich geliebt hat, habe
auch ich euch geliebt« (Johannes 15,9). Wie Gott seine
Liebe Jesus nicht entzieht, so entzieht er auch mir seine
Liebe nicht. Er hat einen ewigen Bund mit mir geschlossen,
der nie gebrochen wird.
Woher weiß ich, dass Gott mir und meinem Versagen
gegenüber verständnisvoll, barmherzig und voller Vergebung
ist? Ich kann es am Beispiel Jesu sehen.
Der Dienst Christi während seines Erdenlebens war
gekennzeichnet von Vergebungsbereitschatt und Erbarmen:
Er sprach die Ehebrecherin von ihrer Sünde
los in Gegenwart derer, die drauf und dran waren, sie
zu steinigen; die religiösen Führer seiner Zeit warfen
ihm Gott eslästerung vor, weil er sich die Vollmacht
anmaßte, Sünden zu vergeben; sogar als er bereits am
Kreuz hing, sprach er dem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt
wurde, noch das ewige Leben zu. Jesus sagte:
»Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen« (Johannes
14,9). Jesus machte Gott es Vergebung deutlich
und sichtbar.
Von den vielen Begebenheiten, bei denen Jesus Menschen
Vergebung schenkte, ist für mich eine der ermu
133
tigendsten die, wie Jesus mit Petrus umging, als er versagt
hatt e.
Simon Petrus war einer der ersten Jünger, die der Herr
er wählte. In vielen Szenen wird Petrus in seiner ganzen
Begeisterungsfähigkeit und Aufrichtigkeit geschildert.
Er war freigebig, rücksichtsvoll, treu und entschlossen,
Christus zur Seite zu stehen. Er bewies starken Glauben,
sprach von Herzen die Wahrheit und sagte, was er
dachte. Petrus war einer der engsten Freunde Jesu während
seines Erdenlebens, und er liebte seinen Herrn von
ganzem Herzen.
Doch kam die Hingabe von Petrus an Christus wohl
nie deutlicher zum Ausdruck als bei der letzten Passahfeier.
Als Jesus seine Jünger um sich sammelte, um
ihnen zu sagen, was die nächsten Stunden und Tage
bringen sollten, wandte er seine Aufmerksamkeit besonders
Petrus zu.
»Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt,
euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich
gebetet, dass dein Glaube nicht autt öre. Und wenn du
einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder! Er aber
sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis
und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich
sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe
du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst« (Lukas
22,31-34; vgl. Matt häus 26,35). Petrus konnte sich nicht
vorstellen, dass er Jesus je verlassen könnte, und auch
als dieser ihm sagte, Petrus werde ihn in Kürze verleugnen,
weigerte sich Petrus zu glauben, dass er jemals zu
so etwas fähig wäre.
Und dann kam der Augenblick, den Petrus sich nicht
hatt e vorstellen können. Die Stunden, die auf die Passahfeier
folgten, waren für alle wie ein Albtraum gewesen.
Petrus war mit Christus zum Garten Gethse
134
mane gegangen und hatt e dort den Verrat des Judas
miterlebt. Und genau an diesem Ort zog Petrus voller
Verzweifl ung über den Verrat und die ungerechte Verhatt
ung Christi durch die römischen Behörden impulsiv
sein Schwert und schlug einem Sklaven des Hohenpriesters
ein Ohr ab.
Lukas berichtet über die Ereignisse, die auf die Festnahme
Jesu folgten:
»Sie ergriff en ihn aber und führten ihn hin und brachten
ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte
von weitem. Als sie aber mitt en im Hof ein Feuer angezündet
und sich zusammengesetzt hatt en, setzte sich
Petrus in ihre Mitt e. Es sah ihn aber eine Magd bei dem
Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach: Auch
dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte: Frau, ich
kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer
und sprach: Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber
sprach: Mensch, ich bin‘s nicht. Und nach Verlauf von
etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In
Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein
Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was
du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte
ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte
Petrus an; und Petrus gedachte an das Wort des Herrn,
wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst
du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus
und weinte bitt erlich« (Lukas 22,54-62; Hervorhebungen
von der Verfasserin).
Jesus war nicht überrascht, als Petrus versagte. Er hatte
sogar vorher schon für seinen Jünger gebetet, dass er
seinen Glauben nicht verlieren möge. Wir sollten beachten,
dass Jesus nicht darum bat, dass Petrus nicht versagen
solle, sondern darum, dass der Glaube von Petrus
nicht versagte.
135
Ich glaube, Christus wollte damit sagen, wenn Petrus
versagte, dann sollte er dennoch weiterhin glauben, dass
er geliebt wurde und dass ihm vergeben war. Kurz gesagt
gab Jesus ihm zu verstehen: »Ganz gleich, was ge schieht,
Petrus, ich will, dass du an das glaubst, was ich dir gesagt
habe; ich will, dass du mich bei meinem Wort nimmst,
dass ich dich liebe …, dass ich dir vergeben habe.«
Christi Vergebung zeigte sich erneut am Auferstehungsmorgen.
Maria Magdalena und zwei weitere trauernde
Frauen, die dem Herrn nachgefolgt waren, hatten
soeben das leere Grab gefunden. Das heißt, es war
nicht leer, sondern ein Engel saß darin, der darauf wartete,
ihnen die Botschatt zu bringen, dass ihr Erlöser
auferstanden war.
Von jeher liebe ich die Worte des Engels:
»Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die
Stätt e, wo sie ihn hingelegt hatt en. Aber geht hin, sagt
sei nen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa
voraus geht!« (Markus 16,6-7; Hervorhebung von der
Ver fas se rin).
Es scheint, als ob sich der Herr hier besonders um
Pe trus besorgt zeigte. Als Petrus die Nachricht von der
Auf erstehung hörte, rannte er buchstäblich zum Grab,
um mit eigenen Augen zu sehen, dass Jesus auferstanden
war.
Christus erschien nach seiner Auferstehung, in jenen
vierzig Tagen bis zu seiner Himmelfahrt, wiederholt
denen, die ihm nachgefolgt waren. Eine dieser Begegnungen
wirtt noch mehr Licht auf seine Vergebung
für Petrus.
Eines Tages fuhren Petrus und die anderen Jünger
zum Fischen auf den See Genezareth hinaus, hatt en aber
keinen Erfolg. Sie arbeiteten die ganze Nacht hindurch,
ohne etwas zu fangen.
136
Bei Tagesanbruch erschien Jesus am Ufer und rief ihnen
zu: »Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen?«
Die Jünger, die ihn nicht erkannten, antworteten:
»Nein.« Nun wies Jesus sie an: »Wertt das Netz auf der
rechten Seite des Bootes aus! Und ihr werdet fi nden.«
Die Jünger warfen das Netz aus und fi ngen so viele
Fische, dass die Männer, unter denen immerhin mehrere
Berufsfi scher waren, das Netz nicht einholen konnten.
Da sagte Johannes zu Petrus: »Es ist der Herr!«
Und als Petrus diese Worte hörte, warf er sich in den
See und schwamm so schnell er konnte, um Jesus am
Ufer zu erreichen (vgl. Johannes 21,1-7).
Wenn Petrus nicht gewusst hätt e, dass ihm sein
Versagen vergeben worden war und er vom Herrn noch
immer geliebt wurde, wäre er dann wohl vor lauter
Verlangen, Jesus zu sehen, aus dem Boot gesprungen?
Höchstwahrscheinlich hätt e er sich mit den Netzen
zugedeckt und tief unten im Boot versteckt. Wenn dann
die Jünger ans Ufer gekommen wären und Jesus sie gefragt
hätt e: »Wo ist Petrus?«, hätt en sie geantwortet:
»Herr, er fürchtet sich vor dir. Er will dich nicht sehen,
weil er weiß, wie zornig du über ihn bist.«
Aber Petrus war von der Liebe und Vergebung Jesu
so überzeugt, dass er, sobald er Jesus am Ufer entdeckt
hatt e, alles daransetzte, um so schnell wie möglich zu
ihm zu gelangen.
Petrus war etwa drei Jahre lang Tag und Nacht mit
seinem Herrn zusammen gewesen. Er hatt e gehört, wie
Christus Vergebung lehrte; er hatt e gesehen, wie Jesus
anderen vergeben hatt e. Er mag sogar gehört haben,
wie Christus am Kreuz für jene um Vergebung schrie,
die ihn kreuzigten: »Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen
nicht, was sie tun« (Lukas 23,34).
137
Nun hatt e Petrus Gelegenheit, die Vergebung Jesu
für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Jesus hatt e gebetet,
dass der Glaube von Petrus nicht autt ören möge.
Und mitt en in jener schrecklichen Nacht vor der Kreuzigung
gelang es diesem Jünger mit seinem gebrochenen
Herzen, sich an die Worte seines Herrn zu erinnern und
sich ihm wieder zuzuwenden in dem Glauben, dass er
noch immer geliebt wurde und ihm trotz allem vergeben
worden war.
Petrus muss auch gelernt haben, wie allumfassend
Christi Liebe ist, diese Liebe, die das Böse, das ihr zugefügt
wird, nicht nachträgt (vgl. 1. Korinther 13,5). Jesus
warf Petrus sein Versagen nicht vor. Die Bibel berichtet
nichts davon, dass Jesus nach der Passahfeier die Verleugnungen
jemals erwähnt hätt e – eine wunderbare Erfüllung
der Verheißung Gott es, dass er unsere Schuld so
weit von uns fortwerfen will, wie der Osten vom Westen
entfernt liegt (Psalm 103,12), und dass er nicht mehr an
unsere Sünden denken will (Jeremia 31,34).
In lebhatt em Gegensatz dazu versucht Satan, unser
Versagen nach allen Regeln der Kunst auszuschlachten.
Er nutzt jede Gelegenheit, um in seine Rolle als »Verkläger
der Brüder« zu schlüpfen und uns denken zu lassen:
»Ich tauge wirklich gar nichts …, ich bin einfach
nicht ›geistlich‹ genug …, ich weiß nicht genug …, ich
tue nicht genug für Gott …«
Aber Jesus Christus rechtfertigt uns und nimmt uns
an und kann sogar noch unser Versagen zu seiner Verherrlichung
gebrauchen. In dem Buch Principles of Spiritual
Growth (»Grundlagen für das Wachstum im Glauben«)
wird berichtet, J.C. Metcalfe habe gesagt:
»Ohne die bitt ere Erfahrung unserer eigenen Unzulänglichkeit
und Armut sind wir ganz unfähig, die
Last eines geistlichen Dienstes zu tragen. Man muss das
138
Ausmaß der eigenen Schwachheit erkannt haben, um
mit den Unzulänglichkeiten anderer geduldig sein zu
können.
Wer das gelernt hat, kennt auch aus erster Hand die
liebevolle Fürsorge des guten Hirten und seine Fähigkeit,
jeden zu heilen, der demütig ihm und nur ihm allein
vertraut. Darum verzweifelt er nicht so leicht an
anderen, sondern schaut über Sündhatt igkeit, Eigenwilligkeit
und Dummheit hinweg auf die Macht der unwandelbaren
Liebe.
Der Herr Jesus gibt den Autt rag: ›Weide meine Lämmer
…, weide meine Schafe‹ nicht auf die selbstbewusste
Versicherung von Petrus hin, er werde ihm immer treu
bleiben, sondern er erteilt diesen Autt rag, nachdem Petrus
völlig versagt hat, sein Versprechen gebrochen und
in den Straßen von Jerusalem bitt erlich geweint hat.«
2
Ich habe mich ott in die Lage von Petrus versetzt,
und ich kann sehr gut all das nachfühlen, was er durchmachte:
wie er Jesus von ferne sah, wie er ihn verleugnete
und sich dann fragte, ob Gott ihn überhaupt noch
lieben und gebrauchen könnte. Genauso ging es mir bei
dem Erlebnis, von dem ich am Anfang sprach, als ich so
sehr in meinem Glauben versagt hatt e. Ich fragte mich,
ob Gott mich noch liebte und ob er mich je wieder gebrauchen
könnte.
Aber als ich über Gott es vollkommene Liebe zu mir
nachdachte, vertrieb seine Liebe alle Angst aus meinem
Herzen (vgl. 1. Johannes 4,18). Ich erkannte, dass Gott
mich so liebt, wie ich bin – genauso, wie er Petrus geliebt
hatt e. Und er vergab mir – genauso, wie er Petrus
vergeben hatt e. Gott sah über mein Versagen und meine
Wankelmütigkeit hinweg auf die bußfertige Haltung
2 Miles J. Stanford, Principles of Spiritual Growth, Back to the Bible Broadcast,
Lincoln, Nebraska, 1974, S. 31.
139
meines Herzens und auf mein aufrichtiges Verlangen,
ihm zu gefallen.
Wo auch immer wir uns in unserem Glaubensleben
in diesem Augenblick befi nden, Gott liebt uns und hat
uns vergeben. Wir sind in Gott es Zeitplan. Gott , der sein
Werk in uns begonnen hat, wird es zu Ende führen …
(vgl. Philipper 1,6). Ja, was Gott angefangen hat, das
führt er zu einem guten Ende (vgl. Psalm 138,8).
Petrus wusste es, als er Christus am Ufer des Sees
erkannte: Es ist nie zu spät, zu Christus zu »schwimmen«.
Es ist nie zu spät, wieder von vorn zu beginnen.
140
141
Worauf gebaut?
Man hatt e mich eingeladen, auf einer Studentenkonferenz
in Washington zu sprechen. Nach der Konferenz
beschlossen Winky Leinster, eine gute Freundin von mir,
und ich, eine sonntägliche Autofahrt durch das ländliche
Virginia zu machen. Erst saß Winky am Steuer,
und als wir gerade einmal eine Pause eingelegt hatt en,
bot ich mich an zu fahren.
Die santt en grünen Hügel mit den altertümlichen
Bauernhäusern, die sich zwischen kleine Baumgruppen
harmonisch in die Landschatt einfügten, machten
diesen Ausfl ug besonders schön. Wir genossen unsere
Fahrt so richtig, bis wir hinter einem Hügel auf dem
grasbewachsenen Mitt elstreifen der Autobahn mehrere
Polizeiwagen stehen sahen.
»Oh, Winky, ich glaube, da ist eine Geschwindigkeitskontrolle.
Hier sind nur neunzig Kilometer pro Stunde
erlaubt, und ich fahre mehr als hundert. Ich glaube,
jetzt gibt’s Ärger.«
Als wir vorbeifuhren, setzte sich sofort einer der Polizeiwagen
mit Blaulicht hinter uns.
Ich bremste, fuhr von der Straße auf den Seitenstreifen
und hielt an. Mir kloptt e das Herz.
Ein gut aussehender, dunkelhaariger Verkehrspolizist
näherte sich unserem Wagen, einem hellgrünen
Chevrolet, den Winky liebevoll »Kichererbse« nannte.
Ich drehte das Fenster herunter.
Der Beamte war sehr sachlich und sein Gesicht völlig
ausdruckslos, als er sagte: »Ihren Führerschein bitt e.«
Ich reichte ihm den Schein durchs Fenster. Er sah ihn
sich sorgfältig an.
»Sie tragen Kontaktlinsen?«
»Ja.«
142
Er sah sich meine Augen genau an, um zu sehen, ob
ich die Wahrheit sagte.
»Sie sind nicht aus diesem Staat?«
»Nein, ich wohne in Kalifornien. Ich bin nur zu einem
kurzen Besuch hier.«
»Wussten Sie, dass Sie hundertdreißig Kilometer pro
Stunde gefahren sind, wo nur neunzig erlaubt sind?«
»Ich weiß, dass ich mehr als hundert gefahren bin,
aber hundertdreißig waren es wohl nicht.«
»Wir haben hundertdreißig Kilometer pro Stunde bei
Ihnen gemessen. Sie müssen mit mir zur nächsten Stadt
zur Friedensrichterin kommen. Da Sie hier nicht wohnen,
bekommen Sie gleich heute ein Schnellverfahren.«
»Zur Friedensrichterin? Herr Wachtmeister, wir sind
auf der Rückfahrt nach Washington, und ich muss morgen
früh dort mein Flugzeug erreichen. Kann ich die Sache
nicht mit Ihnen regeln? Ich bin wirklich in Eile.«
»Tut mir leid, aber Sie müssen mit mir in die nächste
Stadt zur Friedensrichterin.«
Ich suchte verzweifelt nach einem Ausweg. »Mein
Vater ist Rechtsanwalt. Gibt es denn keine Möglichkeit,
diese Sache mit Ihnen zu bereinigen und das Bußgeld
zu überweisen?«
Völlig unbeeindruckt von meiner Herkuntt oder meinen
Bitt en sagte der Beamte: »Nein, tut mir leid, Sie müssen
mit mir zur Richterin.«
»Was meinen Sie, wie lange das dauert?«
»Das hängt davon ab, wie schnell wir sie fi nden und
wie viel sie zu tun hat. Wenn Sie mir jetzt bitt e folgen
wollen …«
Damit ging er zu seinem Wagen zurück. Ich holte tief
Lutt und startete den Motor.
»Na, der war aber sehr amtlich, was?«, suchte Winky
mich zu trösten. »Den kann wohl gar nichts erschüt
143
tern. Ihn interessiert nur, dass du eine Vorschritt übertreten
hast und vor den Kadi gehörst.«
Als wir so Kilometer um Kilometer hinter dem Polizeiwagen
herrollten bis zur Stadt, erschien mir die Sache
langsam wie ein Albtraum.
»Winky, ich kann das alles nicht glauben.« »Ich auch
nicht.«
»Das mit der ›Friedensrichterin‹ kommt mir auch
ziemlich eigenartig vor! Den Ausdruck habe ich noch
nie gehört. Meistens heißt es doch ›Schnellrichter‹.«
»Beten wir doch zusammen.« Wir dankten dem Herrn
für unsere missliche Lage und baten ihn um Gnade und
Erbarmen vor den Augen der Friedensrichterin.
Wir kamen ins Stadtzentrum von Culpeper und fuhren
an Imbissbuden und Tankstellen vorbei und dann
in den älteren Teil der Stadt.
Als wir um eine Ecke bogen, stand vor uns ein altertümliches,
zweistöckiges Gebäude, das aus einer anderen
Zeit zu kommen schien: das Gericht. Rings um
das Gebäude lief ein ebenso altes schmiedeeisernes Gitter.
Ein riesiges Schild verkündete: Gefängnis im Hinterhaus.
Der Beamte fuhr uns voraus durch das Tor und um
das Gebäude herum nach hinten.
»Winky, sieh dir das an! Zum Gefängnis! Er bringt
uns zum Gefängnis! Ich kann’s einfach nicht glauben.«
Wir stie gen aus dem Auto, gingen einen kopfsteingepfl
asterten Weg entlang, durch eine schief in den Angeln
hängende Tür und standen dann unmitt elbar vor
einem langen, weißen Tisch. Dahinter stand der Polizist,
der uns ver hatt et hatt e, und telefonierte mit der
Friedensrichterin.
Wir blieben vor dem Tisch stehen und sahen uns um.
Gleich zu unserer Linken waren eiserne Gitt er und Zel
144
len. Durch die Öff nungen hörten wir Gefangene miteinander
reden.
Die Wand hinter uns war zu allem Überfl uss mit
Pla katen des polizeilichen Suchdienstes bedeckt. Die
grauen, ernsten Gesichter, neben denen die Steckbriefe
aufgeführt waren, trugen noch zusätzlich zur Gefängnisatmosphäre
bei.
»Miss Bailey, ich muss Ihnen einige Fragen stellen.«
Ich wandte mich zu dem Tisch um und sah, dass der
Beamte etliche Formulare vor sich liegen hatt e. Er ging
die Fragen einzeln mit mir durch und kam zu der nach
dem Arbeitgeber.
Leicht peinlich berührt sagte ich: »Ob Sie’s glauben
oder nicht, ich bin Mitarbeiterin bei Campus für Christus,
einer christlichen Studentenbewegung.«
Jetzt entdeckte ich zum ersten Mal den Schimmer
eines Lächelns in seinen Augen. Aber er sagte nichts.
Nachdem er alle Fragen gestellt hatt e, sagte ich: »Sie
haben da genau die gleiche Kaff eemaschine wie ich. Der
Kaff ee wird gut darin.«
Meine Bemerkung schien das Eis noch etwas mehr
zu brechen und seine Amtswürde zu lockern.
Freundlich fragte er: »Möchten Sie eine Tasse?«
»Ja, sehr gern. Vielen Dank.«
Er gab mir den Kaff ee, blieb aber weiterhin hinter seinem
Tisch stehen. Er beobachtete die Eingangstür und
schrieb etwas auf seinen Notizblock. Seine Schreibarbeit
wurde unterbrochen, als die Tür auffl og und eine große,
grauhaarige Frau wie ein Wirbelwind hereinfegte.
Im Sturmschritt ging sie durch den Raum zu ihrem
Büro am hinteren Ende. Ohne den Polizisten eines Blickes
zu würdigen, schoss sie dabei die Worte auf uns
ab: »Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen und nichts als
die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe?«
145
Der Polizist konnte gerade noch sein gewohnheitsmäßiges
»Ich schwöre es!« herausbringen, da war
sie auch schon in ihrem Büro verschwunden. Winky
wollte fl üsternd wissen, ob er sich nicht etwas dümmlich
vorkam, wie er so mit erhobener rechter Hand
dastand, während die Richterin bereits zwei Zimmer
weiter war.
»Lach bloß nicht«, fl üsterte ich zurück. Kramptt att
versuchten wir, unsere Erheiterung über diese Szene,
die eher in ein Kabarett zu passen schien, zu verbergen.
Wir warteten noch etwa zehn Minuten. Dann sagte
der Polizist, der so lange bei uns geblieben war: »Sie
können jetzt hineingehen.«
Als wir in das Büro der Richterin kamen, sah sie nicht
auf und gab auch durch kein Wort zu erkennen, dass sie
unsere Anwesenheit wahrgenommen hatt e. Ich fragte
mich, ob uns der Polizist nicht zu früh hin eingeschickt
hatt e. Winky und ich wechselten fragende Blicke. Wir
standen weitere zehn Minuten wartend da, und ich hatte
fast das Gefühl, ich sei unsichtbar, während wir von
einem Fuß auf den anderen traten. Die Richterin machte
sich inzwischen mit Papieren auf ihrem Schreibtisch
zu schaff en.
Dann sagte sie, ohne aufzusehen, sehr energisch: »Sie
sind hundertdreißig Kilometer pro Stunde gefahren auf
einer Strecke, auf der nur neunzig Kilometer pro Stunde
erlaubt sind. Das macht fünfzig Dollar oder einen
Tag Gefängnis.«
Ich hatt e mein Guthaben nachgerechnet, während
wir im Vorraum warteten, und sagte nun mit einiger Erleichterung:
»So seltsam es auch scheinen mag, aber genau
den Betrag habe ich noch auf meinem Girokonto.«
Sie sah plötzlich auf, als ich nach meiner Hand tasche
146
griff , und sagte in verächtlichem Ton: »Wir können Ihren
Scheck nicht annehmen!«
»Sie nehmen ihn nicht?«, fragte ich erstaunt. »Aber
er ist gedeckt, und ich kann mich hinreichend ausweisen.«
»Das hat nichts zu sagen. Wir nehmen keine Schecks
aus anderen Staaten. Dann bleiben Sie eben über Nacht
im Gefängnis!«
Winky und ich sahen einander entsetzt an.
»Ich habe meinen Wohnsitz im Staat Virginia«, ver -
suchte Winky zu vermitt eln. »Meine Eltern leben in
Vienna, Virginia. Nehmen Sie von mir einen Scheck?«
»Nein. Was ist mit Ihren Eltern? Können sie Ihnen
Geld schicken?«
»Sie würden es bestimmt tun, aber sie sind unterwegs
nach South Carolina. Vor morgen kann ich sie keinesfalls
erreichen.«
Die Richterin sah mich an und sagte sehr bestimmt:
»Sie bleiben über Nacht im Gefängnis.«
Ich wusste, dass ich keine Wahl hatt e. Ich hatt e
das Gesetz übertreten. Der Richterin war es gleichgültig,
wer ich war, welchen Beruf ich ausübte oder
ob mein Vater Jurist war. Auch mein Scheck wurde
nicht angenommen. Ich konnte die Strafe nicht bezahlen.
Also musste ich ins Gefängnis. Da war nichts zu machen.
Ich dachte: »Auch mal eine Erfahrung! Was werden
wohl meine Freunde dazu sagen?«
Der Polizist, der ein paar Minuten zuvor den Raum
betreten hatt e, trat zu uns und sagte zu Winky: »Wenn
Sie einen Scheck über fünfzig Dollar auf meinen Namen
ausstellen wollen, löse ich ihn aus meiner eigenen
Tasche ein. Dann haben Sie das Geld, um die Strafe
zu bezahlen.«
147
Mit einer Handbewegung auf die Friedensrichterin
hin sagte ich: »Warum nehmen Sie einen Scheck an, und
sie tut es nicht?«
»Ich biete es Ihnen als Privatmann und nicht als Amtsper
son an.«
Ehe er noch seine Meinung ändern konnte, nahm
Winky sein Angebot an. Sie schrieb einen Scheck über
fünfzig Dollar aus, und er gab ihr das Geld in bar. Winky
gab dann die fünfzig Dollar der Richterin und zahlte
damit für mich die Geldstrafe. Sie erhielt eine Quitt ung
mit dem Vermerk: »In voller Höhe bezahlt.«
Endlich war ich frei und konnte gehen!
Der Polizist ging mit uns bis vor die Tür. Seine Abschiedsworte
waren: »Meine Damen, fahren Sie in Zukuntt
nicht mehr zu schnell!«
Ich fühlte mich wie durch die Mangel gedreht. Als
wir zu unserem Auto kamen, sagte ich lächelnd zu Winky:
»Für heute bin ich genug gefahren. Fahr du.«
Bevor wir vom Gericht in Culpeper abfuhren, beteten
wir noch einmal und dankten dem Herrn für alles,
was wir durchgestanden hatt en. Wir baten ihn, uns aus
dieser Erfahrung lernen zu lassen.
Als wir dann über das soeben Erlebte sprachen, wurde
uns klar, was für ein gutes Beispiel es war für das,
was Christus für uns am Kreuz getan hat.
Ich hatt e das Gesetz übertreten, weil ich zu schnell
gefahren war, und war dafür zu fünfzig Dollar Geldstrafe
oder einem Tag Gefängnis verurteilt worden.
Ich konnte die Strafe nicht bezahlen, also zahlte Winky
für mich. Ich konnte nichts weiter tun, als das annehmen,
was sie für mich tat – und ich nahm es gern
an.
Genauso haben wir alle Gott es Gesetze gebrochen
und müssen die Strafe zahlen; sie lautet auf Tod. Aber
148
Gott sandte Christus, damit er für unsere Sünden starb.
Er bezahlte für unsere Schuld und machte uns diese Bezahlung
zum Geschenk. Alles, was wir zu tun haben,
ist, ihn selbst und das, was er für uns am Kreuz getan
hat, anzunehmen.
Als wir über diesen Vergleich sprachen, sagte Winky:
»Ney, ich möchte gern, dass du das, was ich für dich
getan habe, als Geschenk annimmst.«
»Das kann doch nicht dein Ernst sein«, sagte ich.
»Meinst du das wirklich …, du willst meine Strafe bezahlen?«
»Ja. Das will ich wirklich. Und außerdem, wenn du
mir das Geld zurückzahlst, stimmt doch unser Vergleich
nicht mehr!«
Es wurde schon dunkel, als wir uns Washington näherten.
»Diesen Tag werde ich nie vergessen«, dachte
ich. »Und auch Culpeper, Virginia, werde ich nie vergessen!«
Wenn jeder eine so klare Vorstellung von dem bekommen
könnte, was Christus für uns getan hat, wie
Winky und ich sie durch unser Erlebnis in Virginia bekamen,
hätt e wohl jeder den Wunsch, Christus sein Leben
zu öff nen.
Aber ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen
nicht richtig wissen, was es bedeutet, Christ zu
werden und eine »Wiedergeburt« zu erleben. Kürzlich
hörte ich von einer Frau, die zu ihrer Freundin sagte:
»Ich bin noch nicht wiedergeboren, aber ich bemühe
mich ständig darum!« Sie hatt e nicht erkannt, dass
Christwerden so einfach ist, dass sogar ein Kind den
Vorgang verstehen kann: Wir haben nichts weiter zu
tun, als an Jesus Christus und sein Wort zu glauben
und ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen und anzuerkennen.
149
Gott führt mir häufi g Menschen über den Weg, die
noch keine Christen sind, die aber einen geistlichen
Hunger haben und Gott kennenlernen möchten. Wie
ott mir solche Menschen schon begegnet sind, kann ich
gar nicht zählen. Mit am merkwürdigsten war wohl ein
Erlebnis in jener Nacht, als in Colorado die Flutkatastrophe
hereinbrach.
Während unserer schrecklichen Flucht in der Finsternis
den rutschigen Berghang hinauf, als uns in jener
Nacht die Flutwelle verfolgte, blieb eine aus unserer
Gruppe zurück, um einer älteren Frau den steilen
Hang hinaufzuhelfen. Als uns die Polizei dann anwies,
wieder auf die Straße unten zurückzukehren, war sie
der erste Mensch, den ich dort sah. Ich schloss sie herzlich
in die Arme und sagte: »Wie freue ich mich, dass
Sie wohlauf sind!«
»Wer sind Sie, und warum sind Sie alle so nett zu
mir?«, fragte sie.
Spontan sagte ich: »Ich kann nur hoff en, dass meiner
Mutt er jemand beistehen würde, falls sie je in eine
solche Situation geriete …«
Ehe ich meinen Satz beenden konnte, drängten uns
die Polizisten, sofort in unsere Autos zu steigen, uns hintereinander
aufzustellen und auf weitere Anweisungen
zu warten. Es war eiskalt und goss in Strömen, als ich
die fünfzig Meter zu meinem Auto rannte, das ich schon
verloren geglaubt hatt e. Ich war froh, dass es sofort ansprang
– das war nicht immer der Fall!
Als ich dorthin kam, wo sich die Autoschlange formieren
sollte, stiegen die Dame, ihr Mann und Jackie
Hudson in mein Auto, um zu warten, bis es weiterging.
Kaum waren sie im Auto, da sagte der Mann: »Ich
will sehen, ob ich weiter oben unseren Wohnwagen fi n
150
den kann. Ich hab Whisky dort, und den kann ich jetzt
brauchen.«
Als er ausgestiegen war, fragte die Frau wieder: »Wer
sind Sie, und warum sind Sie so gut zu uns?«
»Wir sind Mitarbeiter von Campus für Christus, einer
überkonfessionellen christlichen Organisation«, antwortete
ich. »Wir waren heute gerade zu einem Treff en
auf der anderen Seite des Flusses, auf der Sylvan-Dale-
Ranch, als wir die Anweisung der Polizei hörten, das Gebiet
zu verlassen. Einige unserer Mitarbeiterinnen sind
noch drüben, und wir machen uns Sorgen um sie.«
»Von Campus für Christus habe ich schon gehört. Ich
bin seit vielen Jahren Mitglied in der Kirche.«
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Haben Sie in all
den Jahren, in denen Sie zur Kirche gehören, Jesus Christus
persönlich kennengelernt?«
Sie schütt elte den Kopf. »Ich bin mein Leben lang zur
Kirche gegangen, aber ich glaube, so wie Sie über ihn
sprechen, kenne ich ihn nicht.«
Es war dunkel, die Fenster waren beschlagen, und
wir konnten unsere Gesichter gegenseitig kaum erkennen,
als ich anfi ng zu reden.
»Erst einmal: Gott liebt Sie. In Johannes 3,16 heißt es:
›Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.‹ Für den Ausdruck
›die Welt‹ könnte man auch seinen eigenen Namen
einsetzen. Übrigens«, fragte ich lächelnd, »wie heißen
Sie?«
»Lou.«
»Dann würde der Vers also lauten: ›Denn so hat Gott
Lou geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab.
Wenn Lou an ihn glaubt, wird sie nicht verloren gehen,
sondern ewiges Leben haben.‹«
151
»Das ist so, Lou.« Auf meiner beschlagenen Frontscheibe
zog ich zwei parallele Linien, eine oben und
eine unten. »Gott ist dort oben, hoch über uns, und er
ist heilig. Wir Menschen sind hier unten, und wir sind
sündig.«
Ich zog von der unteren Linie aus einige Pfeile hoch
bis etwa zur Hältt e der Scheibe. »Wir versuchen auf
verschiedene Weise, zu Gott zu gelangen, aber die Bibel
sagt, dass wir alle Sünder sind und nichts aufzuweisen
haben, was Gott gefallen könnte (Römer 3,23). Das
heißt einfach, dass niemand von uns so gut ist wie Gott
und dass wir leicht unsere eigenen Wege gehen, ohne
viel an Gott zu denken.
Und die Bibel sagt: Wir haben für unsere Sünden
Strafe verdient. ›Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
die Gnadengabe Gott es aber ewiges Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn‹ (Römer 6,23).«
Sie ließ mich nicht aus den Augen und hörte mir aufmerksam
zu.
»Sünde ist ein Wort, das mich früher sehr gestört
hat. Es gefi el mir gar nicht. Dann sagte mir jemand, ich
sollte mir vorstellen, alles, was ich je in meinem Leben
verkehrt gemacht habe, sei auf einem Film festgehalten
und alle meine Nachbarn und Freunde seien eingeladen,
um sich den Film auf einer großen Leinwand
anzusehen. Und wenn es bei Ihnen so ähnlich aussieht
wie bei mir, gibt es da ein paar Dinge, die Sie anderen
lieber nicht vorzeigen möchten!«
»Das stimmt«, rief sie. »Es gibt wirklich Dinge, die ich
nicht auf der Leinwand gezeigt haben möchte.«
»Eben«, gab ich zurück, »und das sind z.B. solche
Dinge, die in der Bibel als Sünde bezeichnet werden.
Das sind Vergehen, für die Jesus gestorben ist.« Dann
zeichnete ich das Kreuz Jesu Christi zwischen die par
152
allelen Linien und machte damit klar, dass Jesus die
Schuld für unsere Sünde bezahlt hat, für das, was uns
von Gott trennt – dass er die Klutt zwischen Gott und
uns Menschen überbrückt hat. »Als ich das zum ersten
Mal sah, Lou, dass Jesus die Klutt überbrückt, verstand
ich endlich, welche Rolle Jesus eigentlich spielt. Vorher
hatt e ich das nie verstanden.
Jesus ist Gott es einziger Ausweg aus unserer Sünde,
und durch ihn können wir Gott es Liebe für uns und
seinen Plan für unser Leben erfahren. Sie haben sicher
schon mal gehört, dass er gesagt hat: ›Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich‹ (Johannes 14,6).«
»Ja, das habe ich gehört.«
»Es genügt nicht, diese Dinge zu wissen. Manche
von uns haben sie seit ihrer Jugend immer wieder
gehört. Wissen Sie, viele Leute sagen uns, wir sollten
Christen werden, aber nur wenige sagen uns, wie
man das macht. Und das ist doch das Entscheidende
und das eigentlich Wichtige – wie man es macht. Jeder
muss für sich Jesus Christus als Heiland und Herrn
annehmen, indem er ihn persönlich bitt et, die Schuld
zu vergeben und in sein Leben zu kommen. Das bedeutet,
dass niemand ihn an unserer Stelle annehmen
kann.
Jesus sagte: ›Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe
an.‹ Gemeint ist die Tür unseres Herzens und Lebens.
›Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
öff net‹, und das können wir tun oder auch nicht tun …,
es ist Sache unseres Willens, ›zu dem werde ich hineingehen‹,
sagt Christus, ›und mit ihm essen, und er mit mir‹
(Off enbarung 3,20).
Lou, möchten Sie Christus in Ihr Leben bitt en?«
»Oh ja, gern, und zwar jetzt gleich.«
153
»Wir nehmen Christus durch Glauben an, Lou, und
unseren Glauben können wir im Gebet zum Ausdruck
bringen. Beten Sie doch und bitt en Sie Christus, in Ihr
Leben zu kommen, und dann werden Jackie und ich
für Sie beten.«
Sie begann: »Herr Jesus, ich brauche dich. Ich danke
dir, dass du für mich gestorben bist und auch für all die
Dinge, die sonst auf dem Film meines Lebens erscheinen
würden. Ich bitt e dich: Komm in mein Leben und
sei mein Heiland und mein Herr.«
Ich betete: »Herr, danke, dass wir Lou heute Abend
getroff en haben. Ich danke dir, dass du ihr Gebet erhört
hast. Du bist in ihr Herz gekommen. Danke für deine
Verheißung, dass du sie niemals aufgeben und niemals
verlassen wirst (Hebräer 13,5).«
Jackie schniett e ein wenig auf dem Rücksitz und
schloss sich dann unserem Gebet an. »Herr, hab Dank,
dass Lou heute die wichtigste Entscheidung ihres Lebens
getroff en hat. Wenn wir sie auch hier nie wiedersehen
sollten, so doch zumindest im Himmel.«
Nachdem wir gebetet hatt en, fragte ich: »Lou, wo ist
Jesus Christus jetzt?«
Strahlend sagte sie: »Er ist in meinem Herzen.« »Ganz
richtig, und woher wissen Sie, dass er dort ist?« »Weil
ich ihn hereingebeten habe; und ich spüre ihn.« »Ja, und
wenn das Gefühl morgen nicht mehr da sein sollte, wissen
Sie doch, dass er noch da ist, weil er es versprochen
hat, und er kann nicht lügen. Er ist nicht nur in Ihr Leben
gekommen, sondern er hat auch versprochen, Sie nie zu
verlassen oder aufzugeben (Hebräer 13,5). All die Dinge
aus Ihrem Leben, die auf der Leinwand erschienen
wären, sind nun nicht mehr da, weil Jesus Ihnen vergeben
hat. Sie haben eine ›saubere Leinwand‹, einen neuen
Anfang! Ist das nicht eine gute Nachricht?«
154
»Ja, wirklich«, strahlte sie. »Das ist wunderbar … Bitte
geben Sie mir Ihre Adresse.«
Gerade hatt en wir die Adressen ausgetauscht, da
machte ihr Mann die Autotür auf und sagte: »Fahren
wir; die Polizei ist gerade dabei, uns herauszulotsen.«
Zehn Minuten hatt e der Herr uns miteinander gegeben,
und Lou verließ uns mit einem Leuchten in den Augen
und auf dem Gesicht.
Jackie kam nach vorn auf den Beifahrersitz und sagte:
»Ney, die ganze Atmosphäre war erfüllt von Liebe, als
du mit Lou geredet hast. Es war, als hielte Gott die Zeit
einen Augenblick an, und während dieses Augenblicks
war die Flut vergessen.«
Wir konnten beide nur staunen über den genauen
Zeitplan Gott es.
In jener kalten Nacht voll Angst und Not, mitt en im
Unglück, durtt e diese nett e ältere Dame erkennen, dass
Gott sie liebt.
Zum nächsten Weihnachtsfest erhielt ich ein kleines
Päckchen mit zwei handgefertigten Kreuzen, einem
aus Gold und einem aus Silber. Dabei lag ein Briefchen
von Lou, in dem stand: »Eins ist für Sie und eins für
Jackie. Ich danke Ihnen für alles, was Sie in jener Nacht
für mich getan haben.«
Mein Leben schien für immer eingeteilt zu sein in
»vor« und »nach« der Flut. Nach der Flut sagte Marilyn
Henderson einen Satz zu mir, den Jesus gesagt hatt e:
»Denn wer sein Leben errett en will, der wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der wird es errett en«
(Markus 8,35).
Der Vers war mir vertraut, aber der Teil »um des
Evangeliums willen« wurde mir jetzt besonders wichtig.
155
Dreimal war in jener Nacht mein Leben bewahrt worden:
als ich das Gebäude verließ, ehe es bis zur Decke
voll mit Wasser und Schlamm war, als ich über die Brücke
gelangte, kurz bevor sie einstürzte, und als ich die
Anweisung hörte, mein Auto zu verlassen, um höher
gelegenes Gelände aufzusuchen. Mein Leben war bewahrt
worden, weil es einen Grund dafür gab.
Das Erleben der Flutkatastrophe bewirkte in mir, dass
ich den Autt rag Jesu Christi, in alle Welt hinauszugehen
und allen Menschen die rett ende Botschatt zu verkünden
(Markus 16,15), neu durchdachte. In einem tie feren
Sinne sagte ich nun: »Herr, mein ganzes Leben will ich
für die Sache des Evangeliums hingeben. Gebrauche
mein Leben dazu, die Welt für dich zu er reichen.«
Ich fi nde es interessant, dass Jesus die Bergpredigt
damit abschloss, dass er von einer Flut sprach.
Er sagte:
»Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut,
den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der
sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fi el
herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten
und stürmten gegen jenes Haus; und es fi el nicht, denn
es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese
meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem
törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf
den Sand baute; und der Platzregen fi el herab, und die
Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an
jenes Haus; und es fi el, und sein Fall war groß« (Matthäus
7,24-27).
Wenn wir nach Gott es Wort handeln, wenn wir ihn
beim Wort nehmen, sind wir weise und unser Leben ist
fest gegründet auf den Felsengrund seiner Worte. Wenn
wir ihn nicht beim Wort nehmen, sind wir töricht und
bauen unser Leben auf Sand.
156
Die meisten von uns werden nie eine wirkliche Flut
erleben müssen, aber wir alle müssen durch die »Fluten
des Lebens«. Während wir in diesen »Fluten« sind,
möchte Gott , dass wir ihn bei seinem Wort nehmen und
glauben, dass sein Wort wahrer ist als unsere Gefühle
oder als irgendwelche Lebensumstände, denen wir jemals
ausgesetzt sein werden, denn:
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte
aber werden nicht vergehen.
157
Ravensberger Bleiche 6 · 33649 Bielefeld
0521 947240 · [email protected] · clv.de
Christliche Literatur-Verbreitung
Bücher, die weiterhelfen
Glaube ist kein Gefühl
Ney Bailey
Taschenbuch, 160 Seiten
Artikel-Nr.: 255571
ISBN / EAN: 978-3-89397-571-6
Die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, in seiner Menschheit, Bellet J.G.
Die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn, in seiner Menschheit
„Wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Jehova darbringen will, so soll seine Opfergabe Fein Mehl sein; und er soll öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen; und er nehme davon seine Hand voll, von seinem Fein Mehl und von seinem öl samt all seinem Weihrauch, und der Priester räuchere das Gedächtnisteil desselben auf dem Altar: es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova" (3. Mo 2, 1. 2).
Die moralische Herrlichkeit oder mit anderen Worten der Charakter des Herrn Jesu als Mensch ist der Gegenstand der vorliegenden Betrachtung. Alles in Ihm stieg als ein Opfer von
lieblichem Wohlgeruch zu Gott empor. Jeder Ausdruck von dem, was Er war, wie unscheinbar er auch sein und an welchen Umstand er sich auch knüpfen mochte, erwies sich als ein duftender Weihrauch. In Ihm, aber auch nur in Ihm, wurde der Mensch mit Gott versöhnt. In Ihm fand Gott wieder Sein Wohlgefallen an dem Menschen, und zwar mit einem unaussprechlichen Gewinn; denn in Jesu ist der Mensch mehr für Gott, als er es in einer Ewigkeit adamitischer Unschuld gewesen sein würde.
Obwohl ich völlig überzeugt bin, daß ich nur einen geringen Teil dieses bewunderungswürdigen Gegenstandes ans Licht zu stellen imstande sein werde, hoffe ich dennoch, durch diese Zeilen in anderen Seelen nützliche Gedanken wachzurufen, und das wird immerhin von Segen sein.
Mit der Person des Herrn, als Gott und Mensch in einem Christus, wünsche ich mich zu beschäftigen, wie auch mit Seinem Werke, mit jenem leidensvollen Dienst, mit der am Kreuze geschehenen Blutvergießung, wodurch das Sühnungswerk vollendet wurde, das heute verkündigt wird zur Freude des Glaubens.
Die Herrlichkeit des Herrn Jesu kann von drei Gesichtspunkten aus betrachtet werden: entweder betrifft sie Seine Person, oder Seine amtliche Würde, oder Seinen Charakter. Die Herrlichkeit Seiner Person verhüllte Jesus, außer wenn der Glaube sie zu entdecken wußte oder das Bedürfnis des Augenblicks ihre Offenbarung nötig machte. Die Herrlichkeit Seiner amtlichen
Würde verhüllte Er ebenfalls; Er durchschritt das Land weder als der aus dem Schöße des Vaters gekommene Sohn Gottes, noch als der mit Autorität bekleidete Sohn Davids. Diese
beiden Seiten Seiner Herrlichkeit blieben meistens verdeckt, während Er Sich inmitten der mannigfaltigen Umstände des täglichen Lebens hienieden bewegte. Seine moralische Herrlichkeit aber konnte nicht verborgen bleiben: Er konnte in keiner Sache weniger als vollkommen sein, das war der Ihm eigentümliche Charakter, es war miteinem Wort Er Selbst.
Diese Herrlichkeit war infolge ihrer Vortrefflichkeit sogar zu blendend für das menschliche Auge, und der Mensch fühlte sich beständig durch sie bloßgestellt und verurteilt. Aber sie warf,
mochte der Mensch sie ertragen können oder nicht, ihre Strahlen nach allen Richtungen hin; und jetzt erleuchtet sie die Blätter der vier Evangelien, wie sie ehemals die Pfade erhellte, auf
welchen der Herr hienieden wandelte.
Es hat jemand von dem Herrn Jesu gesagt, daß Seine Menschheit in ihrer Entwicklung ganz natürlich gewesen sei. Diese Bemerkung ist sehr schön und wahr. Der letzte Vers des zweiten Kapitels in Lukas setzt dies außer allen Zweifel. Es gab in Jesu nichts von unnatürlichem Wachstum: Er nahm in allem zu in regelrechter Weise. Seine Weisheit hielt gleichen Schritt
mit Seiner Statur und Seinem Alter; zuerst war Er ein Kind, dann ein Mann. Als Mann (als der Mann Gottes in dieser Welt) zeugte Er von der Welt, daß ihre Werke böse seien,
und Er wurde von ihr gehaßt; aber als Kind (ich möchte sagen, als ein Kind nach dem Herzen Gottes) ist Er Seinen Eltern Untertan und befindet sich unter dem Gesetz, und zwar als
jemand, der vollkommen ist; und unter solchen Umständen nahm Er zu an Gunst bei Gott und den Menschen.
Aber obschon somit in Ihm ein Fortschreiten stattfand, zeigte sich doch niemals eine verdunkelnde Wolke, niemals etwas Verkehrtes, niemals ein Fehler; und das ist es, was Ihn von
jedem anderen Menschen unterscheidet. Von Maria, Seiner Mutter, wird gesagt, daß sie alles, was über Jesum verkündigt worden war, „bewahrt und in ihrem Herzen erwägt" habe;
und doch lagerten sich Wolken, Unruhe und selbst Finsternis um ihre Seele, so daß der Herr zu ihr sagen mußte: „Was ist es, daß ihr mich gesucht habt" (Luk 2, 49)? Bei Jesu hingegen
zeigte sich das Fortschreiten stets in einer und derselben Form von moralischer Schönheit. Sein Wachstum war immer regelrecht und der Zeit gemäß, und ich darf hinzufügen, daß, so
wie Seine Menschheit in ihrer Entwicklung ganz und gar natürlich war, auch Sein Charakter in allen seinen Kundgebungen sich als durchaus menschlich erwies. Alles, was diesen Charakter offenbarte, war, wenn ich mich so ausdrücken darf, dem Menschen eigentümlich.
Er war der „Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit" (Ps i, 3). Alle Dinge sind nur schön zu ihrer Zeit. Die moralische Herrlichkeit des „Kindes Jesu" prangte zu ihrer Zeit und an ihrem Platze; und als das Kind zum Manne geworden war, zeigte sich dieselbe Herrlichkeit unter anderen der Zeit gemäßen Formen. Wenn Seine Mutter ihre Ansprüche geltend machte, so wußte Er, wann Er ihnen genügen mußte; Er wußte auch, wann Er ihnen entgegenzutreten, und wann Er sie, selbst ungesucht, anzuerkennen hatte (Luk 2, 51; 8, 21; Joh 19, 27). Und überall, wo wir Seinen Schritten folgen, werden wir dasselbe finden.
Er kannte Gethsemane zu seiner Zeit und nach seinem wahren Charakter, und Er kannte auch den heiligen Berg zu seiner Zeit: es waren die Zeiten des Winters und des Sommers für Seine Seele. Er
kannte den Brunnen zu Sichar, wie auch den Weg, der Ihn zum letzten Mal nach Jerusalem führte. Er verfolgte jeden Pfad und füllte jeden Platz aus in einer Gesinnung, die stets in Übereinstimmung stand mit dem Charakter, den die Dinge in den Augen Gottes hatten. Und dies war auch bei solchen
Gelegenheiten der Fall, in denen mehr Kraft und Energie erforderlich waren. Wenn es sich um die Entweihung des Hauses Seines Vaters handelte, so verwirklichte sich in Ihm das Wort des Psalmisten: „Der Eifer um dein Haus verzehrt mich"; und wenn Ihm von Seiten der samaritischen Dorfbewohner ein persönliches Unrecht angetan wurde, ertrug Er alles und setzte ruhig Seinen Weg fort.
Alles war vollkommen, sowohl im Blick auf seine Zusammenstellung und Verbindung, als auch auf die passende Zeit. Er weinte am Grabe des Lazarus, obgleich Er wußte, daß Er das Leben für den Gestorbenen in sich trug. Und obwohl Er soeben erst gesagt hatte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben", vergoß Er doch Tränen. Die göttliche Macht in Ihm hinderte die menschlichen Sympathien nicht, frei und ungehindert auszuströmen. Und gerade diese Verschmelzung oder Vereinigung von Tugenden macht Seine moralische Herrlichkeit aus. Jesus wußte, um den Ausdruck des Apostels zu gebrauchen, „erniedrigt zu sein und Überfluß zu haben"; Er wußte ebensowohl die Augenblicke des Wohlstandes, wenn man sie so nennen darf, wie die Zeiten des Druckes zu verwerten; denn während Er dieses Leben durchschritt, wurde Er mit beiden Zuständen bekanntgemacht.
So wurde Er auf dem Berge der Verklärung für einen Augenblick in Seine Herrlichkeit eingeführt; und das war in der Tat eine glanzreiche Stunde. Er erschien dort in der Majestät und in den Würden, die Ihm gebührten. Wie die Sonne, die Quelle alles Lichts, so strahlte Sein Angesicht in überwältigendem Glanz; und ausgezeichnete Personen, wie Mose und Elias, standen Ihm zur Seite, indem sie Seine Herrlichkeit teilten und mit Ihm darin glänzten. Als Er aber von dem Berge herabstieg, befahl Er denen, die „Augenzeugen Seiner Majestät" gewesen waren, „niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten". Und als Er am Fuße des Berges angekommen war und die erstaunte Volksmenge zu Seiner Begrüßung zusammenrief (Mk o, 15), und Sein Antlitz ohne Zweifel noch einen, wenn auch schwachen Nachglanz der Herrlichkeit, in der Er soeben gestrahlt hatte, zur Schau trug, verweilte Er doch keinen Augenblick, um die Huldigungen der Menge entgegenzunehmen, sondern wandte sich alsbald wieder Seinem gewöhnlichen Dienst zu; denn Er wußte „Überfluß zu haben".
Der Wohlstand machte Ihn nicht hochmütig. Er suchte nicht einen Platz unter den Menschen, sondern Er entäußerte Sich, machte Sich Selbst zu nichts und verhüllte eilig Seine Herrlichkeit, um der Diener zu sein, welcher gegürtet, aber nicht mit Herrlichkeit bekleidet ist. Ebenso war es mit Ihm, wie uns das 20. Kapitel des Evangeliums Johannes belehrt, bei einer anderen Gelegenheit, als Er aus den Toten auferstanden war. Wir sehen Ihn dort inmitten Seiner Jünger, bekleidet mit einer Herrlichkeit, wie sie dergleichen ein Mensch nie besessen noch angeschaut hatte. Er steht dort als der Überwinder des Todes, als der Zerstörer des Grabes; und dennoch, obwohl Er im Besitz solcher Herrlichkeiten war, ist Er nicht gekommen, um die Glückwünsche Seines Volkes, wie wir zu sagen pflegen, entgegenzunehmen, wie es naturgemäß jeder andere tun würde, der nach ausgestandenen Mühsalen und Gefahren und nach endlichem Sieg in den Schoß seiner Freunde und seiner Familie zurückkehrte. Nicht etwa als ob der Herr Jesus gegen Mitgefühl gleichgültig gewesen wäre; nein, Er verlangte vielmehr danach zu seiner Zeit, und Er entbehrte es tief, wenn Er es nicht fand. Aber jetzt, auferstanden aus den Toten, erscheint Er in der Mitte Seiner Jünger viel mehr wie einer, Der sie für einen Tag besucht, als wie ein triumphierender Überwinder; und Er unterhält Sich mit ihnen weit mehr über das, was sie, als was Ihn interessierte in den großen Dingen, die sich soeben erfüllt hatten. Das hieß in der Tat von dem Siege einen Gebrauch machen, wie Abraham es tat, nachdem er die verbündeten Könige geschlagen hatte; und dergleichen tun zu können, ist, wie jemand mit Recht bemerkt hat, weit schwieriger, als den Sieg selbst zu erringen. Dies war es also wieder, zu wissen, „Überfluß zu haben" und „erfüllt zu sein".
Aber Jesus wußte auch, „erniedrigt zu sein". Betrachten wir Ihn z. B. bei den Bewohnern Samarias in Lk g, 51 usw. Von vornherein versetzt Er Sich im Bewußtsein Seiner persönlichen Herrlichkeit in die Tage Seiner „Aufnahme"; und wie jemand, der als eine Person von Ansehen sein Herannahen ankündigt, sendet Er Boten vor Seinem Angesicht her. Jedoch der Unglaube der Samariter verändert den Zustand der Dinge; sie weigern sich, Ihn aufzunehmen. Sie wollen den Füßen des Herrn der Herrlichkeit keine gerade Bahn bereiten, und zwingen Ihn, als der Verworfene den bestmöglichen Pfad für sich ausfindig zu machen. Und diese Stellung, den Platz eines Verworfenen, nimmt Er sofort ein, ohne daß Sein Herz irgendwie darüber gemurrt hätte. Indem Er Sich als der Bethlehemit verworfen sieht, wird Er wieder der Nazarener (siehe Mt 2); und Er trägt diesen neuen Charakter jenseits des samaritischen Dorfes ebenso vollkommen, wie Er Sich diesseits in jenem anderen Charakter gezeigt hatte.
So also wußte Jesus, „erniedrigt zu sein'. Das gleiche finden wir in Mt 2.1. Er betritt Jerusalem als „der Sohn Davids"; alles was Ihn in dieser glorreichen Würde zu kennzeichnen vermochte, umringt und begleitet Ihn. Wie Er auf dem heiligen Berge in Seiner himmlischen Herrlichkeit erschienen war, so erscheint Er hier in Seiner irdischen Herrlichkeit, die Ihm von Rechts wegen gehörte; und wenn der Augenblick es erforderte, wußte Er sie in würdiger Weise zu tragen. Aber der Unglaube von Jerusalem, wie früher derjenige von Samaria, verändert die Szene; und Er, Der als König Seinen Einzug in die Stadt gehalten hat, ist gezwungen, sie wiederum zu verlassen, um sich gleichsam ein Nachtlager zu suchen, wo Er es am besten finden kann. Und so befindet Er Sich, indem Er wußte, „erniedrigt zu sein", wie einst außerhalb Samarias, so jetzt außerhalb Jerusalems.
Welch eine Vollkommenheit! Wenn die Finsternis das Licht der persönlichen und amtlichen Herrlichkeit Christi nicht erfaßt, so gibt das nur Seiner moralischen Herrlichkeit Gelegenheit, in um so hellerem Glänze hervorzustrahlen. Denn in sittlicher Hinsicht oder in einem menschlichen Charakter gibt es nichts Vortrefflicheres, als diese Verbindung einer freiwilligen Erniedrigung unter die Menschen mit dem Bewußtsein einer durchdringenden Herrlichkeit vor Gott. Wir finden schöne Beispiele von dieser Verbindung in dem Leben etlicher Heiliger.
Abraham war während seines ganzen Lebens freiwillig ein Fremdling unter den Kanaanitern, indem er weder einen Fußbreit Land besaß, noch nach einem solchen Besitz trachtete;
aber wenn die Gelegenheit sich dazu darbot, verstand er es, sich über Könige zu setzen, in dem Bewußtsein seiner Würde vor Gott und nach dem Ratschluß Gottes. Jakob spricht von seiner Fremdlingschaft, von seinen Tagen, die „kurz und böse" gewesen seien, indem er sich so in den Augen der Welt zu nichts macht; aber zu gleicher Zeit segnet er den Mann, der damals der Höchste auf Erden war, wohl wissend, daß er selbst in den Augen Gottes der „Vorzüglichere" war.
David bittet um einen Laib Brot, und er tut es, ohne sich zu schämen; zu gleicher Zeit aber nimmt er die einem König gebührende Huldigung entgegen und empfängt gleichsam aus den Händen Abigails den Tribut seiner Untertanen. Paulus ist mit Ketten gebunden, ein Gefangener im Hause des Landpflegers, und er spricht von seinen Banden; aber zugleich läßt er den Hof
und die ihn umringenden Großen der römischen Welt wissen, daß er sich unter ihnen allen als den gesegneten, den allein glücklichen Menschen erkennt.
Diese Verbindung einer freiwilligen Erniedrigung vor den Menschen mit dem Bewußtsein der Herrlichkeit und Würde vor Gott findet ihre erhabenste, glänzendste, ja (wenn wir daran denken, wer Er war), ihre unendliche Offenbarung in unserem Herrn. Und es gibt in dieser Fähigkeit, zu wissen, „Überfluß zu haben" und „erniedrigt zu sein", „satt zu sein" und „Mangel zu leiden", noch eine andere Schönheit; denn sie sagt uns, daß das Herz dessen, der in diesen Dingen unterwiesen ist, sich viel mehr mit dem Endziel der Reise, als mit der Reise selbst beschäftigt. Wenn unser Herz an die Reise selbst denkt, werden wir ihre Mühseligkeiten und rauhen Wege sicher nicht gern haben; aber in dem Maß, wie wir das Ziel anschauen, werden wir über jene Dinge hinwegzusehen vermögen. Liegt hierin nicht für uns alle eine lehrreiche
Unterweisung?
Indes gibt es in dem Charakter des Herrn noch andere Verbindungen, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sicher war keiner unter den Menschensöhnen, wie jemand von Ihm gesagt hat, so gnädig, so herablassend, so zugänglich wie Er. Man bemerkt in Seinem ganzen Wesen eine Zartheit und eine Freundlichkeit, die man vergeblich bei anderen Menschen suchen würde; und dennoch fühlt man immer, daß Er „ein Fremdling" hienieden war. Ja, ein Fremdling hienieden, ein Fremdling, insoweit der Gott widerstrebende Mensch den Schauplatz dieser Welt ausfüllte; aber sobald irgendein Elend oder ein Bedürfnis nach Ihm verlangte, zeigte Er Sich in vertraulicher Nähe. Die Entfernung, in der Er Sich hielt, und die Vertraulichkeit, mit der Er nahte, beides war vollkommen.
Er betrachtete nicht nur das Ihn umringende Elend, sondern Er nahm Anteil daran, und das mit einem Mitgefühl, das nur in Ihm Selbst seine Quelle hatte; und Er verwarf nicht nur die Ihn umringende Unreinigkeit, sondern Er erhielt auch den Abstand
der Heiligkeit von jeder Berührung mit dem Bösen und jeglicher Befleckung aufrecht.
Betrachten wir Ihn in dieser Entfernung und in dieser Nähe, so wie uns das 6. Kapitel in Markus Ihn darstellt. Es ist eine rührende Szene. Die Jünger kehren nach ermüdendem Tagewerk zu Jesu zurück. Er ist besorgt für sie, nimmt Anteil an ihrer Müdigkeit, und im Blick auf sie sagt Er zu ihnen: „Kommet ihr selbst her an einen wüsten Ort besonders und ruhet ein wenig aus".
Doch da die Volksmenge Ihm bereits vorausgeeilt ist, wendet Er Sich mit derselben Liebe auch dieser zu, nimmt Kenntnis von ihrer Lage, und setzt Sich dann nieder, um sie zu unterweisen, da sie in Seinen Augen wie Schafe waren., welche keinen Hirten hatten. In diesem allen sehen
wir, wie der Herr Jesus den mannigfaltigen Bedürfnissen gegenüber, die sich vor Ihm erhoben, nahe war; mochte es sich um die Müdigkeit der Jünger oder um die Unwissenheit und den Hunger der Menge handeln. Er trug Sorge für das eine wie für das andere. Doch die Jünger, unzufrieden über die Sorgfalt, die Er der Menge widmet, fordern Ihn auf, sie zu entlassen. Das aber entspricht nicht den Gedanken des Herrn; und sofort bildet sich zwischen Ihm und Seinen Jüngern eine Entfremdung, die sich kurz nachher darin kundgibt, daß Er sie in ein Schiff zu steigen nötigt, damit sie vor Ihm an das jenseitige Ufer fahren sollten, während Er die Volksmenge entlassen will. Diese Trennung hat für die Jünger eine neue Not im Gefolge. Der Wind und die Wellen sind ihnen entgegen auf dem See; aber als die Gefahr aufs höchste gestiegen ist, erscheint Jesus wieder in ihrer Nähe, um ihnen zu helfen und ihnen Mut einzuflößen.
Welch eine Harmonie ist in dieser Verschmelzung von Heiligkeit und Gnade! Jesus ist uns nahe, wenn wir müde sind, wenn wir Hunger leiden oder uns in Gefahr befinden; aber Er ist
fern von den Regungen unseres natürlichen Charakters, fern von unserer Selbstsucht. Seine Heiligkeit machte Ihn zu einem völligen Fremdling in einer unreinen Welt; Seine Gnade erhielt
Ihn stets tätig in einer Welt voll Leiden und Bedürfnisse. Und gerade hierin zeigt sich die moralische Herrlichkeit des Lebens unseres Heilands in ganz besonderem Licht: obwohl Er durch den Charakter von dem, was Ihn umgab, notwendigerweise zu einem einsamen Mann wurde, veranlaßten Ihn dennoch das Elend und die Leiden um Ihn her, ununterbrochen tätig zu sein.
Und da diese Tätigkeit sich allen Arten von Menschen gegenüber offenbarte, mußte sie sich auch in die verschiedensten Formen kleiden. Christus hatte mit Widersachern, mit einer Volksmenge, mit Seinen zwölf Jüngern und mit einzelnen Personen zu tun; und diese hielten Ihn nicht nur ununterbrochen, sondern auch auf mannigfaltige Art in Tätigkeit; und Er mußte wissen (und wußte es sicher in vollkommener Weise), welche Antwort Er einem jeden zu geben hatte.
Bei gewissen Gelegenheiten sehen wir den Herrn auch an dem Tisch anderer sitzen; aber es dient wiederum nur dazu, neue Züge Seiner Vollkommenheit vor unseren Blicken zu enthüllen.
Am Tisch der Pharisäer, wo wir Ihm zuweilen begegnen, betritt Er nicht den traulichen Boden der Familie, sondern eingeladen in dem Charakter, den Er Sich bereits in der Öffentlichkeit erworben und dort dargestellt hat, handelt Er diesem Charakter gemäß. Er ist nicht einfach ein Gast, dem die Zuvorkommenheit und Gastfreundschaft des Hausherrn zuteil wird, sondern Er ist in Seinem eigenen Charakter gekommen, und deshalb kann Er lehren und zurechtweisen. Er ist immer das Licht und handelt als das Licht; und so macht Er, wie Er es draußen getan hat, auch im Innern des Hauses die Finsternis offenbar (siehe Lk 7, 40 usw.; ri , 37 usw.).
Während Er aber so wieder und wieder das Haus des Pharisäers als Lehrer betrat und, als solcher handelnd, den moralischen Zustand, wie er sich dort vorfand, verurteilte, erblicken
wir Ihn in der Wohnung des Zöllners als Heiland. Levi bereitete Ihm ein Mahl in seinem Hause und führte Zöllner und Sünder in Seine Gesellschaft ein. Und als dies, wie es ganz natürlich war, den Ärger der Schriftgelehrten, der religiösen Leiter des Volkes, erregte, offenbarte Sich der Herr als Heiland, indem Er zu ihnen sagte: „Die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Gehet aber hin und lernet, was es ist: „Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer"; denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder" (Mt 9, 12. 13). Wie einfach sind diese Worte, aber zugleich wie treffend und bedeutungsvoll! Simon, der Pharisäer, war unwillig darüber, daß eine Sünderin in sein Haus trat und sich Jesu nahte, während Levi, der Zöllner, gerade Sünder einlud, um die Mitgäste des Herrn Jesu zu sein; und infolgedessen handelt der Herr im Hause des einen wie ein Tadler, während Er Sich im Hause des anderen in den Gnadenreichtümern eines Erlösers zeigt.
Doch wir finden den Herrn Jesus noch bei anderen Personen zu Tische. Folgen wir Ihm nach Jericho und nach Emmaus (Lk 19 und 24). Es war ein Herzensbedürfnis, das Ihn bei jeder dieser Gelegenheiten aufnahm, wenn es auch unter verschiedenen Einflüssen erwacht war. Zachäus war bis zu jener Stunde nur ein Sünder, ein Mensch in seinem natürlichen Zustande gewesen, der, wie wir wissen, in seinen Quellen und in seinen Kundgebungen verderbt ist. Aber er stand in jenem Augenblick unter dem Zuge des Vaters zum Sohne, und Jesus wurde der Gegenstand seiner Seele. Er begehrte Ihn zu sehen, und von diesem brennenden Verlangen getrieben, hatte er sich einen Weg durch die Menge gebahnt und war auf einen MaulbeerFeigenbaum gestiegen, um so, wenn möglich, den vorübergehenden Herrn zu sehen. Der Herr blickte zu ihm auf und
lud Sich augenblicklich bei Ihm ein. Das ist sehr beachtenswert; Jesus ist in dem Hause des Zöllners zu Jericho ein ungenötigter Gast, der Sich Selbst eingeladen hat.
Die ersten Regungen des geistlichen Lebens in dem Herzen eines armen Sünders, die durch den Zug des Vaters geweckten Bedürfnisse, waren in diesem Hause zur Bewillkommnung Jesu vorhanden; aber der Herr kommt in einer höchst lieblichen und bedeutungsvollen Weise dieser Bewillkommnung zuvor und tritt in das Haus ein in einem Charakter, der den Bedürfnissen des Augenblicks entsprach und sie beantwortete, um so das neugeweckte Leben anzufachen und zu befestigen, bis es sich in einer seiner kostbaren Tugenden offenbart und etliche seiner guten Früchte entfaltet. „Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfältig" (Lk 19, 8). In Emmaus begegnen wir einer anderen Szene. Hier finden wir nicht das Verlangen einer neuergriffenen Seele, sondern das Begehren wiederhergestellter Heiliger. Die beiden Jünger
hatten dem Unglauben Raum gegeben. Sie kehrten heimwärts unter dem traurigen Eindruck, daß Jesus sie in ihren Erwartungen getäuscht habe. Der Herr Jesus tadelt sie, gleich nachdem Er Sich auf dem Wege zu ihnen gesellt hat; jedoch ist die Art Seiner Unterhaltung so anziehend, daß ihre Herzen zu brennen beginnen (Lk 24, 3z), und sie Ihn, als sie die Tür ihrer Wohnung erreicht haben und Er Miene zum Weitergehen macht, dringend nötigen, bei ihnen einzukehren. Hier ladet Er Sich nicht Selbst ein, wie Er es in Jericho getan hatte.
Die beiden Jünger waren nicht in dem gleichen Zustande, in dem sich Zachäus befand. Aber sobald sie Ihn einladen, kehrt der Herr ein, und zwar um das Verlangen, welches jene zu Seiner
Einladung getrieben hatte, weiter zu fördern, ja, völlig zu befriedigen. Und so geschah es denn auch: die Freude ihrer Herzen war so groß, daß sie, wie weit auch die Nacht schon
vorgerückt sein mochte, noch zu derselben Stunde nach Jerusalem zurückkehrten, um ihren Brüdern von diesen Dingen Kunde zu geben.
Wie voll der mannigfaltigsten Schönheiten sind alle diese Ereignisse! Der Gast des Pharisäers, der Gast des Zöllners, der Gast der Jünger, der geladene und ungeladene Gast, sitzt in
der Person Jesu stets auf Seinem Platz in aller Vollkommenheit und Schönheit. — Es gibt noch andere Fälle, in denen der Herr Jesus als Tischgenosse vor unsere Augen tritt; aber ich
beschränke mich darauf, nur noch einen einzigen anzuführen.
In Bethanien sehen wir Ihn auf dem, wie wir es weiter oben nannten, traulichen Boden der Familie. Würde Er die Idee einer christlichen Familie mißbilligt haben, so hätte Er nicht in
Bethanien sein können. Aber wir sehen Ihn dort, und zwar wieder, um einen neuen Zug Seiner moralischen Herrlichkeit in Ihm zu entdecken. Er ist in Bethanien als ein Freund der Familie, indem Er in ihrem Kreis das findet, was wir noch heute so hoch schätzen: eine Heimat. Die Worte: „Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus", bestätigen dieses zur Genüge. Die Liebe des Herrn zu dieser Familie war nicht die Liebe eines Erlösers oder eines Hirten, wiewohl wir wissen, daß Er beides für sie war; es war die Liebe eines Familienfreundes. Aber obwohl Er ein Freund, und zwar ein vertrauter Freund war, Der, so oft es Ihm beliebte,
unter diesem gastfreundlichen Dach herzliche Aufnahme finden konnte, mischte Er Sich doch niemals in die Einrichtungen und Anordnungen des Hauses. Martha war die Haushälterin,
die am meisten beschäftigte Person der Familie, nützlich und wichtig an ihrem Platze; und Jesus läßt sie da, wo Er sie findet.
Es war nicht Seine Sache, solche Dinge zu verändern oder zu ordnen. Lazarus konnte Platz nehmen zur Seite seiner Gäste an der Familientafel; Maria konnte sich zurückziehen und
gleichsam in ihr eigenes Reich, oder in das Reich Gottes in ihr, sich vertiefen; und Martha konnte beschäftigt sein und ihren häuslichen Pflichten obliegen, Jesus läßt alles gerade so, wie
Er es findet. Er, der nicht ungeladen in das Haus eines anderen eintreten mochte, will, wenn Er bei diesen beiden Schwestern und ihrem Bruder eingekehrt ist, sich nicht in die häusliche
Ordnung und deren Einrichtungen mischen. Welch eine vollkommene Wohlanständigkeit! Aber wenn eines der Glieder der Familie, anstatt den ihm angewiesenen Platz in dem
Familienkreise zu bewahren, sich in der Gegenwart Jesu belehrende Anmerkungen erlaubt, dann muß und wird Er Seinen höheren Charakter annehmen, um in göttlicher Weise die
Dinge zu ordnen, welche Er, häuslich betrachtet, nicht berühren und in die Er Sich nicht einmischen mochte (Lk 10).
Wer könnte alle die schönen Züge in Jesu aufspüren und verfolgen? Und wenn kein menschliches Auge imstande ist, die ganze Fülle dieses Gegenstandes zu erkennen, wo ist dann der menschliche Charakter zu finden, der nicht durch seine eigenen Schatten und Unvollkommenheiten den Glanz dieses Gegenstandes um so klarer hervorstrahlen ließe? Keiner von uns stellt sich den Johannes oder den Petrus oder einen der anderen Apostel als hartherzig und lieblos vor; im Gegenteil fühlen wir, daß wir sie hätten zu Vertrauten unserer Sorgen und Kümmernisse machen können. Dennoch aber zeigt uns jene bereits erwähnte kurze Erzählung in Markus 6, daß sie sich alle auf einem Fehler ertappen ließen, daß sie sich alle in einer gewissen Entfernung hielten, als die hungrige Menge sich an sie wandte und ihre Ruhe zu stören drohte, während für Jesus gerade dies der Augenblick und die Gelegenheit war, Sich zu
nähern. Alles das, geliebter Leser, zeigt uns, was Jesus ist. „Ich kenne niemanden", hat einmal jemand gesagt, „der so gut und so herablassend wäre wie Er, niemanden, der wie Er zu armen
Sündern herabgestiegen ist. Ich setze größeres Vertrauen in Seine Liebe, als in die Liebe einer Maria oder irgendeines anderen Heiligen; nicht nur Seine Macht als Gott, sondern die Zärtlichkeit Seines Herzens als Mensch zieht mich an. Niemand zeigte oder besaß je eine solche Zärtlichkeit; niemand hat mir je ein solches Vertrauen eingeflößt. Mögen sich andere an die Heiligen oder an die Engel wenden, wenn sie wollen; ich habe ein größeres Vertrauen zu der Güte Jesu". — Wahrlich, so ist es; und ich wiederhole, jene Erzählung in Markus 6 bestätigt
dies, indem sie uns einerseits die Engherzigkeit der Besten unter uns, eines Petrus und Johannes, offenbart, und andererseits die volle, unermüdliche und dienende Gnade Jesu ans
Licht stellt.
Aber es gibt in dem Herrn nicht nur Verbindungen von Tugenden und Gnaden, sondern auch von Charakteren. Das zeigen uns Seine Beziehungen zur Welt, als Er hienieden wandelte. Er war zugleich ein Sieger, ein Mann der Schmerzen und ein Wohltäter. Welch eine moralische Herrlichkeit strahlt
uns aus dieser Zusammenfügung entgegen! Er überwand die Welt, indem Er alle ihre Reize und Anerbietungen ausschlug; Er litt von Seiten der Welt, weil Er für Gott gegen den Lauf und den Geist der Welt Zeugnis ablegte; und Er schüttete Seine Segnungen über die Welt aus, indem Er beständig Seine Liebe und Seine Macht walten ließ und Böses mit Gutem vergalt. Die Versuchungen der Welt dienten nur dazu, um aus Ihm einen Sieger zu machen, das Verderben und der Haß der Welt, um aus Ihm einen Mann der Schmerzen, und das Elend der Welt, um aus Ihm einen Wohltäter zu machen. Welch eine Reihe von moralischen Herrlichkeiten findet sich hier miteinander vereinigt!
Der Herr Jesus gab in Seiner Person eine treffende Erläuterung der unter uns oft gehörten Worte: „in der Welt, aber nicht von der Welt", ein Ausdruck, der ohne Zweifel den Worten des Herrn entlehnt ist: „Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt wegnehmest, sondern daß du sie bewahrest vor dem
Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin" (Joh 17, 15. 16). Er war die lebendige Offenbarung dieses Zustandes während Seines ganzen Lebens auf Erden; denn Er war stets in der Welt und wirkte inmitten ihrer Unwissenheit und ihres Glaubens. Niemals aber war Er von der
Welt; nie nahm Er teil an ihren Erwartungen und Plänen, noch wandelte Er in ihrem Geiste. Jedoch zeigt Er Sich in Joh 7, wie ich glaube, in ganz besonderer Weise in diesem Charakter.
Es war die Zeit des Laubhüttenfestes, die Krone der Freudentage in Israel, der Vorgeschmack des kommenden Reiches, die Zeit der Einsammlung der Ernte, wobei sich das Volk nur daran zu erinnern hatte, daß es ehemals in der Wüste umherirrte und in Zelten wohnte. Die Brüder des Herrn drängten Ihn, eine Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen, wo „alle Welt", wie wir sagen würden, in Jerusalem versammelt war. Sie wünschten, daß Er Sich hervortun und Sich, wie
wir uns ausdrücken, als „ein Mann der Welt" zeigen möchte. „Wenn du", sagen sie, „diese Dinge tust, so zeige dich der Welt". Doch Jesus weigert sich, ihrem Wunsche zu folgen. Für Ihn war die Zeit, das Laubhüttenfest zu feiern, noch nicht gekommen. Er wird einmal, wenn Sein Tag angebrochen sein
wird, Sein Reich übernehmen; dann wird Er groß sein, und Seine Herrschaft wird sich ausbreiten bis zu den Enden der Erde; aber jetzt führte Sein Weg zum Altar und nicht zum Thron. Er will nicht auf das Fest gehen, um von dem Feste zu sein, obwohl Er Sich an der Stätte des Festes einfindet. Und
darum sehen wir Ihn auch, sobald Er in Jerusalem angekommen ist, als Diener, nicht aber in Seiner Würde auftreten; auch verrichtet Er kein Wunder, wie es Seine Brüder gewünscht hatten, damit Er dadurch die Aufmerksamkeit der Menschen auf Sich lenke, sondern Er belehrt andere und verbirgt Sich Selbst hinter den Worten: „Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat".
Wie bemerkenswert und charakteristisch ist das alles! Es war etwas on der Herrlichkeit Jesu, des vollkommenen Menschen, in Seinem Verhältnis zur Welt. Er war ein Sieger, ein Mann der Schmerzen und ein Wohltäter in der Welt; aber Er war nicht von der Welt. Indes sehen wir Ihn zu Zeiten mit derselben Vollkommenheit Dinge unterscheiden, wie jene schöne Verbindung offenbaren. Wenn Er Sich z. B. mit Leiden befaßt, welche, wenn ich so sagen darf, draußen liegen, so erblicken
wir eine bewunderungswürdige Zärtlichkeit, verbunden mit der Macht zu heilen; handelt es sich aber um die Trübsale der Jünger, so finden wir ebenso wohl Treue wie Zärtlichkeit. Der Aussätzige in Mt 8 war ein Fremdling. Er kommt mit seinen Leiden zu Jesu und findet sofort Heilung. Im gleichen Kapitel wenden sich auch die Jünger in ihrer Bedrängnis während des Sturms an Ihn; aber sie empfangen mit der Hilfe auch einen Verweis. „Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige"? sagt Er zu
ihnen; und doch hatte der Aussätzige einen ebenso kleinen Glauben wie die Jünger. Denn wenn diese schreien: „Herr, rette uns, wir kommen um"! sagt jener: „Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen"! Aber die Jünger wurden getadelt, der Aussätzige nicht; und zwar mit Recht, denn die beiden Fälle waren durchaus voneinander verschieden. In dem einen handelte es sich nur um das Leiden, in dem anderen neben dem Leiden auch um die Seele. Infolgedessen antwortete der
Herr dem Aussätzigen durch eine unvermischte Liebe, während Er im Blick auf die Jünger mit der Zärtlichkeit die Treue verband. Die Verschiedenheit der Beziehungen zu Ihm (als Jünger oder als Fremdlinge) erklärt die Verschiedenheit in der Handlungsweise des Herrn und zeigt uns, mit welcher Vollkommenheit Er Dinge unterschied, die zwar eine große Ähnlichkeit miteinander hatten, aber doch nicht gleich waren.
Doch betrachten wir diese Vollkommenheit des Herrn noch etwas näher. Obwohl Er Selbst Verweise gibt, so erlaubt Er doch nicht, daß andere dies in leichtfertiger Weise tun. Ähnliches finden wir auch in früheren Tagen. Während Gott Selbst Seinen Knecht Mose demütigte, gestattete Er nicht, daß Mirjam und Aaron ihm Vorwürfe machten (4. Mo 11 und 12). Und während Israel oftmals in der Wüste durch die Hand Gottes gezüchtigt wurde, trat Gott in Gegenwart Bileams und anderer Widersacher stets wie einer auf, der keine Ungerechtigkeit in Israel sah und nicht erlaubte, daß irgendwelche Zauberei wider das Volk den Sieg davontrug. Ebenso treffend und schön ist die Dazwischenkunft Jesu gelegentlich der Unzufriedenheit und des Murrens der zehn Jünger über ihre zwei Gefährten
(Mt 20), sowie Sein Verhalten Johannes dem Täufer gegenüber; obwohl Er, gleichsam im Verborgenen, ein Wort der Warnung und Zurechtweisung an diesen richtete (ein Wort, das wohl nur von dem Gewissen des Johannes verstanden werden konnte), wandte Er Sich an die Menge ausschließlich mit Ausdrücken der höchsten Billigung und der Zufriedenheit über Johannes.
Es gibt noch viele andere Beispiele von dieser Gnade, welche Dinge, die verschieden waren, auch unterschied. Selbst in Seiner Handlungsweise Seinen Jüngern gegenüber kam ein Augenblick, wo die Treue nicht länger am Platze war, sondern wo nur die Liebe ausströmen durfte; ich meine die Scheidestunde (Joh 14—16). Da war es zu spät, „treu zu sein"; der Augenblick erlaubte es nicht. Es war eine Stunde, auf die das Herz, als ihm allein gehörig, Anspruch machte; die Erziehung
der Seele mußte dieses Mal ganz außer acht bleiben. Freilich offenbart der Herr Seinen Jüngern neue Geheimnisse hinsichtlich der innigsten und vertrautesten Beziehungen zwischen ihnen und dem Vater; aber in allen Seinen Worten findet sich nichts, was einem Verweis ähnlich wäre. Jetzt sagt Er nicht:
„Kleingläubige"! oder: „Seid ihr noch unverständig"? Das einzige Wort, das vielleicht wie ein Verweis klingen könnte, dient nur dazu, die Jünger eine Wunde erkennen zu lassen, die Sein Herz erlitten hatte, damit sie so Seine Liebe zu ihnen völliger verstehen möchten. Das war also in den vollkommenen Gedanken und Zuneigungen des Herzens Jesu die Heiligkeit des Schmerzes der Scheidestunde; und auch wir fühlen nach unserem geringen Maß wenigstens so viel davon,
daß wir fähig sind, dessen vollen Ausdruck in Jesu würdigen und bewundern zu können. „Umarmen hat seine Zeit", sagt der Prediger, „und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit". Das ist eine Verordnung im Gesetzbuch der Liebe, und Jesus beobachtete sie.
Jesus ließ Sich indes niemals zur Milde verleiten, wenn die Gelegenheit Treue erforderte, obwohl Er an so vielen Umständen vorüber schritt, welche die menschliche Empfindlichkeit geahndet haben würde, und die nach dem sittlichen Gefühl des Menschen geahndet zu werden verdienten. Er wollte Seine Jünger nicht gewinnen durch das armselige Mittel einer liebenswürdigen Natur. Von den Feueropfern Jehovas war sowohl „Honig" als auch „Sauerteig" ausgeschlossen. Die Speisopfer
durften nichts davon haben (3. Mo 2, 11); und so zeigte sich auch in Jesu, dem wahren Speisopfer, nichts von beidem. Es war nicht eine rein menschliche, natürliche Liebenswürdigkeit, die den Jüngern in ihrem Lehrer entgegentrat.
Bei Ihm war jene Höflichkeit nicht, die stets den Geschmack anderer zu erraten und zu befriedigen trachtet. Er suchte nicht Sich angenehm zu machen, und doch zog Er die Herzen in der innigsten
Weise an Sich; und das ist Macht. Es ist immer ein Beweis von sittlicher Kraft, wenn man das Vertrauen eines anderen erlangt, ohne es zu suchen; denn in diesem Fall hat das Herz
die Wirklichkeit der Liebe erkannt. „Wir alle wissen", sagt ein anderer Schreiber, „wahre Zuneigung von bloßer Aufmerksamkeit und Freundlichkeit wohl zu unterscheiden; das eine kann in großem Maße vorhanden sein, ohne daß sich von dem anderen auch nur eine Spur vorfindet. Manche mögen meinen, sich durch Aufmerksamkeiten das Vertrauen anderer erwerben zu können; aber wir wissen nur zu wohl, daß nichts anderes als Liebe dazu imstande ist". — Wie wahr ist das! Eine bloß
äußerliche Freundlichkeit ist Honig; und wie viel von diesem armseligen Material mag sich wohl unter uns finden! Wir streben vielleicht nach nichts Höherem, als den Sauerteig auszufegen und die Leere mit Honig anzufüllen, und denken so gern, daß dann alles in Ordnung sei. Wenn wir nur liebenswürdig sind im Umgang und, indem wir anderen zu gefallen trachten und alles Mögliche tun, um mit jedem auf gutem Fuß zu leben, unseren Platz auf dem wohlgeordneten und glatten
Boden der menschlichen Gesellschaft geziemend ausfüllen, so sind wir mit uns selbst zufrieden, und andere haben auch nichts an uns auszusetzen. Aber heißt das Gott dienen? Ist das ein Speisopfer? Glauben wir wirklich, daß das einen Teil der moralischen Herrlichkeit des vollkommenen Menschen ausmache? Wahrlich nicht! Wir mögen vielleicht meinen, daß nichts besser und kräftiger zu wirken vermöge, um jenes hohe Ziel zu erreichen; aber dennoch bleibt es eins der Geheimnisse des Heiligtums, daß kein Honig angewendet werden durfte, um dem Opfer einen lieblichen Geruch zu verleihen.
Wir haben also gesehen, wie vollkommen an sittlicher Herrlichkeit und Schönheit alle die Wege des Sohnes des Menschen waren, sei es im Blick auf Entwicklung und der zeitgemäßen Offenbarung, oder auf Verbindungen und Unterscheidungen. Das Leben Jesu war wie das glänzende Licht einer Lampe.
Ja, eine Lampe stand im Hause Gottes, die weder der „Lichtschneuzen" noch der „Löschnäpfe von reinem Golde" bedurfte (vgl. 2. Mo 25, 38), und die stets vor dem Angesicht des Herrn zugerichtet und mit dem „reinen, zerstoßenen Olivenöl" gefüllt war (2. Mo 27, 20). Sie erleuchtete alles, was sie umgab, verurteilte und strafte alles, was verurteilt und gestraft werden mußte, und verrichtete ihren Dienst, ohne selbst jemals Anlaß zu einem Tadel zu geben.
Wie oft auch der Herr, was wieder und wieder geschah, durch Seine Jünger oder durch Seine Widersacher beschuldigt werden mochte, so suchte Er Sich doch nie zu entschuldigen. Bei einer
Gelegenheit beklagen sich Seine Jünger über Ihn, indem sie sagen: „Lehrer, liegt dir nichts daran, daß wir umkommen"? (Mk 4, 38). Aber Er denkt nicht daran, den Schlaf zu rechtfertigen, den sie in dieser Weise stören. Zu einer anderen Zeit machen sie die Bemerkung: „Meister, die Volksmenge drängt und drückt dich, und du sagst: Wer ist es, der mich angerührt hat" (Lk 8, 45)? Aber es bedurfte einer solchen Bemerkung nicht; das zeigte die sofortige Heilung des Weibes. — Wieder
zu einer anderen Zeit sagt Martha zu Ihm: „Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben" (Joh ai , 21). Aber Er entschuldigt Sich nicht wegen Seines langen Ausbleibens, sondern belehrt Martha über den wunderbaren Charakter, den Sein Zögern dieser Stunde verliehen
hatte. Und wie herrlich wurde Sein Zögern dadurch gerechtfertigt !
So war es bei jeder ähnlichen Gelegenheit. Mochte Er beschuldigt oder getadelt werden, Er widerrief nie ein Wort, trat niemals einen Schritt zurück. Er bestrafte jede Stimme, die sich richtend wider Ihn erhob. Seine Mutter gibt Ihm in Lk 2, 48 einen Verweis; aber statt ihre Beschuldigung aufrecht erhalten zu können, muß sie sich von der Finsternis und dem Irrtum ihrer Gedanken durch Ihn überzeugen lassen. Petrus nimmt sich heraus, Ihn mit den Worten zu ermahnen: „Gott behüte
dich, Herr! dies wird dir nicht widerfahren" (Mt 16, 22). Aber er muß lernen, daß Satan selbst es war, der ihm diesen Rat eingeflüstert hatte. Der Diener in dem Palast des Hohenpriesters geht noch weiter, indem er den Herrn scharf zurückweist und Ihm einen Backenstreich gibt (Joh 18); aber er wird überführt, angesichts und an der Stätte des Gerichtshofes die Gesetze geschändet zu haben.
Alles das zeugt von dem Wege des vollkommenen Lehrers. Der Schein mochte zuweilen gegen Ihn sein. Warum schlief Er in dem Schiff, während Wind und Wellen tobten? Warum ließ Er Sich auf dem Wege aufhalten, während die Tochter des Jairus im Sterben lag? Warum blieb Er an dem Ort, wo Er
war, als Sein Freund Lazarus in dem abgelegenen Bethanien krank lag? . . . Wahrlich, der Schein war gegen Ihn; aber auch nur der Schein, und auch das nur für einen kurzen Augenblick.
Wir haben von diesen Wegen Jesu, von Seinem Schlafen, gehört, von Seinem Zögern auf dem Wege und Seinem Bleiben an einem Ort; aber wir haben auch das Ende dieser Wege gesehen, daß in allem nur Seine Vollkommenheit hervortrat. Auch in den Tagen der Patriarchen war der Schein gegen den
Gott Hiobs. Eine Trauerbotschaft folgte auf die andere, schien das nicht hart und grausam zu sein? Aber der Gott Hiobs hatte Sich ebenso wenig zu entschuldigen wie der Jesus der Evangelien.
Wenn wir daher den Herrn Jesum als die Lampe des Heiligtums, das Licht des Hauses Gottes, betrachten, so finden wir, daß die „Lichtschneuzen und Löschnäpfe" im Blick auf Ihn ganz und gar nutzlos waren und sein Gegenbild in Ihm fanden. Aus diesem Grunde mußten auch alle, die sich anmaßten, während Er hienieden wandelte, Ihn zu tadeln und zu beschuldigen, selbst bestraft und beschämt davongehen. Sie gebrauchten die Löschnäpfe und Lichtschneuzen für eine Lampe, die
ihrer nicht bedurfte, und verrieten dadurch nur ihre eigene Torheit; und das Licht dieser Lampe strahlte um so heller, nicht weil die Lichtschneuzen gebraucht worden waren, sondern weil
es durch ihren Gebrauch in den Stand gesetzt wurde, ein neues Zeugnis — und dies geschah bei jeder Gelegenheit — von der Tatsache abzulegen, daß es jener Geräte nicht bedurfte. Alle diese Beispiele geben uns die nützliche Unterweisung, daß es für uns weitaus das Beste ist, uns als ruhige Zuschauer zu verhalten und den Herrn in Seinem Tun nicht zu stören. Wir dürfen anschauen und anbeten, aber nicht uns einmischen und Ihn unterbrechen, wie die Feinde, die Verwandten und selbst die Jünger der damaligen Zeit es taten. Sie konnten dieses hell leuchtende Licht nicht glänzender machen; sie hatten deswegen sich nur des Lichts zu erfreuen und in Seinen Strahlen zu wandeln, ohne es putzen und zurichten zu wollen. Möchte unser Auge einfältig sein; dann wird sicher die Lampe des
Herrn, auf den Leuchter gestellt, unseren ganzen Leib mit Licht erfüllen!
Doch gehen wir weiter. So wie Jesus während Seines Dienstes Sich vor dem Urteil der Menschen nie zu rechtfertigen suchte, so machte Er auch keinen Anspruch auf menschliches Mitleid in der Stunde Seiner Schwachheit, als alle Mächte der Finsternis wider Ihn losgelassen waren. Als Er der Gefangene der Juden und Heiden geworden war, flehte und bat Er in keiner Weise; Er rief weder das Mitgefühl Seiner Umgebung an, noch trat Er für Sein Leben ein. Im Garten Gethsemane war Sein Gebet
zum Vater emporgestiegen; aber durch kein Wort suchte Er das Herz des jüdischen Hohenpriesters oder des römischen Landpflegers zu rühren. Alles was Er in jener Stunde zu dem Menschen sagte, diente nur dazu, die Sünde ans Licht zu stellen, die der Mensch, sowohl Jude als Heide, im Begriff
stand, zu begehen.
Welch ein Gemälde! Wer vermöchte einen solchen Gegenstand bis in seine Tiefen zu erfassen, einen Gegenstand, der, wie andere bemerkt haben, zur Schau gestellt werden mußte, ehe er beschrieben werden konnte! Es war der vollkommene Mensch, der einmal hier auf Erden in der Fülle jener moralischen Herrlichkeit Wandelte, deren Strahlen der Heilige Geist in den Blättern der Evangelien aufgezeichnet hat. Wahrlich, nächst der einfältigen, glückseligen und festen Gewißheit
Seiner persönlichen Liebe zu uns (die der Herr in unseren Herzen vermehren möge), gibt es nichts, was unser Verlangen, bei Ihm zu sein, brennender machen könnte, als die Entdekkung dessen, was Er Selbst ist. Ich habe jemanden, der in den vier Evangelien die herrlichen, lichtvollen Wege des Herrn
verfolgt hatte, mit einem Herzen voll Liebe und unter strömenden Tränen ausrufen hören: „O, daß ich bei Ihm wäre"!
Wenn es mir erlaubt ist, für andere das Wort zu nehmen, dann, geliebte Freunde, muß ich sagen, daß dieses es ist, was uns mangelt und was wir begehren. Wir kennen diesen Mangel, aber wir dürfen auch hinzufügen: der Herr kennt unser Begehren. „Aufbewahren hat seine Zeit, und Fortwerfen hat seine Zeit", sagt der Prediger Salomo (Kap. 3, 6). Der Herr Jesus wußte zur passenden Zeit aufzubewahren und zur passenden Zeit fortzuwerfen.
Wie freigebig das Herz und die Hand im Dienst Gottes auch sein mögen, es wird in diesem Dienste doch nie eine Vergeudung oder Verschwendung geben. „Von dir kommt alles", sagt David zum Herrn, „und aus deiner Hand haben wir dir gegeben" (1. Chron 2Q, 14).
Das Vieh auf tausend Bergen ist Sein, der Erdkreis und seine Fülle ist Sein (Ps 50). Der Pharao aber bezeichnete das Verlangen der Kinder Israel, ihrem Gott zu opfern, als Trägheit; und die Jünger betrachteten die dreihundert Denare, die zur Salbung des Leibes Jesu verwendet wurden, als Verschwendung (Mt 26, 6—13; Joh i2, i—8). Aber dem Herrn das Seinige zu geben: die Ehre oder das Opfer, die Liebe des Herzens, die Arbeit der Hände, oder die Güter des Hauses, das ist weder
Trägkeit noch Verschwendung. Die Rückerstattung dieser Dinge an Gott ist unsere erste Pflicht. Hierbei möchte ich indes noch einen Augenblick verweilen.
Aus Ägypten auszugehen, ist nicht Trägheit, und ein Fläschchen kostbarer Salbe auf das Haupt Jesu ausschütten ist nicht Verschwendung. Und dennoch sehen wir, daß eine gewisse Art, zu rechnen, die sich unter den Kindern dieser Welt, und leider nur zu oft auch unter den Heiligen Gottes findet, Dinge dieser Art so nennt. Wenn jemand irdische Vorteile ausschlägt und günstige Gelegenheiten für sein Fortkommen in dieser Welt versäumt, weil das Herz verstanden hat, in Gemeinschaft mit einem verworfenen Heiland seinen Weg zu gehen, dann ist die Zahl derer nicht gering, die das als „Trägheit" und „Verschwendung" betrachten. Man hätte, meinen sie, die Vorteile, die man besaß, festhalten, und die günstigen Gelegenheiten ergreifen und ausnutzen sollen, um sie dann für den Herrn zu verwerten.
Doch alle, die eine solche Sprache führen, befinden sich in einem groben Irrtum. Nach ihrer Meinung sollte die äußere Stellung, sowie der damit verbundene irdische und menschliche Einfluß als ein Vorrecht betrachtet, ja, sogar als eine „Gabe zum Nutzen, zur Erbauung und zum Segen" für andere angewendet werden (vgl. i. Kor 12, 7 ff.; 14, 1—3. 12 ff.). Aber ein von den Menschen verworfener Christus wird, wenn die Seele Ihn in geistlicher Weise erkannt hat, uns eine ganz andere Belehrung geben. Die Stellung in dieser Welt, die weltlichen Vorrechte und die so sehr empfohlenen
günstigen Gelegenheiten bilden jenes Ägypten, das Moses verließ. „Er weigerte sich, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen". Die Schätze Ägyptens waren nach seinem Urteil kein Reichtum; er konnte im Dienst des Herrn keinen Gebrauch von ihnen machen. Und so verließ er sie, und der Herr begegnete ihm und bediente Sich seiner hernach, und zwar nicht um Ägypten mit seinen Schätzen in Kredit zu bringen, sondern um Sein Volk aus dem Diensthause Ägyptens zu befreien. Diese Verzichtleistung auf alles, von welcher Moses uns ein so schönes Beispiel liefert, muß indes in der Erkenntnis eines verworfenen Heilandes und im Glauben an Ihn stattfinden; denn sonst würde sie ihres eigentümlichen Charakters, ihrer wahren Schönheit und Wirklichkeit entbehren. Wenn man auf einen bloßen religiösen Grundsatz hin handelt, um sich eine Gerechtigkeit zu erwirken oder ein Verdienst zu schaffen, so kann man mit Recht behaupten, daß dies schlechter ist als Trägheit und Verschwendung. In diesem Fall hat Satan viel eher einen Vorteil über uns erlangt, als daß wir einen Sieg über die Welt davongetragen hätten. Aber wenn jene Verzichtleistung im Glauben und aus Liebe zu dem verworfenen Herrn geschieht, in dem Bewußtsein und der Erkenntnis des Verhältnisses dieses Herrn zu dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf, dann ist es ein angenehmes Opfer für Gott, ein wahrer Gottesdienst.
Den Menschen auf Kosten der Wahrheit und der Grundsätze zu dienen, ist kein Christentum, wenn auch diejenigen, die so handeln, „Wohltäter" genannt werden mögen. Wahres Christentum hat ebensowohl die Ehre Gottes wie das Glück der Menschen im Auge; und in dem Maße wie wir dies aus
dem Gesicht verlieren, werden wir bemüht sein, viele Dinge, die wirklich der Ausdruck eines heiligen, geweihten und verständigen Dienstes für Christum sind, als Trägheit und Verschwendung zu betrachten. Daß es so ist, zeigt uns die Rechtfertigung, die der Herr dem Weibe, die ihre kostbare Salbe auf Sein Haupt ausschüttete, zuteil werden ließ (Mt 26). Wir haben in all unserem Tun auf die Ehre Gottes Rücksicht zu nehmen, mögen auch die Menschen ihre Anerkennung allem versagen, was nicht gerade der guten Ordnung in der Welt dienlich und dem Wohl des Nächsten förderlich ist. Jesus entsprach in jeder Beziehung den Rechten Gottes in dieser selbstsüchtigen Welt, wiewohl Er, wie wir wohl wissen, die Ansprüche des Nächsten an Seine Person völlig anerkannte. Er wußte zur passenden Zeit „fortzuwerfen" und zur passenden Zeit „aufzubewahren". „Was machet ihr dem Weibe Mühe?
denn sie hat ein gutes Werk an mir getan", sagte Er, als das Weib von den Jüngern getadelt wurde, weil sie das Fläschchen kostbarer Salbe über Ihn ausgeschüttet hatte; aber nach der Speisung von Tausenden rief Er denselben Jüngern zu: „Sammelt die übriggebliebenen Brocken, auf daß nichts umkomme" (Joh 6, 12).
Das war in der Tat eine Beobachtung der göttlichen Regel: „Aufbewahren hat seine Zeit, und Fortwerfen hat seine Zeit". Wenn einerseits der freigebige Dienst des Herzens oder der
Hand, der zur Ehre Gottes geschieht, keine Verschwendung ist, so sind andererseits die Krümchen der Speise des Menschen geheiligt und dürfen nicht weggeworfen werden. Derselbe Herr, der bei der einen Gelegenheit den Aufwand von dreihundert Denaren rechtfertigte, erlaubte in dem anderen Falle nicht, daß die Brocken von fünf Gerstenbroten am Boden liegen bleiben. In Seinen Augen waren diese Stücke heilig. Sie waren die Lebensspeise, das Kraut des Feldes, welches Gott dem Menschen zu seinem Unterhalt gegeben hatte; und das Leben ist eine geheiligte Sache. Gott ist der Gott der Lebendigen. Er hatte einst zu dem Menschen gesagt: „Ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut . . . und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist: es soll euch zur Speise sein" (1. Mo i, 29); und darum wollte Jesus es geheiligt wissen. Ferner wurde denen, die unter Gesetz waren, das Gebot gegeben: „Wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst (denn du kannst davon essen), und sollst sie nicht abhauen; denn ist der Baum des Feldes ein Mensch, daß er vor dir in Belagerung kommen sollte? Nur die Bäume, von denen du weißt, daß sie keine Bäume sind, von denen man ißt, die darfst du verderben und abhauen" (5. Mo 20, 19. 20). Es würde Verschwendung und Entweihung gewesen sein, wenn mit dem, was Gott zur Unterhaltung des Lebens gegeben hatte, Mißbrauch getrieben worden wäre; darum wollte Jesus
in Reinheit, ja, in der vollkommenen Ausführung der Anordnung Gottes, nicht ein einziges Krümchen am Boden liegen lassen. „Sammelt die übriggebliebenen Brocken, auf daß nichts
umkomme".
Dies sind nur geringfügige Dinge, könnte man einwenden; aber wir sehen daraus, daß alle Umstände des menschlichen Lebens, in denen Jesus Sich befunden hat, wie flüchtig und
unscheinbar sie auch scheinen mögen, durch einen Strahl jener moralischen Herrlichkeit geschmückt wurden, die stets den Pfad erleuchtete, den Seine heiligen Füße betraten. Das menschliche Auge war unfähig, Seine Spuren zu verfolgen; aber alles stieg zu Gott empor als ein duftender Wohlgeruch, als ein angenehmes Schlachtopfer, ein Opfer der Ruhe, das Speisopfer
des Heiligtums.
Es muß noch bemerkt werden, daß der Herr andere Personen nicht, wie dies leider bei uns oft der Fall ist, mit Rücksicht auf Sich Selbst beurteilte. Wir sind von Natur geneigt, andere nach der Art und Weise zu beurteilen, wie sie uns begegnen, indem wir unser Interesse für sie zu dem Maßstabe ihres Charakters und ihres Werkes machen. Doch der Herr handelte nicht in
dieser Weise. Gott ist ein Gott der Erkenntnis; Er wägt alle Handlungen richtig ab, denn Er beurteilt sie alle vollkommen und versteht sie in ihrer sittlichen Bedeutung. Und Jesus Christus, das Ebenbild des Gottes aller Erkenntnis, handelte ebenso während der Tage Seines Dienstes hienieden. Das 11. Kapitel des Lukas liefert uns ein Beispiel dafür. Bei dem Pharisäer,
der den Herrn zu Tische lud, zeigte sich ein Schein von Freundlichkeit und gutem Willen; aber Jesus war der „Gott aller Erkenntnis", und als solcher schätzte Er diese Handlung ab nach
ihrem wahren Charakter und ihrer sittlichen Bedeutung. Der Honig der Höflichkeit, der beste Bestandteil in dem gesellschaftlichen Leben dieser Welt, konnte den Geschmack und das Urteil Christi nicht verderben. Er erkannte alles an, was vortrefflich war. Die Höflichkeit, die Ihn einlud, beeinflußte das Urteil Dessen nicht, Der die Waagschalen und Gewichte des Heiligtums Gottes in Seiner Hand hielt. Es war der Gott aller Erkenntnis, dem die Höflichkeit der Welt bei jener Gelegenheit begegnen mußte; und sie konnte nicht vor Ihm bestehen. Wahrlich, eine beherzigenswerte Lehre für uns! Die Einladung barg einen wohlüberlegten Plan in sich. Kaum
ist der Herr in das Haus eingetreten, so spielt der Hausherr den Pharisäer und nicht den Wirt. Er drückt sein Befremden darüber aus, daß der Herr nicht vor dem Mahl Seine Hände gewaschen habe; und der Charakter, den er so zu Anfang annimmt, zeigt sich am Ende in seiner vollen Stärke. Der Herr begegnet diesem Benehmen in durchaus angemessener Weise; denn Er wägt, wie gesagt, alles ab als der Gott der Erkenntnis, Man möchte vielleicht denken, die Ihm erwiesene Höflichkeit hätte Ihm Schweigen auferlegen müssen; aber Jesus konnte den Pharisäer nicht nur mit Rücksicht auf Sich Selbst betrachten. Schmeichelei konnte Sein Urteil nicht beeinflussen.
Er deckt auf und bestraft, und das Ende der ganzen Szene rechtfertigt Ihn. „Als Er aber dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf Ihn einzudringen und Ihn über vieles auszufragen; und sie lauerten auf Ihn, etwas aus Seinem Munde zu erjagen" (Lk 11, 53. 54). Sehr verschieden hiervon ist das Verhalten des Herrn im Hause eines anderen Pharisäers, der Ihn ebenfalls zu Tische geladen hatte (siehe Lk 7); denn Simon verbarg keine Nebenabsichten bei seiner Einladung. Freilich schien auch er als Pharisäer zu handeln, indem er die arme Sünderin aus der Stadt bei sich selbst verurteilte und seinen Gast tadelte, weil
dieser deren Annäherung duldete; aber der bloße Schein kann einem gerechten Urteil niemals zur Grundlage dienen. Oft haben die gleichen Worte, je nach den Lippen, die sie aussprechen, einen ganz verschiedenen Sinn. Obwohl deshalb der Herr, der alles vollkommen Gott gemäß abwägt, Simon tadelt und vor Sich Selbst bloßstellt, so nennt Er ihn doch bei Namen und verläßt sein Haus, wie ein Gast es verlassen sollte. Er macht einen Unterschied zwischen dem Pharisäer in Ll< 7 und dem in Lk 1%, wiewohl Er bei beiden zu Tische saß.
Ebenso zeigt Sich der Herr Seinem Jünger Petrus gegenüber. In Mt 16 gibt Petrus seiner zärtlichen Liebe zu dem Herrn Ausdruck, indem er sagt: „[Gott] behüte dich, Herr! dies wird
dir nicht widerfahren"! Aber Jesus beurteilt die Worte des Petrus nur nach ihrem moralischen Wert. Uns erscheint es schwer, so zu handeln, wenn man sich bemüht, angenehm gegen uns zu sein. Eine bloß liebenswürdige Natur würde nicht das ernste: „Gehe hinter mich, Satan"! als Antwort auf jene Worte gegeben haben. Aber ich wiederhole, der Herr betrachtete die Worte Seines Jüngers nicht einfach als den Ausdruck eines guten Willens und einer persönlichen Zuneigung zu Seiner Person, sondern Er richtete sie, wog sie ab in der Gegenwart Gottes und fand alsbald, daß sie vom Feinde herrührten; denn er, der sich in einen „Engel des Lichts" verwandeln kann, verbirgt sich oft hinter höflichen und freundlichen Worten.
In derselben Weise handelte der Herr mit Thomas in Joh 20. Thomas hatte Ihm mit „mein Herr und mein Gott" gehuldigt. Doch Jesus war Selbst durch eine solche Huldigung nicht von
der sittlichen Höhe herabzubringen, auf der Er stand, und von wo aus Er alles anhörte und beschaute.
Ohne Zweifel waren die Worte des Jüngers aufrichtig gemeint und entquollen
einem Herzen, das von Gott erleuchtet war und Reue gegenüber dem auferstandenen Heiland fühlte, und anstatt noch länger zu zweifeln, seine Zweifel fahren ließ und anbetete.
Aber Thomas hatte sich so lange wie möglich ferngehalten; er hatte das Maß überschritten. Zwar waren alle Jünger bezüglich der Auferstehung ungläubig gewesen; aber Thomas
hatte erklärt, so lange im Unglauben verharren zu wollen, bis er durch sein Gefühl und seine Augen vom Gegenteil überzeugt werden würde. Das war sein moralischer Zustand gewesen; Jesus richtet den und stellt Thomas, wie einst den Petrus, an seinen wahren Platz, indem Er zu ihm sagt: „Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben"! — Würden in einem ähnlichen Falle unsere Herzen nicht von Erstaunen fortgerissen worden sein? Wahrlich, sie würden den Angriffen, die der gute Wille des Petrus und die Huldigung des Thomas auf sie gemacht hätten, nicht widerstanden haben. Aber unser vollkommener Lehrer stand nicht für Sich Selbst da, sondern für Gott und für Seine Wahrheit. So mochten auch vor alters die Israeliten der Bundeslade alle Ehre erweisen und sie auf das
Schlachtfeld hinausbringen (i. Sam 4), indem sie dadurch gleichsam ausdrückten, daß in ihrer Gegenwart nun alles gut gehen müsse; aber das genügte nicht für den Gott Israels. Er hatte ganz andere Gedanken. Denn obwohl die Lade in der Mitte Israels war, wurde dennoch das Volk von den Philistern geschlagen. Ebenso wurden Petrus und Thomas getadelt, obgleich Jesus, der immer noch der Gott Israels war, durch sie geehrt wurde.
Die Engel freuen sich über die Buße der Sünder. „Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut". Welch ein Glück für uns, daß uns dieses Geheimnis des Himmels geoffenbart ist, und daß wir davon in der Schrift eine bildliche Erläuterung nach der anderen finden, wie dies z. B. in Lk 15 der Fall ist! Aber es gibt noch mehr als das. Die Freude, obwohl sie im Himmel ist, ist öffentlich; sie äußert sich und findet ihren Widerhall. Es geziemt sich, daß es so ist; es geziemt sich, daß das ganze Haus an der Freude Anteil hat und sie als eine allgemeine Freude empfindet. Das ist noch nicht alles, es gibt noch mehr. Es gibt ebensowohl eine Freude des göttlichen Herzens wie eine Freude des Himmels. Die Freude des Himmels finden wir in Lk 15, die des göttlichen Herzens in Joh 4, 31—34. Und es wird kaum nötig sein, zu bemerken, daß die Freude des göttlichen Herzens die tiefste ist.
Sie ist vollkommen, geräuschlos und persönlich, sie macht keinen Anspruch darauf, durch andere hervorgerufen oder unterhalten zu werden. „Ich habe eine Speise zu essen, die
ihr nicht kennet"; das ist die Sprache des Herzens Christi im Genuß dieser Freude. Die Herrlichkeit erfüllt das Haus des Herrn, so daß die Diener des Heiligtums eine Zeitlang beiseitetreten mußten.
Der gute Hirte hatte eben erst das von der Herde abgeirrte Schaf, indem Er es mit Freuden auf Seine Schultern legte, nach Hause gebracht, und noch war die Freude
ganz und gar nicht auf Ihn allein beschränkt. Das Haus war noch nicht zusammengerufen worden, als das samaritische Weib, gerettet und glücklich, Ihn verließ. Die Jünger fühlten
den eigentümlichen Charakter des Augenblicks. Das für den Altar Gottes bestimmte Fett, der reichste, vornehmste Teil des Festes, „die Speise Gottes", war zubereitet; und die Jünger
traten schweigend zur Seite. Es war in der Tat ein wunderbarer Augenblick, man findet nicht viele seinesgleichen. Die tiefe, unaussprechliche Freude des göttlichen Herzens offenbart
sich hier, wie in Lk 15 die öffentliche Freude des Himmels.
Aber Er, Der auf solche Weise festlich gespeist werden konnte, war bisweilen müde, hungrig und durstig. Wir sehen das in demselben Kapitel (Joh 4), wie auch in Mk 4; jedoch mit dem Unterschied, daß Jesus in Mk 4 durch den Schlaf gestärkt und erquickt wird, während dies in Johannes 4 ohne irgendein äußeres Mittel geschieht. Und warum dieser Unterschied? In Markus hatte der Herr einen mühevollen Tag zurückgelegt, und am Abend fühlte Er Sich müde und erschöpft, wie dies bei
der menschlichen Natur nach einem schweren Tagewerk der Fall ist. „Der Mensch geht aus an sein Werk und an seine Arbeit, bis zum Abend" (Ps 104, 23). Dann ist der Schlaf für
ihn vorgesehen, damit er für den Dienst des wiederkehrenden Tages gestärkt und erquickt werde. Jesus erprobte alle diese Dinge. Er war im Schiff auf einem Kopfkissen eingeschlafen.
In Joh 4 ist Er ebenfalls ermüdet und hat zugleich Hunger und Durst. Er setzt Sich wie ein müder Reisender an dem Brunnen nieder und harrt der Rückkunft der Jünger mit Speise aus der
benachbarten Stadt entgegen. Doch als diese zurückkehrten, finden sie den Herrn erquickt und ausgeruht, und zwar ohne daß Er gegessen oder getrunken oder geschlafen hätte. Seine
Müdigkeit hatte eine Erfrischung gefunden, die Ihm der Schlaf nicht hätte verschaffen können. Er war dadurch glücklich gemacht worden, daß Er eine Frucht Seiner Arbeit sah in der
Seele einer armen Sünderin; das Weib war fortgegangen in der Freiheit des Heils Gottes. In Markus aber findet sich kein samaritisches Weib, und der Herr macht deshalb in Seiner
Müdigkeit von einem Kopfkissen Gebrauch.
Wie wahr und wie übereinstimmend ist dies alles mit den Erfahrungen unserer menschlichen Natur! Wir fassen es sehr leicht. In Joh 4 war, wenn ich mich so ausdrücken darf, das
Herz des Herrn fröhlich, während in Mk 4 nichts vorhanden war, was Ihn hätte fröhlich stimmen können; und die Heilige Schrift sagt (und unsere Erfahrungen bestätigen die Wahrheit
dieses Wortes): „Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein" (Spr 17, 22). Der Herr konnte daher in dem einen Falle sagen: „Ich
habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennet", während Er in dem anderen von einem Kopfkissen Gebrauch machte, das liebende Sorge für Seine Ermüdung herbeigeschafft hatte.
Wie vollkommen in allen ihren Empfindungen war die durch den Sohn Gottes angenommene Menschheit! Gewiß, es war ganz und gar die menschliche Natur, nur ohne Sünde.
Doch gehen wir weiter. In einer Zeit, wo alles in Verwirrung ist, neigt man leicht dahin, alles als hoffnungslos aufzugeben und zu sagen: Es ist nutzlos und eine Arbeit ohne Ende, noch
ferner einen Unterschied machen zu wollen. Alles ist in Unordnung und Abfall; warum also den Versuch machen, zu unterscheiden?
Das war nicht die Sprache des Herrn. Er befand sich inmitten der Verwirrung, aber Er hatte kein Teil daran, gerade so wie Er in der Welt, aber nicht von der Welt war. Er traf mit allerlei Arten von Leuten in den verschiedensten Zuständen zusammen; ein Haufe folgte dem anderen, während doch alle hätten zusammen vereinigt sein sollen; aber ohne die geringste Abweichung verfolgte Er stets Seinen geraden, schmalen und heiligen Pfad. Die Anmaßungen der Pharisäer, der Weltsinn der Herodianer, die Philosophie der Sadducäer, die Neugierde der Menge, die Anfälle der Widersacher, die Unwissenheit und Schwachheit der Jünger, alle diese Dinge bildeten die sittlichen Elemente, denen Er begegnete und mit denen Er Tag für Tag zu schaffen hatte.
Und wie die verschiedenen Charaktere der Personen, so übten auch die Ihn umgebenden Zustände das Herz des Herrn: die Münze des Kaisers war gangbar im Lande Immanuels, die
Trennungsmauern lagen in Trümmern; der Jude war mit dem Heiden, der Reine mit dem Unreinen vermengt, wenn nicht etwa religiöser Stolz die den verschiedenen Nationen eigentümlichen Weisen aufrecht erhielt. Aber die goldene Regel Jesu: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist", stellte die Vollkommenheit ans Licht, mit der Er Sich durch alles dieses hindurch bewegte. In den Tagen der Gefangenschaft, einer ähnlichen Zeit der Verwirrung, betrug sich der Überrest Israels sehr schön, indem er einen Unterschied machte zwischen dem, was verschieden war, und nicht alles als hoffnungslos aufgab. Daniel war der Ratgeber des Königs, aber er weigerte sich, sein Fleisch zu essen. Nehemia diente in dem Palast, aber er duldete nicht die Moabiter und Ammoniter im Hause des Herrn. Mordokai wachte über das Leben des Königs, aber er wollte sich nicht vor dem Amalekiter beugen. Esra und Serubbabel nahmen die Begünstigungen des persischen Königs an, aber sie wiesen die Hilfe von sich und gestatteten keine Ehen mit den Heiden. Die Gefangenen beteten für den Frieden Babylons, aber sie weigerten sich, die Lieder Zions dort zu singen.
Alles das ist von großer Schönheit, und der Herr offenbarte in Seinen Tagen vollkommen diesen Charakter des Überrestes. Liegt darin nicht für uns ein bedeutsamer Wink? Auch wir
leben in einer Zeit, die bezüglich ihres Charakters der Verwirrung den Tagen der jüdischen Gefangenschaft oder den Tagen Jesu nicht unähnlich ist. Und wie damals, so sind auch
wir heute berufen zu handeln, nicht als solche, die ihr Auge auf die Hoffnungslosigkeit der Dinge um sie her richten, sondern als solche, die immer noch wissen, „dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist". Alle moralische Schönheit des Herrn wird zu einem Vorbilde für uns.
Indes sehen wir Jesum auch als Gott dem Bösen gegenüberstehen; das ist eine Stellung, die wir selbstverständlich nie einnehmen können. Er rührte den Aussätzigen an und auch die
Tragbahre, und dennoch blieb Er rein. Er stand als Gott der Sünde gegenüber. Er kannte das Gute und das Böse; aber Er stand in göttlicher Unumschränktheit über dem einen wie
über dem anderen, indem Er beides kannte, so wie Gott es kennt. Wäre Jesus nicht gewesen, wie Er war, so würde es Ihn verunreinigt haben, den Aussätzigen und die Tragbahre anzurühren. Er hätte in diesem Fall außerhalb des Lagers gebracht werden und Sich der Reinigung unterziehen müssen, die durch das Gesetz vorgeschrieben war. Aber wir entdecken
nichts derartiges in Ihm. Er war nicht ein unreiner Jude. Nicht nur wurde Er nicht befleckt, sondern Er war auch unbeflecklich. Und dennoch war, so groß ist das Geheimnis Seiner Person
und die Vollkommenheit der mit der Gottheit in Ihm vereinigten Menschheit, die Versuchung für Ihn ebenso wirklich, wie die Verunreinigung unmöglich.
Verweilen wir hier einen Augenblick. Unser Platz gegenüber einem großen Teil dieser so notwendigen, obgleich geheimnisvollen und unendlich kostbaren Wahrheit ist es viel mehr,
sie anzunehmen und anzubeten, als darüber zu disputieren und sie zergliedern zu wollen. Indes ist es wohltuend für unser Herz, wenn wir es dem sehnlichen Verlangen etlicher einfältiger Seelen abfühlen, daß es ihnen um Christum Selbst zu tun ist. Oft gehen wir mit Wahrheiten in einer Weise um, daß uns schließlich nichts als die beschämende Überzeugung übrigbleibt, daß, wie sehr wir auch beschäftigt waren, wir dennoch Christum Selbst nicht erreicht haben. Wir entdecken dann, daß wir auf der Straße die Zeit unnütz vertändelt haben.
Der Herr war „arm, aber viele reich machend" — „nichts habend, und alles besitzend". Diese erhabenen und wunderbaren Zustände wurden in Ihm, und zwar in einer Ihm durchaus eigentümlichen Weise, geoffenbart.
Er nahm die Beisteuer einiger frommer Weiber an, die Ihn mit ihrer Habe unterstützten, und dennoch verfügte Er über die ganze Erde und ihre Fülle, um die Bedürfnisse derer zu stillen, die um Ihn waren. Er vermochte Tausende in öden Gegenden zu speisen, während Er Selbst Hunger litt, harrend auf die Rückkehr Seiner Jünger, die ausgegangen waren, um Speise zu kaufen. Das
hieß wahrlich: „nichts haben und alles besitzen". Aber obwohl der Herr arm und bedürftig war, mancherlei Gefahren ausgesetzt, so findet man doch nicht das mindeste in Ihm, was einer unedlen Gesinnung ähnlich wäre. Nie bat Er um eine Gabe, wiewohl Er keinen Pfennig besaß; denn wenn Er (jedoch nicht zu Seinem eigenen Gebrauch) einen Denar brauchte (Lk 20, 20—26), so war Er genötigt, Sich einen zeigen zu lassen. Nie floh Er, wenn Er auch in augenscheinlicher Lebensgefahr war; Er zog Sich zurück oder ging, gleichsam vor den Augen Seiner Feinde verborgen, vorüber. Ich wiederhole daher, obgleich Armut und Gefahren Sein tägliches
Los waren, so haftete Ihm doch nichts an, was unedel gewesen wäre oder mit der vollkommenen Würde Seiner Person im Widerspruch gestanden hätte.
Welch eine bewunderungswürdige Vollkommenheit! Wer könnte je eine Person vor unsere Augen stellen, die so vollkommen, so untadelig und von solch ausnehmender, zarter Reinheit in den gewöhnlichsten und geringfügigsten Einzelheiten des menschlichen Lebens wäre! Paulus konnte es nicht; Jesus allein, der Mensch Gottes, vermochte es. Daß Seine außergewöhnlichen Tugenden inmitten der gewöhnlichen Umstände Seines Lebens so hervorstrahlten, redet laut zu uns von Seiner Person. Es muß eine besondere Person, ein göttlicher Mensch sein, wenn ich so reden darf, der uns solche außergewöhnlichen Erscheinungen in so gewöhnlichen Umständen
darstellen kann. Wir finden, ich wiederhole es, dergleichen nicht bei Paulus. Er besaß ohne Zweifel viel Würde und sittliche Größe, und wir müssen bekennen, daß, wenn es je einen
Menschen gab, in dem jene Dinge sich vorfanden, Paulus dieser Mensch war. Aber Sein Verhalten war nicht das Verhalten Jesu.
Er befindet sich in Lebensgefahr, und er bedient sich der Beschirmung durch seinen Neffen. Zu einer anderen Zeit lassen ihn seine Freunde an der Stadtmauer herab. Ich sage nicht, daß er jemanden um Geld ansprach; aber er bekennt, Geld empfangen zu haben. Ich verweile nicht dabei, wie er vor einer aus Pharisäern und Sadducäern zusammengesetzten Versammlung sich als einen Pharisäer ausgab, um sich so zu schützen; noch dabei, wie er übel von dem Hohenpriester redete, der über ihn zu Gericht saß. In diesen beiden Fällen war sein
Betragen verwerflich. Ich rede nur von Fällen, die, ohne gerade moralisch verkehrt zu sein, dennoch unter der vollkommenen persönlichen Würde stehen, die den Pfad Christi kennzeichnete. Die sogenannte Flucht nach Ägypten macht keine Ausnahme bezüglich des Charakters des Herrn; denn diese Reise wurde zur Erfüllung der Prophezeiung und auf die Autorität eines göttlichen Ausspruchs hin unternommen. Dies alles ist in der Tat nicht nur moralische Herrlichkeit, nein, es ist ein moralisches Wunder; und es ist erstaunlich, wie eine
von Menschenhand geführte Feder solche Schönheiten aufzuzeichnen vermocht hat. Wir können dieses Wunder nur durch die Tatsache erklären, daß es eine Wahrheit, eine lebendige Wirklichkeit ist. Zu diesem gesegneten Schluß sind wir gezwungen. Es gibt keine andere Erklärung.
In der Behandlung dieses herrlichen Gegenstandes fortschreitend, erinnern wir uns der Schriftworte: „Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem
einzelnen antworten sollt" (Kol 4, 6). Unsere Worte sollten in der Tat „allezeit in Gnade" sein, so daß sie anderen zum Nutzen sind und „den Hörenden Gnade darreichen" (Eph 4,
29). Oft werden indes unsere Worte den Charakter der Ermahnung oder der Zurechtweisung annehmen, zuweilen auch in entschiedenem und strengem Ton, oder gar in Eifer und heiligem Zorn gesprochen werden; und so werden sie, wie die Schrift sagt, mit „Salz gewürzt" sein. Und wenn sie diese schönen Eigenschaften besitzen, d. h. „in Gnade" und doch „mit Salz gewürzt" sind, so werden sie davon zeugen, daß wir wissen, wie wir jedem einzelnen antworten sollen.
Unter allen Zügen der moralischen Vollkommenheit des Herrn Jesu tritt besonders dieser scharf hervor, daß Er einem jeden durch Worte zu begegnen wußte, die stets, mochte der Mensch
sie nun hören oder das Ohr vor ihnen verschließen, nutzbringend für die Seele waren; durch Worte allerdings, die zu Zeiten mit Salz, ja, bisweilen sogar stark mit Salz gewürzt waren. So war es z. B., wenn Er an Ihn gerichtete Fragen beantwortete, weniger Sein Zweck, eine genügende Erwiderung zu geben, als vielmehr das Gewissen des Fragenden zu erreichen und auf seinen Zustand einzuwirken.
In Seinem Schweigen und in Seiner Weigerung, irgendeine Antwort zu geben, als Er am Ende Seiner Laufbahn vor den Juden oder Heiden, vor den Hohenpriestern oder vor Herodes
und Pilatus stand, zeigt sich Sein Verhalten ebenso geziemend, als wenn Er redete oder die an Ihn gerichteten Fragen beantwortete. Er legte in dieser Weise vor Gott Zeugnis ab, daß
unter den Menschensöhnen wenigstens einer war, der verstand, daß es eine Zeit gibt zu schweigen, und eine Zeit zu reden.
Auch bemerkt man eine große Verschiedenheit des Tones und der Redeweise bei dem Herrn in den mannigfaltigen Umständen Seines Lebens; und diese Verschiedenheit, ob sie unscheinbar oder hervorragend war, bildet einen Teil des duftenden Wohlgeruchs, der allezeit zu Gott emporstieg. Oft war das Wort Jesu sanft und lieblich, oft bestimmt und streng; bisweilen redete Er in belehrender Weise, manchmal tadelte Er mit aller Schärfe; und hie und da machte die ruhige Belehrung plötzlich dem niederschmetternden Ton der Verurteilung Platz.
Denn Er betrachtete und wog alle Dinge stets ab nach ihrer moralischen Bedeutung.
Das 15. Kapitel des Evangeliums Matthäus hat mich in ganz besonderer Weise getroffen, indem es diese Vollkommenheit unter verschiedenen schönen und vortrefflichen Formen hervortreten läßt. Der Herr sieht Sich dort veranlaßt, der Reihe nach den Pharisäern, der Volksmenge, dem armen, betrübten kananäischen Weibe und Seinen eigenen Jüngern, sei es nach ihrer Unwissenheit oder ihrer Selbstsucht, zu antworten; und wir können bei dieser Gelegenheit die verschiedenen Weisen sehen, in welchen Er tadelt oder überführt, ruhig und geduldig lehrt oder eine schwache Seele mit Weisheit und Gnade zu erziehen trachtet. Und diese Verschiedenheit ist stets passend für den Ort und für die Gelegenheit, die Ihn zur Tätigkeit beruft.
Die gleiche Schönheit und das gleiche geziemende Verhalten finden wir in Lk 2, wo Er weder unterweist noch unterwiesen wird, sondern wo Er nur zuhört und fragt. Es wäre für Ihn
nicht passend gewesen zu unterweisen; denn Er war ein Kind inmitten älterer Leute. Sich unterweisen zu lassen, hätte nicht in völliger Übereinstimmung gestanden mit dem reinen und
herrlichen Licht, das Er, wie Er wußte, in Sich trug; denn man kann von Ihm in Wahrheit sagen, daß „Er verständiger war als alle Seine Lehrer, und daß Er mehr Einsicht hatte als die
Alten" (Ps 119, gg. 100). Ich rede hier nicht von dem, was Er als Gott, sondern was Er als Mensch war, „erfüllt mit Weisheit", wie es in jenem Kapitel von Ihm heißt. Er wußte von dieser Fülle der Weisheit nach der Vollkommenheit der Gnade Gebrauch zu machen; darum stellt der Evangelist Ihn inmitten der Lehrer im Tempel weder lehrend noch lernend vor unsere Augen, sondern sagt einfach, daß Er ihnen zuhörte und sie fragte.
„Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf Ihm". So redet die Schrift von Seiner Jugend; und wenn Er als Mann mit den Menschen in der Welt verkehrt, so ist Sein Wort „allezeit in Gnade, mit
Salz gewürzt", wie das Wort eines Mannes, der weiß, wie er einem jeden zu antworten hat. Welch eine Herrlichkeit und Vollkommenheit, und zwar in völliger Übereinstimmung mit
den verschiedenen Zeitabschnitten der Jugend und des Mannesalters !
Jedoch wird uns Jesus noch unter verschiedenen anderen Gesichtspunkten vor Augen gestellt. Zuweilen steht Er vor uns als der Verachtete und Geschmähte, belauert und gehaßt von
Seinen Feinden; wir sehen Ihn Sich zurückziehen, um gleichsam Sein Leben vor ihren Anfällen und Verfolgungen in Sicherheit zu bringen. In anderen Fällen erblicken wir Ihn in Schwachheit, nur gefolgt von den Ärmsten des Volkes; auch ist Er ermüdet,
hungrig und durstig, sowie abhängig von der Bedienung einiger frommer Weiber, die fühlen, daß sie Ihm alles verdanken.
Ein anderes Mal begegnen wir Seiner zärtlichen Güte, Seinem Wohlwollen und Mitgefühl gegenüber der Volksmenge; oder Er vereinigt Sich mit Seinen Jüngern bei ihren Mahlzeiten oder auf ihren Reisen, indem Er Sich mit ihnen unterhält, wie es ein Mensch mit seinen Freunden tun würde. Wieder ein anderes Mal zeigt Er sich uns in Macht und Ehre, verrichtet Wunder und läßt einige Strahlen der Herrlichkeit hervorleuchten. Obwohl Er in Seiner Person und in Seiner Stellung nichts in der Welt war als der ungelehrte und unbedeutende Sohn eines
Zimmermannes, so rief Er dennoch unter den Menschen und zu Zeiten selbst in den Gedanken der Regenten dieser Erde eine größere Bewegung hervor, als je ein Mensch dies zu tun
vermocht hatte.
So stellt uns Kindheit wie Mannesalter, mit einem Wort das ganze menschliche Leben in all seiner Mannigfaltigkeit Christum vor Augen: O wenn unser Herz Ihn nur festzuhalten
vermöchte! In manchen der unscheinbarsten Einzelheiten zeigt sich eine Vollkommenheit, die es laut bezeugt, daß eine göttliche Hand sie ausgezeichnet hat. Welcher Schreiber, wenn er
nicht durch den Heiligen Geist geleitet und überwacht wäre, hätte dieses vollkommene Gemälde entwerfen und seine feinen, zarten Züge wiedergeben können! Im Garten Gethsemane bat Er die Jünger, mit Ihm zu wachen; aber Er forderte sie nicht auf, für Ihn zu beten. Er verlangte
nach ihrem Mitgefühl; Er schätzte es hoch in der Stunde der Schwachheit und der Angst und wünschte, daß die Herzen Seiner Genossen in jenem Augenblick mit Ihm verbunden sein
möchten. Ein solcher Wunsch bildete einen Teil der moralischen Herrlichkeit, die Seine Vollkommenheit als Mensch ausmachte; aber obwohl Er diesen Wunsch fühlte und ihn den Jüngern zu erkennen gab, konnte Er sie dennoch nicht auffordern, zu Seinen Gunsten vor Gott hinzutreten.
Er wollte, daß sie sich Ihm geben möchten; aber Er konnte unmöglich von ihnen fordern, sich Gott zu geben für Ihn. Darum, wie gesagt, bittet Er sie, mit Ihm zu wachen, aber Er bittet sie nicht, für Ihn zu beten. Wenn Er kurz nachher das Wachen und das Beten vereinigt, so spricht Er von ihnen und zu ihrem Wohl, es handelt sich durchaus nicht mehr um Ihn. Er sagt: „Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung kommet". — Paulus konnte an seine Mitgläubigen schreiben: „Indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirket" (2. Kor 1, 11); oder: „Betet für uns; denn wir halten dafür, daß wir ein gutes Gewissen haben"
(Hebr 13, 18). Aber das war nicht die Sprache Jesu, und ich brauche wohl nicht zu sagen, daß sie es auch nicht sein konnte. Aber ich wiederhole: die Feder, die ein solches Leben für uns
aufzeichnen und uns einen solchen Charakter vor Augen malen
konnte, war geführt von dem Geiste Gottes Selbst. Er allein
konnte so schreiben.
Jesus tat Gutes und lieh aus, ohne etwas zurückzuerwarten. Er gab, und Seine linke Hand wußte nicht, was die Rechte tat. Niemals, bei keiner Gelegenheit, so viel ich weiß, machte Er
Anspruch auf die Person oder den Dienst derer, die Er befreit oder geheilt hatte. Niemals leitete Er aus der durch Ihn bewirkten Befreiung von irgendeinem Übel die Verpflichtung her, Ihm zu dienen. Er liebte und heilte und rettete, ohne jemals eine Vergeltung zu erwarten. Er wollte nicht, daß der Gadarener, der sich „Legion" nannte, Ihm folgte. Das Kind, das er am Fuße des Berges heilte, gab Er Seinem Vater zurück. Die Tochter des Jairus ließ Er im Kreise ihrer Familie. Den Sohn der Witwe zu Nain gab Er der weinenden Mutter wieder.
Nicht einen von diesen allen forderte Er für Sich. Und sollte Christus wohl etwas geben, um es wieder zurückzuerlangen?
Ist Er, der vollkommene Meister, nicht der beste Vollstrecker Seiner Worte: „Tut Gutes und leihet, ohne etwas wieder zu hoffen"(Lk 6, 35)? Die Natur der Gnade ist, anderen darzureichen, nicht aber sich selbst zu bereichern; und Jesus kam, damit in Ihm und in allen Seinen Wegen die Gnade in ihrem unausforschlichen Reichtum und in der ihr eigentümlichen
Herrlichkeit hervorstrahlte. Er fand Knechte in dieser Welt; aber Er begann nicht damit, sie zu heilen, um dann Seine Ansprüche an sie geltend zu machen. Er berief sie und teilte ihnen Gaben mit. Sie waren die Frucht der Energie Seines Geistes und von Neigungen, die in ihren durch Seine Liebe ergriffenen Herzen geweckt worden waren. Und als Er sie aussandte, rief Er ihnen zu: „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet" (Mt 10, 8).
Sicher, es gibt in den Zügen eines solchen Charakters etwas, das außer dem Bereiche menschlicher Begriffe liegt. Dieser Gedanke drängt sich uns immer wieder von selbst auf; und
es ist lieblich, hinzufügen zu können, daß die moralische Herrlichkeit des Herrn oft in den einfachsten Formen ans Licht tritt, in Formen, die für die Begriffe und Sympathien des Herzens sofort verständlich sind.
So wies Jesus niemals den schwächsten Glauben von sich ab, wiewohl Er andererseits mit Freuden dem kühnsten Glauben entgegenkam und Seine Forderungen beantwortete. Der starke
Glaube, der ohne Umschweife und ohne sich zu entschuldigen in voller Zuversicht Ihm nahte, fand stets eine willkommene Aufnahme bei Ihm, während die schüchterne Seele, die Ihm
nur ängstlich und verschämt zu nahen wagte, ermuntert und gesegnet wurde. Das Wort, das von den Lippen des Herrn floß, befreite den armen Aussätzigen augenblicklich von der einzigen Sache, die wie eine dunkle Wolke über seinem Herzen hing. „Herr"! sagt er, „wenn du willst, kannst du mich reinigen". „Ich will, sei gereinigt"! antwortet Jesus. Doch kurz nachher drücken dieselben Lippen das aus, wovon das Herz Jesu gegenüber dem zuversichtlichen, nicht zweifelnden Glauben des heidnischen Hauptmanns erfüllt war. Ähnliches finden wir, wenn der kühne, ernste Glaube einer Familie in Israel das Dach des Hauses abdeckt, in dem der Herr Sich befindet, um ihren Kranken vor Seine Füße herabzulassen.
Wenn ein schwacher Glaube sich an den Herrn wandte, so gewährte Er die Segnung, die der schwache Glaube suchte; aber Er tadelte den Menschen, der in dieser Weise zu Ihm kam. Indes ist selbst ein solcher Verweis stets voll von Ermutigung für uns; denn er scheint uns zu fragen: „Warum machst du keinen ausgedehnteren, freieren und glücklicheren Gebrauch von mir"? Schätzten wir nur den Geber so hoch wie die Gabe, das Herz Christi so hoch wie Seine Hand, so würde uns die Bestrafung des schwachen Glaubens ebenso köstlich sein, wie die Antwort, die er hervorlockt. Und wenn der schwache Glaube in dieser Weise durah Ihn getadelt wird, wie willkommen muß dem Herrn dann ein starker Glaube sein! Wir können daher einigermaßen begreifen, welch ein lieblicher Anblick es für das Auge des Herrn sein mußte, als in dem oben
erwähnten Fall die vier Träger des Gichtbrüchigen das Dach abdeckten, um in Seine Nähe zu kommen. Ja, es muß ein herrliches Schauspiel für unseren hochgelobten und göttlichen Heiland gewesen sein. Diese Handlung erzwang sich den Eingang in Sein Herz ebenso sicher wie in das Haus zu Kapernaum.
Wahrlich, wir erblicken in der Person unseres Herrn Höhen der Herrlichkeit und Tiefen der Erniedrigung; und wir haben beides nötig. Der, Welcher einst am Brunnen zu Sichar saß, ist
Derselbe, Der jetzt in den höchsten Himmeln Platz genommen hat. „Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel". Hoheit und Niedrigkeit sind
Sein. Er hat einen Platz zur Rechten Gottes, und dennoch läßt Er Sich herab, die Füße Seiner Heiligen auf Erden zu waschen. Welch eine Verbindung! Er büßt nichts von Seiner Würde und
Größe ein, wenn Er Sich auch in Seiner unendlichen Gnade unserer Armut anpaßt; nichts mangelt Ihm, was uns dienlich sein könnte, und doch ist Er herrlich, fleckenlos und vollkommen Sich Selbst. Die Selbstsucht wird durch fortgesetztes, unverschämtes Drängen müde gemacht; wie wir lesen: „Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf" (Lk 11, 8). Also steht es mit dem Menschen, oder mit der Selbstsucht; aber
anders steht es mit Gott, oder mit der Liebe; denn der Gott in Jes 7, 10—16 bildet das Gegenteil von dem Menschen in Lk 11 , 5—13.
Der Unglaube, der sich nicht an Gott wenden will und sich weigert, eine Segnung von Ihm zu erbitten, ist es, der Gott ermüdet; nicht aber unverschämtes Anhalten und Drängen,
sondern, wenn ich so sagen darf, gerade wenn es daran fehlt.
Und diese göttliche Herrlichkeit und Vortrefflichkeit, die wir in Jes 7 bei dem Jehova des Hauses David finden, strahlt bei dem Herrn Jesu von neuem hervor, und das in den verschiedenen Weisen, wie Er den schwachen und den starken Glauben behandelt. Alles zeugt von Seiner Vollkommenheit. Aber welch einen kleinen Teil dieser ganzen Herrlichkeit vermögen
wir zu ergründen!
Wir wissen, in wie mannigfaltiger Weise unsere Mitpilger uns auf die Probe stellen und in Versuchung bringen, und ohne Zweifel tun wir ihnen gegenüber das auch. Wir sehen, oder wir glauben an ihnen irgendeine Verkehrtheit zu sehen, und es erscheint uns schwer, noch länger den Verkehr mit ihnen zu unterhalten. Und doch kann in allem oft die Schuld allein auf unserer Seite liegen, indem wir das, was nicht mit unserem Geschmack und unserem Urteil in Obereinstimmung ist, als etwas Tadelnswertes an ihnen betrachten.
Aber der Herr konnte Sich nie so täuschen; und doch ließ Er Sich nie „durch das Böse überwinden", sondern „überwand das Böse mit dem Guten", d. h. das Böse in dem Menschen
mit dem Guten, das in Ihm war. Eitelkeit, böse Laune, Gleichgültigkeit gegen andere, Eigenliebe, Unwissenheit trotz aller Mühe, die Er Sich gab, um sie zu belehren, — das alles hatte
Jesus beständig von Seiten Seiner Umgebung zu erdulden. Sein Leben war in einem gewissen Sinn ein Tag der „Erbitterung", wie es die vierzig Jahre in der Wüste gewesen waren. Israel
versuchte sozusagen von neuem den Herrn und erfuhr von neuem, wer Er war. Es ist in der Tat ein lieblicher Gedanke: sie reizten den Herrn, aber sie stellten dadurch nur ans Licht,
wer Er war. Er litt, aber Er ertrug es mit Geduld, und nie gab Er sie auf. Er warnte und belehrte, Er tadelte und verurteilte sie, aber nie wandte Er Sich von ihnen ab. Im Gegenteil, am
Ende ihrer gemeinschaftlichen Wanderung ist Er ihnen näher als je.
Wie vollkommen und trefflich ist das alles, und wie ermunternd für uns! Die Bemühungen des Herrn, unser Gewissen zu erreichen, lassen nie Sein Herz erkalten. Wir büßen nichts
ein, wenn Er uns tadelt. Und Er, der Sein Herz nicht von uns abwendet, wenn Er Sich mit unserem Gewissen beschäftigt, ist bereit, unsere Seelen wiederherzustellen, damit das Gewissen, wenn ich mich so ausdrücken darf, bald imstande sei, Seine Schule zu verlassen und das Herz die glückselige Freiheit in Seiner Gegenwart wiederfinde.
Weiter möchte ich bemerken, daß wir in den Charakteren, die der Herr, wenn auch nur gelegentlich und vorübergehend, während Seines Dienstes berufen war zu offenbaren, stets
dieselbe Vollkommenheit und dieselbe moralische Herrlichkeit erblicken, wie auf dem Pfade, den Er täglich ging; so z. B. wenn Er in Mt 23 als Richter, oder in Mt 22 als Sachwalter
erscheint. Doch ich darf diesen reichhaltigen Gegenstand nur
andeuten. In jedem Schritt Jesu, in jedem Wort, in jeder Handlung zeigte sich ein Strahl Seiner Herrlichkeit; und das Auge Gottes fand in dem Leben Jesu eine größere Befriedigung, als
es in einer Ewigkeit von adamitischer Unschuld hätte finden können. Jesus wandelte inmitten des sittlichen Verfalls der Menschheit; und aus diesem Bereich des Elendes ließ Er zum
Throne Gottes ein reicheres Opfer duftenden Wohlgeruchs emporsteigen, als jemals Eden und der Adam Edens, auch wenn sie rein geblieben wären, darzubringen vermocht hätten.
Die Zeit brachte keinen Wechsel in dem Herrn hervor. Dieselben Offenbarungen Seiner Gnade und Seines Charakters vor und nach Seiner Auferstehung bestätigen diese für uns
so wichtige Wahrheit. Das, was Er einst war, sagt uns, was Er in diesem Augenblick ist und was Er ewig sein wird, sowohl in Seinem Charakter als auch in Seiner Natur, sowohl im Blick auf uns als auch im Blick auf Ihn Selbst. „Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit" (Hebr 13, 8). Die bloße Erwähnung dieser Wahrheit ist schon köstlich für uns.
Bisweilen können Veränderungen uns betrüben; zu anderen Zeiten wünschen wir sie herbei. Auf verschiedenen Wegen lernen wir alle die unbeständige, unsichere Natur dessen erkennen, was das menschliche Leben ausmacht. Nicht nur die Umstände, sondern auch die gesellschaftlichen Beziehungen und Verbindungen, die Freundschaften, die Zuneigungen und Charaktere sind beständigen Veränderungen unterworfen, die uns überraschen oder betrüben. Wir eilen von einer Station des Lebens zur anderen; aber nie erkaltete Zuneigungen und makellose Grundsätze begleiten uns selten auf dem Wege, mag es sich nun um uns oder um unsere Reisegefährten handeln. Unser Herr und Heiland aber war nach Seiner Auferstehung derselbe, der Er vorher war, obwohl die dazwischenliegenden Ereignisse eine weitere Entfernung zwischen Ihm und Seinen Jüngern hervorgerufen hatten, als dies unter „Reisegefährten" je der Fall sein kann. Die Jünger hatten ihre untreuen Herzen verraten, indem sie ihren Herrn verließen und in der Stunde Seiner Schwachheit und Angst die Flucht ergriffen; Er aber war für sie durch den Tod gegangen, und zwar durch einen Tod, dem sich kein anderes Geschöpf hätte
unterwerfen können, ohne vernichtet zu werden. Sie waren immer noch nichts anderes als arme, schwache Galiläer; Er aber war verherrlicht und mit der ganzen Macht im Himmel und
auf Erden bekleidet.
Dennoch führte alles das keinen Wechsel in dem Herrn herbei. „Weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf", um mit dem Apostel zu reden, konnte Ihn verändern. Die
Liebe widerstand allem, und der Herr kehrt zu den Seinigen als Derselbe Jesus zurück, Den sie von jeher gekannt hatten. Er nimmt teil an ihrer Arbeit nach Seiner Auferstehung, ja,
selbst nach Seiner Himmelfahrt, wie Er es während der Tage Seines Dienstes und Seines Pilgerns mit ihnen getan hatte. Wir sehen dies aus dem letzten Vers des Evangeliums Markus. In der Zeit von Mt 14 glaubten die Jünger auf dem See ein Gespenst zu sehen und schrien vor Furcht; aber der Herr ließ sie erkennen, daß Er Selbst es war, gegenwärtig in Gnade, und doch zugleich in Macht und Oberhoheit über die Natur. Ebenso nimmt Er in Lk 24, nach Seiner Auferstehung, ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe und ißt vor ihren Augen, damit sie mit derselben Gewißheit und Herzensruhe wie früher erkennen möchten, daß Er es war. Auch fordert Er sie auf, Ihn zu betasten und anzusehen, indem Er ihnen sagt, daß ein Geist nicht Fleisch und Bein habe, wie dies, wovon sie sich überzeugen konnten, bei Ihm der Fall war.
In Joh 3 führt Er einen „von Herzen trägen" Rabbi ins Licht und auf den Weg der Wahrheit, indem Er ihn erträgt mit der ganzen Geduld der Gnade. In gleicher Weise handelt Er nach
Seiner Auferstehung mit den beiden „unverständigen und von Herzen trägen" Jüngern auf dem Wege nach Emmaus (Lk 24). In Mk 4 bringt Er die Furcht der Seinigen zum Schweigen, ehe
Er sie wegen ihres Unglaubens tadelt; Er bedroht den Wind und spricht zu dem See: „Schweig, verstumme"! bevor Er zu den Jüngern sagt: „Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr
keinen Glauben"? Gerade so macht Er es in Joh 21 nach Seiner Auferstehung; Er setzt Sich mit Petrus, als sei nichts vorgefallen, in voller, ungehinderter Gemeinschaft zum Mahle nieder, und dann erst zieht Er den Jünger zur Rechenschaft und wirkt auf sein Gewissen ein durch die Worte: „Simon, Sohn Jonas', hast du mich lieb"?
Bei der Begegnung des auferstandenen Jesus mit Maria Magdalena trägt der Evangelist Sorge, uns mitzuteilen, daß Er Derselbe Jesus war, der sieben Teufel von ihr ausgetrieben hatte;
und Maria erkennt die Stimme Dessen, Der sie bei ihrem Namen rief, als eine seit langem ihrem Ohr bekannte Stimme. Welch eine Ähnlichkeit zwischen dem Christus in Niedrigkeit
und dem Christus in Herrlichkeit, zwischen dem Heiland der Sünder und dem Herrn der zukünftigen Welt! Wie laut verkündet uns dies alles, daß Er, Der einst herniederstieg, sowohl
hinsichtlich des Charakters als auch der persönlichen, göttlichen Herrlichkeit „derselbe ist, der auch hinaufgestiegen ist". Auch wird Johannes, nachdem sein Herr auferstanden ist, uns als
der Jünger vorgestellt, der während des Abendmahls an der Brust seines Meisters gelegen hatte. „Ich bin Jesus"! lautete ferner die Antwort des Herrn von dem erhabensen Platz des
Himmels, von der Rechten des Thrones der Majestät her, als Saulus von Tarsus die Frage erhob: „Wer bist du, Herr" (Apg 9)?
Alles das findet auf uns persönlich seine Anwendung; wir sind unmittelbar dabei interessiert. Petrus erkannte, daß sein Meister vor und nach Seiner Auferstehung für ihn derselbe war.
In Mt 16 tadelt ihn der Herr; aber wenige Tage nachher führt Er ihn, und zwar in völliger Freiheit des Herzens, als ob nichts vorgefallen wäre, mit Sich auf den heiligen Berg. In Joh 21
wird Petrus von neuem getadelt. Nach seiner Gewohnheit hatte er sich mit Dingen eingelassen, die seine Begriffe überstiegen und, auf Johannes zeigend, die Frage erhoben: „Herr, was soll
dieser"? Und sein Meister war gezwungen, ihn mit den Worten: „Was geht es dich an"? in seine Schranken zurückzuweisen. Und dennoch, gleichsam angesichts dieser scharfen
Zurechtweisung, läßt der Herr ihn mit Johannes Sich nachfolgen, hat ihn in Seiner Gemeinschaft auf Seinem Wege zum Himmel. Ein bestrafter Petrus war einst mit dem Herrn auf den heiligen Berg gestiegen; und derselbe bestrafte Petrus begleitet jetzt den zum Himmel auffahrenden Herrn, indem er auf diese Weise gleichsam zum zweiten Mal den Berg der Herrlichkeit, den Berg der Verklärung, besteigt.
Welch ein mächtiger Trost liegt in diesem allen für uns! So ist Jesu, unser Herr, „derselbe gestern und heute und in Ewigkeit", Derselbe während der Tage Seines Dienstes auf Erden und nach Seiner Auferstehung, Derselbe jetzt im Himmel, in den Er hinaufgestiegen ist, und Derselbe in alle Ewigkeit. Und so wie Er nach wie vor Seiner Auferstehung stets denselben Charakter zeigte und Sich in derselben Gnade offenbarte, so erfüllt Er auch alle Verheißungen, die Er Seinen Jüngern hinterlassen hat.
„Fürchtet euch nicht"! Dieses Trostwort, ob von den Lippen Jesu Selbst oder von den Lippen Seiner Engel ausgesprochen, gilt jetzt wie damals, sowohl seitdem Er auferstanden ist, als
auch bevor Er litt (siehe Mt 14, 27; Mk 5, 36; Lk 5, 10 ff.). Vor Seinem Tode hatte Er Seinen Jüngern gesagt, daß Er ihnen Seinen Frieden geben wolle, und nach Seinem Tode sehen wir
in der Tat, daß Er ihnen Seinen Frieden in der feierlichsten Weise gibt. Er ruft ihnen zu: „Friede euch" (Joh 20, 20—26)! und mit diesen Worten zeigt Er ihnen Seine Hände und Seine
Seite, wo sie in symbolischen Zügen lesen konnten, welches ihre Rechte auf einen Frieden waren, den Er durch Sich Selbst für sie erfüllt und erworben hatte. Zu einer anderen Zeit hatte der Herr zu ihnen gesagt: „Weil
ich lebe, werdet auch ihr leben" (Joh 14, 19); und jetzt, in den Tagen Seiner Auferstehung, im Besitz eines siegreichen Lebens, teilt Er ihnen dieses Leben in vollkommener Weise mit, indem
Er sie anhaucht und die Worte sagt: „Empfanget den Heiligen Geist" (Joh 20, 22). Die Welt sollte Ihn nicht mehr sehen, wie Er zu Seinen Jüngern gesagt hatte. Doch sie sollten Ihn sehen;
und dies geschah denn auch. Er wurde vierzig Tage hindurch von ihnen gesehen, und Er redete mit ihnen „über die Dinge, welche das Reich Gottes betreffen" (Apg 1). Aber alles das
geschah im Geheimen. Die Welt hat Ihn seit der Stunde von Golgatha nicht mehr gesehen, und wird Ihn auch nicht sehen, bis Er zu ihrem Gericht erscheint.
Als ein einfacheres und, wenn ich es so nennen darf, demütigeres Zeugnis von Seiner völligen Treue allen Seinen Verheißungen gegenüber begegnet der Herr den Seinigen in Galiläa,
wie Er es ihnen gesagt hatte. Als einen völligeren, weitergehenden Ausdruck derselben Sache führt Er die Jünger zu dem Vater im Himmel, indem Er ihnen die Botschaft sendet:
„Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott" (Joh 20, 17). Mochte Er ihnen daher in unserem Galiläa auf Erden oder in Seiner Wohnung im Himmel Seine Gegenwart verheißen haben, Er hat beide Verheißungen erfüllt; und es ist sicher zum Nutzen für unsere Herzen, wenn wir die Demut, die Treue, die Fülle, die Einfachheit, die Größe und die Erhabenheit alles dessen betrachten, was den Pfad des Herrn vor uns entfaltet und unterscheidet.
Der Herr hatte viele Mühe mit Petrus, mehr als mit den anderen Jüngern, so lange Er in ihrer Mitte umherwandelte; und so war es auch, nachdem Er aus den Toten auferstanden war. Petrus füllt sozusagen das ganze letzte Kapitel des Evangeliums Johannes aus. Der Herr setzt im Blick auf ihn das Werk der Gnade fort, das Er, bevor Er ihn verließ, begonnen hatte; und Er nimmt es genau an dem Punkt wieder auf, wo Er es aufgegeben hatte. Petrus hatte ein großes Selbstvertrauen verraten. „Wenn sich alle an dir ärgern werden", hatte er gesagt, „ich werde mich niemals an dir ärgern. . . . Selbst wenn ich mit dir sterben müßte, werde ich dich nicht verleugnen" (Mt 26, 33. 35). Doch der Herr hatte ihm die Eitelkeit jenes Rühmens unter die Augen gestellt, zugleich aber die Verheißung hinzugefügt, daß Er für ihn beten werde, damit sein Glaube nicht aufhöre. Und als später dieses Rühmen sich wirklich als eitel erwies und Petrus seinen Herrn tatsächlich, selbst mit einem Eide, verleugnete, da blickte der Herr ihn an; und dieser Blick trug seine gesegnete Frucht.
Das Gebet und der Blick übten eine vortreffliche Wirkung aus. Das Gebet erhielt den Glauben des Petrus aufrecht, und der Blick brach sein Herz. Petrus ging nicht weg, sondern er weinte, und er „weinte bitterlich" (Lk 22, 62).
Im Anfang von Joh 21 finden wir Petrus in dem Zustande wieder, in den das Gebet und der Blick Jesu ihn versetzt hatten. Daß sein Glaube nicht aufgehört hatte, wird dadurch in lieblicher Weise bezeugt, daß er, sobald er vernimmt, daß der am Ufer stehende Fremdling der Herr sei, sich ins Wasser stürzt, um Ihm entgegenzueilen; und er tut dies nicht als ein Büßender, nicht wie einer, der nicht bereits Tränen vergossen hat, sondern als einer, der vor Jesu erscheinen durfte in voller Zuversicht des Herzens. Und in diesem Charakter empfängt ihn sein wohlwollender Herr, und sie essen zusammen am Ufer des Sees. Das Gebet und der Blick hatten in dem Herzen des Jüngers bereits ihr Werk getan, und sie sollten sich nicht wiederholen. Der Herr setzt einfach das begonnene Werk fort, um es zur Vollendung zu führen; und somit folgt jetzt dem Gebet und dem Blick das Wort.
Der Überführung von der Sünde und den Tränen folgt die Wiederherstellung. Petrus wird in den Stand gesetzt, seine Brüder zu stärken, wie es sein Herr ihm einst angekündigt hatte, und er wird zugleich befähigt, Gott durch seinen Tod zu verherrlichen, ein Vorrecht, das er durch seinen Unglauben und durch seine Verleugnung verloren hatte. Das war das wiederherstellende Wort, welches dem Gebet folgte, das seinen Glauben aufrecht erhielt, und das dem Blick
folgte, der sein Herz brach. Wie wir in Joh 13 lesen, hatte der Herr Seinen vielgeliebten Jünger darüber belehrt, daß, wer einmal gebadet ist, ganz rein ist und nicht nötig hat, sich zu
waschen, ausgenommen die Füße. Und in dieser Weise handelt der Herr hier mit Petrus. Er läßt ihn nicht zum zweiten Male die Erfahrung von Lk 5 machen, wo der wunderbare Fischzug
ihn mit Erstaunen erfüllt und er sich als Sünder erkannt hatte; sondern der Herr wäscht die beschmutzten Füße des Petrus. Er stellt ihn wieder her und führt ihn auf den ihm gebührenden Platz zurück (siehe Joh 21, 15—17).
Welch ein vollkommener Lehrer und Herr ist unser Jesus! Und „Er ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit", Derselbe in Seiner gnadenreichen, überströmenden Liebe, die das begonnene Werk fortsetzt, indem Er als der auferstandene Herr den infolge der Trennung von Seinen Jüngern unvollendet gebliebenen Dienst genau wieder an dem Punkte aufnimmt,
wo Er ihn abgebrochen hat, und also in vollkommener Gnade und Weisheit den vergangenen Dienst mit dem gegenwärtigen verknüpft.
Ein wenig weiter noch sehen wir, wie der Herr Seine Verheißungen erfüllt. Ich denke an jene besondere, nach Seiner Auferstehung gegebene Verheißung, die Er „die Verheißung des Vaters" und „die Kraft aus der Höhe" nannte (Lk 24), und die erst, nachdem Er gen Himmel gefahren und dort verherrlicht war, ihre Erfüllung fand (Apg 2). Dies ist sicherlich nur die Fortsetzung der Geschichte und des Zeugnisses von der Treue Jesu. Sein Leben vor dem Kreuze, Seine Beziehungen zu Seinen Jüngern nach Seiner Auferstehung und jetzt dasjenige, was Er seit Seiner Himmelfahrt getan hat — alle diese Dinge sind deutliche Beweise von der Tatsache, daß es bei Ihm keine Veränderung noch einen Schatten von Wechsel gibt.
Ungern möchte ich einen anderen Beweis von dieser Tatsache, den wir in demselben Kapitel des Evangeliums des Lukas finden, mit Stillschweigen übergehen. Der auferstandene Herr führt dort Selbst Seine Jünger zu dem Punkt zurück, wo Er Seine letzten Unterweisungen abgebrochen hatte. „Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, daß alles erfüllt werden muß, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses' und den Propheten und Psalmen". Er erinnert sie so an das, was Er ihnen schon früher gesagt
hatte, daß nämlich die Schrift das große Zeugnis der Gedanken Gottes sei, und daß alles, was in ihr geschrieben stehe, erfüllt werden müsse. Und was tut der Herr dann? Er setzt in einfacher, natürlicher Weise die Belehrung fort, die Er vor Seinem Leiden begonnen hatte. „Dann öffnete Er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen". Seine Macht vereinigt sich
jetzt mit Seinen vorhergegangenen Belehrungen; und Er vollendet in den Seinigen das, was Er ihnen bereits mitgeteilt hatte.
In gewissem Sinne blieben selbst die Natur und der Geist des Verkehrs Jesu mit Seinen Jüngern während der vierzig Tage unverändert. Er kennt sie bei Namen wie früher; Er offenbart
Sich ihnen auf dieselbe Weise; nach wie vor Seiner Auferstehung nimmt Er bei Tisch, obwohl Er als Gast geladen ist, *) Zu unserem Trost möchte ich noch hinzufügen, daß der Herr Seine Jünger niemals daran erinnerte, daß sie alle Ihn in der Stunde der Versuchung verlassen hatten.
den Platz des Hausherrn ein (vgl. Joh 2; Lk 24); und durchdrungen von dem Gefühl der Bedeutung des Augenblicks, betrachten Seine jünger Seine Anwesenheit, wie sie es früher zu tun pflegten. Am Brunnen zu Sichar (Joh 4) fürchteten sie sich, Ihn zu stören, und stellten sich schweigend seitwärts. Ebenso verhalten sie sich, als sie nach dem Fischfang zu Ihm kommen (Joh 2x), wiederum schweigend, da sie nach dem Charakter des Augenblicks urteilen, daß, wie sehr auch ihre Herzen mit Bewunderung und Freude erfüllt sein mochten, es nicht an der Zeit war, viele Worte zu machen. Welch zarte und doch wie mächtige Bande bestehen daher
zwischen Ihm, den wir bereits in den gewöhnlichen Umständen des menschlichen Lebens kennen gelernt haben, und Ihm, den wir alle Ewigkeit hindurch erkennen sollen! Jesus stieg zuerst in unsere Umstände hinab, um uns dann in Seine Umstände einzuführen. Aber in unseren Umständen ist es, daß wir Ihn kennen gelernt, ja, für immer kennen gelernt haben. Dies ist eine Wahrheit, deren Kostbarkeit uns durch die Erfahrungen des Petrus bezeugt wird. Ich habe die betreffende Szene bereits unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, aber ich möchte
zum zweiten Mal einen Augenblick dabei verweilen.
Bei jenem wunderbaren Fischzug, der vor der Auferstehung stattfand (Lk 5), wurde Petrus von der Sünde überführt. Petrus, der Fischer, wurde in seinen eigenen Augen Petrus, der Sünder. „Gehe von mir hinaus", sagt er zum Herrn, „denn ich bin ein sündiger Mensch" (Lk 5, 8). Der außerordentliche Fang, welcher den Beweis lieferte, daß der in sein Schiff getretene Fremdling der Herr des Meeres und seiner Fülle war, führte den Jünger im Geist in die Gegenwart Gottes, und hier lernte er sich selbst kennen. Wir können in der Tat nur hier diese Lektion lernen. Aber der Herr rief ihm in jenem Augenblick, wie aus der Herrlichkeit her, das Trostwort zu: „Fürchte
dich nicht"! und — Petrus war zur Ruhe gebracht. Die Herrlichkeit oder die Gegenwart Gottes, die ihn von seiner Sündhaftigkeit überführt hatte, wurde jetzt ein Ruheplatz für ihn; und
Petrus wandelte in völliger Ruhe des Herzens vor dem Herrn.
Dementsprechend genießt er auch bei dem zweiten Fischzug (Joh 21), nach der Auferstehung des Herrn, die gleiche Zuversieht; er hat nur die früher empfangene Unterweisung praktisch auszuüben. Und dies tut er. Er macht die Erfahrung, daß die Gegenwart des Herrn der Herrlichkeit eine Ruhestätte für ihn ist. Er erfahrt und bezeugt es uns, daß er das, was er in
bezug auf Jesum gelernt hatte, für immer gelernt hatte. Er erkannte den am Ufer stehenden Fremdling zuerst nicht; sobald aber Johannes ihm sagte, daß es der Herr sei, da war
jener Fremdling kein Unbekannter mehr für Petrus; nein, er beeilte sich, so schnell und so nahe wie möglich zu Ihm zu kommen. Glückselig das Herz, das diese Dinge versteht! Wenn
es eine Freude ist, zu wissen, daß Jesus stets Derselbe ist, sowohl in unserer Welt, als auch in der Seinigen, sowohl inmitten der Umstände auf Erden, als auch in Seiner Herrlichkeit, welch
eine weitere Freude ist es dann, jemanden von uns, wie einst Petrus, in seiner Seele die Seligkeit genießen zu sehen, die aus einer solchen Tatsache hervorströmt!
Ja, Jesus ist tatsächlich immer Derselbe, Treu und Wahrhaftig! Alles, was Er Seinen Jüngern vor dem Kreuze verheißen hatte, hat Er nach Seiner Auferstehung erfüllt. Alles, was Er vorher
in ihrer Mitte war, das ist Er auch nachher geblieben.
Der Herr gab unaufhörlich, aber Er fand selten Beifall. Er teilte in Überfluß mit, aber Er fand nur wenig Gemeinschaft. Dies erhöht und verherrlicht nur Seine Güte. Es gab hier gleichsam
nichts, was Ihn hätte veranlassen können, Seine Güte zu zeigen; und dennoch teilte Er immer aus. Er war wie der Vater, der in den Himmeln ist, von Dem Er Selbst gesagt hatte:
„Er läßt Seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte" (Mt 5, 45). Dies sagt uns, zu Seinem Preise, was Er ist, und zu unserer Beschämung, was wir sind.
Jesus war indes nicht nur dem Vater in den Himmeln gleich, das Bild Gottes in dessen Handlungen, sondern Er war in dieser Welt zugleich wie der „unbekannte Gott", von Dem
Paulus redet (Apg 17, 23). Die Finsternis begriff Ihn nicht; die Welt erkannte Ihn weder durch ihre Religion noch durch ihre Weisheit. Die überschwenglichen Reichtümer Seiner Gnade, die Reinheit Seines Königreichs, das Fundament und die Rechte, auf die allein die Herrlichkeit, die Er in einer Welt wie diese suchte, gegründet werden konnte, alles das blieb den Menschenkindern ein unauflösliches Rätsel. Dies zeigen zur Genüge die groben Irrtümer und Fehler, in die sie unaufhörlich verfielen. Als z. B. die Menge mit Begeisterung Jesum als den König und in Seiner Person das Königreich begrüßte (Lk ig), sagten die Pharisäer: „Lehrer, verweise es deinen Jüngern"! Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, daß der Thron einem solchen Menschen, wie Er war, gehören sollte.
Es war nach ihrer Meinung eine Anmaßung von Ihm, dem Jesus von Nazareth, zu gestatten, daß königlicher Jubel Ihn umgebe. Sie erkannten nicht das Geheimnis wahrer Größe in dieser falschen, abgefallenen Welt; sie hatten das Geheimnis des „Wurzelsprosses aus dürrem Erdreich" nicht erfaßt, noch vermochte ihr Geist den „Arm des Herrn" zu unterscheiden (Jes 53). Nur da, wo der Geist des Herrn die Herzen leitet, werden Entdeckungen betreffs Jesu gemacht — Entdeckungen, die ebenso kostbar wie verschieden in ihrem Maße sind.
In Mk 1 wird von vielen Seiten auf den Dienst der Gnade und Macht des Herrn Anspruch gemacht. Kranke aller Art kommen zu Ihm. Die Menge hört Ihm zu und erkennt die Autorität an, mit der Er redet. Ein Aussätziger bringt seinen Aussatz vor Ihn und erkennt somit in Ihm den Gott Israels an. Es war in jenem Augenblick eine gewisse, verschieden große Erkenntnis von Jesu vorhanden, sei es bezüglich Dessen, was Er war, oder Dessen, was Er besaß. Aber im zweiten
Kapitel desselben Evangeliums begegnen wir einer Erkenntnis von Ihm, die sich in einer weit lebendigeren und vortrefflicheren Weise kundgab, sowie Beispielen eines Glaubens, der
Jesum verstand.
Die Männer von Kapernaum, die ihren gichtbrüchigen Freund zu Ihm bringen, verstehen den Herrn und bedienen sich Seiner. Sie verstehen, meine ich, was Er in Sich Selbst, in Seinem
Charakter, in Seinen Gewohnheiten und in den Gefühlen Seiner Seele ist. Schon die Art und Weise, wie sie sich Ihm zu nähern suchen, zeigt uns das. Sie kommen nicht zweifelnd
oder schüchtern und ängstlich, sie machen es vielmehr wie Jakob, als Er sagte: „Ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet" (1. Mo 32)! Ihm so zu nahen ist dem Herrn
angenehm und der Weise entsprechend, in der uns diese Liebe gern handeln sieht. Sie fragen nicht um Erlaubnis, sie machen keine Umstände, sondern decken ohne weiteres das Dach des
Hauses ab, um zu Ihm zu kommen. Alles das zeigt uns, daß sie den Herrn kannten und sich Seiner bedienten. Sie wußten, daß es Seine Freude war, wenn Notleidende Seiner Gnade vertrauten und sich ohne Rückhalt Seiner Macht bedienten. Levi handelt wenige Augenblicke später in gleicher Weise. Er richtet ein Gastmahl an und läßt Zöllner und Sünder in der Nähe
Jesu Platz nehmen. Auch hieraus geht hervor, daß Levi seinen Gast kannte. Er wußte, wen er geladen hatte, so wie Paulus wußte, an „wen er geglaubt hatte" (2. Tim 1, 12).
Diese Erkenntnis des Herrn ist wahrhaftig gesegnet; sie ist göttlich. Fleisch und Blut vermögen sie nicht zu geben. Die Brüder Jesu besaßen sie nicht; denn als der Herr Sich in Seinem
Dienste erschöpfte, sagten sie: „Er ist außer sich" (Mk 3, 21). Aber der Glaube macht im Blick auf Jesum große, köstliche Entdeckungen und handelt demgemäß. Es mag zuweilen scheinen, als ob er die richtigen Grenzen überschritte und uns über das geziemende Maß hinausführte; aber nach dem Urteil Gottes ist dies nie der Fall. Die Menge gebot dem blinden Bartimäus zu schweigen; aber er weigerte sich, weil er Jesum kannte, wie Levi ihn kannte (Mk 10).
Die Fülle von dem, was der Herr tut, übersteigt unsere Begriffe; und doch besteht gerade in dieser Fülle die Herrlichkeit Seines Tuns. Der Heiland kommt uns in jeder Not entgegen;
aber zu gleicher Zeit bringt Er Gott hinein. Jesus heilte die Kranken, aber Er predigte auch das Reich. Doch das paßte dem Menschen nicht, wie seltsam dies auch scheinen mag, da er
seinen eigenen Vorteil sonst gut zu schätzen weiß. Der Mensch kennt wohl die Freude der wiederhergestellten Natur; aber
die Feindschaft des fleischlichen Herzens gegen Gott geht so
weit, daß, sobald die Segnung mit der Gegenwart Gottes in
Verbindung steht, sie nicht mehr willkommen geheißen wird.
Da aber der Zweck Christi ebensowohl die Verherrlichung Gottes als auch die Rettung des Sünders ist, so kann von Seiner Seite die Segnung nur in dieser Verbindung erscheinen. Gott ist
in dieser Welt verunehrt worden, und der Mensch hat sich in ihr verderbt. Der Herr nun, der den Bruch heilt, tut ein vollkommenes Werk, indem Er einerseits den Namen und die Wahrheit Gottes unverletzt aufrechterhält, Sein Reich und Dessen Rechte ankündigt und Seine Herrlichkeit offenbart, und indem Er andererseits den verlorenen, toten Sünder rettet und
lebendig macht.
Aber dies steht, wie schon gesagt, dem Menschen nicht an. Wohl will er, daß man sich seiner annehme; aber von der Herrlichkeit Gottes will er nichts wissen. So ist der Mensch. Aber welch ein schönes Schauspiel, wenn das Herz eines armen Sünders durch den Glauben anderes Sinnes geworden ist und er sich in Wahrheit der Herrlichkeit erfreuen kann! Das kananäische Weib liefert uns ein Beispiel davon. Die Herrlichkeit des Dienstes Christi hatte lebendig und kräftig ihre Seele getroffen. Dennoch hält der Herr, trotz der Betrübnis des armen Weibes, die Grundsätze Gottes aufrecht und weist sie mit den Worten ab: „Ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel", und: „Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen" (Mt 15, 24. 26). Doch das Weib unterwirft sich
diesem Ausspruch; sie erkennt den Herrn als den Verwalter der Wahrheit Gottes und setzt keinen Augenblick voraus, daß Er zur Abhilfe ihrer Not das Ihm anvertraute Pfand, die Wahrheit und die Grundsätze Gottes, verleugnen würde. Sie will, daß Gott nach Seinen eigenen Ratschlüssen verherrlicht werde, und daß Jesus fortfahre, der treue Zeuge dieser Ratschlüsse
und der Diener des Wohlgefallens Gottes zu sein, wie auch immer ihre eigene Sache ablaufen möge. „Ja, Herr"! sagt sie und bestätigt also alles, was der Herr gesagt hat, fügt aber in
völliger Übereinstimmung mit den Worten Jesu hinzu: „Denn es essen ja auch die Hündlein von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren fallen". — Wie lieblich ist dies alles! Es
war die Frucht des Lichtes Gottes in der Seele. Die Mutter Jesu in Lk 2 steht unter dieser Heidin. Maria wußte nicht, daß Er „in dem sein mußte, was seines Vaters war", während das
kananäische Weib erkannte, daß nichts anderes als das Seine Beschäftigung bilden konnte. Sie wünschte die Verherrlichung der Wege Gottes durch die treue Hand Christi, wenn sie auch, selbst in ihrer Not, dadurch beiseitegesetzt wurde. Das hieß Christum erkennen und Ihn in der Fülle Seines Werkes annehmen als Den, Der in einer abgefallenen Welt sowohl für Gott, als auch für den durch sich selbst verderbten, unwürdigen Sünder Seinen Platz eingenommen hatte.
Es ist nicht gut, immer verstanden zu werden. Unsere Gewohnheiten und Handlungen sollten die eines Fremdlings, eines Bürgers aus einem anderen Lande sein, dessen Sprache, dessen
Gesetze und Gebräuche nur unvollkommen begriffen werden. Fleisch und Blut vermögen sie nicht zu schätzen; und darum befinden sich die Heiligen Gottes in keinem guten Zustande,
wenn die Welt sie versteht. Selbst die nächsten Verwandten Jesu erkannten Ihn nicht. Oder kannte Ihn Seine Mutter, als sie auf der Hochzeit zu Kana in Ihn drang, Seine Macht zu
entfalten und Wein für das Fest herbeizuschaffen (Joh 2)? Oder kannten Ihn Seine Brüder, als sie zu Ihm sagten: „Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt" (Joh 7, 4)? Welch
ein Gedanke! Sie suchten, den Herrn zu veranlassen, Sich zu dem. zu machen, was wir einen „Mann der Welt" nennen. Darf man irgendeine wahre Erkenntnis Jesu voraussetzen,
wenn solche Gedanken im Herzen Raum finden? Wahrlich nicht; darum fügt auch der Evangelist sogleich hinzu: „denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn". Sie kannten die
Macht des Herrn, aber nicht Seine Grundsätze; und nach Menschenweise verbanden sie den Besitz von Macht und Talenten mit der Verfolgung der Interessen des Menschen in der Welt.
Es wird nicht nötig sein zu bemerken, daß der Herr Jesus das unmittelbare Gegenteil von diesem allen war; und Seine vom Geiste dieser Welt geleiteten Verwandten nach dem Fleische
konnten Ihn daher nicht erkennen.
Die Grundsätze, die Seine Handlungen bestimmten, waren der Welt gänzlich fremd; man verachtete sie, wie einst die Tochter Sauls den König David verachtete, als er vor der Bundeslade des Herrn tanzte (2. Sam 6, 16). Aber welch eine Anziehungskraft übte die Gegenwart Jesu auf jedes Herz und Auge aus, das durch den Heiligen Geist geöffnet war! Die Apostel bezeugen es uns. Sie kannten der Lehre nach nur wenig von ihrem Meister, und ihr Bleiben bei Ihm war kein Gewinn, d. h. kein weltlicher Gewinn für sie. Ihre äußere Lage wurde durch ihren Wandel mit Jesu durchaus nicht verbessert. Auch kann man nicht sagen, daß sie sich Seine Wundermacht zu nutze machten; im Gegenteil zweifelten sie weit eher an Seiner Macht, als daß sie sich ihrer bedient hätten, und dennoch hingen sie an Ihm. Sie gesellten sich nicht zu
Jesu, weil sie in Ihm die unversiegbare und stets fließende Quelle erkannten, die alle ihre Bedürfnisse zu stillen vermochte; ich glaube vielmehr, daß wir sagen können, daß sie nie zu ihren Gunsten von Seiner Macht Gebrauch machten.
Dennoch blieben sie stets bei Ihm, waren in Verlegenheit, wenn Er von Seinem Weggehen sprach, und ihre Augen waren mit Tränen gefüllt, als sie Ihn wirklich verloren zu haben
meinten. Ich wiederhole daher: Welch eine Anziehungskraft mußte die Gegenwart Jesu auf alle diejenigen ausüben, deren Herzen und Augen durch den Geist erleuchtet, oder die „durch
den Vater gezogen" worden waren (Joh 6, 44)!
Aber auch mit welcher Gewalt drang bisweilen ein einziger Blick, ein einziges Wort Jesu in das Herz! Wir sehen dies bei Matthäus. Das eine Wort von den Lippen des Herrn:
„Folge mir"! war völlig hinreichend für ihn, um alles zu verlassen. Und diese Autorität, diese Anziehungskraft wurde von Menschen mit ganz entgegengesetztem Charakter und völlig
verschiedener Gemütsart gefühlt. Der vernünftelnde, glaubensträge Thomas und der feurige, unbedachtsame Petrus, beide wurden durch diesen wunderbaren Mittelpunkt angezogen und festgehalten. Ja, Thomas, für einen Augenblick beseelt von dem Geiste des eifrigen Petrus, konnte unter dem Eindruck dieser Anziehungskraft die Worte hören lassen: „Laßt auch uns gehen, auf daß wir mit ihm sterben" (Joh 11, 16)!
Was wird es sein, wenn auch wir dies alles dereinst in gänzlicher Vollkommenheit sehen und empfinden werden! Was wird es sein, wenn jene unzählige Schar aus der ganzen
menschlichen Familie, aus aller Herren Länder, von allen Farben und Charakteren, versammelt sein wird, und alle Geschlechter und Sprachen und Völker und Nationen bei dem
Herrn sein und Ihn in einer Welt, die Seiner würdig ist, umringen werden! Es ist wahrlich der Mühe wert, auf jene Beispiele unsere Gedanken zu richten, da sie uns zeigen, welch
eine Kostbarkeit der Herr Jesus für Herzen haben kann, die den unsrigen gleich waren, und da wir sie zugleich als Unterpfänder dessen betrachten dürfen, was in Hoffnung sowohl
uns jetzt gehört als jenen damals.
Das Licht Gottes strahlt oft vor uns, auf daß wir nach der uns verliehenen Kraft es unterscheiden und benutzen, uns seiner erfreuen und ihm folgen können. Nicht daß es uns anklagt oder Forderungen an uns stellt, sondern es strahlt vor uns, auf daß wir es, soweit wir Gnade empfangen haben, zurückstrahlen lassen. In dieser Weise sehen wir es in der ersten
Gemeinde zu Jerusalem wirken. Das dort scheinende Licht Gottes forderte nichts. Es strahlte in Klarheit und Macht; aber das war alles. Petrus redete die Sprache dieses Lichtes, als er
zu Ananias sagte: „Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt"
(Apg 5, 4)? Das Licht hatte keine Forderungen an Ananias gestellt; es leuchtete einfach vor und neben ihm in seiner Schönheit, damit er nach seinem Maße darin wandeln möchte.
In dieser Weise glänzt größtenteils die moralische Herrlichkeit Jesu; und diesem Lichte gegenüber ist es unsere erste Pflicht, zu lernen, was Christus ist. Wir haben nicht damit zu beginnen, daß wir uns mit Angst und Furcht nach seinem Scheine messen, sondern wir sind berufen, mit Ruhe, Freude und Danksagung Christum in der sittlichen Vollkommenheit Seiner
Menschheit kennenzulernen. Freilich hat uns diese Herrlichkeit verlassen; ihr lebendiges Bild existiert auf der Erde nicht mehr.
Die Evangelien liefern uns eine Beschreibung von ihr; aber nirgends erblicken wir jetzt hienieden ihren mächtigen Schein Er, dessen Herrlichkeit in dieser Welt geoffenbart worden ist,
ist zum Vater zurückgekehrt; aber obwohl Sein Fuß nicht mehr die Erde berührt, ist Er dennoch geblieben, was Er war, und wir kennen Ihn, so wie Er uns auf den Blättern des göttlich
inspirierten Wortes vor Augen gemalt ist.
Die Jünger kannten den Herrn in hervorragendem Sinne persönlich. Es war Seine Person, Seine Gegenwart, Sein Ich, das sie anzog; und dies ist es gerade, was auch wir in einem höheren Maße bedürfen. Wir mögen bemüht sein, Wahrheiten bezüglich der Person Jesu kennenzulernen, und mögen auf diesem Wege bedeutende Fortschritte machen; dennoch können die Jünger, bei all unserer Erkenntnis und trotz all ihrer Unwissenheit, uns weit hinter sich zurücklassen, wenn es sich um die Kraft einer alles beherrschenden Liebe zu Ihm handelt.
Gewiß, geliebte Brüder, es ist gut, wenn die Zuneigungen unserer Herzen zu Jesu das Maß der Erkenntnis überschreiten, die wir uns bezüglich Seiner haben erwerben können; denn
nur dann beweisen wir, daß wir Ihn wirklich verstanden haben. Glücklicherweise gibt es noch einfältige Seelen, bei denen sich diese das Maß ihrer Erkenntnis übersteigende Anhänglichkeit an die Person Christi offenbart, aber leider ist es im allgemeinen nicht so. In unseren Tagen ist meist das Gegenteil der Fall, das Licht und die Erkenntnis überschreiten gewöhnlich das Maß dessen, was unsere Herzen für den Herrn fühlen; und diese Entdeckung ist für einen jeden, der noch irgendwie ein wahres Gefühl besitzt, höchst schmerzlich.
„Das Vorrecht unseres christlichen Glaubens", sagt ein anderer Schreiber, „und das Geheimnis seiner Kraft besteht darin, daß alles, was er besitzt, und alles, was er darbietet, in einer Person
enthalten ist. Während so vieles andere sich als schwach erwiesen hat, zeigt der Glaube darin seine Kraft, daß er einen Christus zum Mittelpunkt besitzt, und daß er keinen Kreis ohne einen Mittelpunkt, keine Erlösung ohne einen Erlöser, keine Seligkeit ohne einen Seligmacher hat. Das ist es, was den christlichen Glauben für pilgernde und reisende Menschen passend macht, was ihn zu einem Licht macht, das heller glänzt als die Sonne. Alles andere erscheint im Vergleich damit nur wie das Licht des Mondes, das zwar glänzt, aber kalt und unwirksam ist, während hier Licht und Leben eins sind". —
„Wie groß ist der Unterschied", fährt jener Schriftsteller dann fort, „ob man sich einer Sammlung von Vorschriften unterwirft oder sich an ein liebendes Herz flüchtet, ob man ein
System annimmt oder sich fest an eine Person klammert! Mögen wir es nie aus den Augen verlieren, daß unsere Schätze in einer Person aufgespeichert sind, die nicht für ein einzelnes
Geschlecht ein lebender und gegenwärtiger Lehrer und Herr war und hernach aufhörte, das zu sein, sondern die für alle Geschlechter zu allen Zeiten lebendig und gegenwärtig bleiben
wird". Das sind meines Erachtens gute und beachtenswerte Worte.
Der Herr offenbart uns in Seinem Dienst auf der Erde eine ebenso wunderbare Vereinigung moralischer Herrlichkeiten, wie in Seinem Charakter. Hinsichtlich dieses Dienstes können wir
den Herrn betrachten in Beziehung zu Goff, zu Satan und zu dem Menschen. In Seinem Verhältnis zu Gott stellte der Herr Jesus in Seiner Person und in Seinen Handlungen stets den
Menschen so vor Gott hin, wie der Mensch nach dem Willen Gottes sein sollte. Er stellte die menschliche Natur wieder her als ein Opfer der Ruhe oder des lieblichen Geruchs, als einen
reinen duftenden Weihrauch, als eine reine Garbe der auf menschlichem Boden gewachsenen Erstlingsfrüchte. Er führte den Menschen in die Gunst Gottes zurück, die durch Adam
oder durch die Sünde für ihn verloren gegangen war. Gott reute es, daß Er den Menschen gemacht hatte (r. Mo 6, 6),
aber diese Reue verwandelte sich in Wonne und Wohlgefallen an dem Menschen. Und dieses Opfer wurde Gott dargebracht inmitten aller Widersprüche, aller entgegenwirkenden Umstände, aller Mühsale, Leiden und herzbrechenden Enttäuschungen.
Wunderbarer Altar! Wunderbares Opfer! Es war, wie schon früher bemerkt, ein unendlich reicheres Opfer, als es eine Ewigkeit adamitischer Unschuld hätte sein können. Und ebenso wie Jesus den Menschen vor Gott darstellte, so stellte Er auch Gott vor dem Menschen dar.
Infolge des Falles Adams hatte Gott Sein Ebenbild nicht mehr auf Erden; aber jetzt fand Er es in Christo weit vollkommener und herrlicher, als es Adam je hätte darstellen können. Nicht
einer sehr guten, makellosen Schöpfung, sondern einer verlorenen und verderbten Welt offenbarte Christus Gott, indem
Er Ihn in Gnade vorstellte und sagte: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (Joh 14, 9). Alles, was Gott ist, und was man von „dem Lichte", dem niemand nahen kann, zu
erkennen vermag, ist uns in Jesu vor Augen gestellt worden.
Bei der weiteren Beschäftigung mit dem Dienst Christi, betrachtet in seiner Beziehung zu Gott, sehen wir, daß Christus Sich immer der Rechte Gottes erinnerte, und daß Er stets der Wahrheit und den Grundsätzen Gottes treu blieb, während Er täglich unermüdlich beschäftigt war, die Not der Menschen zu lindern. Mit welch einem Anliegen das menschliche Leid
sich auch an Ihn wenden mochte, niemals opferte Er etwas auf,
das Gott gehörte. Bei Seiner Geburt sprachen die Engel sowohl:
„Herrlichkeit Gott in der Höhe"! als auch: „an den Menschen
ein Wohlgefallen" (Lk 2, 14)! und dementsprechend zog Er
während Seines ganzen Dienstes die Ehre Gottes mit demselben Eifer zu Rate, wie Er Sich dem Dienst der Bedürfnisse
und des Heils des Sünders widmete. Das Echo der Worte:
„Herrlichkeit Gott in der Höhe"! und: „Friede auf Erden"!
ließ sich sozusagen bei jeder Gelegenheit vernehmen. Die bereits erwähnte Geschichte des kananäischen Weibes liefert uns
davon ein lebendiges Beispiel. Solange sie nicht hinsichtlich
der Absichten und Ratschlüsse Gottes ihren wahren Platz einnahm, konnte Er nichts für sie tun; hernach aber vermochte Er alles.
Das sind einige der Herrlichkeiten des Dienstes Jesu, wenn
wir Ihn in Seinen Beziehungen zu Gott betrachten.
Wir kommen jetzt zu dem Dienst des Herrn in Seiner Beziehung zu Satan. Da sehen wir denn, daß Jesus ihm zunächst, und zwar zur passenden Zeit, im Augenblick Seines Dienstantritts, als dem Versucher begegnet. Satan trachtete in der Wüste danach, den Herrn in dasselbe sittliche Verderben hineinzustürzen, in das er in seiner List Adam und die menschliche Natur gestürzt hatte. Der Sieg über den Versucher bildete die notwendige, gerechte Einleitung zu allen Werken und Handlungen des Herrn. Darum war es auch der Geist, der Ihn dem Versucher entgegenführte, wie wir lesen: „Dann wurde Jesus von dem Geiste in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden" (Mt 4). Ehe der Sohn des enschen in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben konnte, mußte Er den Starken binden (Mt 12,
29). Ehe Jesus die „unfruchtbaren Werke der Finsternis" bestrafen konnte (Eph 5, 11), mußte Er zeigen, daß Er keine Gemeinschaft mit ihnen hatte. Ehe Er in das Reich des Feindes
eindringen konnte, um seine Werke zu zerstören, mußte Er ihm die Stirn bieten und ihn von Sich fernhalten.
Jesus nun hat Satan zum Schweigen gebracht, Er hat ihn gebunden. Satan mußte sich als ein völlig überwundener Versucher zurückziehen. Er konnte nichts von dem Seinigen in
Jesum hineinbringen, sondern er mußte im Gegenteil erkennen, daß alles, was in Christo gefunden wurde, von Gott war. Christus hielt alles von Sich fern, was Adam, gegenüber einer
ähnlichen Versuchung, in sich hatte eindringen lassen; und nachdem Er Sich also rein erwiesen und die Probe bestanden hat, besitzt Er jetzt ein vollkommenes sittliches Recht, alles
Unreine zu strafen.
„Haut um Haut"! (Hi 2) mag der Ankläger im Blick auf einen anderen Menschen zu sagen haben und durch solche und ähnliche Worte die verderbte Natur des gefallenen Menschen beschuldigen können. Aber als Verkläger Jesu hatte er vor
dem Thron Gottes nichts zu tun; er wurde zum Schweigen
gebracht. In dieser Weise beginnt das Verhältnis Jesu zu Satan.
Hierauf tritt Er in das Haus des Starken ein und beraubt ihn
seines Hausrats. Die Welt ist dieses Haus, und hier sieht man
den Herrn in Seinem Dienste die mannigfaltigen und tiefeingedrungenen Spuren der Macht des Feindes austilgen. Alle
Tauben und Blinden, die geheilt, alle Aussätzigen, die gereinigt
wurden, alle wiederherstellenden und heilenden Werke der
Hand Jesu, welcher Art sie auch sein mochten, sind Zeugnisse
von dieser Beraubung des Starken in seinem eigenen Hause.
Nachdem Er Satan gebunden hat, beraubt Jesus ihn seiner
Güter. Am Ende überliefert Er Sich ihm als Den, Der „die Macht des Todes" hatte (Hebr 2). Golgatha war die Stunde der „Macht der Finsternis" (Lk 22, 53). Dort erschöpfte Satan alle seine Hilfsmittel und setzte seine ganze List in Tätigkeit; aber er wurde besiegt: sein scheinbar Gefangener wurde der Überwinder. Durch den Tod machte Jesus den zunichte, der die Macht des Todes hatte. Durch das Opfer Seiner Selbst hat Er die Sünde hinweggetan; der Kopf der Schlange wurde zertreten, und so ist, wie jemand gesagt hat, „nicht der Mensch, sondern
der Tod kraftlos geworden".
So hat also Jesus, der Sohn Gottes, den Teufel zu Boden geworfen, nachdem Er ihn vorher gebunden und ihn dann seines Hausrats beraubt hatte. Doch noch eine andere moralische Herrlichkeit sieht man in dem Dienst Christi hinsichtlich Seiner Beziehung zu Satan hervorstrahlen. Christus erlaubt dem Satan niemals, Zeugnis von Ihm abzulegen. Das Zeugnis mag wahr und, wie wir sagen, selbst in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßt
sein, wie z. B.: „Ich kenne dich, wer du bist: der Heilige
Gottes" (Mki). Aber Jesus gebietet ihm dennoch, zu schweigen.
Der Dienst des Herrn war ebenso rein, wie voll von Gnade,
Er nahm in keiner Weise in Seinem Dienste die Hilfe dessen
an, den er zerstören sollte, wozu Er gekommen war. Ebenso
wenig wie in Seiner Natur konnte Er in Seinem Dienst mit
der Finsternis Gemeinschaft haben. Bei Ihm konnte der Zweck
die Mittel nicht heiligen; und so wurde der Teufel, als Antwort
auf Sein Zeugnis, bestraft und zum Schweigen gebracht. ')
Endlich strahlen uns auch die moralischen Herrlichkeiten des
Dienstes Christi in Seiner Beziehung zu dem Menschen im
hellsten Lichte entgegen. Ohne Unterbrechung erquickt und
bedient Er den Menschen in den verschiedensten Arten seiner
Leiden; aber zu gleicher Zeit offenbart Er ihm immer wieder
in der deutlichsten Weise, daß er eine verderbte, aufrührerische,
von Gott entfremdete Natur besitzt. Außerdem stellt Er den
Menschen auf die Probe; und diese Wahrheit verdient um so
mehr unsere Aufmerksamkeit, als sie im allgemeinen wenig
beachtet wird. In Seinen Unterweisungen prüft der Herr die
Menschen, mochte es nun die Volksmenge, oder Seine Jünger,
oder eine hilfesuchende Schar, oder mochten es Seine Feinde
sein, in welcher Stellung sie sich Ihm gegenüber befanden.
Während Er mit Seinen Jüngern umherzog und sie unterwies,
') Insoweit die Evangelien von dem Dienst des Heim hinsichtlich Seiner
Beziehung zu Satan reden, stellen sie Ihn als Den vor, der Satan zu Boden
wirft, ihn bindet und ihn seines Hausrats beraubt. Die Offenbarung zeigt uns
das fernere Verhalten Jesu gegen denselben Widersacher. Dort sehen wir, wie
„Satan auf die Erde geworfen wird" (Offb 12), und wie Jesus ihn, wenn die
Zeit gekommen ist, „gebunden in den Abgrund" und schließlich in den „Feuer=
und Schwefelsee" wirft (Offb 20). Wir können somit den Sieg des Herrn Jesu
über Satan von der Wüste, der Stätte der Versuchung an bis zum Feuersee
hin verfolgen.
232
führte Er sie beständig durch Übungen des Herzens und des
Gewissens; und dies fand so statt, daß es überflüssig ist, Beispiele dafür anzuführen.
Auch die Volksmenge, die Ihm folgte, behandelte Er in gleicher
Weise. „Höret und verstehet" (Mt 15, 10)! rief Er ihnen zu,
um so ihren Geist zu üben, während Er sie belehrte. Zu
etlichen, die mit ihren Krankheiten zu Ihm kamen, sagte Er:
„Glaubet ihr, daß ich dieses tun kann" (Mt 9, 28)? Das kananäische Weib ist ein bemerkenswertes Beispiel von der Art
und Weise, wie Er diese Klasse von Personen auf die Probe
stellte. Im Hause Simons wandte Er Sich, nachdem Er die Geschichte von dem Menschen mit den zwei Schuldnern erzählt
hatte, mit der Frage an Simon: „Wer nun von ihnen, sage,
wird ihn am meisten lieben" (Lk 7)?
Ebenso stellte Er die Pharisäer, Seine unermüdlichen Widersacher, beständig auf die Probe; und diese Tatsache zeugt mit
Macht von dem, was Christus ist. Wir lernen daraus, daß Er
die Pharisäer nicht unter ein allgemeines, summarisches Urteil
stellte, sondern daß Er sie gern zur Buße leiten wollte. In
gleicher Weise verfährt Er mit Seinen Jüngern, wenn Er ein
Selbstgericht in ihnen wachruft. Er belehrt uns dadurch, daß
wir Seine Unterweisungen tatsächlich nur insoweit lernen, als
unser Verständnis, unser Herz und Gewissen in Tätigkeit gesetzt werden. Und diese Art und Weise, diejenigen, die Er
leitete und belehrte, zu üben, ist sicher auch eine der moralischen Herrlichkeiten, die den Dienst Christi auszeichnen.
Doch noch mehr. In Seinem Dienst dem Menschen gegenüber
nimmt Jesus oft die Stellung eines Tadlers oder Verurteilers
ein; und dies kann kaum anders sein inmitten einer Umgebung,
wie die menschliche Familie in ihrem gegenwärtigen Zustande
ist; aber bewunderungswürdig ist die Art und Weise Seines
Tadeins. Steht Er den Pharisäern gegenüber, deren irdische
Gesinnung sich stets wider Ihn erhob, so nehmen Seine Worte
einen ernsten Ton an, wie z. B.: „Wer nicht mit mir ist, ist
wider mich" (Mt 12, 30). Wendet Er Sich hingegen zu denen,
die Ihn angenommen hatten und Ihn liebten, die aber, um
Seine volle Gemeinschaft zu genießen, einer größeren Kraft
des Glaubens und eines größeren Maßes von Licht bedurften,
233
so bedient Er Sich einer ganz anderen Sprache; Er sagt: „Wer
nicht wider euch ist, ist für euch" (Lk a, 50). — In Mt 20, 20-28,
wo es sich um die zehn Jünger und die zwei Söhne des Zebedäus handelt, tritt Er in demselben Charakter vor uns. Wie
mildert Er Seinen Verweis im Hinblick auf das Gute und
Schöne, das sich bei denen fand, die Er zurechtweisen mußte!
Welch einen ganz anderen Platz nimmt Er ein als Seine unwilligen Jünger, die ihre Brüder in keiner Weise geschont zu
sehen wünschten! Er prüft mit Geduld die ganze Frage und
„scheidet das Köstliche vom Gemeinen aus".
Ebenso wendet der Herr Sich tadelnd an Johannes, als die
Jünger jemanden, der nicht mit ihnen wandeln wollte, verboten
hatten, im Namen Jesu Teufel auszutreiben. Doch in jenem
Augenblick war das Herz des Johannes unter die Zucht des
Herrn gekommen. Im Licht der vorhergehenden Worte Jesu
hatte er den begangenen Fehler entdeckt und machte nun eine
Anspielung darauf, obwohl der Herr Selbst die Sache mit
keinem Worte erwähnt hatte. Und eben weil Johannes sich
seines Fehlers bewußt war und ihn nun offen und ungeschminkt bekannte, antwortete ihm der Herr mit der größten
Zartheit (siehe Lk o, 46—50).
Bei Johannes dem Täufer finden wir Ähnliches. Jesus tadelt
ihn, aber unter welch einer gnädigen Berücksichtigung der
Umstände! Johannes befand sich damals im Gefängnis. Von
welcher Bedeutung mußte dieser Umstand für Jesum in jenem
Augenblick sein! Dennoch verdiente Johannes einen Tadel,
weil er eine Botschaft an seinen Herrn geschickt hatte, die für
diesen einen Vorwurf enthielt. Doch wie zart ist die Zurechtweisung Jesu! Er sendet Johannes eine Antwort zurück, die
nur von diesem völlig verstanden und gewürdigt werden
konnte. Er läßt ihm sagen: „Glückselig ist, wer irgend sich
nicht an mir ärgern wird" (Mt n , 6). Selbst die Jünger des
Johannes, welche die Botschaft ihres Meisters überbracht hatten, vermochten die Tragweite dieser Worte nicht zu verstehen.
Jesus wollte Johannes vor sich selbst bloßstellen, nicht aber
vor seinen Jüngern, noch vor der Welt.
Die zurechtweisenden Worte ferner, welche Jesus an die
Emmaus-Jünger, sowie die, welche Er nach Seiner Auferstehung
234
an Thomas richtete, haben ihre besondere Vortrefflichkeit.
Auch Petrus wird in Mt 16 und in Mt 17 getadelt; aber wie
verschieden ist bei diesen beiden Gelegenheiten die Art der
Zurechtweisung! Und alle diese Verschiedenheiten enthalten
eine Fülle von Schönheit. Mag Jesus ernst oder milde, scharf
oder schonend reden, mag der Ton Seiner tadelnden Worte
so zart sein, daß sie kaum mehr wie ein Verweis klingen, oder
mag der Tadel sich zu einer Höhe steigern, daß er fast einer
Verwerfung gleich kommt, stets können wir mit Bestimmtheit
sagen, daß wir (nach Erwägung der Umstände, welche die
Worte Jesu hervorriefen) in allen diesen Schattierungen ebenso
viele Vollkommenheiten entdecken. Alle diese Verweise des
Herrn waren wie „ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide von feinem Golde", mochte nun das „Ohr" ein „hörendes"
sein oder nicht (Spr 25, 12). „Der Gerechte schlage mich: es
ist Güte, und er strafe mich: es ist ö l des Hauptes" (Ps 141, 5).
Wahrlich, der Herr ließ Seine Jünger diese Erfahrung machen!
* *
So habe ich denn einige Züge der moralischen Herrlichkeit
Jesu Christi in Seiner Menschheit aufgezeichnet. Er stellte vor
Gott den Menschen dar, wie er sein sollte; und Gott ruhte in
Ihm. Diese Vollkommenheit des Menschen Christus Jesus und
Seine Aufnahme vor Gott werden uns vorbildlich in dem
Speisopfer gezeigt, in dem Opfer von Feinmehl und ö l und
Weihrauch, gebacken in der Pfanne oder im Ofen (3. Mo 2).
Während der Herr Jesus auf Erden war und Sich so vor Gott
als Mensch offenbarte, drückte Gott beständig Sein Wohlgefallen an Ihm aus. Jesus wuchs auf vor dem Auge Gottes in
Seiner menschlichen Natur und in der Entwicklung aller menschlichen Tugenden; und Er bedurfte, in welchem Augenblick es auch sein mochte, nichts anderes zu Seiner Empfehlung als Sich Selbst, gerade so wie Er war. In Seinen Wegen und in
Seiner Person wurde der Mensch moralisch verherrlicht, so daß Er, als Sein Lauf vollendet war, geradewegs zu Gott gehen konnte, so wie einst die „Garbe der Erstlinge der Ernte" unmittelbar, so wie sie war, vom Felde genommen und, ohne irgendwelcher Vorbereitung unterworfen werden zu müssen, zu Gott gebracht und von Ihm angenommen wurde.
Der Rechtstitel Jesu auf die Herrlichkeit war ein moralischer Titel. Er besaß das Recht, verherrlicht zu werden; dieses Recht lag in Ihm Selbst. In Joh 13, 31. 32 wird diese Wahrheit an
dem ihr gebührenden Platz klar vorgestellt. „Jetzt ist der Sohn
des Menschen verherrlicht", sagt der Herr in dem Augenblick,
als Judas den Tisch verlassen hatte; denn diese Handlung des
Judas war der sichere Vorläufer Seiner Gefangennahme durch
die Juden, so wie die Gefangennahme der sichere Vorläufer
Seiner Verurteilung zum Tode durch die Heiden war. Das
Kreuz war die Fülle und Vollendung aller moralischen Herrlichkeit in Ihm; deshalb sagt Er gerade in diesem Augenblick:
„Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht", und fügt dann
hinzu: „und Gott ist verherrlicht in ihm".
Gott war damals ebenso vollkommen verherrlicht wie Jesus
Selbst, obwohl die Herrlichkeit eine ganz verschiedene war.
Der Sohn des Menschen war verherrlicht, indem Er die sittliche
Schönheit, die während Seines ganzen Lebens aus Ihm hervorgestrahlt war, in ihrer ganzen Vollendung darstellte. Kein
Strahl dieser Herrlichkeit durfte in jener Stunde fehlen, ebensowenig wie von Anfang an irgend etwas, das ihrer unwürdig
gewesen wäre, mit ihr vermengt worden wäre. Die Stunde
war angebrochen, in welcher der letzte Strahl dieser Herrlichkeit hervorleuchten sollte, um ihren Glanz zu vollenden. Aber
auch Gott wurde verherrlicht, weil alles, was von Ihm war,
aufrechterhalten oder entfaltet wurde. Seine Rechte wurden
aufrechterhalten, Seine Güte entfaltet. Gnade und Wahrheit,
Gerechtigkeit und Friede wurden aufrechterhalten und befriedigt. Gottes Wahrheit, Heiligkeit, Liebe, Majestät und Herrlichkeit, mit einem Wort, alles was Er ist, wurde in einer
Weise und in einem Licht geoffenbart und verherrlicht, wie
es durch nichts anderes hätte geschehen können. Das Kreuz
ist, wie jemand gesagt hat, das moralische Wunder des Weltalls.
Doch der Herr fügt hinzu: „Wenn Gott verherrlicht ist in ihm,
so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und alsbald
wird er ihn verherrlichen" (Joh 13, 32). Jesus bestätigt hier
Sein Recht auf die persönliche Herrlichkeit. Er hatte bereits
das ganze Bild der moralischen Herrlichkeit während Seines
Lebens und in Seinem Tode vollendet. Auch hatte Er, wie wir
236
gesehen haben, die Herrlichkeit Gottes behauptet und aufrechterhalten; daß Er jetzt in Seine eigene persönliche Herrlichkeit einging, war daher nur eine gerechte Sache. Und dieses
Rechtes hat Sich Jesus bedient, als Er Seinen Platz im Himmel,
zur Rechten der Majestät, bei Gott Selbst einnahm, und zwar
„alsbald" einnahm.
Das Werk Gottes, des Schöpfers, war sehr bald unter der Hand
des Menschen verunreinigt worden. Der Mensch hatte sich
selbst verderbt, so daß geschrieben steht: „Es reute Jehova,
daß er den Menschen gemacht hatte auf der Erde" (i. Mo 6, 6).
Welch ein schrecklicher Wechsel in den Gedanken Gottes seit
jenem Tage, da „Gott alles sah, was er gemacht hatte, und
siehe, es war sehr gut"! Aber in dem Herrn Jesu fand Gott
wieder Sein Wohlgefallen an dem Menschen. Welch eine
Segnung! um so größer und herrlicher, dürfen wir sagen,
wegen der Reue, welcher Gott einst Ausdruck gegeben hatte.
Es war mehr als ein erster Genuß; es war eine Wiederherstellung nach Verlust und Enttäuschung, und zwar eine Wiederherstellung, die das Verlorene bei weitem übertraf. Und
wie der erste Mensch, wenn ich mich so ausdrücken darf, zufolge seiner Sünde außerhalb der Schöpfung seinen Platz fand,
so w\irde der zweite Mensch (der zugleich der „Herr vom
Himmel" war), nachdem Er Gott verherrlicht hatte, als das
Haupt der Sdiöpfung zur Rechten der Majestät in der Höhe
gesetzt. Jesus ist ein verherrlichter Mensch im Himmel, weil
Gott auf der Erde in Ihm, dem gehorsamen Menschen, im
Leben und im Tode verherrlicht worden ist. Wohl ist Er, wie
wir wissen, noch in anderen Charakteren im Himmel: Er ist
dort als ein Überwinder, als ein Wartender, als der große
Hohepriester in der Hütte, welche Gott aufgerichtet hat, als
unser Vorläufer und als Der, welcher die Reinigung unserer
Sünden vollbracht hat usw. Aber Er ist dort in den himmlischen örtern auch verherrlicht, weil Er Gott hier auf Erden
verherrlicht hat.
Leben und Herrlichkeit gehören also dem Herrn Jesu kraft
eines persönlichen und moralischen Anrechts. Es ist erquickend,
bei dieser Wahrheit zu verweilen und sie immer von neuem
zu wiederholen. Jesus hat niemals den Garten Eden verloren.
Zwar wandelte Er alle Seine Tage außerhalb Edens, inmitten
237
der Dornen und Disteln, der Mühsale und Entbehrungen einer
verderbten Welt; aber Er tat es in Gnade. Er versetzte Sich
freiwillig in diese Lage, aber Er war ihr nicht unterworfen.
Er war nicht, wie Adam und wie wir alle es sind, durch die
Cherubim und durch das flammende Schwert von dem Baume
des Lebens und dem Paradiese getrennt. In Seiner Geschichte
sehen wir, daß die Engel, statt Ihn außerhalb des Gartens
von dem Eingange fernzuhalten, zu Ihm kommen und Ihm
dienen, nachdem Er die Versuchung bestanden hat; denn Er
hielt da stand, wo Adam wankend wurde und fiel. Obwohl
daher Jesus wirklich und wesentlich Mensch war, so war Er
doch dieser besondere „vollkommene Mensch". Gott wurde in
Ihm verherrlicht, wie Er durch alles außer Ihm getäuscht und
verunehrt worden war.
In einem Sinne ist diese Vollkommenheit des Sohnes des
Menschen, diese moralische Vollkommenheit, ganz für uns.
Sie verleiht dem Blute, das unsere Sünden sühnt, seine Kostbarkeit. Sie ist wie jene Wolke von Weihrauch, die am Versöhnungstage zugleich mit dem Blute in die Gegenwart Gottes
kam (3. Mo 16, 13).
In einem anderen Sinn aber ist diese Vollkommenheit zu groß
für uns. Sie ist so erhaben, daß wir sie nie erreichen können.
Sie überwältigt uns, insoweit wir sie betrachten in der Erinnerung daran, was wir in uns sind; und sie erfüllt uns mit
Bewunderung, insoweit wir sie als den Ausdruck dessen betrachten, was Er ist. Die persönliche richterliche Herrlichkeit Gottes, wie sie in früheren Zeiten erschien, war überwältigend.
Selbst die am meisten Begünstigten unter den Menschenkindern,
wie Jesaias, Hesekiel oder Daniel, konnten ihren Glanz
nicht ertragen; auch Petrus und Johannes machten die gleiche
Erfahrung. Und so ist auch diese moralische Herrlichkeit, wenn
sie in derselben Weise uns bloßstellt, überwältigend. Nur der
Glaube fühlt sich in ihrer Gegenwart zu Hause. Der Gott
dieser Welt verblendet die Sinne, damit man jene Herrlichkeit
nicht begreife noch sich ihrer erfreue, während der Glaube sie
mit Freuden begrüßt. Das ist die Geschichte der Herrlichkeit
hienieden unter den Menschen. In ihrer Gegenwart fordern
die Pharisäer und Sadducäer gemeinschaftlich ein Zeichen vom
Himmel. Die Mutter und die Brüder Jesu mißkennen sie, Seine
Mutter aus Eigenliebe, Seine Brüder aus Weltlichkeit: und
selbst die Jünger werden beständig durch sie bestraft.
Das „zerstoßene Olivenöl", das dieses Licht nährte, war für
alle zu rein; aber es brannte beständig im Heiligtum „vor dem
Angesicht des Herrn". In der Synagoge zu Nazareth (Lk 4)
sehen wir, wie wenig der Mensch bereit ist, dieses Licht aufzunehmen. Alle erkannten die gnadenreichen Worte, die den
Lippen des Herrn entströmten, und fühlten deren Kraft; aber
bald drängte sich ein mächtiger Strom des natürlichen Verderbens dazwischen, widerstand dieser Bewegung in den Herzen und trug den Sieg davon. Der demütige, selbstlose Zeuge
Gottes trat inmitten einer hochmütigen, rebellischen Welt ans
Licht; aber das gefiel ihr nicht. Mag der „Sohn Israels" auch
gütige und trostreiche Worte reden, man verweigert Ihm dennoch die Aufnahme, Er ist der Sohn eines Zimmermanns (Lk 4).
Welch ein erstaunliches Zeugnis von der tiefen Verderbtheit
unserer Herzen! Der Mensch hat seine liebenswürdigen Eigenschaften, seine Tugenden, seinen guten Geschmack, seine zarten Gefühle, wie wir dies bei jener Szene zu Nazareth gewahren. Die gnadenreichen Worte Jesu rufen für einen Augenblick mancherlei gute Gefühle wach; aber was galten sie und wo blieben sie, als Gott sie auf die Probe stellte? Ach, geliebter Leser, trotz unserer Liebenswürdigkeit, trotz des Ansehens, das wir genießen mögen, trotz unserer guten Neigunger. und zarten Gefühle sind und bleiben wir zu dem
Bekenntnis gezwungen: „In mir, das ist in meinem Fleische,
.vohnt nichts Gutes" (Röm 7, 18;.
Doch, ich wiederhole, der Glaube fühlt sich bei Jesus zu Hause.
Könnten wir, möchte ich sagen, gegen einen solchen Herrn
argwöhnisch sein oder Ihn fürchten? Könnten wir irgendeinem
Zweifel im Blick auf Ihn Raum geben? Könnten wir uns fernhalten von Ihm, der am Jakobsbrunnen Sich mit dem Weibe
von Sichar unterhielt? Hielt sie sich etwa fern von Ihm? Wahrlich, wir sollten einen innigen, vertrauten Verkehr mit Jesu
unterhalten. Die Jünger, die allezeit um Ihn waren, mußten
ihre Lektionen stets aufs neue lernen; und auch wir wissen
etwas davon zu sagen. Sie hatten immer von neuem die Entdeckung zu machen, was Christus war, statt sich dessen zu erfreuen, was sie bereits von Ihm kennengelernt hatten.
In Mt 14 mußten sie ausrufen: „Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn"! das hieß aufs neue entdecken was Jesus war. Wäre ihr Glaube einfältig gewesen, so würden sie sich im Schiff ruhig neben Ihm zum Schlummer niedergelegt haben (Mk 4). Welch eine Szene war es, zu ihrer Beschämung und zu Seiner Ehre! Sie hatten den Herrn in verletzendem, vorwurfsvollem Ton angesprochen, als wäre Er gleichgültig gegenüber der Gefahr, in der sie schwebten. „Lehrer, liegt dir nichts daran, daß wir umkommen"? rufen sie Ihm zu. Er erwacht und beseitigt alsbald die Ursache ihrer Angst. Dann aber tadelt Er sie, jedoch nicht wegen des Unrechts, das sie Ihm durch ihre harten
Worte angetan hatten, sondern wegen ihres Kleinglaubens.
Wie vollkommen ist das alles! Wahrlich, alles in Jesu ist vollkommen; alles ist an seinem Platz: die menschlichen Tugenden, die Früchte der Salbung, die Ihm zuteil geworden war, und Seine göttliche Herrlichkeit. In Seiner Person sind die beiden Naturen nicht miteinander vermengt, sondern der Glanz der göttlichen Natur ist gemildert, und das Gewöhnliche in der menschlichen Natur ist erhöht. Nichts Ähnliches wird und kann in der ganzen Schöpfung gefunden werden. Und dennoch war das Menschliche in Jesu wirklich menschlich, und das Göttliche wirklich göttlich. Er schlief im Schiff: Er war Mensch; Er brachte Wind und Wellen zu Schweigen: Er war Gott. Diese moralische Herrlichkeit muß hervorstrahlen; und bis dies erfüllt ist, müssen andere Herrlichkeiten in den Hintergrund treten. Die Griechen, die nach Jerusalem gekommen
waren, um auf dem Feste anzubeten, fragen nach Jesu und wünschen Ihn zu sehen (Joh 12). Dies erinnerte an das Reich, oder an die Entfaltung der königlichen Herrlichkeit des Messias; es war eine vorbildliche Darstellung des Tages, an dem die Nationen in die Stadt der Juden kommen werden, um Festfeier zu halten, und wenn Christus, als König in Zion, Herr
über alles und Gott der ganzen Erde sein wird.
Aber es gab ein tieferes Geheimnis als das; und es bedarf einer richtigeren Erkenntnis der Wege Gottes, als einfach das Reich zu erwarten. Diese Erkenntnis mangelte den Pharisäern
(Lk 17), als sie die Frage an den Herrn richteten, wann das Reich Gottes kommen würde. Jesus hatte daher mit ihnen von einem anderen Reich zu reden, das sie nicht erwarteten und
nicht schätzten, von einem Königreich in ihrer Mitte, einem gegenwärtigen Reich, in das man eingehen mußte, bevor das in Herrlichkeit geoffenbarte Reich erscheinen konnte. Auch
den Jüngern fehlte diese Erkenntnis, als sie den Herrn in Apostelgeschichte i fragten: „Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her"? und auch sie mußten an
etwas erinnert werden, was stattfinden mußte, bevor diese Wiederherstellung sich erfüllen konnte, nämlich an die Tatsache, daß sie den Heiligen Geist empfangen würden, um die
Zeugen Christi zu sein bis an das Ende der Erde. Gerade so ist es in Joh 12. Der Herr belehrt uns hier, daß die moralische Herrlichkeit dem Reiche vorangehen müsse. Sicher wird der Augenblick kommen, wo Jesus in der Herrlichkeit des Thrones glänzen wird, wo die Heiden nach Zion kommen und den König in Seiner Schönheit sehen werden; aber ehe dies in die Erscheinung treten kann, muß die moralische Herrlichkeit Sich in ihrer ganzen Fülle und Reinheit entfalten.
Dieser Gedanke beschäftigte Jesus, als die Griechen Ihn zu sehen begehrten. „Die Stunde ist gekommen", sagt Er, „daß der Sohn des Menschen verherrlicht werde". Daß es sich hier um Seine moralische Herrlichkeit handelt, bemerkten wir bereits bei der Betrachtung von Joh 13, 51. 32. Diese Herrlichkeit hatte von der Geburt des Herrn an bis zu diesem Augenblick alle Seine Pfade erleuchtet; und Sein Tod sollte ihre Vollendung sein. Darum war die Stunde nahe, wo sie ihre letzten Strahlen aussenden sollte, um eben diese Vollendung herbeizuführen. Der
Herr teilt also bei dieser Gelegenheit, wie Er dies in ähnlicher Weise in Lk 17 und in Apg 1 tut, die Wahrheit mit, die notwendig ist, um eine richtigere und tiefere Erkenntnis von den
Wegen Gottes zu empfangen. Die moralische Herrlichkeit muß vollständig geoffenbart sein, ehe der Messias Sich in Seiner königlichen Herrlichkeit bis an die Enden der Erde zeigen ann.
Indes gehört diese Herrlichkeit Ihm, nur Ihm allein. Unsere Herzen fühlen dies tief. Als in Apg 10 der Himmel aufgetan wurde, kam das leinene Tuch hernieder, bevor Petrus den Befehl empfing, Gemeinschaft mit ihm zu machen, oder bevor es wieder in den Himmel aufgenommen wurde und sich in der Höhe von neuem den Blicken entzog. Der Inhalt des leinerten Tuches mußte gereinigt oder geheiligt werden. Aber als in Mt 3 die Himmel sich öffneten, war es durchaus unnötig, daß Jesus von der Erde in den Himmel aufgenommen wurde,
um so das Siegel des Wohlgefallens Seines Vaters zu empfangen; vielmehr drückten Stimmen und Erscheinungen aus der Höhe ihr Siegel auf Ihn und zeugten von Ihm, so wie Er war:
„Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe"!
Und als die Himmel in Mt 27, 51 sich noch einmal auftaten, d. h. als der Vorhang des Tempels in zwei Stücke zerrissen wurde, da war alles vollbracht; nichts mehr war zu tun übriggeblieben. Das Werk Christi wurde besiegelt und anerkannt, so wie es damals war. So zeugt ein im Anfang geöffneter Himmel von der völligen Annehmlichkeit der Person Christi, während ein am Ende geöffneter Himmel Zeugnis ablegt von der völligen Annehmlichkeit Seines Werkes.
Indem ich hiermit diese Betrachtung schließe, möchte ich noch bemerken, daß es kostbar und lieblich für uns ist und zu gleicher Zeit einen Teil unseres Gottesdienstes ausmacht, die
charakteristischen Züge der Wege und des Dienstes Jesu hienieden zu bezeichnen, so wie ich es in meinem Maße in dieser
Schrift zu tun versucht habe. Denn alles was Jesus getan hat, alles was Er geredet hat, Sein ganzer Dienst, sowohl in seinem Wesen als in seiner äußeren Form, alles legt Zeugnis ab von
dem, was Er war; und Er ist für uns der Zeuge von dem, was Gott ist. In dieser Weise schwingen wir uns, indem wir den in den Evangelien aufgezeichneten Pfaden des Herrn Jesu folgen, zu Gott Selbst empor. Jeder Schritt auf diesen Pfaden wird bedeutungsvoll für uns. Alles, was Jesus getan und geredet hat, war der wahre und treue Ausdruck Seiner Selbst, so wie Er der wahre und treue Ausdruck Gottes war. Und wenn wir fähig sind, den Charakter Seines Dienstes zu verstehen, wenn wir die moralische Herrlichkeit, die mit jedem Moment und mit jeder Einzelheit des Lebens und Dienstes des Herrn hienieden verknüpft ist, zu unterscheiden vermögen, indem wir so lernen, was Er ist, und mithin auch was Gott ist, so erreichen wir Gott in einer gewissen und unbewölkten Erkenntnis Seiner Selbst mittels der gewöhnlichen Pfade und Tätigkeiten des göttlichen Menschensohnes.
Die Versammlung des lebendigen Gottes, Rudolf Brockhaus :
R. Brockhaus - Die Versammlung oder Gemeinde
„Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! Wie das köstliche 01 auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider; wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit“ (Psalm 133).
Das Wort „ekklesia“ im Neuen Testament
Es darf heute als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, daß das Wort „Versammlung“ oder „Gemeinde“ die Übersetzung des griechischen Wortes ekklesia ist. Dieses, von dem Zeitwort ekkalein = herausrufen, berufen gebildet, bezeichnet zunächst eine Versammlung von Leuten, welche in den griechischen Städten Bürgerrecht hatten, gegenüber solchen Einwohnern, die desselben ermangelten und paroikoi genannt wurden.‘ Vergl. Apostelgeschichte 19,39: „Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden“. Weiterhin bezeichnet es eine Volksversammlung im allgemeinen Sinne, eine zusammengeströmte Volksmenge: „Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung“ (V 41; so auch V 32). Dann wird die Gemeinde Israels in der Wüste ekklesia genannt (Apg 7,38). Und schließlich wird das Wort angewandt auf die Versammlung der aus Juden und Heiden berufenen Gläubigen (oder Heiligen; 1. Kor 14,33), sowohl in allgemeiner, alle Gläubigen umfassender Bedeutung, als auch in begrenztem Sinne nur die Gläubigen an irgendeinem Orte bezeichnend. Zuweilen liest man auch von einer Versammlung in irgendeinem Hause, wie z.B. in 1. Korinther 16,19: „Es grüßen euch ... Aquila und Priscilla, samt der Versammlung in ihrem Hause“ (vgl. Röm 16,5; Kol 4,15; Phlm 2). Aber daraus geht keineswegs hervor, daß in den Häusern der an den verschiedenen Stellen genannten Gläubigen besondere, selbständige Versammlungen bestanden hätten. Im Gegenteil schreibt der Apostel „der Versammlung Gottes, die in Korinth ist“, „der Versammlung der Thessalonicher“; er redet von „der Versammlung der Laodicäer“ und von „der Dienerin der Versammlung in Kenchreä“. Lukas redet in der Apostelgeschichte immer wieder von „der Versammlung in Jerusalem“, obwohl schon bald die Zahl der Gläubigen dort auf viele Tausende anwuchs und deshalb wohl niemals an dem nämlichen Orte versammelt sein konnte, von „der Versammlung in Antiochien, in Ephesus“ (vgl. Kap. 2,47; 13,1; 14,27; 15,3.4; 18,22; 20,17).
Die Einheit der Versammlung an einem Ort
Von mehreren, nebeneinander bestehenden Versammlungen an einem Orte weiß die Schrift nichts. Wohl aber werden die Gläubigen eines Ortes, wenn die wachsende Zahl es nötig machte, in mehreren Häusern zusammengekommen sein, oder auch, durch mancherlei Umstände, Verfolgungen usw. gezwungen, ihre Versammlungsstätten häufig gewechselt haben. Doch dadurch wurde nichts an der Einheitlichkeit des ganzen an einem Orte durch die Gnade Gottes errichteten Zeugnisses geändert. Auch wurde, wenn es sich um außergewöhnliche Angelegenheiten, ernste Entscheidungen und dergleichen handelte, die ganze Versammlung zusammengebracht. (Apg 14,27; 15,22; vgl. auch 1. Kor 14,23).
So war es im Anfang, und so entsprach es den Gedanken Gottes. Er selbst tat, wie wir in Apostelgeschichte 2,47 lesen, in Jerusalem täglich „zu der Versammlung“ hinzu, die gerettet werden sollten. Von der Errichtung mehrerer Versammlungen oder Gemeinden an einem Orte finden wir, wie gesagt, nirgendwo eine Spur. Steht das Wort in der Mehr zahl, so sind immer entweder alle Versammlungen oder diejenigen einer Provinz, eines Landes usw. gemeint. (So z.B. Apg 9,31; 15,41; 16,5; Röm 16,4.16; 1. Kor 7,17; 11,16 u.a.St.) Wenn man, um das Bestehen verschiedener christlicher Körperschaften oder Gemeinschaften an einem Ort zu rechtfertigen, zu beweisen sucht, es sei im Anfang der Geschichte der Kirche auch schon so gewesen, so kann man nur sagen, daß der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Man will es so, darum ist es so. Andererseits bedarf es kaum einer Erwähnung, daß es nicht nur eine große Anmaßung, sondern auch eine völlige Verdrehung der Wahrheit sein würde, wenn irgendeine Gemeinschaft von Gläubigen, mag ihre Zahl groß oder klein sein, sich den Namen die Versammlung „ oder „die Gemeinde“ beilegen wollte.
Sie würde damit ja alle übrigen Gläubigen als nicht zur Versammlung oder Gemeinde gehörend ausschließen. Nein, die Versammlung im weiteren Sinne besteht aus allen wahren Gläubigen auf der ganzen Erde, und die Versammlung im begrenzten örtlichen Sinne aus allen wahren Gläubigen an dem betreffenden Orte, mögen sie stehen und sich nennen, wie sie wollen, ja mögen sie in noch so viele größere oder kleinere Körperschaften und Benennungen zerteilt sein. Nach Gottes Wort und Gedanken gibt es an einem Orte nur eine Versammlung, nur eine Gemeinde, und wir sollten doch bemüht sein, mit Gottes Gedanken zu denken, und alle eigenen Gedanken und Meinungen fahren lassen.
Trennungen in der geschichtlichen Entwicklung
Aus der durch die Untreue des Menschen entstandenen Verwirrung und aus jenen eigenen Gedanken und Meinungen heraus kommen alle solche Fragen wie: „Wie nennst du dich?“ „Wozu gehörst du?“ „Wo hast du dich angeschlossen?“ usw. Niemand wird behaupten wollen, daß in der Zeit der Apostel irgendein Christ den anderen so gefragt haben könne. Nun, wenn es damals nicht richtig war, so zu fragen, kann es dann heute richtig sein? Ganz gewiß nicht, oder man müßte die sogenannte „geschichtliche Entwicklung“ der christlichen Kirche betrachten als von Gott gewollt und von Ihm anerkannt. Wenn man das nicht tut und welcher einfältige, dem Wort und Willen Gottes unterworfene Christ könnte es? kann man die vielen verschiedenartigen Körperschaften nicht als Gott wohlgefällig anerkennen.
Aber, fragt man, sind denn nicht reiche Segensströme von vielen dieser Gemeinschaften nach nahe und fern hin ausgeflossen? Haben nicht treue, wackere Gottesmänner an ihrer Spitze gestanden, oder stehen heute noch da?
Haben nicht viele ihrer Glieder bis aufs Blut gelitten und gestritten für ihren Herrn? Werden sie nicht reichen Lohn empfangen für ihre Treue bis in den Tod, für ihren Fleiß, ihre Liebe, ihr Ausharren? Wieder antworten wir: Ganz gewiß! Wer könnte, wer wollte das in Frage stellen? Wer es verkleinern oder neidisch gar leugnen? Aber so laut die genannten Dinge Zeugnis geben mögen von der richtigen Herzensstellung jener treuen Männer zu Jesu, ihrem Herrn, beweisen sie doch nichts für die Richtigkeit ihrer Stellung zu ihren Mitgläubigen oder, besser gesagt, von dem Erfassen und Verwirklichen der Gedanken Gottes über „Christum und die Versammlung“, die Sein Leib ist, in welchem keine Spaltung sein sollte (l. Kor 12,25). Man mag demgegenüber einwenden: Die Trennungen und Spaltungen sind einmal da, man kann sie nicht mehr hinwegschaffen, man muß sich darum, so gut oder so schlecht es gehen mag, mit ihnen abfinden; andere mögen sie sogar zu entschuldigen oder selbst zu rechtfertigen und als nützlich und segenbringend hinzustellen suchen aber ein zartes Gewissen, das in allem den Willen des Herrn zu tun bereit ist, wird sich dabei nicht beruhigen können.
Man sagt auch oft: Der Herzenszustand eines Gläubigen ist viel wichtiger als seine äußere christliche Stellung, seine Zugehörigkeit oder Nicht Zugehörigkeit zu irgendeiner religiösen Körperschaft. Aber ohne die Grade der Wichtigkeit dieser beiden Dinge gegeneinander abwägen zu wollen, ist das Wort des Herrn doch jedenfalls auch in dieser Hinsicht wahr: „dies hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen.“ Falsch ist es jedenfalls, das eine auf Kosten des anderen abzuschwächen.
Das schriftgemäße Heilmittel
Aber um auf die oben angeführten Fragen zurückzukommen, ist es allerdings, nachdem einmal die große Verwirrung eingetreten ist, bei dem besten Willen oft schwer, sich richtig auszudrücken, um so schwerer, weil der Gedanke, irgendeiner religiösen Körperschaft angehören, „Anhänger“ irgendeines Mannes, eines Lehrsystems oder eines Bekenntnisses sein zu müssen, den meisten Christen (echten und unechten) so in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß sie sich eine andere Möglichkeit gar nicht denken können. „Das Kind muß doch einen Namen haben!“ sagt man. So redet man sogar von „Anhängern der Versammlung“ oder der „Versammlungen“! Nun ist es ganz gewiß wahr, daß Gott nicht will, daß Seine Kinder ein jedes für sich allein stehen. Im Gegenteil, wir sind ermahnt, Gemeinschaft miteinander zu pflegen und unser Zusammenkommen nicht zu versäumen. Christus ist gestorben, „auf daß Er die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte“ (Joh 11,52). Aber wird jener Ermahnung oder dieser Liebesabsicht des Herrn in Seinem Tode dadurch entsprochen, daß man je nach Belieben oder vermeintlichem Bedürfnis selbständige, unabhängige Gemeinden mit Namen, Glaubensbekenntnis und eigener Verfassung gründet? Oder wird dadurch etwas gebessert, daß man diese Gemeinden „biblische Gemeinde“ nennt? Sind sie wirklich biblisch? In dem vorliegenden Sinne gewiß nicht. Denn wenn Christus gestorben ist, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln, kann es nicht biblisch sein, wenn die Kinder Gottes an einem und demselben Orte sich in zehn, zwölf oder gar noch mehr Gruppen mit verschiedenen Benennungen, Bekenntnissen usw. aufgelöst haben. Wo ist da die Einheit, von welcher in Johannes 17,21 die Rede ist, infolge derer die Welt glauben soll, daß der Vater den Sohn gesandt hat? Die Einheit, von welcher der Herr sagt: „gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir“?
Indem ich dies schreibe, denke ich keineswegs daran, die Schuld an diesem traurigen Zustand anderen zuzuschieben. Nein, wir haben gesündigt, wir alle, die wir zu der großen Schar der Erretteten, der mit Blut erkauften Familie Gottes gehören, die wir uns Brüder und Schwestern in Christo nennen, aber vielfach einander so fremd geworden sind, daß wir einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Schreiber und Leser dieser Zeilen, wir alle sind schuldig. Unser ist die Beschämung des Angesichts. Aber wo ist das Heilmittel? Es besteht nicht darin, daß wir das Übel verdecken, beschönigen, oder von Zeit zu Zeit für einige Tage so tun, als wären wir alle ein Herz und eine Seele, und sind es doch nicht; daß wir rufen: Friede, Friede! und da ist doch kein Friede. Nein, das Heilmittel liegt in einer persönlichen ernsten Beugung vor Gott und einer persönlichen aufrichtigen Umkehr zu dem, was wir aufgegeben und verloren haben. „Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße“ (Off 3,3)!
Seit Jahrzehnten haben viele Gläubige durch Gottes Gnade dies als einziges Heilmittel erkannt und, unter Aufgebung aller Parteiunterschiede und mit Abreißung der Zäune und trennenden Schranken, sich bemüht, nach Gottes Gedanken einfach als Brüder, als Kinder Gottes, als Glieder des Leibes Christi, ohne irgendwelche SonderBenennung, sich in dem Namen, der allein vor Gott Wert hat, in dem Namen Jesu, zu versammeln. Man hat sie deshalb viel angefeindet. Sie selbst haben auch durch Untreue, durch Mangel an Demut und Wachsamkeit, durch Eigenwille und Lieblosigkeit viel Anlaß zu berechtigtem Tadel gegeben. Gott hat sie infolge dieser ernsten Verfehlungen in den Staub geworfen. An manchen Orten sind gerade sie, die viel und mit Recht von der Einheit der Kinder Gottes gezeugt und dafür gelitten haben, geradezu zu einem Sprichwort geworden.
Alles das ist leider nur zu wahr. Aber was beweist es? Daß das, was sie bekannt und darzustellen gesucht haben, falsch ist? Nein, sondern daß sie das anvertraute Gut nicht treu verwaltet haben. Sie haben von neuem gezeigt, was in der Geschichte der Menschen sich schon so oft wiederholt hat, daß alles, was Gott dem Menschen anvertraut, von diesem veruntreut und verdorben wird. Aber Gott sei gepriesen! Seine Treue wankt nicht, und Seine Wahrheit verändert sich nicht. Mögen die von Ihm benutzten Gefäße und Werkzeuge auch wechseln Seine Gedanken und Ratschlüsse sind unveränderlich. Er kann einen Leuchter, einen Lichtträger, hinwegtun und einen anderen an dessen Stelle setzen, aber das Licht bleibt dasselbe.
Ein weiteres Bekenntnis, eine zusätzliche Körperschaft?
Wir haben vorhin gesagt, daß die Gläubigen, welche wünschen, in der angegebenen Weise zusammenzukommen und ein einheitliches Zeugnis von der kostbaren Wahrheit darzustellen, daß da ein Leib und ein Geist ist, keine SonderBenennung angenommen haben; und wir fragen: Sollen sie, können sie irgendeinen Namen, eine Benennung suchen, die sie von den anderen Gläubigen unterscheidet, die aus ihnen eine neue Gemeinschaft oder Genossenschaft macht? Würden sie damit nicht sofort das, was sie darstellen und bezeugen wollen, wieder umstoßen? Sie sind Kinder Gottes und deshalb Brüder, sie sind Glieder am Leibe Christi, durch einen Geist zu einem Leibe getauft; das Wort nennt sie Heilige und Geliebte. Ist das nicht genug? Sollen sie dem noch irgendeinen anderen Namen, ein anderes Bekenntnis hinzufügen?
Wozu gehören sie? Sie sind, wie bereits gesagt, Glieder am Leibe Christi, sie sind Christi Eigentum, sie gehören zu der Versammlung des lebendigen Gottes (l. Tim 3,15), sind lebendige Steine in dem geistlichen Hause, dem heiligen Tempel Gottes, sie sind heilige und königliche Priester (Eph 2 und 1. Pet 2), Anbeter Gottes in Geist und Wahrheit usw. Sind das denn nicht auch die übrigen Gläubigen, alle Kinder Gottes? Selbstverständlich! Oder sind jene es mehr oder in einem anderen Sinne als diese? Keineswegs! Haben sie irgendetwas voraus vor anderen Kindern Gottes? Nicht das Geringste! Was scheidet sie denn von diesen? Von ihrer Seite nichts; die Scheidungsgründe liegen auf der anderen Seite, in den vielen menschlichen Zutaten, Namen, Bekenntnissen, Statuten, Einrichtungen, die sie nicht als von Gott kommend anerkennen und deshalb auch nicht annehmen können.
Und wenn nun einer von ihnen gefragt wird: „Was bist du?“ was soll er dann antworten? Der Lutheraner sagt: „Ich bin Lutheraner“; der Methodist: „Ich bin Methodist“; der Baptist: Ich bin Baptist“; der Freigemeindler: „Ich gehöre zur freien Gemeinde“ usw. Wenn er antwortet: „Ich bin ein Christ“, so muß er sich sagen lassen: „Das sind wir alle; wir wollen wissen, wie du dich nennst, wozu du gehörst“. Antwortet er dann: „Ich gehöre zur Versammlung Gottes“, so ist es wieder nicht recht. Was soll er nun tun? Und wer trägt die Schuld an der Schwierigkeit? Warum ist der Name „Christ“ und die Zugehörigkeit zum „Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist“, nicht mehr genügend? Jene, welche die Fragen stellen, mögen die Antwort hierauf geben.
Zuweilen hat man auf die Frage: „Wozu gehörst du?“ einfach geantwortet: „Zur Versammlung“, und dadurch allerdings der Möglichkeit eines Mißverstandenwerdens den Weg bereitet, als wäre „Versammlung“ nur eine Bezeichnung mehr, um eine bestimmte Anzahl oder eine Genossenschaft von Christen von anderen Benennungen zu unterscheiden. In den meisten Fällen wird dieser Gedanke dem Auskunftgebenden aber ganz fremd gewesen sein; denn wenn jemand den Ausdruck so verstehen würde, als ob die Wenigen oder Vielen, mit denen er sich an seinem Wohnort versammelt, mit Ausschluß der übrigen Gläubigen an jenem Orte, die Versammlung bildeten, so würde er sehr verkehrt denken und reden. Möglich ist es ja, daß, aus Mangel an Verständnis, bei Einzelnen je einmal solche Gedanken gewesen sind, aber es wäre doch unrecht, die Fehler Einzelner der Gesamtheit zur Last zu legen.
Ach! wenn die Verwirrung nach außen und innen, in den Erscheinungen und in den Begriffen, nicht so groß wäre, so würde eine solche Frage überhaupt nicht gestellt werden und niemand in Gefahr kommen, eine unrichtige Antwort zu geben. Könnten wir uns wohl den Fall denken, daß der Herr Jesus die Frage: „Wozu gehörst du?“ an einen Gläubigen richten könnte? Wahrlich nicht, es sei denn, daß Er ihn von der Verkehrtheit seiner Zugehörigkeit zu irgendeiner von Menschen errichteten Körperschaft überzeugen wollte
Bouter Hugo, Die Heilung Naamans 2.Könige 5

1. Naamans Aussatz
2.Könige 5,1
In diesem Büchlein werden wir Naamans Aussatz und seine Heilung aus der neutestamentlichen Sicht betrachten. Seine Reinigung verschafft eine klare Illustration von der Reinigung eines Sünders von der Sünde. Nach dem ersten kurzen Vertrautwerden mit den Hauptpersonen dieses Kapitels, werden wir uns mit der Frage befassen, warum Aussatz ein Bild der Sünde ist.
Die Hauptpersonen
Nun, diese gut bekannte Geschichte ist ein Musterbeispiel für eine kraftvolle Erzählung. Eine Anzahl von Personen werden hier in eine Art und Weise geschildert, die schärfer und klarer ist, als in der faszinierendsten Novelle. Das ist nicht erstaunlich, da es ja das Wort Gottes ist, welches lebendig und kraftvoll ist. Zuerst wollen wir uns mit den Hauptpersonen beschäftigen:
(1) Naaman, Kommandeur der Syrischen Armee: Ein sehr geachteter und geliebter Mann, sowohl in den Augen seines Herrn als auch in den Augen seiner Diener (Verse 1 und 13). Aber er hatte ein unlösbares Problem: Er war ein Aussätziger.
(2) Ein junges Mädchen aus dem Lande Israel. Sie lebte im Exil in einem fremden Land, aber sie blieb dem Gott Israels treu. Sie hatte einen großen Glauben und sie liebte ihre Feinde (Vers 3). Dieses junge Mädchen bleibt anonym, ist aber aufgrund ihrer geistlichen Qualitäten sehr bemerkenswert.
(3) Der König Israels. Sein Name ist auch nicht erwähnt, aber wir nehmen an, es Joram war, der Sohn des bösen Ahab. Er war charakterisiert durch Unglaube, Verzweiflung und Misstrauen (Vers 7).
(4) Der Prophet Elisa, der Sprecher des lebendigen Gottes. Er ist die Hauptperson in diesem Kapitel. Er war bekannt für seine Einfachheit und Entschiedenheit sowohl gegenüber seinem irdischen Herrscher als auch gegenüber seinem eigenem Diener Gehasi.
(5) Gehasi, der Diener des Propheten. Er steht durch seine Gier, Unwissenheit und Weltlichkeit in scharfem Kontrast zu seinem Herrn. Die tiefsten Regungen seines Herzens lagen bloß, geradeso wie später ein Judas durch den HERRN selbst bloßgestellt wurde. Das Kapitel endet wie es beginnt: Mit einem Aussätzigen! Naamans Aussatz würde für immer an Gehasi und seinen Nachkommen haften (Vers 27).
Naaman, Kommandeur der Syrischen Armee
Naaman war ein sehr geachteter und bekannter Mann. Sein Name bedeutet „Annehmlichkeit“ oder „Lieblichkeit“. Die Achtung, die andere ihm gegenüber hatten, mag ihm durch seine hohe Persönlichkeit zugestanden haben. Sowohl sein Herr als auch sein Diener scheinen ehrlich mitfühlend gegen ihn gewesen zu sein (Verse 4-5 und 13). Wie dem auch sei (Vers 1) die Gunst die er hatte war verbunden mit seinen militärischen Erfolgen, „denn durch ihn hatte Jehova den Syrern Sieg gegeben“.
Dies ist eine sehr aufschlußreiche Aussage. Sie sagt, in Wirklichkeit regiert der Herr. Gott regiert nicht nur seine eigenes Volk, sondern auch die Nationen auf der Erde. Und das ist immer noch der Fall, obwohl Seine Regierung oft unerforschlich ist und seine Wege (XXX S.12). Dies ist die erste Lektion, die wir hier lernen. Gott ist nicht ein örtlicher Gott, ein Berggott oder ein Gott der Ebene oder von einem der Elemente. Das ist es zwar was die Heiden lehrten; das ist es auch was auch die Syrier lehrten (1.Könige 20, 23 ff). Aber das war ein Fehler. Gott ist der lebendige Gott, der Herr des Himmels und der Erde. ER hält die ganze Welt in Seinen Händen.
Zweitens, Er gebraucht die Nationen, wenn nötig, um sein eigenes Volk zu richten. Aram (Syrien) war solch eine disziplinarische Rute in den Tagen des bösen Ahab und seiner Nachfolger. Und Assyrien, die Weltmacht die sich dann erhob, würde das in einer größeren Ausdehnung sein (Jesaja 10, 5). Aram war von Norden her schon eine Bedrohung für Israel seit der Zeit Salomos (1.Könige 11, 25). Zwischen den zwei kleinen Staaten fanden nicht immer Kriege statt, zeitweise wollten sie Friedensverträge schließen (vergleiche den Bund zwischen Ahab und Ben-Hadad in 1.Könige 20, 34). Die Beziehungen zwischen Syrien und Israel in dieser Zeit scheinen mehr ein bewaffneter Friede zu sein. Dasselbe scheint hier der Fall zu sein, da der König von Israel in dem Brief des Königs von Syrien einen Anlaß für einen neuen Krieg sieht (Vers 7).
Gott gebraucht den nördlichen Feind als Rute Seines Zorns. Aram bedeutet „hoch“ oder „erhöht“. In Aram sehen wir ein Bild der Welt als stolzer Gegner von Gottes Volk, ein Feind, der von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt ist und der in einer selbstzufriedenen Art und Weise über seine eigenen Möglichkeiten spricht (vergleiche Naamans Einstellung in Vers 12). Wenn sich das Volk Gottes in einem schlechten Zustand befindet, muss es in seiner Konfrontation mit der Welt eine Niederlage hinnehmen. Und heute ist es noch genauso. Sind wir uns dessen bewusst?
Wir nehmen an, Naamans Sieg tatsächlich über Israel erreicht war, obwohl das nicht in vielen Worten gesagt wird. Es gibt eine interessante jüdische Überlieferung, in der es heißt, Naaman der Bogenschütze war, der König Ahab in der Schlacht bei Ramoth–Gilead verwundete (1.Könige 22, 34). Andere meinen, es ein Sieg von Aram über Assyrien war. Wie auch immer, das zweite Buch der Könige macht klar, Elisa eine wichtige Rolle im Krieg zwischen Aram und Israel spielt. Der Prophet erscheint sogar in Damaskus und war mit eingebunden in die Ernennung Hasaels zum König von Aram (2.Könige 8, 7 ff). All dies gehört zu Gottes Plan, Sein vom Wege abgekommenes Volk zu züchtigen und es zur Reue zu rufen.
Naaman, der Kommandeur der syrischen Armee, war deshalb ein großer Mann. Jeder war ihm gut gesonnen. Er war sogar ein Werkzeug in den Händen des Herrn. Wir würden sagen, er in allen Dingen erfolgreich war. Aber es war alles nur Schau. Es war nur die äußerliche Seite seines Lebens.
Sein Aussatz
Naaman hatte ein verborgenes Problem. Das schöne Portrait aus Vers 1 ist verdorben durch das ernste „aber“. Es ist in einer solch treffenden Art gesagt, „aber aussätzig“. Er hatte eine unheilbare Krankheit, und niemand konnte ihm helfen. Es ist möglich, die Krankheit noch im Anfangsstadium war, da Vers 11 von der befallenen „Stelle“ an seinem Körper spricht.
Aber die Krankheit würde sich heimtückisch ausbreiten und immer mehr Körperteile befallen. Das war eine schreckliche Aussicht. Was würde vor ihm liegen? Wie würde er mit diesem Problem weiterleben können?
Was meint die Bibel mit Aussatz? Es scheint, es eine umfassende Bezeichnung gewesen ist, welche auch auf Kleidung und Haus bezogen wurde (3.Mose 13-14). Einige sagen, er alle Arten von Ausschlag und Hautkrankheiten umfaßt. Aber das Gesetz selbst macht in bezug auf Aussatz schon einen Unterschied zwischen dem „Aussatz–Übel“ und dem „Ausschlag“ (3.Mose 13, 39). Wenn es Menschen betrifft, müssen wir speziell über Aussatz nachdenken, besonders in dem Fall von Naaman und Gehasi und in dem von Miriam (4.Mose 12). Wir sehen noch andere Beispiele in den Leben von Moses (2.Mose 4, 6), dem König Asarja oder Ussija (2.Könige 15, 5; 2.Chronika 26, 16 ff).
Wir wissen, Krankheit und Tod, Leid und Traurigkeit Folgen der Sünde sind (1. Mose 3, 16 ff). Die Beziehung zwischen Sünde und Krankheit ist jedoch eine sehr komplexe Sache. Aber Aussatz betreffend, kann man sagen, die Krankheit ein sehr treffendes Bild der Sünde und ihrer tödlichen, zerstörenden Folgen gibt.
Die folgenden Argumente können erwähnt werden, um dies zu unterstützen:
(1) Aussatz war eine ansteckende Krankheit, die sich fortlaufend heimtückisch ausbreitet und den ganzen Körper bedeckt. Wir wissen, nichts Gutes in unserem sündigen Fleisch wohnt (Römer 7, 18).
(2) Der Aussätzige wird betrachtet als ein Toter, der lebt. Aaron sprach über seine Schwester „als eine Tote, deren Fleisch halb verwest ist“ (4.Mose 12, 12). Als Sünder sind wir tot in unseren Vergehungen und Sünden, und dem Leben Gottes entfremdet (Epheser 2, 1; 4, 18). Nur Gott kann uns lebendig machen (2.Könige 5, 7).
(3) Der Aussätzige wurde als unrein angesehen. Er musste als ein Zeichen der Trauer seine Kleider zerreißen und rufen, „Unrein! Unrein!“ (3.Mose 13, 45). In derselben Art und Weise haftet die Unreinheit und Beschämung der Sünde von Natur aus an uns.
(4) Der Aussätzige bleibt wegen seiner Unreinheit außerhalb des Lagers, außerhalb des Platzes, wo ein heiliger Gott in der Mitte seines Volkes wohnt (3.Mose 13, 46; 4.Mose 5, 2; 12, 14; 2.Könige 7, 3; 2.Chronika 26, 21). Wir lebten einst ohne Gott in der Welt, entfremdet von Ihm.
(5) Der Aussätzige wurde nicht von einem Arzt geheilt, sondern in der Gegenwart eines Priesters gereinigt. Die zeremonielle Reinigung auf der Grundlage des vorgeschriebenen Opfers (unter anderen ein Schuld- und Sündopfer, um Sühnung für den geheilten Aussätzigen zu tun), deutet auf das Werk Christi hin. Nur Sein erlösendes Werk war in der Lage, die Befleckung der Sünde wegzunehmen. Ferner, als Menschen, die durch Seinen Tod gereinigt worden sind, wandeln wir in Neuheit des Lebens durch die Kraft Seiner Auferstehung. Die Salbung mit dem Heiligen Geist (das „Öl“) wird uns befähigen es zu tun.
Wenn wir auf den Aussatz Naamans schauen, sehen wir wirklich ein Bild von uns selbst. Wir können alle Arten von Begabung haben. Wir können erfolgreich sein. Die Menschen können uns schätzen. Jedoch, in jedermanns Leben gibt es ein ernstes „aber“, das Problem der Sünde. Die Krankheit der Sünde haftet an uns und ruiniert uns. Selbständig können wir das tödliche Problem, das unser Leben ruiniert nicht lösen. Aber was bei Menschen unmöglich, ist möglich bei Gott.
Fragen
1. In welchem der fünf Hauptpersonen dieser Geschichte erkennst Du etwas von Dir selbst?
2. Bist Du vielleicht so eine stolze weltliche Person wie Naaman?
3. Siehst Du ein, Du wegen Deiner Sünde unheilbar krank bist? Erkennst Du, Du schlecht und verloren bist und Du unfähig bist Dich selbst zu retten?
@2004 Ernst Paulus-Verlag
Bovet Theodor, Die Ehe Ein Handbuch für Eheleute

Unterwegs zur Liebe
Man hat immer wieder versucht, »echte« und »unechte« Liebe zu unterscheiden, und es war eine Zeitlang Mode, die unechte Liebe als »Eros« und die echte als ».Agape« zu bezeichnen. Heute halte ich aus verschiedenen Gründen diese Unterscheidung für unhaltbar. Wir wollen statt dessen untersuchen; wie Liebesgefühle eigentlich entstehen..
Die erste Beziehung eines jeden Menschen ist die zu seiner Mutter. Sie ist: noch keine personale Liebe, wie ich sie schilderte, aber sie gibt dem Kind das Erlebnis der Geborgenheit, der unbedingten Gegenwart des Andern seiner Zuneigung und Zärtlichkeit. Wo die Mutter (oder eine mutter-flehe Pflegerin) in den ersten Lebensjahren fehlt, entsteht eine schwere Schädigung, ein »Verlassenheitskomplex« und ein so geschadigter Mensch hat es im späteren Leben viel schwerer, Liebe zu geben und Liebe anzunehmen.
Später kommen noch andere Beziehungen hinzu, zum Vater; den Geschwistern, zu Kameraden, aus .denen allmählich das personhafte Dü-Erlebnis entsteht. Aber die Mutterbeziehung ist wohl die allerwichtigste und am wenigsten ersetzbare Wir haben Liebe nicht einfach »in uns«, wie unsere Triebe sie steht uns nicht zur Verfügung; wir können nur die Liebe .: weitergeben, die wir selber bekommen haben, allerdings in neuer und reiferer Weise Damit hängt eine merkwürdige Erscheinung zusammen.
Wenn ein Kind einem neuen Menschen begegnet, hat es .die Neigung, diesen mit einer bereits bekannten Person gleichzusetzen und ihm ähnliche Gefühle entgegenzubringen Die ältere Frau ist eine »Mutti« der altere Mann ein »Vati« (oder »Großvater«) gleichaltrige Kinder sind »Bruder« und »Schwestern«.Psychologisch sagt man: Das Kind projiziert das Bild eines ihm vertrauten Menschen auf den fremden, und es braucht einige Zeit, bis es erkennt, daß dieser eine Person für sich ist.
Nun kommen aber solche Identifikationen und Projektionen nicht nur bei Kindern vor, sondern wir neigen alle mehr oder weniger dazu, auf einen neuen Menschen unbewußt das Bild eines bekannten zu projizieren. Dieses Bild kann positiv oder negativ • sein, so daß wir einen Unbekannten auf den ersten Blick als »sehr sympathisch« oder »widerwärtig« empfinden können. Auch brauchen wir einige Zeit, um hinter dem projizierten, gewissermaßen von außen aufgeklebten. Bild das wahre, eigene Gesicht •dieses Menschen zu erkennen.. Vielleicht 'sind wir dann enttäuscht, vielleicht angenehm überrascht, auf jeden Fall aber der Wirklichkeit näher. '
Indessen projizieren wir nicht nur die Bilder uns vertrauter Menschen •aus unserm persönlichen Unbewußten, sondern auch :Urbilder, Archetypen, die sich in Zehntausenden von Jahren im sogenannten »kollektiven Unbewußten« (C. G. JUNG) gebildet haben und damit so etwas wie die kollektive Erfahrung der Menschheit seit frühester Zeit widerspiegeln. Sie können bisweilen mit verblüffender Ähnlichkeit in mythologischen Gestalten, in primitiven Malereien oder in den Träumen moderner Menschen wiedergefunden werden. Einer der wichtigsten Archetypen ist die sogenannte »Anima« beim Mann (»Animus« bei der Frau).: Meine Anima entspricht etwa der Frau, die ich hätte werden können, wenn ich eben kein Mann wäre; sie bezeidinet also meine ungeleb-. ten weiblichen Möglichkeiten und bildet damit weitgehend mein unbewußtes Ideal der Frau; Begegne ich nun einer Frau, auf die 'meine Anima mit mehr oder weniger Recht projiziert werden kann (natürlich unbewußt), dann habe ich das Gefühl: »Das ist sie, die lang Ersehnte, endlich habe ich sie gefunden!« Durch meine Projektion wird für mich natürlich das wirkliche Wesen dieser Frau zugedeckt, und wenn ich es mit der Zeit allmählich entdecke, bin ich zunächst auch enttäuscht. Sie ist nicht mehr meine Traumgeliebte, sondern »nur noch« die Anna Meier. Wiederum braucht es einige Zeit, bis ich merke, daß ich allein die wirkliche Anna Meier aus Fleisch
und Blut im eigentlichen Sinne lieben kann, während meine traumgeliebte Anima nur ein Aspekt von mir• selber ist,. ich also in mein eigenes (weibliches) Spiegelbild verliebt war. Ein anderer Archetyp ist der von Jung so benannte »Schatten«'. Er bezeichnet das genaue Gegenteil meines »Ideals«, also all das, was ich nicht sein will, was ich besonders . verabscheue. Nun besitzen wir in Wirklichkeit diese, negativ bewerteten Eigenschaften trotzdem - vielleicht sogar.. in, besonders starkem Grade -‚ nur haben wir sie ins Unbewußte verdrängt und glauben von ihnen .frei zu sein. Die Folge dieser Verdrängung ist indessen, daß wir diesen »Schatten« ‚auf andere Menschen projizieren, bald mit mehr, bald mit we-niger Grund, und ihm genau das' vorwerfen, was wir im Unbewußten selber (auch) sind Wenn wir also einen Menschen ganz besonders hassen oder verabscheuen, muß immer kritisch untersucht werden, ob er für uns nicht einfach ‚eine »Schattenprojektion« bedeutet., Haben wir diese einmal durchschaut, kann der Haß plötzlich verschwinden. Praktische Beispiele: Für den Kampfsportler, der seine Angst verdrängt, ist der Ausdruck »Feigling« das ärgste Schimpfwort. Für die Frau, die ihre an sich starke Sexualität verdrängt,' ist die »Hure« der Inbegriff alles Bösen.
Solche Projektionen spielen bei der Partnerwahl und zu Beginn der Ehe oft eine große Rolle, und es bedarf. einiger Mühe, um sie zu durchschauen. Wir werden, später darauf zurückkommen.
Was veranlaßt uns nun - abgesehen von den Projektionen, einen bestimmten Menschen zu lieben? Es können zunächst äußere Eigenschaften sein Schönheit, Kraft Fröhlichkeit, Intelligenz, Verständnis, Güte usw. Oder besondere Gelegenheiten, die uns einen anderen Menschen nahebringen: ein freudiger . Sieg ‚oder trauriger Anlaß, ein persönlicher Triumph, 'eine schöne Wanderung oder akute Lebensgefahr - das alles kann ein Liebesgefühl auslösen, das man zunächst noch als Verliebtheit bezeichnen, mag.
Solche Eigenschaften sind jedoch austauschbar: Ich kann, später einem andern Menschen begegnen, der noch schöner, intelligenter oder' gütiger ist, und das bei einer nöch eindrucksvolleren Gelegenheit Dann geht die Verliebtheit auf diesen üben Im günstigen Fall aber führen die als sympathisch empfundenen Eigenschaften weiter zur eigentlichen Person, und dann entsteht aus Verliebtheit Liebe. Der Freund erzählt von seinem Leben, von seinen äußeren und inneren Nöten, von seinen geheimsten Schwierigkeiten und Hoffnungen, und die Freundin hört zu, stundenlang; sie ermuntert ihn, weiter zu reden, zeigt Verständnis für das, was er selber nicht verstand, und hilft ihm, den »roten Faden« seines Lebens zu finden und weiterzuführen. Denn Liebe erkennt uns besser, als wir uns selber kannten, und zeigt uns den einzuschlagenden Weg sicherer, als wir es allein könnten DoSTOJEWSKiJ sagt: '>Einen Menschen lieben heißt, ihn sehen, wie ihn Gott gemeint hat.« Diese Liebe vergeht nie, sie gilt einem ganz bestimmten Menschen und kann durch keine andere verwischt werden. Erst wenn wir solche Liebe erleben? wagen wir, ganz zu uns selbst zu stehen. Jeder Mensch hält Ausschau nach einem Menschen, der ihm das Ja des Seindürfens zuspricht« (Martin BUBER). Liebe ist jedoch kein Zustand, der ein für allemal erreicht wäre; sie ist ein immerwährender Prozeß, eine ständige NeuwSdung der Liebenden und ihrer Beziehung, ein unaufhörlicher Kampf umeinander und die Neuentdeckung durch den Andern. Wenn wir einander in dieser Weise lieben, merken wir zuinnerst, daß wir nicht allein sind, daß ein Dritter mitten unter uns ist.
Anstatt eine »echte« von einer »unechten« Liebe zu unterscheiden, ist es richtiger; von »reifer« und »unreifer« Liebe zu reden. Liebe ist ein höchst dynamischer Ausdruck der Person, sie ist nie vollendet und bleibt wohl zeitlebens im Kampf mit unserem trägen Ich und seinem Machtanspruch. Aber auch kämpfende und unvollendete Liebe ist Liebe.
Projektionen und Verliebtheit sind meistens notwendig; um eine Beziehung anzuknüpfen; danach zeigt es sich, ob Liebe entstehen kann. WERNER HOFMANN sagt das sehr anschaulich: »Man muß verliebt sein, wenn man einen Menschen heiraten
will. Das ist gewissermaßen die Initialzündung, der Anlasser. Aber man kann nicht ständig mit dem Anlasser allein Auto fahren. Für eine Ehe braucht es neben der Verliebtheit die Liebe.« (»Ich, Du, wir«) Ja es braucht noch mehr als Liebe. In der Ehe erzeugt die Liebe nicht nur Nachkommen, sie macht auch aus Mann und Frau mehr und mehr ein neues Wesen, ohne ihre Persönlichkeiten auszulöschen. Im Gegenteil: Sie sind erst recht sich selbst und dabei dennoch eins mit dem Andern. In der Schöpfungsgeschichte wird das so ausgedrückt: »Mann und Frau werden ein Fleisch« (Gen 2, 24). Der Ausdruck »Fleisch« heißt hier so viel wie »Geschöpf«, »lebendige Ganzheit«. Modern können wir sagen »Person«. In der Ehe werden Mann und Frau eine neue Person, die ihre beiden Personen erst recht stark macht.
@1972 Katzmann Verlag
Böhm Heinz, Die Stunde der Abrechnung

Wohin mit der Schuld.?
Schräg sickerte das graue Licht des schwindenden Tages in das heimelige Dachzimmer, in dem Ralph Breuer grübelnd wach lag. Die erste Begegnung mit seinen Eltern war gut verlaufen. Selbst sein Vater hatte angesichts des fiebernden Patienten jegliche Grobheit unterlassen, und gerade diese Art Begegnung hatte in Ralph das Gewissen mächtig in Wallung gebracht'. Wenige Minuten war auch Reiner bei ihm gewesen. Zuerst hatten beide sehr wenig gesprochen, aber dann hatten sich ihre Zungen gelöst. »Ich war gemein zu euch, besonders zu Heiko. Dabei hat er mir nie einen Grund gegeben, ihn zu hassen.« Reiner hafte Ralphs kräftige Hand ergriffen.
Weißt du, manchmal erschrickt man selbst über die dunkle Landschaft im eigenen Herzen.« Ralph hafte nur genickt. »Ich habe oft versucht, meine bösen Gefühle Heiko gegenüber zu rechtfertigen, aber da war nichts. Meinst du, Reiner, daß auch alles gut werden kann - mit ihm?« - »So 'wie ich ihn in den wenigen Tagen kennengelernt habe, auf jeden Fall.«
Nach diesem zuversichtlichen Satz hafte Reiner dem anderen noch einmal freundlich zugelächelt und war leise aus dem Zimmer gegangen.
Nach dieser Begegnung mit Reiner konnte Ralph einfach nicht mehr, einschlafen. Die Schatten an den Wänden wurden immer länger und dunklen Durch das geöffnete Fenster drang das Pfeifen einer Singdrossel. Unten vom Balkon klang Tellergeklirr herauf. Ralph richtete sich ein wenig auf.
Jetzt sah er den grauen, unscheinbaren Sänger auf der Spitze einer Lärche sitzen. Von draußen dröhnte die liefe 'Stimme des Försters. Der Lauschende hörte Stühlerücken, dann wieder die Stimme des Hausherrn.
»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne alles, was du aus Gnaden beschert hast.«
Daß es so etwas heute noch gab? Tischgebet. Ralph spitzte die Ohren, um irgend etwas von der Unterhaltung mitzubekommen. Dominierend war die brummige Stimme des Försters. »Langsam kommen mir Bedenken, daß es sich bei unserem Widersacher um einen Geistesgestörten handelt. Mir scheint, daß da einer berechnend, gut durchdacht, all seine Gemeinheiten plant und ausführt. Ich werde die Wälder solange durchstreifen, bis ich ihn habe.«
»Und hast du keinen Verdacht, Obkel Robert?« fragte Reinen Ralph wäre am liebsten von seiner Liege heruntergekrochen und ans offene Fenster gehumpelt. Dr. Zähr aber hatte strengstens angeordnet, in den nächsten drei Tagen im Bett liegen zu bleiben.
»Ich wüßte nicht, Junge. Vor etwa vier Wochen habe ich einen Beerensammler ganz furchtbar zur Schnecke gemacht, weil er rücksichtslos ein eingegrenztes Gebiet überklettert hatte, aber das war doch nicht mehr als die Ordnung.«
Reiners Blicke huschten zu seiner Cousine hinüber. Sie hatte ihren Kopf gesenkt und stocherte offenbar unbeteiligt auf ihrem Salatteller herum.
»Onkel, ich sehe ein, daß wir dir helfen müssen. Wenn Ralph wieder gesund ist, werden wir gemeinsam dem Unheimlichen auf die Spur kommen, verlaß dich drauf.«
Der Lauschende in seinem Dachzimmer lächelte vor sich hin. Seltsam - jetzt freute er sich auf die Aussicht, in Reiner und Heiko neue Freunde zu bekommen.
Das wäre eine tolle Sache, diesem Lumpenkerl sein Handwerk zu vermasseln. Ralph rieb sich über seinen dicken Verband. Hoffentlich heilte die tiefe Schnittwunde bald zu. Unten auf dem Balkon klapperten wieder die Teller.
»Heute liest Silvia uns einen Abschnitt aus dem Andachtsbuch, dann werde ich unserem Patienten etwas raufbringen.«
»Vorausgeetzt, daß er wach ist«, warf die Försters-frau ein. »Er ist wach«, murmelte Ralph, »sogar hellwach.«
Laut und deutlich drang die Stimme des jungen Mädchens durch den Abend. »Da trat Petrus zu ihm und sprach, wie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal?«
Ralph setzte sich kerzengerade in seinem Bett auf. Ein kurioser Zufall. Als ob dieses Wort für ihn ausgesucht wäre. Irgendwie kannte er dieses Gleichnis von dem Knecht und dem König. Er lauschte gespannt bis zum Ende. »Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebet in eurem Herzen, ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler.«
Die Mädchenstimme brach ab und die des Försters setzte ein. »Nun wollen wir noch beten und uns der treuen Fürsorge Gottes für diese Nacht anbefehlen.« In freien Worten dankte der Förster Gott für alles Durch-tragen an diesem Tag, dankte dafür, daß dem Patienten nicht mehr passiert sei und befahl ihn im besonderen der Treue und Obhut Gottes an. Ralph wischte sich eine dicke Träne aus seinen Augen.
Solche Art Mitgefühl war ihm völlig .fremd. In seinem Elternhaus wurde nicht gebetet. Er konnte sich schwach erinnern, daß seine Oma immer ein ziemlich zerflattertes Buch gelesen hatte, aber seit ihrem Tode herrschte, wie sein Vater es einmal ausgedrückt hatte, aufgeklärte Nüchternheit. Ralphs Gedanken wurden durch .schwere Schritte draußen auf dem Gang unterbrochen. Ein leises Klopfen. »Ja, herein.«
Die Tür wurde aufgedrückt, und in der Öffnung stand die wuchtige Gestalt des Försters.
»Na, schläft mein Patient?«
Das Licht flammte auf.
»Seit dem. Besuch meiner Eltern bin ich wach, Herr Thielscher.«
»Dann kannst du ja was Anständiges essen.«
Ralph leckte sich über die Lippen. Schinken mit Spiegelei und eine riesige Schüssel. frischer Salat. Der Mann schob seinem Patienten den Stuhl nahe an das Bett heran und lud ihm eine ansehnliche Portion Schinken auf einen großen blaugemusterten Teller. »Läß es dir schmecken, Junge. Ach so.. Die Buttermilch habe ich noch vergessen. Du trinkst doch welche?«
»Und ob, Herr Thielscher.«
Verführerisch stieg der Duft des Gebratenen in Ralphs Nase.
Verlegen registrierte er das erwartungsvolle Gesicht seines freundlichen Gastgebers.
»Gebetet haben Sie ja schon. Ich hab' es gehört, auch das lange biblische Gleichnis«, fügte er leise hinzu.
»Ja, auf diese geistliche Nachspeise können und wollen wir nicht mehr verzichten.«
»Tun Sie das schon immer? In unserer Familie wird das Leben ohne Gebet nicht als ein Verzicht empfunden.«
Ralph fühlte fl die große Hand des Försters auf seinem Haar. »Du hast recht, es war nicht immer so. Mein Lebenswagen hatte auch ohne Gott gute Fahrt bekommen, und ich glaubte nie daran, daß gerade seine Hand die tolle Fahrt bremsen würde.«
Ralph kaute mit vollen Backen. »Ich hoi' nur die Buttermilch.«
Der Mann wandte sich um. Im Türrahmen stand Reiner mit einem bauchigen, buntbemalten Porzellankrug.
»Du hattest die Milch vergessen, Onkel Robert.« »Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Gerade wollte ich sie unserem Gast holen.«
Reiner kam einige Schritte näher. »Na, wie geht es dir, Ralph?«
»Blendend.«
»Übrigens, gerade hat ein gewisser Paulchen angerufen. Deine Eltern hatten ihn getroffen und ihm von deinem Mißgeschick erzählt.«
@1975 cLv
Bibra O S von, Heimbucher Kurt, Nürnberger Predigten
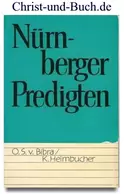
"Sehet, da ist euer Gott!"'
Es begab sich aber zu der Zeit ... Luk-, 2,1-14
Irgendwo ist Krieg. Die Furie des Krieges walzt über das Land. Menschen sind auf der Flucht. Ihre paar Habseligkeiten haben sie dabei. Unter den vielen Menschen ist eine schwangere Frau. Die Stunde der Geburt ihres Kindes kommt. Wo soll sie gebären? Man findet ein halbzerschossenes Haus. Dort hinein geht die Frau und bringt ihr Kind zur Welt. Um sie herum ist Elend, Not, Armut und Kälte.
Immer wieder werden auf dieser Welt Kinder in Elend und Not, in Hütten und Notquartieren geboren.
Ist das eine Wiederholung oder eine Zweitausgabe von Weihnachten?
Nein und tausendmal nein! Zu Weihnachten gehören Bethlehem und die Engel. Wir wüßten gar nicht, daß es Weihnachten geworden ist, wenn sie es uns nicht verkündigt hätten. Wer wäre denn schon auf den Gedanken gekommen, daß ein Kind, in einem Stall geboren, Gottes letztes und Gottes entscheidendes Wort an die Welt ist? Das kann sich kein Mensch ausdenken. Das muß uns gesagt werden.
Weihnachten ist nicht eine tragische menschliche Geschichte, die uns ans Herz geht. Es ist die Frage, ob sie uns ans Herz geht. Vielleicht sind wir seelisch schon viel zu abgehärtet von all den vielen Tragödien, die uns fast Tag für Tag begegnen.
Weihnachten ist der Einbruch der anderen Welt. Die Krippe, das Kreuz und das leere Grab sind Zeichen des Handelns Gottes zu unserem Hell. Weil Gott uns helfen will, darum ist es Weihnachten geworden.
Wir wollen an diesem Christfestmorgen drei Wahrheiten aus dem Bericht des Lukas uns sagen lassen.
1. Gott macht Geschichte.
„Es war einmal...", so beginnen alle Märchen. „Es begab sich aber zu der Zeit...", so beginnt der geschichtliche Bericht des Lukas. An Weihnachten geht es weder um fromme Märchen noch um religiöse Mythen. Mit Märchen und Mythen kann man sich vergnügen, aber man kann mit ihnen weder leben noch sterben.
Wir sind heute Menschen der Realitäten. Wir leben wirklichkeitsnah. Wir wollen handfeste Tatsachen.
Weihnachten ist der Einbruch Gottes in diese Welt - in ihren Raum, in ihre Zeit, in ihre Geschichte.
Auf diesem Planeten Erde hat Gott sich geoffenbart. In einer bestimmten geschichtlichen Stunde ist Er zu uns gekommen.
Die Namen des Kaisers Augustus und des Statthalters Cyre-nius, der Hinweis auf die Steuererhebung, die Volkszählung und auf Bethlehem stecken den geschichtlichen Raum und Rahmen ab, in dem sich das Handeln Gottes vollzieht.
Augustus, der gewaltige und große römische Kaiser, hätte es sich doch nie träumen lassen, daß er mit seinen Plänen der Vollstrecker der Pläne Gottes ist. Ist Augustus nicht der souveräne Herr? Gelten nicht seine Befehle im ganzen, großen Weltreich?. Aber am Schalthebel der Weltpolitik sitzt der lebendige Gott. Er macht Geschichte mit Präzision. Das wird an Weihnachten deutlich.
Wir wollen es uns an einer konkreten Stelle des Berichtes vergegenwärtigen.
Jahrhunderte vor der Geburt Jesu hat der Prophet Micha Bethlehem als den Geburtsort des kommenden Messias angekündigt. Maria ist von Gott bestimmt und erwählt als Mutter des Messias. Sie aber wohnt in Nazareth. Wie soll sie nach Bethlehem kommen? Da bringt Gott ein Weltreich in Bewegung. Maria ist mit Joseph verlobt. Joseph stammt aus dem Geschlecht Davids. Der Stammsitz des Davidgeschlechtes aber ist Bethlehem. Zur Volkszählung und Steuererhebung aber muß jeder zum Stammsitz seines Geschlechtes. Ein Weltreich kommt in Bewegung, damit Gottes Verheißung eingelöst wird. „Des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was Er zusagt, das hält Er gewiß." Gott macht Geschichte mit Präzision.
„Sehet, so ist euer Gott!"
2. Gott wird ein Kind.
Durch die Jahrhunderte war es die Sehnsucht Israels, des erwählten Gottesvolkes, daß Gott sich mächtig offenbaren möchte. Im Propheten Jesaja hören wir den Schrei der Sehnsucht: „Ach, daß Du den Himmel zerrissest und führest herab,
daß die Berge vor Dir zerfiössen ....daß Dein Name kund würde unter Deinen Feinden und die Heiden vor Dir zittern müßten durch die Wunder, die Du tust..." Dies ist der Wunsch der Frommen und die Herausforderung der Spötter: Gott soll sich zeigen. Er soll seine Macht offenbaren.
Gott aber kommt anders. Er wird ein Kind. Um dieses Kind her ist Elend und Armut. Dieses Kind wird armen Eltern anvertraut. Maria und Joseph sind einfache Leute. Draußen auf dem Feld hören Hirten, daß ein Kind in einem Stall geboren worden sei. Die Engel deuten auf dieses Kind und rufen:
„Sehet, da ist euer Gott!"
Es ist ein merkwürdiger Weg, den Gott einschlägt. Warum kommt Er so unscheinbar, so klein, so arm, so jämmerlich?
Gott wird wie wir, damit wir Vertrauen zu Ihm fassen. Paulus sagt im Brief ian die Philipper im Blick auf Christus: „ Er ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden..."
Was hülle uns ein Gott, der auf Distanz zu uns bliebe! Was nützte uns ein großer Weltgeist, der sich von uns verehren ließe' Was nützte uns ein Gott, der aus einer fernen, heilen Welt uns ein paar Lebensanweisungen gäbe!
Wir wären mißtrauisch gegenüber einem Gott, der sich zu gut wäre, daß er sich die Finger an dieser Welt schmutzig machte. Das Kind in der Krippe zeigt uns: Gott geht uns nach. Er ist nicht gegen, sondern für uns. Er will uns helfen.
Gott geht in die Tiefe, damit jeder Mensch sich von Ihm verstanden weiß.
Paul Gerhardt singt in einem Weihnachtslied:
„Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen, daß meines Heilandes Lager sei auf lieblichen Violen...'
Da kommt das Empfinden zum Durchbruch, daß Heu und Stroh, Stall und Krippe kein würdiger Platz sind für den HERRN der Herrlichkeit. Wenn Gott aber wird wie wir, dann wird Et. ein Mensch im Elend.
Was hülfe uns ein Gott, der in einem Palast geboren worden wäre! Was hülfe uns ein Gott der oberen Zehntausend! Wie könnte solch ein Gott uns verstehen?
Gott geht ganz in die Tiefe, damit jeder sich verstanden weiß. Gott liegt in einer Krippe, damit kein Mensch vor Seiner Türe stehenbleiben muß.
Wir kommen alle aus unserer Welt. Jeder von uns hat einen Weg hinter sich. Wir sind belastete Leute. Wir haben unsre Zweifel und Nöte. Wir tragen unsere Schuld und stehen in manchen Anfechtungen. Unser inneres Gewand gleicht wohl gar nicht dem Festtagsgewand, das wir anhaben.
Die Tür zum Stall ist offen. Keiner muß draußen bleiben. Gott wird ein Kind.
„Sehet, da ist euer Gott!" -
3. Das Kind ist der Heiland der Welt.
So sagt es der Bote aus der anderen Welt den Hirten. Die Hirten sagen es weiter. „Sie breiteten das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war." Durch die Jahrhunderte bis in diese Stunde herein geht das Zeugnis der Zeugen: Das Kind ist der Heiland.
Das Wort des Engels war damals eine ungeheure Provokation. Die Weihnachtsbotschaft ist es bis heute. War nicht damals Heiland und Retter der Welt der römische Kaiser? Verstand er sich nicht selber so und ließ er sich nicht so von seinen Untertanen feiern? Wurden nicht die Regierungserlasse der Cäsaren „Evangelium" genannt?
Augustus war einer der Großen der Weltgeschichte. Aber er war nicht Retter und Heiland der Welt. Seine Regierungserlasse sind kein Evangelium. Hier im Stall von Bethlehem kann man den Heiland sehen. Über dem Hirtenfeld kann man das eine Evangelium hören, das der Welt gegeben ist.
Augustus ist tot. Andere vermeintliche Retter haben die Welt in tiefe Abgründe gestürzt. Sie haben Verrat geübt an dem, was Menschsein heißt.
Wer ist der Retter?
In vielen Sprachen, weltweit, erklingt es heute von neuem: „Christus, der Retter ist da!"
Das Kind ist der Heiland. Dieses Kind im Stall wird zum Mann am Kreuz. Durch Ihn versöhnt Gptt die Welt. Krippe und Kreuz sind die Zeichen der Versöhnung. In diesem Kinde hellt Gott die Krankheit zum Tode. Dieses Kind holt uns aus Schuld und Tod. In diesem Kind greift Gott nach unsrem Leben.
„Seht, so liebt euch euer Gott!"
Dienet einander!
Dienst einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat! 1. Petr. 4,10a
„Das Ziel aller Dinge ist nahe!", so schreibt Petrus kurz vor unserer Stelle (V. 7). Das Ziel aber ist die Wiederkunft des HERRN in Herrlichkeit. Weil wir auf dieses Ziel zugehen, weil der Tag des HERRN nahe ist, deshalb gilt es, die Zeit auszukaufen, nämlich dazu, das Leben einzusetzen zum Dienst füreinander. „Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat!"
Was ist mit „Dienen" gemeint? Dienen heißt: jemanden anderes höher achten als sich selbst und sich darum ihm zur Verfügung stellen. So wollen wir mit Ehrfurcht zu unseren Mitmenschen aufblicken und ihnen zu helfen jederzeit bereit sein. Das Gegenteil von Dienen ist Herrschen, die anderen niederhalten. In den • Weltzuständen, so mannigfaltig sie sonst aussehen mögen, ist es doch durchweg so, daß der Stärkere den Schwächeren seinen Zwecken dienstbar macht, ihn gering achtet. Gleichviel, ob es sich um politische, wirtschaftliche, geistige, gesellschaftliche, sittliche oder religiöse Überlegenheit handelt: jede Übermacht wird dazu gebraucht, den anderen in eine abhängige Stellung zu bringen.
„So soll es bei euch nicht sein", sagt Jesus. Vielmehr soll sich jeder mit seiner Überlegenheit den anderen zur Verfügung stellen, um ihre Zwecke zu fördern; nicht sie niederhalten, sondern sie höher heben, nicht sie abhängig machen, sondern ihnen zur Freiheit verhelfen. Je mehr Gaben, Vorzüge, Besitz einer hat, um so mehr ist er gehalten, sich anderen zur Verfügung zu stellen, ihre Lasten zu tragen, sich den Geringen und Elenden zu verschreiben. Als großes und ermutigendes Vorbild steht hier der Herr Jesus vor uns, der von sich sagen konnte: „Ich bin unter euch wie ein Dienender" (Luk. 22,27) und:,, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und Sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele" (Matth. 20, 26). In diesem Sinne also: „Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat!"
Ein jeglicher! Keiner braucht sich zurückgesetzt oder benachteiligt zu fühlen, keiner muß denken, daß er keine Gaben hätte. je der hat etwas von Gott empfangen, jeder darf sich
INHALTSVERZEICHNIS
Luk. 2,1-14 „Sehet, da ist euer Gott!" (Zu Weihnachten)
1. Petr. 4,1Oa Dienet einander! (Zu Neujahr)
Ps. 33,4 Des HERRN Wort ist wahrhaftig! ....
Eph. 6,1-9 Autorität und Ordnung
Hebr. 3,1.6b-14 Heute .......
Joh. 12,20-26 Vom Weg Jesu und Seiner Nachfolger
Matth. 16,26 Mit Christus ins Leben (Zur Konfirmation)
Matth. 27,15-26 Jesus oder Barabbas? (Zum Karfreitag)
1. Kor. 15,50-58 Auferstehung in drei Etappen (Zu Ostern)
Luk. 11,5-13 Betet! ......
Matth. 28, 18-20 Werben für Jesus
Apg. 1, 8 Unser Zeugendienst
Apg. 2,1-13 Gott gibt der Welt Seinen Geist ....
2. Kor. 4,7-18 Von der Spannung eines Christenlebens
Luk. 9,57b - 62 Nachfolge ......
Mark. 4,26-29 Saat und Ernte . (Zum Erntedankfest)
Matth. 5,13-16 Die Aufgaben des Christen in der Welt .....
Josua 24,1.2a. 13-28 Moderner Götzendienst
Hebr. 13, 7-9 Gedenket an euere Lehrer! (Zum Reformationsfest)
Röm. 10, 1-4.12-17 Das Gebot der Stunde
Luk. 15,11-32 Ruf zur Heimkehr (Zum Buß- und Bettag)
Offb. 22, 12-1 „Siehe, Ich komme bald!"
Bibra Otto S von, Die Bevollmächtigten des Auferstandenen

EINLEITUNG
Am Abend nach dem Osterereignis trat der Auferstandene in den Kreis Seiner verängstigten Jünger mit den Worten: „Friede sei mit euch! Wie Mich der Vater gesandt hat, so sende auch Ich euch" (Joh 20,21). Damit wurde ihnen ein unvergleichlicher göttlicher Auftrag anvertraut, der fortan den Inhalt ihres Lebens ausmachen sollte und auch ihre ganze Freude wurde.
Dieser Auftrag galt aber nicht nur für damals, sondern steht noch heute in Kraft.
Und es gilt nicht nur für Apostel und Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer der Gemeinde, sondern für alle, die den Anruf ihres Erlösers jemals gehört und befolgt haben.
Dementsprechend gilt auch der Inhalt dieses Buches ihnen allen. Denn er bezieht sich auf eben diesen Auftrag und Dienst, wie er in unserer Zeit an unserer Generation auszurichten ist.
Den Ausgangspunkt sollen dabei weder unsere Traditionen noch persönliche Erfahrungen bilden, nicht die Kirchengeschichte noch die Psychologie und auch nicht eine bestimmte Frömmigkeitsform.
Ganz im Gegenteil: in bewußter Unabhängigkeit von all diesen sonst gebräuchlichen und herrschenden Maßstäben wollen wir offen und frei sein für eine Neuorientierung.
Da Gott uns Seinen eigenen Maßstab in die Hände gelegt hat - die Heilige Schrift -, haben wir ja die verheißungsvolle Möglichkeit, uns an dieser untrüglichen Norm auszurichten.
Und das wollen wir versuchen
1. Die Grundlage ihres Dienstes
Der Dienst am Wort muß eine doppelte Grundlage haben: die göttliche Berufung und die göttliche Bevollmächtigung.
1. Die göttliche Berufung
Wer den Dienst am Wort as Beruf ausüben will, sollte bedenken, daß es sich dabei um einen heiligen Dienst handelt, zu dem die Berufung dessen gehört, dem man dienen will. Denn Seine Botschafter zu berufen, hat sich der dreieinige Gott selbst vorbehalten. Wer ohne göttliche Berufung im Dienste Gottes steht, der sehe zu, daß ihn nicht die Anklage trifft: „Ich habe sie nicht gesandt, und doch sind sie so geschäftig! Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben und doch reden sie in Meinem Namen. Hätten sie wirklich in Meinem Rat gestanden, so würden sie Mein Volk. . . von seinem bösen Wandel und seinem gottlosen Tun zur Umkehr bringen" (Jer 23,21ff.). Wie stark betont doch Paulus seine göttliche Sendung, wenn er sich bezeichnet als „Apostel, nicht von Menschen (gesandt), auch nicht durch einen Menschen (eingesetzt), sondern unmittelbar durch Jesus Christus persönlich und damit durch Gott den Vater selbst" (Gal. 1,1). Wenn man auch kein Apostel ist, so sollte doch irgendwie jeder Diener am Wort in Bezug auf Grundlage und Motiv seiner Wirksamkeit solches von sich sagen können.'
Auch sonst kommt in den paulinischen Briefen die göttliche Autorität und Sendung aller wirklichen Jesuszeugen immer wieder zum Ausdruck, wenn er schreibt: „So treten wir nun als Botschafter für Christus auf, indem Gott selbst durch uns mahnt" (2 Kor 5,20 a) oder: „Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes ein unlauteres Gewerbe treiben (oder: es verwässern);2 nein, aus lauterem Herzen, nein, als aus Gott heraus (= als Gottes Beauftragte) vor Gottes Angesicht in Christus reden wir" (2 Kor 2,17). So unterscheidet sich der Dienst am Wort grundsätzlich von jedem anderen Beruf3. Um beispielsweise Richter oder Staatsanwalt zu werden, genügt es, Rechtswissenschaft zu studieren, seine beiden Examina abzulegen und sich dann nach der entsprechenden praktischen Vorbereitungszeit vom Staat anstellen zu lassen. Jurist, Techniker, Lehrer, Handwerker, Bauer kann man ohne weiteres werden kraft eigenen Entschlußes, - examinierter Theologe auch! Aber Diener am Wort im neutestamentlichen Sinn wird man nur durch göttliche Einsetzung;4 wo diese fehlt, läßt sie sich auch durch die Ordinatioii nicht ersetzen.5 Auf welche Weise der llErr4iieinzelner4 Fall Seinen Ruf ergehen läßt, kann angesichts 'der Mannigfaltigkeit Seiner Wege keinesfalls festgelegt werden. Auch auf die viel erörterte Frage, wie man seiner göttlichen Berufung gewiß wird, gibt es keine allgemein gültige Antwort. Es kommt nur darauf an, daß sie wirklich vorliegt, und das ist auf keinen Fall automatisch mit der kirchlichen Amtseinsetzung gegeben. Gott der HErr läßt sich nämlich von Menschen nicht vorschreiben, Wen Er in Seinen Weinberg beruft. Auch läßt Er sich weder durch Ordination noch durch Installation zwingen, Amtsträger als, Seine Diener dort zu bestätigen, wo Er sie nicht gesandt hat. Vielmehr bleibt Er so u v er ä n und beruft sich Seine Zeugen nach Seinem eigenen Ermessen, wo und wann Er will.6
Freilich, wo Gott berufen hat, gehört dann auch die durch die Gemeinde geschehende Bestätigung und Sendung dazu, die schon vielen in der Anfechtung ein großer Trost und Halt gewesen ist. Es ist aber klar, daß deren Voraussetzung nach dem Neuen Testa-ment7 nur die durch den Heiligen Geist erfolgte Berufung ist 8 (vgl. Apg 13,1-3; 20,28b!). Deren Echtheit zu prüfen ist allerdings der Gemeinde befohlen (vgl. Offb 2,2b!). So wird eine gewissenhafte Kirchenleitung darin eine ernste und verantwortungsvolle Aufgabe zu erblicken haben, die am besten schon während des Studiums der Bewerber zu beginnen hat und auf jeden Fall vor der Ordination zu lösen ist.
2. Die göttliche Bevollmächtigung
Nun sendet der HErr keinen Arbeiter in Seinen Weinberg, ohne ihm die nötige Dienstausrüstung mitzugeben. Worin besteht diese?
Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir ausgehen von jener Dienstausrüstung, die unser HErr Jesus für Sein messianisches Wirken auf Erden vom Vater mitbekommen hatt&: der Vollmacht des Heiligen Geistes, die Ihm auf Schritt und Tritt anzumerken war. Im einzelnen zeigte sich diese Vollmacht bei Ihm besonders in folgender Hinsicht:
a) Auf dem Gebiet der Verkündigung
Nach Abschluß der Bergrede lesen wir: „Tief betroffen waren die Volksscharen über Seine Lehre; denn Er lehrte sie als einer, der 1. Die Grundlage ihres Dienstes 14
Vollmacht hatte, und nicht wie ihre Schriftgelehrten" (Mt 7,28f.). So konnte Jesus von sich feststellen: „Die Worte, die Ich zu euch gesagt habe, sind Geist und sind Leben" (Job 6,63c), das bedeutet: sie stammen vom Heiligen Geist und bringen denen, die darauf hören, das ewige Leben!
b) Auf dem Gebiet der Sündenvergebung
Vor Feinden und Freunden hat Jesus aus Nazareth bewiesen, daß Er auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, das bedeutet: den Schuldiggewordenen und Verlorenen den Freispruch des lebendigen Gottes zu vermitteln, so daß sie aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen und unter die befreiende Herrschaft des Sohnes Gottes versetzt werden (Kol 1,13).
c) Auf dem Gebiet der Krankenheilung
Das hängt mit dem Umfang der Erlösung zusammen, die nicht nur die Seele, sondern auch den Leib betrifft. Der Gekreuzigte hat nämlich nicht nur unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz (1 Petr 2,24), sondern ebenso auch unsere Krankheiten auf sich genommen und an unserer Statt weggetragen (lies Mt 8, 16f. = Jes 53,4!). Denn nicht nur durch die Sünde legt der Feind uns in Ketten, sondern auch durch Krankheiten: sie • sind eine «Fessel", mit der Satan uns bindet und von der Jesus uns löst (Lk 13,16). Dazu hat Er den Starken gebunden und entwaffnet (Mt 12,29; Kol 2,15). Nun führt Er dessen Gefangene siegend heraus. Und eben deshalb finden wir in der Wirksamkeit des Messias immer beides nebeneinander: „Er proklamierte' die frohe Botschaft von der Königsherrschaft und heilte - nicht nur „allerlei Seuche" (Luther), sondern - jede Krankheit und jedes Gebrechen" (Mt 9,35).
d) Gegenüber den Dämonen
Sooft der HErr Jesus mit Besessenen zusammentraf, erwies ;ich Seine diesbezügliche Vollmacht. Deshalb erschraken auch die bösen Geister jedesmal so sehr, wenn sie Seiner ansichtig wurden, denn sie wußten genau, daß sie jetzt ihre Positionen räumen mußten. Was für eine zentrale Bedeutung die Ausübung der Vollmacht über die Finsternisiiiächte hatte, zeigt das Wort des EiErrn:„Wenn aber ich durch den Geist Gottes die Dämonen hinauswerfe, dann hat euch die Herrschaft Gottes jäh überrascht" Mt 12,28).
e) Für das Beten
Was für eine Vollmacht des Gebets der Sohn Gottes besaß, kann uns beispielhaft deutlich gemacht werden, wenn wir Ihn am 15 Die göttliche Bevollmächtigung
Grabe Seines Freundes Lazarus sehen. Während dessen Leiche noch (stinkend) im Grabe lag, konnte Jesus foJbi&ttmaßen$eten: „Vater, Ich danke Dir, daß Du Mich erhört hast!" (Job rl,41) Und wenige Minuten später kehrte der Verstorbene auf das'Wort des HErrn hin ins Leben zurück.
J) Für ein Leben der Aufopferung
Wenn es heißt, der Messias habe sich selbst durch den Geist als fehlerloses Opfer Gott dargebracht (Hebt 9,14), ist nicht nur an Seinen Tod, sondern an Sein ganzes Leben zu denken, das ja eine ständige Aufopferung gewesen ist. Daß dies aber auf Vollmacht beruhte, das sagt Er selbst mit, den Worten: „Niemand hat Mir Mein Leben entrissen, sondern Ich setze es von Mir aus ein. Vollmacht habe Ich, es einzusetzen, und Vollmacht habe Ich, es wieder zu empfangen" (Job 10,18).
g) Für ein Leben selbstloser Liebe
Daß das Leben unseres Meisters geprägt war von der Vollmacht der göttlichen Liebe, das hat Ihn am meisten unterschieden von allen anderen Menschen.
Und eben diese Seine eigene Vollmacht in der skizzierten siebenfachen Hinsicht hat der Auferstandene auf Seine Jünger und Seirdboten übertragen (vgl. Job 20,21-23; Mt 10,1!)." So sind diese nun nicht darauf angewiesen, in eigener Kraft zu wirken, sondern sie reden und handeln - sofern sie wirklich „Bevollmächtigte des Auferstandenen" sind - in der Kraft ihres Herrn und in der Vollmacht der göttlichen Liebe."
Schon hier erhebt sich für jeden einzelnen die existentielle Frage, ob er diese Vollmacht hat oder nicht. Grundlegend ist in diesem Zusammenhang das Wort des Auferstandenen:,, Und siehe, Ich sende das Verheißungsgut des Vaters auf euch; ihr aber, ihr sollt euch (erst einmal) in der Stadt hinsetzen, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe" (Lk 24,49). Was war vorausgegegangen? Mehr als zwei Jahre lang hatte der HErr Seine Jünger unterwiesen und auf ihren späteren Zeugendienst vorbereitet. Damit aber hatten sie die beste theologische Ausbildung empfangen, die es jemals gegeben hat. Trotzdem muß ihnen eröffnet werden, daß diese Vorbereitung noch nicht genügt, sie vielmehr noch eine Ausrüstung brauchen, die so unentbehrlich ist, daß sie keinen Schritt im Dienst wagen können, bevor sie diese empfangen haben: die Kraft aus der Höhe.`
Das aber heißt für uns: Wenn unser HErr nicht einmal den Männern, die Er selbst auserwählt und auf dieses Werk vorbereitet hatte, erlauben konnte, ihren Dienst zu beginnen, bis sie die dazu nötige Vollmacht von oben empfangen hatten, - wie können wir als gewöhnliche Sterbliche in diese Arbeit eintreten, ehe wir mit dem Heiligen Geist gesalbt (erfüllt, versiegelt), d. h. von Gott so bevollmächtigt sind, daß wir es wissen?
Diese Vollmacht des Heiligen Geistes ist es, mit der jeglicher Dienst am Wort steht und fällt.13
Anmerkungen zu 1.
Vgl. dazu, was Hans Asmussen im Anschluß an Gut 1.15f schreibt: „Frage dich an Hand der Schrift, ob es dir mit Gott so ging, daß er dich besonders stellte. Du bist zwar sicher kein Apostel. Aber ein entsprechendes geschieht jedem Christen. Frage dich, ob du von einer Berufung weißt, die nicht im Normalverlauf deines Lebens liegt. Frage dich, ob der Sohn Gottes auch in dir enthüllt sei.-. Bist du Prediger des Evangeliums, dann frage dich, ob im Verfolge derartiger Ereignisse deine Predigt geschehe. Geschieht sie nur und wesentlich im Verfolge deiner natürlichen Lebensgeschichte, dann kannst du gar nicht Evangelium predigen, du seiest lutherisch oder reformiert, Pietist oder Rationalist, Liberaler oder Dialektiker. Darm bist du in jedem Fall ein Lehrer des Gesetzes, aber nicht mehr..." (Theologisch-kirchliche Erwägungen zum Galaterbrief, Zweite Auflage, München 1935. S.56f.)
2 Vgl. Werner de Boo r in der Wuppertaler Studienbibel (W. Stb.) z. St.: „Paulus grenzt sich gegen eine Art der Verkündigung ab, die er als eine wachsende Gefahr durch die ganze Kirche gehen sieht. Es handelt sich nicht nur um einzelne Fälle, sondern es sind ‚die vielen', die die Verkündigung gründlich entstellen. Wodurch tun sie es? Indem sie ‚mit dem Wort Gottes Handel treiben'.Das hier verwendete Wort meint speziell den unredlichen Handel damaliger Schankwirte, die den Gästen minderwertige Speisen vorsetzten und den Wein panschten, um zu Geld zu kommen. Es liegt also auch der Vorwurf der Entstellung und ‚Verwässerung' der Botschaft in dem Wort. In 4,2 wird Paulus darum direkt von dem ‚Verfälschen des Wortes' sprechen. Wie kann es bei den vielen zu einem solchen Verhalten kommen? Paulus hat in Phil 3,17-19 in schärfster Weise die inneren Beweggründe solcher Männer enthüllt... Was aber ist von Männern zu halten, die mit dem Wort Gottes Handel treiben und ihre Hörer um das ewige Leben betrügen! Kein Wunder, daß Paulus sie in 11,13-15 als Diener Satans bezeichnet." (2. Korintherbrief, Wuppertal 1972, S. 64.0
„Ein Diener Christi, ein Träger des Reiches Gottes kann man nicht werden, weil man in sich einen Trieb dazu fühlt oder sich dazu entschlossen hat, ebensowenig wie man heute Professor an einer Universität werden kann, weil man sich dazu gedrungen fühlt; es gehört ein Ruf dazu. Unter Berufung wird überall im NT. verstanden nicht etwas, was man sich vorstellt, sondern etwas, was man v er - nimmt; nicht etwas, was man aus sich heraussetzt, sondern was an einen herantritt; nicht etwas Abstraktes, sondern etwas Konkretes, nicht ein Gedankending, sondern ein Ereignis." (Ralf Luther, Neutestamentllches Wörterbuch. Berlin 1932; 18., neubearbeitete und gekürzte Auflage, Hamburg 1976; zitiert nach der 11. Aufl. 1937, Stichwort „Beruf, Berufung". - Sperrungen meist von mir. Der Verf.)
Vgl. auch, was Edmund Schlink zu Job. 20,21 schreibt: „Das Wort des Auferstandenen »Gleichwie Mich der Vater gesandt hat, so sende Ich euch« macht sündige Menschen zu „Botschaftern an Christi Statt« ... Sündige Menschen werden zu ... Boten Gottes ... Das kann kein Mensch fassen ... Dazu kann niemand sich selbst erklären, ohne in umso größere Gotteslästerungen zu verfallen. Dazu kann nur Gott selbst den Menschen machen ...(Der Auferstandene spricht. Eine Auslegung ausgewählter Worte des auferstandenen Christus. Berlin 1939, S.
38.) So schrieb auch der spätere Bischof D. G. Jacob i in seinem „Tagebuch
eines Großstadtpfarrers" (Berlin 1929), S. 39: „Es sollte eigentlich so sein, daß nur der predigen darf, den Gott beruft. Daß man aber predigen darf, weil man - vor dem Staate ein Abiturientenexamen und vor dem Konsistorium zwei Examina abgelegt hat, die genau so verlaufen, wie jedes zahnärztliche und Brückenbauer-examen, das ist doch zu weit ab von dem, wie es sein soll, ist doch zu anders, als es der Sache nach sein darf." - Watchman Nee sieht eben hierin den kirchlichen Notstand der Gegenwart begründet, wenn er sagt: »Die Tragödie in der christlichen Arbeit heute liegt darin, daß so viele Mitarbeiter einfach losgegangen sind, ohne daß sie gesandt waren... Wenn kein Ruf von Gott da ist und das angefangene Werk somit nicht göttlichen Ursprungs ist, hat es auch keinen geistlichen Wert. Arbeit für Gott muß göttlich begonnen werden.« (Das normale Gemeindeleben, Hannover 1966, S. 32f.) - Und C. H. Spurgeon sagte im Kolleg zu seinen Hörern:,, »Werde nicht Pastor, wenn es dir möglich ist, etwas anderes zu werden« war der weise Rat, den ein Theologe einem Fragenden gab. Wenn einer von unseren Studenten hier in diesem Saal auch als Zeitungsschreiber oder Kaufmann oder Landwirt oder Doktor oder Jurist glücklich sein könnte, so soll er doch um Himmels willen seiner Wege gehen ...(Ratschläge für Prediger. 21 Vorlesungen. Wuppertal 1962, S. 22).
„Früher, in der Zeit des Paulus, hieß es; Einen Dienst bekommt, wer eine Gnadengabe, ein Charisma des Heiligen Geistes empfangen hat, das der Geist gibt, welchem Er will. Jetzt heißt es: Der Geistempfang, der für ein bestimmtes Amt qualifiziert, ist gebunden an die Handauflegung. . . Es ist nur noch ein kleiner Schritt bis zu dem Satz Cypriaos: Wer das Amt hat, bekommt den dazu erforderlichen Geist. Das Amt aber bekommt man durch die Ordination mit Handauflegung. Über den Geist verfügt man dadurch, daß man die Hand auflegt...- Man verfügt jetzt - mindestens praktisch, wenn auch nicht theoretisch - über den Heiligen Geist; man stattet den, dem man das Amt überträgt, durch die Ordination mit dem Heiligen Geist aus" (Emil Brunner, Das Mißverständnis der Kirche, Zürich 195 1,, S. 92 f.) - Durch dieses Zitat soll die in der Vollmacht des Heiligen Geistes vollzogene Handauflegung gewiß nicht abgewertet werden, spielt sie doch im N.T. eine gewichtige Rolle: Die Warnung gilt nur einem kurzschlüssigen Automatismus auf diesem Gebiet. - Prälat Th. 5 ehren k weist mit Rechtdarauf hin, daß es einen Unterschiedbedeut, ob man nur von seiner Kirche aus „rite vocatus" im amtlichen Sinne oder von Gott aus „kletos"
1. Die Grundlage ihres Dienstes 18 19 Anmerkungen zu L
im neutestamtlichen Sinne sei. (Im Gedächtnisheft für Adolf Schlatter, Stuttgart 1938,S. 44.) - Vgl. auch Martin Luther zu Röm. 1,1 Berufener Apostel": Apostel sind „Knechte, d.h. Diener, solche, die ein Werk des HErrn über andere und an anderen auszurichten haben anstatt des HErrn selbst als Seine Stellvertreter. Er trifft mit diesem Wort... erstens die Lügenapostel, die damals überall haufenweise zu finden waren, die der Teufel wie Unkraut dazwischen säte (Mt 13,25) und von Mitternacht her wie den siedenden Topf des Jeremia hat herwehen lassen, Jer 1, 13. Andere sind wiederum die, welche mit ehrsüchtigen Hintergedanken eindringen. Sie mögen vielleicht keine Lügenapostel und Lügenknechte sein, weil sie lehren, was rechtschaffen und wahr ist, und weil sie in gut katholischem Sinne anderen vorstehen. Trotzdem werden sie, weil sie nicht zu diesem Amt berufen sind, durch dieses Wort »Berufene« für schuldig erklärt. Gewiß, sie sind nicht Diebe und Räuber (Job 10,1) wie die ersten, aber doch sind sie Mietlin ge, die ihren eigenen Vorteil im Auge haben und nicht die Sache Jesu Christi. Wenn es sich nun also bei den heiligen Ämtern um etwas so Erhabenes handelt, so muß man sich davor mehr als vor allen anderen Gefahren dieser und der zukünftigen Welt hüten, ja dies ausschließlich und allein als die allergrößte Gefahr ansehen: ein Amt anzutreten ohne göttliche Berufung." (Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Übertragen von Eduard Ellwein, München 1927. S. 811.).
6 Karl Barth bezeichnet die wirliche Verkündigung als „menschliche Rede von Gott auf Grund der alle menschliche Veranlassung grundsätzlich transzendierenden und also menschlich nicht zu begründenden, sondern nur faktisch sich ereignenden und anzuerkennenden Anweisu ngGottes selber." (Kirchliche Dogmatik, 1. Band, 1. Halbband. München 1932. S. 92.)— Vgl. auch Hans Dannenbaum, der die gleiche Tatsache mit folgenden Worten hinweist: „Das Ministerium des Wortes ist schlechterdings jeglichem Zugriff von Menschen entzogen und in allen Zeiten und unter allen Umständen nur von dem lebendigen Gott selber bestimmt und besetzt worden." (Sieghaftes Christentum. Berlin 1938. S. 184.)
Welche Gefahr die überlieferten menschlichen Gesichtspunkte in der Auswahl der zukünftigen Pastoren für die Kirche bedeuten, deutet auch Bischof D. Dr. Dibelius an, wenn er schreibt: „Strenge Auslese am Anfang—das ist es, was nottut, um die Kirche vor Amtsträgern zu bewahren, die für die Gemeinde eine Last sind und kein Segen." - Diese schwierige Aufgabe wird heute von verschiedenen Kirchenleitungen durchaus ernstgenommen, z.B. durch Beratungsgespräche mit Abiturienten, durch Prüfung der Studiumsmotivation bei der Aufnahme in die Liste der „Anwärter für das geistliche Amt", durch Begleitung der Studierenden seitens der Gemeindepastoren oder Superintendenten und auf Freizeiten für Theologiestudenten, sowie vor allem im Zusammenhang mit der Ordination durch eine einzureichende ausführliche persönliche Stellungnahme zu Schrift und Bekenntnis, ein mehrstündiges Ordinationsgespräch mit dem zuständigen Prälaten (bzw. Propst, Kreisdekan oder Landessuperintendenten) und dessen Gutachten für die Beschluß-fassung über die Ordination durch die Kirchenleitung.
Vgl. auch Heinrich Vogel, „Wer regiert die Kirche?" in: Theologische Existenz heute, Heft 15, S. 12: „Es ist von entscheidender Bedeutung, daß die Beziehung von Auftrag und Dienst, von Mandat und Amt klar und sicher gestellt wird gegen jedes den Glaubensgehorsam unter den Gnadenbefehl verfälschende Mißverständnis. Diesem Glaubensgehorsam unter die Alleinherrschaft Jesu Christi kann sich aber das Amt auf zweierlei Weise zu entwinden versuchen: einmal indem es vergißt, woher es seinen Auftrag und seine Vollmacht hat, welchem Herrn es steht und fällt, sodann aber auch, indem es meint, dieses Mandat als einen verfügbaren Besitz, gleichsam ein vererbtes Kapital überkommen zu haben."
° Das hier gebrauchte „käryssein" heißt eigentlich: herolden, als Herold ausrufen, eine Botschaft überbringen. Luther hat es mit „predigen" übersetzt. Dies Wort ist aber heute so abgegriffen, nichtssagend und mißverstäpdlich, daß es als Übersetzung von käryssein nicht mehr brauchbar ist und deshalb vermieden werden sollte. Mit Recht sagt Ralf Luther in seinem „Neutestamentlichen Wörterbuch" dazu: „Der Ausdruck: predigen, wie wir ihn gebrauchen, ist hier irreführend. Wir verstehen unter einer Predigt einen Lehrvortrag, eine Kunstrede. Das NT aber meint hier einen Heroldsruf, das Ausrufen einer Botschaft, die Bekanntgabe einer göttlichen Tat, die Nachricht von einem unmittelbar bevorstehenden Eingreifen des Allmächtigen... Ein Herold der kommenden Gottesherrschaft sein, kann nur, wer besonders dazu beauftragt (gesandt) ist (Röm 10,15)." (Unter dem Stichwort „predigen", zitiert nach der 11. Aufl.) - Vgl. dazu auch, was Werner de Boot zu Röm 10,8 b schreibt: „Wo wir gewohnt sind, in unserer Lutherbibel »predigen« zu lesen, verwendet Paulus wie hier den Ausdruck »herolden«. Es ist wichtig, daß auch wir uns zu diesem Ausdruck zurückfinden. Allzusehr ist uns die ‚>Predigt« zu einer Entwicklung der - eigenen Gedanken und Ansichten des jeweiligen Predigers geworden, zu sehr eine »erbauliche« Sache. Der „Herold« ist der öffentliche Ausrufer bestimmter kaiserlicher Willenserklärungen. Seine persönliche Meinung ist dabei völlig unwichtig. Er tritt mit seiner Person ganz hinter dem zurück, was er in dem Auftrag und in der Vollmacht seines kaiserlichen Herrn zu sagen hat." (W. Stb., Römerbrief, Wuppertal 1962, S. 247.)
lt Vgl. auch Julius Schniewind z.St.: „Jesu Jünger setzen sein Werk fort. Vom Auftrag, der Jünger wird fast mit den gleichen Worten gesprochen, wie 9,35 von den Heilungen Jesu. Sie haben die Vollmacht wie Jesus selbst; dies höchste Wort kehrt hier wieder." (Das Evangelium nach Matthäus. Göttingen 1937. 5.123.)
11 „Das Wort Gottes ist in der Ekldesia vorhanden und wirksam als Wort des Heiligen Geistes, darum in einer Einheit von Logos und Dynamis, die jenseits alles Verstehens liegt. Diese Einheit ist das später nicht mehr vorhandene und nicht mehr verstandene Geheimnis der Urgemeinde. Es ist zugleich das Geheimnis ihrer Gemeinschaft und ihrer sittlichen Kraft; denn auf dem Heiligen Geist beruht die kolnonta, das miteinander Verbundensein, und zwar ihre organische, organismusähnliche Verbundenheit, die die Gleichheit und Verschiedenheit, oder die Gleichrangigkeit aller und gegenseitige Unterordnung in sich schließt. Das entscheidende Merkmal und zugleich das eigentliche Wesen dieser Verbundenheit ist die Agape, die das neue Ethos dieser Gemeinschaft und ihrer Glieder ist. Es ist verständlich, daß eine spätere Zeit, in der diese ursprüngliche Kraft und Einheit nicht mehr in derselben Fülle vorhanden war, das Fehlende zu ersetzen und das Entschwindende zu sichern suchte. Diese Sicherung und dieser Ersatz erfolgt in drei verschiedenen Richtungen: Das Wort Gottes wird gesichert - und zugleich ersetzt - durch Theologie und Dogma; die Gemeinschaft wird gesichert - und zugleich ersetzt durch die Institution; der Glaube, der in der Liebe wirksam sich erweist, wird gesichert - und zugleich ersetzt - durch das Glaubens- und Moralgeset?'. (Emil Brunner, Das Mißverständnis der Kirche, S.601.)
12 Sup. v. Sauberzweig berichtet aber eine Konferenz des Pastoren-Gebetsbundes im Jahre 1918: Damals habe der alte Pastor Krawielitzki einen Vortrag über das Thema „Ausbildung und Ausrüstung" gehalten, wobei er nicht milde geworden sei, zu betonen, „daß noch viel nötiger als die beste Ausbildung die Ausrüstung mit dem Heiligen Geiste sei... Krawielitzki hatte diesen Vortrag kurz vorher vor Schwestern des von ihm geleiteten Diakonissenmutterhauses gehalten, ein Zeichen, daß er die Ausrüstung als ein Erfordernis nicht nur für Pastoren, sondern für jeden Reichgottesarbeiter ansah. Darin hatte er ohne Zweifel recht. Ebenso sicher aber steht auch fest, daß niemand so elend daran ist wie ein Prediger des Evangeliums, wenn ihm diese Ausrüstung fehlt... - Liegt hier nicht vielleicht der Grund für die Unfruchtbarkeit vieler Prediger? Es sind Männer, die die besten Zeugnisse von ihrer Ausbildungsstätte haben... Es fällt ihnen nicht schwer, eine homiletisch einwandfreie Predigt auszuarbeiten... Und doch: es fehlt etwas, es fehlt das Beste. Es ist wie ein Licht, das nicht leuchtet, wie ein Ofen, der keine Wärme spendet... Es fehlt das Feuer von oben, das Feuer des Heiligen Geistes. Und wo das beim Prediger fehlt, da kann auch im Herzen des Hörers keine Flamme des Glaubens entstehen." (Hans v. Sauberzweig, Wünsche eines Pastoren für sich selbst und seine Brüder. Berlin 1952. S. 9f.)
3 Hierin also liegt das erste Kriterium zur Unterscheidung der echten Hirten von den Mietlingen. Echte Hirten oder „Priester sind solche Menschen, die von Gott berufen und darum auch mit heiligem Geist erfüllt sind, die unter Befehl stehen uad dumm mit Vollmacht handeln und zeugen'. Mietlinge „sind solche Leute, die aus eigenem Ermessen und nach eigener Wahl sich das Amt anmaßen..." (Dannenbaum, a.a.O., S. 101.)— „Ist es nicht symptomatisch,.. für viele alte und viele mittelalterliche und auch für viele junge Pfarrer, daß sie in den Pfarrberuf hineinrutschen wie in jeden weltlichen Beruf?' (Jacobi, a. a. 0., S. 17617;) - Über die heutigen ernsthaften Bemühungen, dies zu verhindern, vgl. Anm. 7.
II. Die inneren Voraussetzungen ihres Dienstes
1. Die Ausschaltung des Ich.
Durch den Gist der Wahrheit von der uneingeschränkten Verdorbenheit ihres Wesens überführt (Röm. 7,18), haben sie ihr Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt (Gal 5,24) und damit ihr Ich-Leben, d. h. ihre Selbstsucht in den Tod gegeben. Seitdem wollen sie ihr Ich nicht mehr lieben, sondern wahrhaft hassen (Offb 12,11 c; Lk 14,26b). In diesem Sinne kann Paulus von sich sagen: „Es lebt aber nun nicht mehr mein Ich, sondern es lebt in mir (nur noch) Christus. Was ich aber jetzt noch im Fleisch lebe, - im Glauben lebe ich's, (und zwar) in dem des Sohnes Gottes, der mich in Seine Liebe aufgenommen und sich selbst für mich dahingegeben hat" (Gal 2,20). Während Viele Hirten sich selber weiden! und bei ihrer Arbeit letztlich doch das Ihrige suchen (Hes 34,2; Phil 2,21), sind diejenigen, die Gott als Hirten nach Seinem Herzen bezeichnet (Jer 3,15), frei von sich selber geworden.' Voraussetzung hierfür ist aber, daß sie auf Grund des Mitbegraben-Seins (Röm 5,4-6) die Befreiung von den Fesseln der Sünde erfahren haben (Röm 6,18.22; 8,2) und dadurch in der Lage sind, ihren Leib mit seinen Gliedern als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer für den Dienst zur Verfügung zu stellen (Röm 6,13.19; 12,1; 2 Kor 5,15). So haben sie ihr Leben dem HErrn als Ganzopfer auf den Altar gelegt (Lk 9,24b; 14, 33) und wiederholen diese Hingabe tägl ich von neu em. Sie scheuen sich
daher auch nicht, in letzter radikaler Offenheit jede erkannte Sünde ans Licht zu bringen: Sie suchen deshalb und um der Fruchtbarkeit
ihres Dienstes willen auch jederzeit die brüderliche Gemeinschaft
zu Seelsorge, Austausch und gemeinsamem Gebet.2 Denn nur, wer sich selber seelsorglich dienen läßt, kann anderen ein wirklicher
Seelsorger werden.' Und nur wer auf dem Altar durch Gottes Feuer glühend im Geist (Röm 12,11b) geworden ist, kann andere ent-zünden.4
2. Das innere Muß.
Wieviele gibt es, die ihren Pastorenberuf freudlos und nur mechanisch ausüben!5 Ihre Amtsverpflichtungen sind ihnen eine Last, die sie nur deswegen tragen, weil es verlangt wird.6 So stehen
Kennzeichen echter Diener am Wort nach dem Neuen Testament in 5facher Beziehung
1. GRUNDLAGE IHRES DIENSTES
2. INNERE VORAUSSETZUNGEN IHRES DIENSTES
- Ausschaltung des Ich
- das innere Muss
- keine Menschengefälligkeit
- alleinige Abhängigkeit vom Herrn
- Mitbeteiligung der Gemeinde
- bleibendes Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit
3. INHALT IHRES DIENSTES
- der Dienst im Heiligtum
- der Dienst in der Öffentlichkeit
- Zeugnis des Wortes, Wandels, Wunders
4. ZWECK IHRES DIENSTES
- schlafende Sünder aufwecken
- aus dem Tod ins Leben führen
- Wiedergeborene in der Heiligung bestärken
5. AUSWIRKUNG IHRES DIENSTES
- Kraftwirkung Gottes durch den Heiligen Geist
- gegenwärtiger Christus redet durch Beauftragte
- Gewissen der Zuhörer im Tiefsten treffen
- es scheiden sich die Geister
SEELSORGERLICHES SCHLUSSWORT
Bonhoeffer Dietrich, Der Traum vom schönen frommen Tod 1914-1918, Renate Wind
Am 1. August 1914 wird in Deutschland die Generalmobilmachung erklärt. Auf den Straßen herrscht Volksfeststimmung. Die Bonhoeffer-Kinder werden davon angesteckt. Dietrichs älteste Schwester Ursula stürmt von der Straße ins Haus, ruft: »Hurra, es gibt Krieg!« - und bekommt eine Ohrfeige. Krieg ist eine ernste Sache.
Die deutsche Bildungsellte will den Krieg nicht, aber sie glaubt, daß er unvermeidlich sei. Nach der offiziellen Version ist der Angriff die beste Verteidigung gegen die Einkreisung der »Achsenmächte«, die dem erstarkten deutschen Konkurrenten den »Platz an der Sonne« verwehren und den Krieg auf zwingen wollen.
Keiner will das Vaterland in dieser Situation im Stich lassen. Selbst die Sozialdemokraten wollen nicht als »vaterlandslose Gesellen« da stehen. Sie bewilligen am 4. August gegen die Stimmen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht der Regierung die Kriegskredite. Der Kaiser verkündet: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!«, Pfarrer beider Kirchen predigen: »Gott mit uns!«, Soldaten schreiben an ihre Frontzüge: »Jeder Schuß ein Russ',jeder Stoß ein Franzos'« und winken dazu, als ginge es zum Schützenfest.
Von dieser Art Kriegsbegeisterung sind die Bon-hoeffers weit entfernt. Aber sie sind von der Jtechtmä-ßigkeit der deutschen Kriegsziele überzeugt und tun ihre »vaterländische Pflicht«. Kriegsanleihen werden gezeichnet, und Karl Bonhoeffer unterschreibt, wie Tausende anderer Universitätsprofessoren, eine Erklärung: »Es erfüllt uns mit Entrüstung, daß die Feinde Deutschlands einen Gegensatz machen wollen zwischen dem Geiste der deutschen Wissenschaft und dem, was sie preußischen Militarismus nennen. In dem deutschen Heere ist kein anderer Geist als in dem deutschen Volke.
Der Dienst im Heer macht unsere Jugend tüchtig für alle Werke des Friedens, denn er erzieht sie zu selbstentsagender Pflichttreue und verleiht ihr das Selbstbewußtsein und Ehrgefühl des wahrhaft freien Mannes, der sich willig dem Ganzen unterordnet. Unser Glaube ist, daß für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Sieg hängt, den der deutsche Militarismus erkämpfen wird, die Manneszucht, die Treue, der Opfermut des einträchtigen deutschen Volkes.«'
In diesem Sinne werden deutsche Kinder und Jugendliche erzogen. Das Bewußtsein, daß »am deutschen Wesen die Welt genesen« soll, wird weit über den ersten Weltkrieg hinausreichen. Auch Dietrich wird die Werte, an denen angeblich das Heil der Kultur Europas hängt, erst nach und nach in Frage stellen.
Tag für Tag steckt er mit seinen Schulkameraden den neuesten Frontverlauf ab. In jedem Klassenzimmer hängt die Karte mit den Ländern Europas, auf der das Vorrücken der deutschen Armeen mit schwarz-weißroten Fähnchen dokumentiert wird. Doch dann kommt die Front zum Stehen. Man hört Gerüchte über Materialschlachten, Stellungskrieg und Giftgas; In der großen Verwandtschaft der Bonhoeffers gibt es die ersten Kriegstoten.
Der Tod der älteren Vettern beschäftigt Dietrich und seine Zwillingsschwester Sabine bis tief in die Nacht hinein. »Wir lagen abends noch lange wach und versuchten, uns das Totsein und das ewige Leben vorzustellen. Wir bemühten uns, der Ewigkeit jeden Abend etwas näherzukommen, indem wir uns vornahmen, nur an das Wort Ewigkeit zu denken ... sie erschien uns sehr lang und unheimlich.«'
Die beiden Zehnjährigen sind nicht die einzigen, die sich mit solchen existentiellen Fragen beschäftigen. Der Krieg, der nicht enden will, bringt den Tod ins öffentliche Bewußtsein. Der Kirche wird die Stärkung des Durchhaltewillens anvertraut. Die Allgemeine Lutherische Kirchenzeitung zitiert 1917 aus einer Rede des Theologieprofessors Reinhold Seeberg, Dietrichs späteren Doktorvaters: »Weiter kämpfen, weiter aushalten! Überall Zeugnis ablegen für einen deutschen Frieden!
Wir vertrauen auf den gesunden Sinn unseres Volkes, auf unser Heer und seine Führer, auf unseres Kaisers deutsches Herz, auf Gott. Der deutsche Friede ist der Friede der siegenden Kultur. Diesen deutschen Frieden schenke uns Gott!«3
Diese Rede wurde auf einer Kundgebung gegen einen möglichen Friedensschluß auf der Grundlage der bestehenden Grenzen gehalten. Deutscher Friede ist: Landgewinn für Deutschland.
Mit den Durchhalteparolen geht die Romantisie-rung des Todes einher. Vaterländische Lieder und Postkarten verherrlichen den Soldatentod. Humanistische Pädagogen traktieren den Satz des Horaz: »Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben.« Der Augsburger Gymnasiast Bertolt Brecht entgeht nur knapp der Relegation, als er in einem Aufsatz über Horaz schreibt, im Ernstfall würde dieser Hofnarr »als erster entwetzen«4.
Dietrichs Gefühls- und Gedankenwelt sieht dagegen eher vaterländisch und opfermütig aus. Mit Begeisterung liest er Geschichten von Menschen, die für eine gute Sache ihr Leben opfern. Für den empfindsamen und phantasievollen Jungen wird die Auseinandersetzung mit dem Tod zeitweilig zu einem Dauerthema. Dietrich ist fasziniert von der Frage, wie der Tod zu bestehen sei. Juden schon erwähnten Selbstreflexionen aus dem Jahr 1932 schildert er, was damals in ihm vorging: »Er wäre gern und früh gestorben, einen schönen frommen Tod. Sie sollten es alle sehen und wissen, daß das Sterben nicht hart, sondern herrlich ist für den, der an Gott glaubt.«
Aber der Traum vom schönen frommen Tod hat seine Tücken. Dietrich sehnt sich nach dem Tod und fürchtet ihn zugleich. Denn er lebt auch sehr gerne. Manchmal genießt er sein Leben so intensiv, daß es der Familie auffällt. Als am Ende des Krieges die Versorgung auch in großbürgerlichen Haushalten knapp wird, entwickelt Dietrich unerwartete Fähigkeiten beim Organisieren von Lebensmitteln. Er ißt nämlich sehr gern und möglichst gut.
Diese vitale und sinnliche Lebensbejahung steht der Todessehnsucht entgegen. Dietrich erinnert sich: »Abends, wenn er übermüdet zu Bett ging, hatte er manchmal gemeint, es sei jetzt so weit. Dann schrie er in seiner Ahnungslosigkeit zu Gott und forderte Aufschub. Diese Erfahrung verwirrte ihn einigermaßen. Also wollte er offenbar doch nicht sterben, also war er doch feige ... Er war wirklich todesbereit, es war nur sein animalisches Dasein, das ihn immer wieder vor sich selbst verächtlich machte, das ihn an sich irre werden ließ.«'
Es ist sicher kein Zufall, daß Dietrich sich als erwachsener Mann gerade an diese Szene erinnert. Wie bei vielen sensiblen und lebendigen Menschen bleiben auch bei ihm diese inneren Gegensätze ein Leben lang bestehen. Dietrich wird immer wieder beides in sich zu vereinen suchen, Einsatzbereitschaft und den Hang zum angenehmen Leben, freiwilligen Verzicht und Le-bensgenuß, Todessehnsucht und Lebensbejahung.
Die kindliche Vision vom schönen frommen Tod verschwindet jedoch in dem Maße, wie das wirkliche Leben vom wirklichen Tod bedroht wird. 1917 werden die großen Brüder eingezogen. Über Vaters Beziehungen könnten sie sich der unmittelbaren Gefahr entziehen, aber sie melden sich zur Infanterie, »weil dort die Not am größten ist«?.
Im April 1918 wird Walter Bonhoeffer schwer verwundet. Drei Stunden vor seinem Tod diktiert er einen Brief nach Hause: »Meine Technik, an den Schmerzen vorbeizudenken, muß auch hier herhalten. Doch gibt es in der Welt interessantere Sachen als meine Verwundung. Der Kemmelberg und das heute besetzt gemeldete Ypern gibt uns viel zu hoffen
In diesen Zeilen kommt alles zusammen, was die Bonhoeffersche Erziehung ausgemacht hat: die Beherrschung des Affektiven und die selbstverständliche Erfüllung dessen, was man für seine Pflicht hält. Es ist nur logisch, daß sich auch Karl Bonhoeffer seinen Schmerz nicht anmerken läßt. Wie tief er getroffen ist, zeigt sich erst später, als sich herausstellt, daß er das traditionelle Familientagebuch zehn Jahre lang nicht weiterführen kann.
Das, was er selbst sich an Gefühlen nicht leisten kann, überläßt er auch diesmal so vollständig seiner Frau, daß es ihr fast zuviel wird. Paula Bonhoeffer lebt ihren Schmerz aus, auf eine Weise, die der Familie unheimlich wird. Wochenlang wird sie bei einer befreundeten Familie in der Nachbarschaft untergebracht.
Dietrich ist tief getroffen vom Tod des Bruders und vom Schmerz der Mutter. Der Krieg hat einer scheinbar heilen Welt ein Ende bereitet. Die Bilder aus der »guten alten Zeit« sind nicht wiederherstellbar. Dietrich wird sich den Krisen und Konflikten einer veränderten Welt stellen. Aber er wird lange nicht aufhören, Sehnsucht zu haben nach den intakten Ordnungen einer vergangenen Welt.
Erich Beyreuther, August Hermann Francke, Zeuge des lebendigen Gottes
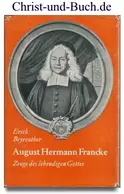
Herkunft, Kindheit und Jugend
August Hermann Francke ist ein Sohn der freien Reichsstadt Lübeck. In ihren Mauern erblickte er am 22. März 1663 das, Licht der Welt. Wer heute den alten Stich aus Merians Städtebuch zur Hand nimmt, der das Antlitz der alten Hansestadt nachzeichnet, ist von dem Bild entzückt, das sich ihm darbietet. Vieltürmig grüßt die Stadt vom Westen her. Wie eine schöne steinerne Blume wächst sie gen Himmel. Die spitzgiebligen Dächer der gedrängten Häuserzeilen überragen die schützenden Wälle.
Alles ist in diesem Jahrhundert noch ganz unzerstörte mittelalterliche Wirklichkeit. Die barocken Bastionen, die sich wie eine stachlige Schale um den Kern des alten Festungsringes legen, und die zahllosen Wassergräben heben die Stadt noch strenger und abweisender aus der offenen Landschaft heraus. Fremdartig ist uns heute diese ganze Welt. Zerfahrene, schmutzige Straßen führen zu den wenigen Toren. Die bescheidenen Vorstadthäuser und die Gärten, die vor den Wallgräben und den sumpfigen Wiesen zu sehen sind, verschärfen noch die abweisende Härte der Grenze.
Wer durch die Stadttore eintritt, wandert durch enge Straßen. Die Pflasteruiig ist von alters her ganz unregelmäßig; denn sie obliegt den einzelnen Hausbesitzern. Die Straßenbeleuchtung kommt in Lübeck erst im Jahre 1704 auf. Ein eifriger Bürger errichtet sie mit Billigung des Rates. Aber sie brennt nur zwei Winter hindurch. Die Stadt steuert gerade mühsam am Bankerott vorbei, und viele Hausbesitzer weigern sich, die für die Lampen festgesetzte Abgabe zu leisten.
Und doch kündigt sich ein helleres Jahrhundert an, das nach dem Dreißigjährigen Krieg aufzieht. Einzelne gut gepflasterte Hauptplätze mit ihren heiteren Barockpalästen machen es wahrnehmbar. In diese und in die gotischen Hauptkirchen, deren neue Barockaltäre marmorne Kühle ausstrahlen, führt man die Fremden. Die auswärtigen Geschäftsfreunde sitzen lieber in den Kontoren der Lübecker Großkaufleute und wandern mit ihnen durch die hochstöckigen Lagerhäuser. Die übergroße Mehrheit der Firmen ist tatsächlich immer noch dort seßhaft, wo sie seit der Stadtgründung sich angesiedelt hatten. Seit nunmehr 600 Jahren sitzen sie in der Gründerstraße und um den Markt, auch in der Holstenstraße und
in der Petersgrube. -
So schön und weiträumig die Häuser der Kaufherren oft angelegt sind, so eng kleben die alten schmalen GiebelhäusS mit den kleinen Fenstern in den Gassen aneinander. Hier lebt und webt das alte ehrsame Handwerk in althergebrachten und oft sehr um-
ständlichen Gebräuchen. Es hält starr und steif am Kleinbetrieb fest. Es fehlen aber auch nicht die Künstlerwerkstätten. Denn um diese Zeit empfängt das rein gotische Bild der Reichsstadt einen barocken Zug.
Das Wasser wird aus den öffentlichen Brunnen geholt, die eine Zierde der Stadt darstellen. In den Patrizierhäusern sprudelt das Wasser aus kunstvoll geformten Hausbrunnen. Aber an eine Kanalisation ist nicht zu denken. Auch das Badezimmer ist fast unbekannt. Neunzig von hundert Menschen leben in Europa noch von der bäuerlichen Urproduktion auf dem flachen Land. An den Werktagen beherrschen nicht die herrschaftlichen Karossen, sondern die ländlichen Karren die Straßen. Man sieht mehr Bauern als Reiter.
Eng sind, die Städte und nicht sonderlich dem Neuen aufgeschlossen. Man sucht sich oft recht ängstlich gegen alle Zugluft zu schützen. Vorherrschend ist ein konservativer Grundzug. Auf uralten Grundmauern stehen die Bürgerhäuser. Fest gegründet in den Tiefen vergangener Jahrhunderte sind Sitte und Gewohnheit der bürgerlichen Welt, der auch August Hermann Franckes Geschlecht sich eingefügt hat. Reichtum und Stolz der Geschlechter, die jene alten Häuser bewohnen, zeigen sich in den prächtigen Rahmen der Portale.
In Lübeck hat man noch zur Zeit des Vaters unseres August Hermann Francke fünf Hexen nach hochpeinlichen Untersuchungen und schauerlichen Folterungen verbrannt. Zwei wurden aus den Toren gejagt. Der Hexenglaube geistert noch lange durch die Winkel der Stadt. August Hermann Francke ist noch keine dreiundzwanzig Jahre alt, als man einen Schmiedegesellen aus Ostpreußen in Lübeck enthauptet. Er hat sich in Herbergsgesprächen zu freimütig über die Lehre von der Dreieinigkeit ausgesprochen, mit der er nicht mehr zurechtkommt. Der Gotteslästerer wird nach einem eingeholten Universitätsgutachten aus. Wittenberg, das reichsgesetzlich verankert ist, in Lübeck zu Tode gebracht. Man weiß mit verirrten Seelen noch nicht anders umzugehen, als mit dem blutigen Ketzerrecht, das sich im Mittelalter voll ausgebildet hat. Die harte Scheidewand zwischen den Gelehrten, zu denen die Juristen, Mediziner und Theologen zählen, und dem schlichten Volk ist noch nicht gefallen. Man hat förmlich Angst vor jeder selbständigen religiösen Stimme, die sich im einfachen Volk meldet. Man wittert nur Gefahr, nur Schwärmerei, nur Auflehnung gegen die Obrigkeit.
Die Hansestadt hat sich hier nicht besser und nicht schlechter benommen als all die großen und kleinen Städte in der damaligen Welt. Denn wer mit den Augen des modernen Besuchers durch die größere City von London, durch die Altstadt von Paris, durch
Wien, durch Frankfurt, durch die mitteldeutschen Städte jener Zeit wandert, dem bietet sich immer wieder das gleiche Bild: In der Enge dieser mittelalterlichen Städte mit ihren einigen zehntausend Einwohnern, vielleicht aber nur von wenigen tausend Menschen, leben die Dichter und Denker, die Musiker und Gelehrten, die Theologen und Schulmeister, die Berufenen und die Unb ruf e-nen. Hier lebt und webt die bürgerliche Welt.
Es ist eine Welt, die bei aller Schwere und Last alter Traditionen um diese Zeit in eine große Krise gerät und in eine Wandlung hineingezogen wird, wenngleich sie sich auch sträubt. Dieser Epoche gehört August Hermann Francke an. Schon sein Großvater mütterlicherseits, Dr. David Gloxin, ahnt den Wandel der Zeiten. Er ist einer der großen Bürgermeister dieser stolzen Stadt, und sein Name bleibt für immer mit folgenreichen Veränderungen in ihrem Leben verbunden. Lübecks Größe ist dahin. Einst war sie das Oberhaupt der mächtigen Hanse, die Stadt an der Trave. Der Bund hat einmal die Schiffahrtsstraßen von den Häfen Rußlands und Skandinaviens nach Flandern und England beherrscht. Aber in dem Jahrhundert, in dem August Hermann Francke heranwächst, sinkt diese Herrlichkeit endgültig dahin. Manche der Hansestädte sind bereits zu Landstädtchen in Fürstenhand geworden. Die freie Reichsstadt Lübeck hat die Ehre, bei den unaufhörlichen Kriegs' -händeln des morschen Reiches deutscher Nation zu bluten und zu zahlen; denn ihr Beitrag richtet sich noch nach dem einstigen, längst dahingeschmolzenen Reichtum. Zu melden hat sie nichts mehr.
Die Bürgerschaft stemmt sich tapfer gegen alle Verfallserscheinungen. Es treibt die Lübecker Kaufleute immer neu auf die alten Schiffahrtsrouten. Weltweite Erfahrung und kluge Regierungskunst vererben sich noch ungebrochen von Geschlecht zu Geschlecht. Nur das alte Adelspatriziat, das die Ratssitze besetzt, resigniert. Es ist landsässig geworden, wohnt zumeist auf den großen Gütern und zeigt kein Interesse mehr am Fernhandel. Was Wunder, daß es mit den Schwierigkeiten der Zeit längst nicht mehr fertig wird. Die Schuldenlast der guten Stadt steigt ins Unermeßliche. Charakterlos buhlen die alten Adelsgeschlechter der Stadt weithin schon um die Gunst der mächtig aufstrebenden Fürstenmacht; denn hier liegt die Zukunft ihrer Kinder, nicht bei den versinkenden Stadtrepubliken. Alte Stadtrechte werden schmählich verraten
Dieser 'Umstand bleibt nicht unbemerkt, und die Kaufmannsgeschlechter rebellieren. Es hätte ihnen vielleicht nicht viel genützt, Wenn nicht David Gloxin in die Bresche gesprungen, wäre. Erst nach weiten Reisen, die ihn nach Holland, England, Frankreich und Spanien führen, nach zehnjähriger Tätigkeit als Rat des Herzogs von Schleswig-Holstein, tritt dieser Jurist, in dessen Adern auch holländisches Blut fließt, in den Dienst der Stadt
10
Lübeck. Auf dem Friedensschluß zu Münster und Osnabrück (1648) vertritt er die Hansestädte so geschickt, daß er eine weltbekannte Persönlichkeit wird. Er ist es gewöhnt, mit Königen und Fürsten umzugehen, und muß noch auf manchem Reichstag erscheinen.
Mit Weisheit und überlegener Ruhe weiß er die verfahrenen Verhältnisse der Stadt Lübeck zu ordnen und besiegelt auch die Mitarbeit der Bürgerschaft an den Ratsgeschäften in der Stadtverfassung, die bis 1848 gilt.
David Gloxin, der an der Hochburg des Luthertums, in Wittenberg, studiert hat, ist ein Mann, der mit Gott lebt. Es tritt uns in ihm eine ausgesprochene Kämpfernatur entgegen. Eine Kampfes-freudigkeit, die an Schwierigkeiten wächst, beseelt ihn offenbar von Natur aus. Wir finden diese Charakterzüge in seinem Enkel August Hermann Francke wieder. Klugheit von staatsmännischem Format gepaart mit Entschlossenheit, Tatkraft verbunden mit Großmütigkeit sind die Gaben, die vom Großvater auf den Enkel übergehen.
Neben den Großvater mütterlicherseits tritt ebenbürtig die Großmutter väterlicherseits, die Bäckersfrau Elsabe Francke, geborene Wessel, aus altem hanseatischen Geschlecht. Sie gehört zu den seltenen Frauen, bei denen Herz, Gemüt und Geist sich harmonisch vereinen. Sie zählt zu den Menschen, die man nicht mehr vergißt; wenn man ihnen einmal begegnet ist. Wir besitzen über sie das schöne Zeugnis Magister Bangerts, des Rektors des Lübecker Gymnasiums, der jahrzehntelang Wand an Wand mit ihr gewohnt hat: „Ihr Leben währte neunundsiebzig Jahre und fünf Wochen. Und es war wirklich ein Leben, nicht bloß ein Geborenwerden, Atmen, Kriechen, ja vielmehr Gequält-, Gefoltert-, Hin-und-her-geworfen-, Emporgehoben- und Nieder gedrücktwerden. Es war wirklich ein Leben, weil sie ganz ihrem Gott lebte, ihn beständig lobte, liebte, anbetete und verehrte und seinem Willen sich überließ und weil sie ihre Kraft in den Dienst ihrer Mitmenschen stellte. Ihnen zu helfen, wurde sie niemals müde.«
Auf ihrem letzten Lager antwortet sie ihrem Sohn, dem Vater August Hermann Franckes, auf die Frage, ob sie etwas wünsche, in Plattdeutsch: „Wat ich noch hebben mücht? Einen seligen Dod mücht ich hebben und bi minen Herrn Christus sin un cm mit de ganze heilige Dreieinigkeit von Angesicht seihn in ehre himmlische Majestät un Herrlichkeit. Sünst will ich nix mehr hebben.«
Sie kann als Mutter für ihren Sohn auf der Universität beten: „0 Herr, ich schließe zwar meinen Sohn; der in der Ferne weilt, aus diesem meinen Hause aus, niemals aber aus meinem Herzen. Und dich, o heiliger Gott, flehe ich inständigst an, du wollest ihn nie ausschließen aus deiner Gnade und deinem göttlichen Schutze." Mit besonderer Vorliebe liest sie in Johann Arnds Schriften. Nach
dessen „Vier Bücher vom wahren Christentum" will sie fern von allem Heuchelsdiein ein ganz gottergebenes, dem Nächsten dienen-:des und von ihrem Heiland zeugendes Leben führen.
Die Kraft holt sie sich aus Gottes Wort. Elsabe Francke steht früh morgens um drei Uhr auf, um die Stille zu finden. Da schlägt sie die Bibel auf und schüttet ihr Herz aus vor ihrem Heiland. Diese Bäckersfrau lebt darum in einer weiten und reichen Welt. Wie kann das auch anders sein! Wem die letzten und tiefsten Fragen beantwortet sind, die das Herz stellen kann und muß, der wird frei für die andern und für die ganze Welt. Im Bäckerhaus zu Lübeck hat eine Bibliothek erlesener Bücher und alter Handschriften gestanden. Darunter fehlen nicht die Kirchenväter und Zeugen der ersten Christenheit. Aber sie sammelt auch gemeinsam mit ihrem Mann Hans Francke Nachrichten zu einer Lübecker Stadtchronik. Sie ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und wird unermüdlich ergänzt. So stark fühlen sich beide mit ihrer Stadtrepublik, mit deren Wohl und Wehe verbunden.
Wie kann diese tüchtige Geschäftsfrau, die ihren Mann lange überlebt, helfen und raten! Wo jemand in der Nachbarschaft krank liegt oder Mangel leidet, sendet sie Speise und Trank sowie Arznei. An Krankenlagern und Sterbebetten weiß sie zu trösten, weil sie selbst eine Getröstete ist. Die letzten Lebensjahre verlebt sie im Hause ihres Sohnes, des Juristen Dr. Johannes Francke, des Vaters unseres August Hermann. Hier ist die achtundsiebzigjährige Bäckerswitwe Elsabe Francke auch beim Tauffest ihres Enkels August Hermann der von allen geliebte Mittelpunkt. Welch eine herzbewegende Stunde! Ihren hochbegabten und früh zur Theologie entschlossenen ältesten Sohn Hermann hat sie zeitig ins Grab sinken sehen, und ihr Sohn Johannes, bei dem sie nun ihren Lebensabend verbringt, hat wegen seiner schwachen Brust auf diesen Berufsweg verzichten müssen. Nun hält sie auf ihren zitternden Armen und an ihrem von Jesusliebe brennenden Herzen den dritten Enkelsohn, August Hermann, der ein so Großer werden soll im Reiche Gottes. Eineinhalb Jahre hat sie über diesem Kind noch die Hände gefaltet.
Von dieser Frau mit dem von Christusliebe übervollen Herzen, das sich ein Leben lang in mütterlichem Erbarmen über alles beugt, was elend und hilflos ist, hat August Hermann Francke wohl entscheidende Züge empfangen. Veranlagung, Gabe und Segen der Großeltern formen sich neu in den Enkeln. Die moderne Tiefenpsychologie bestätigt, was die Glaubensaussage vom Segen der Väter erzählt. Denn nach der tlberzeugung der modernen Seelenkunde ist es durchaus gegeben, daß Leitbilder der Seele, die von den Vorf ahren geträumt und ersehnt worden sind, in denEnkeln als potentielle Energie nachwirken. Im Leben der Seele spielen
12
13
die sogenannten Leitbilder eine besondere Rolle. Darunter sind die Zielsetzungen zu verstehen, die ein Mensch in sich trägt im Handwerk zurück, aber sein Rektor ruht nicht, bis dieser Schüler wieder aufs Gymnasium zurückkommt. Der Sohn des schlichten Handwerksmeisters tritt nunmehr in die große Welt ein. Sein juristisches Studium führt ihn nach Königsberg und Rostock. Nach Abschluß der Studien begibt er sich noch an holländische und französische Hochschulen. Dort sitzt er zu Füßen weltberühmter Rechtsgelehrter; Auf den Landstraßen der Welt weiten sich Blick und Herz. In Basel erwirbt er sich den Doktorgrad beider Rechte, des weltlichen und des geistlichen. Die Reise nach Italien bricht er jedoch ab, als ihn die Nachricht von der schweren Erkrankung
Blick auf Berufswahl, auf Wünsche und Hoffnungen, die an die • seines Vaters erreicht. Er eilt heim.
Zukunft gestellt werden. Die Leitbilder sind niemals nur eine blasse Idee oder ein begrifflich geschauter Vorgang. Das wirkt und - Johannes Francke besitzt viele Freunde unter den Theologen. Die Sehnsucht nach einem wahren Christentum ohne Heuchelei verbindet sie untereinander.
wogt in uns und lebt in geschauter farbiger Plastik. Von guten Leitbildern strömen der Seele Segenskräfte zu, die Geist und Herz beflügeln und anspornen. Das ist das Streben aller ernsten Geister der Zeit. Weltoffenheit vereinigt sich bei dem tüchtigen. Juristen mit persönlicher Bescheidenheit und ausgeprägter Wahrhaftigkeit. Kein Wunder, daß der mit Geschäften überbürdete Syndikus David Gloxin dem jungen Rechtsgelehrten, der in Kiel, der Residenzstadt der Holsteinischen Herzöge, Mandanten sucht, die ersten Aufträge gibt. Als Johannes Francke in den Dienst des evangelischen Domkapitels zu Ratzeburg tritt, gibt David Gloxin ihm ohne Zögern eine seiner Töchter zur Frau. Es ist die siebzehnjährige Anna Gloxin, die Dr. Johannes Francke in die Wohnung im Domkapitel zu Ratzeburg heimführen darf. Ein weiträumiges Haus, Gärten, Pferde
Nach demTaufeintrag inSt.Agidien znLübeck vom 15. März 1663 gehört zu den Paten August Hermann Franckes die Herzogin Hedwig Sybilla von Sachsen-Lauenburg, Tochter des regierenden Herzogs von Sachsen-Lauenburg. Nach ihm ist der Täufling August genannt worden. Diese Herzogsfamilie greift tief hinein in die Schicksalsführung des ganzen Frandceschen Geschlechtes. Noch ist das zur Stunde nicht sichtbar. Den Namen Hermann verdankt der Täufling seinem zweiten Paten Hermann von Dorne, dem ältesten Bürgermeister von Lübeck unter den vieren, die miteinander die Geschicke der Stadt lenken; Neben einem zweiten Vertreter der Patrizierfamilien finden wir aber auch zwei Anverwandte aus dem Kleinbürgertum. Diese Zusammenfügung von Paten aus den verschiedensten Ständen, angefangen bei dem Mitglied eines regierenden Fürstenhauses bis zu den Kleinbürgern, charakterisiert die innere Haltung des Franckeschen Geschlechts. Dr. Johannes Francke, der Vater des Täuflings, hat später einem der tüchtigsten Fürsten seiner Zeit den schönen Satz geschrieben: „Ich bin zwar nicht von großen und hochansehnlichen, jedoch gottseligen, redlichen und frommen Eltern geboren, deren ich mich noch nie geschämt, noch schämen werde." Das ist die Freiheit von Menschen, die an Gott gebunden sind und darum auch in der Zeit barocker Enge mit der betonten Abstufung der Stände nicht der Unterwürfigkeit verfallen, sondern das freie Manneswort behalten. und Wagen stehen zur Verfügung. -
In der Patenwahl der Eltern August Hermann Franckes bahnt sich die große Wende an, die einmal seinen ganzen Lebensweg bestimmen wird. Das Geschlecht Francke ist schnell emporgestiegen zu Rang und Geltung. Der Großvater väterlicherseits ist noch auf einem hessischen Dorf, in Heldra, nahe der thüringischen Grenze 1617 geboren. Den jungen Bäcker hat zweifelsohne das Kriegselend, das Hessen besonders hart traf, in die Ferne, nach Hamburg getrieben. Den beruflich hervorragenden Freibäcker holt man dann nach Lübeck. Seine ungekünstelte Gottesfurcht und seine Rechtschaffenheit, die Tugenden des alten Handwerksmeisters, bringen ihm in der Hansestadt schnell die wohlverdiente öffentliche Anerkennung ein. Nun tritt Dr. Francke noch in die Dienste der beiden Fürstinnen von Sachsen-Lauenburg. Er ist damit dem Zug der Zeit gefolgt. Die alten Reichsstädte, die langsam verkümmern, bieten den jungen aufstrebenden Vertretern des Bürgertums kaum noch Aufstiegsmöglichkeiten, geschweige denn weitreichende Aufgaben. Die Fürstenmacht ist in unaufhörlichem Anstieg begriffen. Der moderne Machtstaat ist im Kommen. Die barocke Welt wertet den Menschen nur nach seinem Rang im Staate. Hier steht der Bürgernoch weit weg von dem allein lichtgebenden Strahlenthron der Fürsten. Und doch bedürfen die Fürsten, die ihre Staatsmaschinerie immer komplizierter ausbauen, vieler tüchtiger Bürgersöhne in all den neu entstehenden Staatsfunktionen. Der moderne Verwaltungsstaat, der in alles hineinregiert und hineinredet, ist bereits in den Umrissen sichtbar. So lebt das Bürgertum im ganzen auf den Adel hin, der die Zeit beherrscht, den Zeitstil prägt und den Bürger doch nicht entbehren kann. An rohen Landjunkern und bornierten Höflingen fehlt es hier nicht, an Adligen, die auf den Bürgersmann herabsehen und ihn höchstens auszunützen trachten. Aufs allgemeine gesehen, sind das freilich Ausnahmen.
Sein hochbegabter Sohn Johannes kehrt zwar mit fünfzehn Jahren von der Lateinschule in die Backstube zum väterlichen 15
14
Hoch über dem Tal, Ein Leben zerrüttet durch eine Tragödie, Mary Brite
Hoch über dem Tal, Ein Leben zerrüttet durch eine Tragödie, Mary BriteMittags um 12 Uhr ahnte ich noch nichts davon, daß bereits zwölf Stunden später, um Mitternacht, mein Leben in Trümmern hegen wurde Es war der erste Tag im Januar 1967 Wolken über dem Pike's Peak breiteten im Zusammenspiel mit der Mittagssonne eine grün-braune Decke wie Lochstickerei über die Erde.
ich noch nichts davon, daß bereits zwölf Stunden später, um Mitternacht, mein Leben in Trümmern hegen wurde Es war der erste Tag im Januar 1967 Wolken über dem Pike's Peak breiteten im Zusammenspiel mit der Mittagssonne eine grün-braune Decke wie Lochstickerei über die Erde.
Eine Welle der Liebe zog mich zu meinem Mann Charhe, als sein schüchternes Lächeln es wieder einmal fertigbrachte, mein Herz zum Rasen zu bringen Meine Persönlichkeit war seit Jahren in seinen Lebenszielen aufgegangen, aber es machte nur nichts aus Ich beneidete sein natürlich gebräuntes Aussehen, wie er so auf der Kirchentreppe stand, im Gespräch mit Don Beal, unserem Jugendpfarrer.
»Hallo Don Wie war denn die Nacht« fragte Charhe Seine aufmerksamen, nußbraunen Augen zeigten ehrliches Interesse Ich bewunderte seine breiten Schultern und riß einen locker gewordenen Knopf von seinem Wollsakko ab, wahrend ich mich zu ihm stellte
»Gelungen, Dr. Venable Ich hab' sogar von vier bis sechs geschlafen«, antwortete Don, indem er sich die Augen rieb. Don war nicht sehr groß, doch in den Augen unserer Kinder war er überragend, weil er ein reges Leben mit ihnen plante Sie hatten gerade ein gemeinsames Wochenende hinter sich
»Konnten Sie das Feuerwerk um Mitternacht sehen, ganz nah an der Spitze des Pike's Peak?« Charile und ich hatten
diesen einzigartigen Gruß der Mitglieder eines Clubs beobachtet Sie kletterten in jedem Jahr auf den Berg
»Emen Teil davon«, sagte Don, müde nickend »Wie geht es Ihrer Frau« fragte Charlie
»Sie ist in Kansas, besucht ihre Eltern Ich will heute nachmittag hinfahren und sie und das Baby nach Hause holen.«
Wir gingen gemeinsam zu Don's Wagen und halfen unserem ältesten Sohn und unserer Tochter, ihre Schlafsäcke umzuladen.
>Könnn Sie sich denn auf dieser langen Fahrt noch wachhalten?« fragte Charhe, wahrend er die Taschen in unser Auto packte
»Ich hoffe doch«, erwiderte Don
Charhe dankte ihm, daß er für Danny und Kathy so gut gesorgt hatte Rudi und Paul David, unsere beiden jüngeren Kinder, kamen aus der Kirche, und dann fuhr unsere sechsköpfige Familie nach Hause Die frische Luft wehte durch die geöffneten Wagenfenster. Der Winter war selten ein anhaltendes Problem in Colorado Springs Am Fuße der Berge gelegen, war die Stadt vom Pike's Peak teilweise geschützt.
In unserer kleinen Küche nahm Charhe mich in seine starken Arme, hob mich hoch und druckte mich kräftig an sich
»Mir gefallt einfach das neue rote Kleid an dir«, sagte er und hielt mich immer noch fest Er brachte selten Anerkennung oder offene Liebesbezeugungen in Worten zum Ausdruck, aber wenn er es tat, dann war es ihm ernst
Tiefe Zuneigung und Freude durchfluteten mich Nur ungern ließ ich ihn gehen
Ein Kaleidoskop farbenvoller Erinnerungen kam mir in den Sinn, eine nach der anderen - wie ich Charhe aus der Hand futterte mit einem Stuck unserer Hochzeitstorte,- Klänge seines tiefen Gelächters - wie wir beide zweisu n-mig sangen - wie Charhe mit unseren Kindern Krocket spielte— ich sah die Lachfältchen in seinen Augenwinkeln, bevor er mich abends fest in seine Arme schloß
Immer etwas sentimental ordnete ich die neue Umarmung und das Kompliment in meinen Erinnerungsstrom so ein, daß es in Zukunft golden vor mir aufsteigen mußte Das neue Jahr schien gut zu beginnen'
»Könnte ich nicht Don anbieten, ihn nach Kansas zu fliegen, um seine Frau und das Baby abzuholen?«, fragte Charlie. »Es ist ein großartiger Tag zum Fliegen.«
»Das wäre eine gute Idee«, erwiderte ich
Ich wußte, wir dachten dasselbe, indem wir uns beide an eine schreckliche Autofahrt erinnerten Wir hatten damals eine weite Strecke zurückzulegen um heimzukommen, und wir hatten in der vorhergehenden Nacht nicht gut geschlafen. Schon nahe an unserem Zuhause fielen Chailie -die Augen zu.
»Als ich die Augen aufriß, waren wir schon auf dem Seitenstreifen, stracks auf den Graben zu Ich wollte die Ra-der nicht zu plötzlich herumreißen, aus Angst, der Wagen würde sich überschlagen. Ich konnte mich nur noch etitt-. scheiden, die Richtung des Wagens emzuhalten«, erklärte er später.
Ober den Rand eines zwei Meter tiefen Abhangs und noch
einigeMter*eiter holperten wir z u einem abrupten Halt.. Wir beruhigten unsere schreienden Kinder und waren er-leichten, nicht eine körperliche Verletzung zu finden Wenn auch der Wagen die Hinterachse gebrochen hatte, so konnten wir doch wenigstens die letzte Meile heimlaufen
Daran dachten wir. Es konnte ja auch sein, daß Don bei seiner Fahrt heute nicht so viel Gluck haben wurde, wie wir vor einigen Jahren
Ich dachte wieder an Charhes Frage Der Ausflug konnte einen doppelten Zweck erfüllen. Charlie brauchte die Entspannung Fliegen war sein Hobby. Unsere Lebenskosten, kombiniert mit den Kosten zur Eröffnung einer Zahnarztpraxis in den letzten drei Jahren, hatten es für ihn notwendig gemacht, gewöhnlich bis zur Grenze des Möglichen zu arbeiten. Und ich hatte notgedrungen in der Schule weiter Unterricht gegeben. Wir konnten nicht oft ein Flugzeug mieten.
Charlie strich eine dunkle Haarlocke von seiner Stirn, wahrend er mit Don telefonierte. »Ich hatte Lust, ein Flugzeug zu mieten und Sie nach Kansas zu fliegen.« Ich horte eine wachsende Begeisterung in seiner Stimme
Don sagte »Okay«, Charlie drehte sich um und rief es nur zu
»Sag ihm, er kann 'rüberkommen zum Mittagessen.« Ich war gerade dabei, das Roastbeef in Scheiben zu schneiden
Charlie wiederholte meine Einladung durchs Telefon »Wir essen zusammen und machen dabei Plane«, meinte er am Ende des Gesprächs.
Dann wählte er die Nummer einer Flugzeugvenmetung und buchte eine Cessna 205, einen Sechssitzer.
Als nächstes fragte er jedes Kind, ob es mit nach Kansas fliegen wolle Paul David, neun Jahre alt, schüttelte seinen kastanienbraunen Schopf. »Ich nicht Ich werde luftkrank'«
»Ich bin müde«, sagte Kathy, als sie sich zum Essen an den Kuchentisch setzte »Wir haben uns die ganze Nacht unterhalten « Konnte sie endlich ihre Scheu überwinden?, dachte ich zufrieden
»Ich bin zu müde«, rief Danny aus dem Schlafzimmer, wo er und Paul David Dummheiten machten Er war im Stimmbruch und wechselte die einzelnen Oktaven m der Mitte seiner Sätze. Als er ins Wohnzimmer kam, bemerkte ich, daß seine Jeans schon wieder zu kurz wurden Als mein Bruder 15 Jahre alt war, hatten wir ihn »Silo« genannt wegen seines großes Appetits und der langen Beine. Auch eine passende Bezeichnung für Danny, dachte ich
Die elfjährige Rudi ging am liebsten immer mit ihrem Daddy, ein Gefühl, das sie und ich teilten Sie war das einzige der vier Kinder, das in diesem Augenblick Eifer ent-. wickelte, obwohl wir noch mehr Platz in dem Flugzeug gehabt hatten
Nach dem Mittagessen rief Charlie bei Burl an, dem Baß-solisten unseres Kirchenchores »Hatten Sie Lust, mit nach Kansas zu fliegen, wenn wir vor Dunkelheit zurück sind« horte ich ihn fragen »Sie sagten einmal, daß Sie gern mal irgendeinen tYberlandflug mitmachen wurden Wir haben einen freien Platz.«
Buri nahm das Angebot an und freute sich auf das Erlebnis eines Oberlandfluges, das so schrecklich enden sollte Er war vor uns am Flughafen und trug eine lange Flugjacke, die seme zwei Meter Große warmte Er grußte uns mit tie-
fer Stimme »Hall& Das Wetter ist großartig zum FIte-gen!«
Ruth und ich kletterten in das Flugzeug Wir konnten die Männer bei der Besichtigung hören, wie sie die Tragflachen des Flugzeuges überprüften. Ihre Stimmen wurden einen Augenblick von einer vorbeirollenden kleinen Ma-sclune übertönt, die gerade gelandet war.
Ich mußte häufig nach der Chorprobe am Donnerstag warten, wenn BurI und Charlie sich noch über die Fliegerei unterhielten Buri besaß ein kleines Flugzeug und hatte auch einen eigenen Flugschein
Charhe, Burl und Don kletterten herein, und wir alle schnallten uns an Charhe befolgte genauestens die Prozedur der Checkliste, bevor er etwas später als geplant abhob. Die alltäglichen Probleme waren zurückgelassen, als wir aufstiegen und nach Osten drehten, fort von den Bergen
Während des ruhigen Fluges nach Dighton war ich von angenehmer Unterhaltung umgeben Aber meine Gedanken wanderten Jahre zurück, indem ich mir erlaubte, über alle möglichen Unglücksfälle nachzudenken - nur kurz, denn ich fürchtete, sonst Charhe gegenüber einen Mangel an Vertrauen zu zeigen Haue er in den 16 Jahren unserer Ehe nicht viele Stunden und viel Muhe eingesetzt, um jedes Gelernte zu vervollkommnen?
Auch beim Fliegen? Oder bei allem anderen— außer beim Fliegen? Oder war es nur, daß er sich in der Luft so viel freier fühlte als anderswo, daß er dachte, er beherrsche es und könne unbekümmert sein Handle wie gewohnt, sei ein guter Vogel Strauß, steck deine eigentliche Meinung in den Sand - ich zweifelte an mir selbst
Trotzdem, ich mußte an einen Start im April 1958 denken »Wir waren dicht davor, einige Baume zu entblättern«, sagte Charhe damals gleich nach dem Abflug in Richtung Oklahoma auf dem Weg zu Paul Davids Geburt
Ich mußte schwer schlucken, aber ich sagte nichts:
»Ich wußte, daß unsere Piper PA-12 überladen war, aber ich war zum Start entschlossen«, sagte er.
Ich war erschrocken, aber ich wollte nicht darüber nachdenken So verbarg ich bewußt die Zweifel, die ich fühlte. Und ich hatte sie bis heute nicht analysiert Auch hatte ich bis heute noch nicht die Stunden zusammengezahlt, die es mich gekostet hatte, ohne Furcht zu fliegen.
Als zweites dachte ich zurück an einen geradezu katastrophalen Nachtflug im Mai 1965. Damals war die Maschine noch nicht auf Instrumentenflug eingestellt, aber Charlie hatte genügend Erfahrung im Nachtflug, so daß seine Eltern, eine Schwester und ich spät am Abend vertrauensvoll mit ihm als Piloten den Flug nach Oklahoma antraten
Nach ungefähr einer Stunde wich die Maschine vom Kurs ab, weil Charlie es versäumt hatte, einen Richtungswechsel zu korrigieren Durch einen Seitenwind war das notig geworden Wir verloren das Piep-piep-Geräusch des Omni-Signals, das uns geführt hatte, und steuerten weiter außer Kurs, wahrend er versuchte, eine Flugkarte mit Markierungspunkten unter uns zu vergleichen. In der Dunkelheit waren die Orte, die durch wenige Lichter angedeutet waren, nur schwer auszumachen
Unbehagen machte sich breit Wo waren wir
Während Charlie auf der Karte suchte, strengte sich der Rest von uns an, irgendwo unten in der Dunkelheit nur
nen-kleinen erleuchteten Streifen zu entdecken. Wir suchten in Panik, 30 Minuten lang. Endlich sahen wir- eine kleine eleuchtete Landebahn, einen Kreis, und landeten. Ich konnte wieder normal atmen.
Charlie und sein Vater stürmten aus der Maschine. Sie schauten durch ein Fenster in einekleine Flugzeughalle und lasen eine Schrift an der Wand.
»Wir sind in Woodward, Oklahoma.. Charlie sagte es uns, als sie genug entspannt waren, um wieder zu uns her-
einzuklettern. »Wir konnten in Kansas oder in Texas
sein..
- Dann starteten wir gleich wieder und flogen ohne weitere Schwierigkeiten nach Stillwater.
- »t)berläßt du das Leben anderer nicht zu sehr dem Zufall, zumal es deine Angehörigen sind., warf ich ihm später vor. Ich konnte seinem Handeln kein Vertrauen schenken, denn es war seiner sonstigen Art ganz entgegengesetzt.
Denk an etwas Gutes, sagte ich mir selbst und erlebte noch einmal den Frieden eines Weihnachtsferienabends im -Jahre 1%5, als wir über eine geschlossene Wolkendecke flogen. Die Sterne waren hell und strahlend und erschie-
• nen mir so nah, daß es mich lockte, danach zugreifen. Der Nachthimmel war wunderschön, und plötzlich kam ich zu dem Schluß, daß er zu schön sei, um nicht dorthin zu kommen.
»Da möchte ich sein,, wenn ich sterbe., hatte ich geflüstert Gott schien mir nah, und meine Angst fiel von mir ab. Nach diesem Erlebnis begann ich, Charlies Liebe zum Fliegen besser zu verstehen, ich war entspannt i.md konnte nun, das In-der'Luft-Sein genießen.
Trotz- meines Versuchs, mir keine. negativen Gedankeh., mehr zu gestatten, erinnerte, ich mich, daß wir damals ohne zu tanken losgejagt waren, um wegen eines unerwarteten Schneesturms einen anderen Ort zu erreichen.
»Schnallt euch an und steckt eure Nasen in das Kissen., hatte Charlie die Kinder und mich gewarnt.
Wir landeten in einem kaktusübersäten Weideland mit auseinandersebendem Vieh. Nun war es Charlie, der überrascht war, während niemand von uns eine Aufregung zeigte.
»Ich dachte, ihr würdet in Panik geraten., sagte er, »ich bin stolz auf euch..
»Warum sollten wir, haben wir denn nicht Notlandung geübt?«, forschte ich leise.
»Ja., erwiderte er mit Bewunderung in der Stimme.
Positiv denken. Nur drei Zwischenfälle in neun Jahren Flugpraxis, redete ich mir selbst gut zu.
Ich zwang meine Gedanken zurück in die Gegenwart und beteiligte mich an der allgemeinen Unterhaltung.
»Dighton ist in Sicht., hörte ich Don eine Stunde später zu Charlie sagen. Charlie drehte eine Runde, nachdem er den Flughafen gesichtet hatte, und dann eine zweite, so daß er den Windsack sehen konne. Mein Blick glitt aus dem Seitenfenster, und ich entdeckte, daß die Landebahn trocken war, glatt, von Schneerändern gesäumt. Auf den Weiden in der Nähe waren noch Stellen von ungeschmolzenem Schnee. -
Dons Frau und ihre Eltern waren schon am Flughafen, als unsere Maschine zum Stehen kam. Die Männer diskutier-.
ISBN: 9783882240504
Verlag: Francke
Erschienen: 1978
Einband: Taschenbuch
Format: 18 x 11 cm
Seiten: 107
Ich will von Blumhardt lernen, dass Jesus Sieger ist, Erwin Rudert
Streiflichter aus Blumhardts Leben und Werk in Gemeinschaft mit seiner Frau Doris und der geheilten Gottliebin Dittus
geheilten Gottliebin Dittus
Überblickt man das ganze Leben von Blumharct, dann heben sich deutlich zwei Perioden voneinander ab: die erste als Zubereitung auf die besondere Lebensaufgabe, die zweite als Erfüllung dieser Lebensaufgabe, in der Mitte (am 26. Juni 1842 - zugleich Lebensmitte) die große und entscheidende Wende.
Das ganze Leben durchziehen drei Klänge, die in jeder Phase hörbar sind: Lobgesang, Gebet und Bibellesen im Aufblick zu Jesus Christus als seinem Herrn und Heiland. Blumhardt war von Jugend an kein Einzelgänger, scndern ein Mensch, der Gemeinschaft brauchte und Gemeinschaft schenkte. Diese Charaktereigenschaft fand in seiner Frau Doris volle Ergänzung. Frau Doris wurde nicht nur eine vorbildliche Pfarrfrau im üblichen besten Sinne, sie wurde ihm auch hinsichtlich seiner Lebensaufgabe ebenbürtig. Es war beider Lebensaufgabe, sodaß man, wie Zündel in der Biographie mahnt, dies auf keinen Fall übersehen darf. In dieses Doppelgespann wuchs nach ihrer Heilung auch die Gottliebin geistig voll hinein. Blumhardt war sehr musikalisch, was in vielen Liedern und Kompositonen einen reichen Niederschlag gefunden hat, der mit Unrecht fast ganz übersehen wird. Wie die meisten pietistischen Väter ist auch Blumhardt stark auf Luther bezogen.
In diesen kurzen «Streiflichtern« konnte längst nicht alles aus Blumhardts Leben und Werk erwähnt werden und längst nicht alles Erwähnte ausführlich genug behandelt werden. Es mußte eine Auswahl getroffen werden. Wer etwas vermißt oder über Gebrachtes mehr gehört hätte, der wird um eigene Weiterarbeit gebeten. Gerade solche eigene Weiterarbeit möchte diese Schrift bei vielen wecken.
A. Zubereitung auf die besondere Lebensaufgabe 16. Juli 1805 -26. Juni 1842. 1. Elternhaus und Kindheit Johann Christoph Blumhardt ist am 16. Juli 1805 in Stuttgart als 2. Sohn des Johann Christoph Blumhardt und der Johanna Luise, Tochter des Schneidermeisters Deckinger geboren. Die Vorfahren waren Bauern im mittleren Neckarraum, die dem Zug der Zeit in die Hauptstadt folgten. Der Vater war zunächst Bäcker, dann Mehlhändler, schließlich Holzmesser im städtischen Dienst, um Bäckern und anderen das nach Stuttgart angefahrene Langholz zuzumessen.
Die Eltern Blumhardts gehörten somit zum Kleinbürgertum. Sie waren nicht begütert. »Schmalhans« war oft Gast im Haushalt; die Kinder mußten frühzeitig mithelfen, z. B. Holz herantragen. In der Verwandtschaft bestand die Tendenz zum beruflichen und damit auch wirtschaftlichen Aufstieg - in fürstliche Dienste oder auch als Pfarrer, wie ein Onkel von Johann Christoph, der als Pfarrer in seinem Leben noch eine bedeutende Rolle spielen sollte. Die Eltern waren evangelisch und gehörten zu den damals recht starken pietistischen Kreisen, vornehmlich den Pregizerianern, einer fröhlichen und sangeslustigen Gemeinschaft, weswegen man sie auch Juchhe-Christen nannte. Durch ihren Gründer, Pfarrer Pregizer, waren sie lutherisch geprägt, was auch auf Blumhardt gewirkt hat. Über den Ernst christlicher Erziehung durch Vater und Mutter berichtete der Sohn später: »Dem Vater lag die Erweckung eines christlichen Sinnes seiner Kinder sehr am Herzen.
Er versammelte uns Geschwister regelmäßig zu Gebet und Bibellesen, ließ uns geistliche Lieder miteinander singen und ermunterte uns auf die verschiedenste Art. Unvergeßlich sind mir die Augenblicke, da er einmal eines Abends von etwaigen Verfolgungen mit uns redete, die in späterer Zeit das Bekenntnis des Namens Jesu zur Folge haben könnte. Alle meine Glieder durchzuckte es, als er uns zuletzt unter lebhaften Bewegungen zurief: 'Kinder, lasset euch lieber den Kopf abschlagen, als daß ihr Jesum verleugnet!'. Solche Erzählungen, durch die gleiche Sorgfalt einer zärtlich liebenden Mutter und eines .teilnehmenden Oheims unterstützt, ließ frühzeitig das Gute in mir erwachen; und ich rechne es mir zu besonderem Glück zu, manche lebhafte Erinnerung aus meiner Kindheit von besonderen Gnadenzügen Gottes an meinem Herzen zu haben.« Zündel berichtet, daß das Leben des Neugeborenen durch in Stuttgart einziehende marodierende französische Soldaten in höchster Gefahr stand. Der Vater suchte Hilfe auf dem Rathaus. Entgegen dieser Version hat Ernst nachgewiesen, daß es sich bei der Zeitangabe von Zündel um einen Irrtum handelt.
Der Einmarsch der Franzosen in Stuttgart fand erst Ende September - Anfang Oktober statt. In der Nacht vom 30. September auf 1. Oktober wurden in Stuttgart etwa 12 000 französische Soldaten einquartiert. Dabei mag auch die Familie Blumhardt in Bedrängnis oder gar Gefahr gekommen sein. Am 4. Oktober hielt Napoleon selbst seinen großen Einzug in Stuttgart. In den Tagen darauf mußten weitere 40 000 Soldaten einquartiert werden. Überblickt man die Überlieferungen zum Lebensbeginn von Johann Christoph Blumhardt, dann sind von Anfang an drei Klänge deutlich wahrzunehmen: Lobgesang im Namen Jesu Christi, Gebet und Bibellesen. Es sollten die großen Klänge für sein ganzes Leben bleiben, 2. Schulzeit und Landexamen. Zu den beiden Buben gesellten sich im Hause Blumhardt noch weitere 4 Geschwister hinzu. Es wird berichtet, daß Blumhardt auch noch viel Kontakt mit Kindern in der Nachbarschaft und in derVerwandtschaft hatte, natürlich auch in der Schule. Dies war gewiß eine sehr gute Vorschule für seine große Kinderfreundlichkeit zeitlebens.
Als Frühreifer kam er schon mit vier Jahren zur Schule. Da er sehr klein von Wuchs war (er blieb ein »Kleiner« sein Leben lang), trug ihn der Vater öfter zur Schule und der Lehrer zurück, Was im Elternhaus religiös gelebt und von den Kindern miterlebt wurde, fand zunächst in der Bürgerschule und dann im Gymnasium eine segensreiche Fortsetzung durch Lehrer, die wie die Eltern an Jesus Christus als ihren Herrn glaubten. Die Schulbildung entfernte nicht vom Glauben der Eltern. Dadurch ist Blumhardt vor einem »Bruch« in seinem Glaubensleben bewahrt geblieben, so daß er durch keine »Bekehrung« neu zum Glauben finden mußte. Die Bangigkeit der Eltern vor allzu hohen finanziellen Belastungen im Gymnasium wurde durch Zureden der Lehrer mit dem Hinweis überwunden, daß der Sohn auf Grund seiner guten Begabung gewiß bald eine Freistelle erhalten würde, was auch geschehen ist. Stimmlich und musikalisch war er auch recht gut begabt, das Üben machte ihm Freude. Die Bibel, die er im Elternhaus lieb gewonnen hatte, blieb ihm das liebste Buch. Mit 12 Jahren hatte er sie schon zweimal durchgelesen. Der Dreiklang, der ihn von Geburt eingehüllt hatte: Lobgesang, Gebet und Bibellesen, verließ ihn auch nicht während der Schulzeit, im Gegenteil, die Berichte über diese Zeit erwecken den Eindruck, daß er vertieft worden ist. Hier wuchs kein »essigsaurer Mucker« heran, sondern ein im Herrn Jesus fröhlicher Junge. a. Berufsziel und Landexamen 1820. Als Berufsziel ergab sich für Johann Christoph auf Grund seiner inneren Einstellung und dem Vorbild des Onkels das Amt des Pfarrers.
Finanzielle Bedenken brauchten die Eltern deswegen nicht zu haben, weil die Württembergische Landeskirche schon damals die Ordnung hafte, geeignete Kandidaten, die durch ein besonderes »Landexamen« ausgesucht wurden, völlig kostenlos auszubilden und zwar zunächst auf dafür bestehende Seminare und anschließend auf der Universität in Tübingen mit Wohnung im »Stift«, einem ehemaligen Kloster.Nach der Konfirmation 1819, die auf Johann Christoph einen tiefen Eindruck gemacht hatte, wurde er zum Landexamen angemeldet. Von etwa 100 Kandidaten wurden 30 ausgesucht. Hier fand also eine Auslese aus allen Schichten statt, alleinige Voraussetzung entsprechende Leistungen im Gymnasium. Nach seinen Leistungen bestand für Johann Christoph eigentlich kein Bedenken am Bestehen des Examens, trotzdem bestand er es nicht. Da die Möglichkeit zur Wiederholung nach einem Jahr war, entschlossen sich die Eltern dazu. Diesmal bestand er die Prüfung und somit konnte er die Lautbahn eines Pfarrers in der Württembergischen Landeskirche ergreifen.
Das Nichtbestehen des »Landexamens« im ersten Anlauf und das ungewisse Wartenmüssen 1 Jahr lang war - auf Blumhardts ganzes Leben gesehen - eine ausgezeichnete Schule für seine Lebensaufgabe. Er »scheiterte« immer wieder äußerlich, jedes solches »Scheitern« wurde ihm letztlich aber zum großen Gewinn. So auch schon dieses große erste »Scheitern«, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden. 3. Seminar Schöntal 1820- 1824. Blumhardt wurde in das Seminar Schöntal! Jagst eingewiesen. Schon auf der Hinfahrt begann offenkundig zu werden (aus der Rückschau natürlich), weshalb er erst beim zweiten Versuch das Landexamen bestanden hat. Die Kutsche, in der er nach Schöntal gefahren wurde, begegnete unterwegs einer anderen Kutsche, die offensichtlich das gleiche Ziel hatte. Auch in dieser Kutsche saß ein Junge in seinem Alter, nur nicht klein und mit fast schwarzem Haar wie er, sondern groß und mit blondem Haar. Beide sollten vom Eintreffen in Schöntal an eine innige Freundschaft fürs ganze Leben schließen. Darüber hinaus öffnete diese Freundschaft ihm Tor und Herz der Korntaler Brüdergemeinde. Inder anderen Kutsche saß nämlich der Gründer und Leiter eben dieser Brüdergemeinde, Gottlieb Wilhelm Hoffmann mit seinem Sohn Wilhelm.
Schon bald wurde Blumhardt auch nach Korntal eingeladen, wo er seine eigentliche, vor allem seine geistige Heimat fand, sonderlich nachdem der eigene Vater 1822 starb und Hoffmann auch ihm Vater wurde. Hier in Korntal fand Blumhardt das, was er für seine Lebensaufgabe einmal dringend brauchen wird, ihm das Schöntaler Seminaraber nicht geben konnte: Vertiefung des Glaubens durch Gebet und Bibellesen in einer Gemeinschaft, besonders in lutherischer Prägung. Auch der Lobgesang wird in der Gemeinde in Korntal noch ganz anders geklungen haben als im Buben-Seminar in Schöntal. In Schöntal herrschte strenge Zucht, und es wurde sehr fleißig gearbeitet.
Sehr gründlich wurden die alten Sprachen (hebräisch, griechisch, lateinisch) gelehrt und gelernt. Zusammen mit Hoffmann übte sich Blum-hardt auch in der französischen und englischen Sprache. Unterstützt durch Korntal verlor Blumhardt im Seminar auch nicht den Glauben an Jesus Christus als seinen Herrn. Zusammen mit Hoffmann konnte das Seminar so abgeschlossen werden, daß es zum Studium der Theologie und zur Aufnahme ins Stift in Tübingen berechtigte. Blumhardt war für die Zeit in Schöntal und für das, was er dort gelernt hatte, seih Leben lang dankbar. Was er Korntal verdankte, hat er in einer Ansprache zu dessen 50jährigem Jubiläum 1869 in großer Dankbarkeit bekannt: »Ich gehöre seit 1820 dem Geiste der Gemeinde Korntal an. In jenem Jahr kam ich 15 Jahre alt ins Kloster Schöntal....Seitdem war ich auch in allen Ferien, bisweilen 8 Tage lang bei Vater Hoffmann
Inhalt
1. Teil Streiflichter aus Blumhardts Leben und Werk in Gemeinschaft
mit seiner Frau Doris und der geheilten Gottliebin Dittus
A. Zubereitung auf die besondere Lebensaufgabe 16. 7. 1805 - 26. 6. 1842
1. Elternhaus und Kindheit geb. 16. 7. 1805
2. Schulzeit 1805 - 1820, Landexamen 1820
3. Seminar Schöntal 1820 -1824
4. Theologiestudium in Tübingen, Stiftler 1824 - 1829
5. Vikar in Dürrmenz 1829 - 1830 6. Lehrer am Missionshaus in Basel (Verlobung) 1830 - 1837
7. Vikar in Iptingen 1837 - 1838
8. Pfarrer in Möttlingen (Hochzeit) 1. Abschnitt Juli 1838 - 26. 6. 1842
B. Wende - Die Lebensaufgabe 26. 6. 1842
C. Erfüllung der Lebensaufgabe 26. 6. 1842 - 6. 7. 1886
1. In Möttlingen 2. Abschnitt 26. 6. 1842 -1. 7. 1852
1. Kämpfe und Siege 26. 6. 1842 - Ende Dezember 1843
2. Erweckung und ihre Folgen 1. 1. 1844 -1. 7.1852
11. In Bad Boll 1.7.1852-6.7.1886
1. Bis zum Tode von Gottliebin Dittus 26.1.1872
2. Bis zum Tode von Blumhardt 25. 2.1880
3. Bis zum Tode von Doris Blumhardt 6.7.1886
Anhang zum 1. Teil
1. Bad Boll in der Zeit des Sohnes Christoph 6. 7.1886 - 2. 8.1919
2. Bad Boll nach dem Tode von Christoph Blumhardt 1919 bis heute
3. Erweckung durch Blumhardt
a. im Schwarzwald (Johannes Seitz)
b. auf den Fildern bei Stuttgart
4. Möttlingen seit Blumhardts Wegzug
a. Das Dorf
b. Rettungsarche von Friedrich Stanger
c. Pension Kriegbaum
d. Judenchristliche Gemeinde Patmos (Poljak)
e. Blumhardt-Gesellschaft e.V.
5. Psychiatrische Gutachten über den Gottliebin Dittus"„Fall
6. Blumhardt-Forschungsstelle Stuttgart (Dr. Paul Ernst)
2. Teil: Blumhardt-Gemeindesonntag in Möttlingen 20. 7.1980
Festgottesdienst am Vormittag
Grußwort Ortspfarrer Löffler
Predigt Prälat Theo Sorg, Stuttgart
Festversammlung am Nachmittag
Grußwort Dekan Wirth
Grußwort Prälat Askani
Vorträge: Professor Dr. Helmut Lamparter, Tübingen
Landgerichts-Direktor Eberhard Krüger,
Leiter der Rettungsarche
Verleger Friedrich Hänssler, Neuhausen-Stuttgart
3. Teil: Predigt von Dr. Paul Ernst in Möttlingen 11. 8. 1974
Abschiedspredigt von Ortspfarrer Karl Löffler 15. 2. 1981
Pfarrer Richard Haug: J. Chr. Blumhardt und die Reformation
ISBN:9783772202414
Format:15 x 21 cm
Seiten:124
Gewicht:181 g
Verlag:Ernst Franz
Erschienen:1987
Einband:Paperback
Gott begegnete mir, Hans Brandenburg
Der erste Weltkrieg beginnt
Es war am 2. August 1914. Ein Sonntag. Meine Eltern saßen mit uns Kindern, meiner fünfzehnjährigen Schwester Gretel und mir, dem jungen Studenten der Theologie im dritten Semester, beim Morgenfrühstück im Hotel »Westfälischer Hof« am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Trotz der Unruhe der Zeit - die Reichsregierung hatte gestern die Mobilmachung befohlen! - ließ ich mir die knusprigen Berliner Brötchen munden. Ich war jung genug, um das Abenteuerliche der Spannung dieser Tage zu genießen, und unreif und töricht genug zu meinen, daß jetzt einige Wochen deutschen Triumphes folgen würden, von dem ich Zeuge sein durfte. Weltgeschichte! Bisher war sie immer Vergangenheit gewesen. Nun sollte sie als Gegenwart erlebt werden.
Während wir uns am Kaffee stärkten, erschien ein elegant gekleideter Herr an unserem Tisch, zog eine Marke von Metall aus der Tasche und sagte: »Gestatten Sie, ich bin Kriminalbeamter, darf ich Ihre Papiere sehen!«
Die Situation war überraschend und ungewohnt. Ich sah, wie unserem Vater, der eine schwere Operation hinter sich hatte, das alles peinlich war. Er holte seinen Familienpaß aus der Tasche, auf dem wir alle verzeichnet waren, reichte ihn dem Beamten und war sichtlich erleichtert, als dieser nach kurzer Prüfung den Paß zurückreichte und sich dankend verabschiedete. Wir wagten nur noch, im Flüsterton zu sprechen, hatten aber doch alle vier das Gefühl eines vorübergezogenen Gewitters. Ich fand es sehr interessant. Es sollte noch interessanter werden.
»Ich möchte zum Reichstagsgebäude gehen. Um zehn Uhr hält dort der Hofprediger Doehring einen Freilicht-Gottesdienst. Ich komme anschließend gleich wieder.«
Doehring stand auf der Freitreppe des bekannten Wallot-Gebäudes. Das war ein ungünstiger Platz. Ich habe darum von Doehrings Predigt nicht viel gehört, wohl aber den Text verstanden und höre noch seine langsam gesprochenen Worte:
»Fürchte vor der keinem, das du leiden wirst; sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir die Krone des Lebens geben.«
Hernach wurde »Deutschland, Deutschland über alles« gesungen. Ich versuchte, mit einzustimmen, obgleich ich den Text nur flüchtig kannte. Daß ich als Deutschbalte russischer Staatsangehöriger war, fiel für mich in dieser Stunde nicht ins Gewicht, da ich von kleinauf deutsch empfunden hatte.
Singend zogen wir hernach im Demonstrationszug durch die »Linden«. Im Kronprinzenpalais standen die kleinen Söhne des Kronprinzenpaares in weißen Anzügen am Fenster und winkten uns zu. Wir jubelten. - Als ich nach meiner Uhr sah, erschrak ich. Es waren Stunden vergangen. Ich kannte die Nervosität meiner Eltern. Sie würden sich ängsten, denn es war bald Mittagszeit. So drängte ich in die Neustädtische Kirchstraße. Vor dem »Westfälischen Hof«, gegenüber dem Hotel »Continental« sah ich meinen Vater - eines Hauptes länger denn alles Volk! - schon gespannt Ausschau halten. »Gut, daß du kommst. Der Kriminalbeamte war noch einmal da und hat nach dir gefragt. Geh hinauf zur Mutter! Sie hat mit ihm gesprochen. Mich regt das alles zu sehr auf.«
Unsere Mutter ließ sich auch nicht von der preußischen Polizei imponieren, so propreußisch ihr Herz sonst auch schlug. »Was ist denn los? Ist mein Sohn etwa denunziert worden?« hatte sie den Beamten energisch gefragt. Doch in dessen Brust schlug ein gemütvolles Berliner Herz: »Rejen Se sich man nur nich uf,« war seine Antwort. »Ick kann Ihr Mutterherz janz jut vastehn. Aber wissen Se, hier in Ballin passiert niemand wat, der nix losjelassen hat.« Auf diesen Ton reagierte unsere Mutter positiv. Ich fand sie sehr gefaßt.
»Er meinte, du solltest dich selbst auf der Polizeiwache melden. Es braucht nicht schon heute zu sein. Aber, « fügte sie in ihrer bewährten Lebensweisheit hinzu, »geh nur gleich! Es macht einen besseren Eindruck.« Dazu war ich immer bereit. Mit einem »Ich bin gleich wieder da« verabschiedete ich mich, lernte aber in den nächsten Stunden, daß wir unser Leben keineswegs in freier Entscheidung gestalten können.
Die Polizeiwache war in der Mittelstraße nahe den Linden, eine Treppe hoch. Ich grüßte freundlich und berief mich auf die Einladung des Beamten, worauf mir nur kurz geantwortet wurde, ich sollte warten. Ich setzte mich zu einer aufgeregt diskutierenden Gruppe von etwa zehn russisch sprechenden Männern, in der Mehrzahl Juden, die meist aus deutschen Badeorten kamen. Nun geriet ich freilich in ciii völlig anderes Milieu als am Vormittag. »Es ist ja alles gelogen, wiu die deutschen Zeitungen bringen.« »Es ist ja nichts wahr.« »Was wird man denn aus uns machen?« So schwirrte es in der den Beamten unverständlichen Sprache durcheinander.
Endlich hieß es: »Der Wagen ist da! Sie können kommen!« Ja wieso? Wer hat denn einen Wagen bestellt? Als wir unten auf der Straße standen, verstand ich schon mehr. Da stand die bekannte »grüne Minna«, der Arrestantenwagen der Berliner Polizei. Und rechts und links drängte sich das Volk, um die »russischen Spione« zu sehen.
So, nun erlebte ich etwas, was noch keiner meiner Freunde daheim erlebt hatte. Wie freute ich mich schon jetzt aufs Erzählen! Aber ich war noch sehr jung. Meine Mitreisenden hatten schon mehr von der Schattenseite des Lebens gesehen und erlebt. Namentlich die Juden aus Rußland waren an Bedrohung und Ungerechtigkeit gewöhnt. Einer fragte ernsthaft: »Wird man uns gleich erschießen?« - »Nur keine Einzelhaft«, sagte ein anderer, »da werde ich wahnsinnig.« Schließlich fand einer den Mut zu einer Scherzfrage an den Beamten: »Herr Schutzmann, is dis Omnibus ganz ohne Billet?« Der Beamte lächelte väterlich: »Ja, ja, Se fahren janz umsonst.«
Im großen Hof des Polizeipräsidiums hieß es: »Aussteigen! Zu zweien aufstellen!« Der Kommandoton war eindeutig. Wir marschierten in den großen Vortragssaal der Berliner Polizei, wo schon Hunderte von Leidensgenossen unser warteten.
Es dauerte wieder einige Stunden. Ein Beamter, der ein wenig Russisch sprechen konnte, verhörte umständlich jeden Eingelieferten. Als alle registriert waren, erschien ein neuer Herr von höherem Dienstgrad. Seine inhaltsschwere Rede an uns lautete: »Alles hierhergehört! Im Namen des Oberkommandierenden der Mark habe ich Ihnen mitzuteilen, daß Sie sofort die Mark Brandenburg und das deutsche Reichsgebiet zu verlassen haben! Die russische Grenze ist gesperrt. Ich empfehle Ihnen, nach Dänemark zu fahren. Wer morgen noch hier vorgefunden wird, wird unweigerlich eingesteckt. Sie können gehen!« Ich eilte auf schnellstem Wege ins Hotel, um meine Sachen zu packen und noch am gleichen Abend zurück nach Kopenhagen zu fahren. Dort waren wir während der Operation unseres Vaters einige Monate gewesen.
Nach einigen Minuten Überlegens wurden die Hindernisse sichtbar. »Hast du einen Paß?« Wir besaßen nur den erwähnten Familienpaß der uns zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschloß. Den Eltern konnte ich unmöglich eine neue plötzliche Reise zumuten. »Hast du denn Geld?« Unser Vater hatte einen sogenannten Weltkreditbrief mit einer ausreichenden Summe. Aber erstens war es Sonntag, die Banken waren geschlossen. Zweitens war erster Mobilmachungstag, wo auch der beste Freund nichts zu pumpen in der Lage war. Unsere Mutter hatte einen Vorschlag: »Weißt du, Hans, geh doch hin und sprich dich mit den Leuten aus!« Ach, unsere gute Mutter! Die Zeit der Aussprachen war vorbei. Du hattest nie mit der preußischen Polizei zu tun gehabt und hast nie einen Mobilmachungstag erlebt! In den vorkommenden Aussprachen hatte der Angeredete Haltung einzunehmen und höchstens mit einem »Jawohl!« zu antworten.
Just an jenem Tage war ein Freund meines Vaters, der Tuchhändler Georg Holzapfel aus Brandenburg an der Havel, zu den Eltern gekommen. Er sah unsere Verlegenheit und bot mir seine Begleitung an. »Wir werden die Sache schon deichseln«, sagte er.
Bald waren wir wieder auf dem Alex, wie der Berliner das Polizeipräsidium nennt. Hier herrschte ein tolles Tohu-Wabohu. Weinende Kinder suchten ihre Väter, heulende Frauen fragten nach ihren Männern, Beamte mit hochrotem Kopf liefen durch die Korridore. Als wir den entscheidenden Polizeikommissar endlich gefunden hatten, bewies auch dieser, daß seine Nervenkraft zu Ende war.
»Gehen Sie dort hinein! Warten Sie!« schnarrte er uns an. Ich hatte das peinliche Gefühl, schon in eine Zelle gesperrt iu sein. Wir warteten. Ich trank eine Karaffe Wasser aus und schielte immer wieder nach der Uhr. Schließlich kam der Herr. Ich durfte sprechen, erzählte meine Lage und bat höflichst, den Ausweisungstermin um vierundzwanzig Stunden zu verlängern, damit ich mich morgen mit den nötigen Papieren und Reisegeld versehen könnte.
»Was morgen mit Ihnen wird, weiß ich nicht,« war die trostreiche Antwort. Nun, ich wußte es erst recht nicht. In diesem Augenblick kam der Kommissar von heut mittag herein und fragte seinen Kollegen nach dem »Fall«. Ich hörte sie flüstern: »... Ausnahmen ... gestattet. . .« Und wirklich, in wenigen Minuten hatte ich ein postkartengroßes Stück Papier in den Händen. Darauf stand geschrieben:
»Der russische Staatsangehörige stud. theol. Hans Brandenburg, geboren den 4. März 1895 in Riga, ist nicht ausgewiesen.
Berlin, Polizeipräsidium
Abt. VII. Exekutive.« Mützlitz, Polizeikommissar
An der Laune jenes Beamten entschied sich äußerlich gesehen mein Geschick. Ich habe mir oft ausgemalt, was geworden wäre, wenn das Zünglein der Waage auf die andere Seite gegangen wäre. Wäre ich nach Dänemark gefahren, so wäre ich im Kriege ins russische Heer eingezogen worden. Selbst wenn ich am Leben geblieben wäre, so wäre mein Leben äußerlich und wahrscheinlich auch innerlich anders verlaufen. Viel später erkannte ich, daß hier Gottes allmächtige Hand am Hebel gelegen hatte.
Von einer Weiterreise der Eltern zur Nachkur in die Schweizer Berge war nun keine Rede mehr. Bald hatten wir alle die Auflage, uns
als »feindliche Ausländer« jede Woche auf der Polizei zu melden und unsere Wohnung nicht ohne polizeiliche Zustimmung zu verändern. Bis auf diese Auflage geschah uns nichts.
Es ist nötig, hier einen Rückblick auf das Jahr zu tun, das diesen Ereignissen voranging. Vor einem Jahr war ich nicht unbeschwert,
aber doch mit einer neugierigen Spannung nach Dorpat an die Uni-
versität gegangen, wo ich einer Studentenkorporation beitrat. Hier herrschte noch der alte sogenannte Pennalismus, d. h. jene Erziehung
der jungen Semester, die reichlich roh war, obgleich sie zur Erziehung
zum vollen Mannestum beitragen sollte. Dieser Härte war ich weder äußerlich noch innerlich gewachsen. Ich war an der Mutter Schürze
aufgewachsen, dazu in einem Elternhause, das in ungewöhnlicher
Sauberkeit alle Schattenseiten des Lebens uns Kindern fernzuhalten wußte; nun brach in mir meine kindliche Weltansicht zusammen. Ich
merkte erschrocken, welche Gewalt nicht nur Bacchus, sondern auch
Venus über die jungen Menschen hatte. Auch über solche, die ich bisher alle für höchst »anständig« anzusehen gewohnt war. Ich habe
nachträglich meinem Gott zu danken, daß er mich vor vielem bewahrte, auch wenn ich nicht entfernt die sittliche Kraft zu einem wirksamen Protest hatte. Gewiß gab es daneben auch nette Geselligkeit, gute Musik und Einladungen zu Tanzfesten.
In Dorpat war mir ein Zeuge Christi begegnet, der mir durch seine Art noch mehr als durch seine Predigt die Wirklichkeit Jesu nahe-
brachte, wie ich sie bisher noch nicht gekannt hatte. Es war Professor
Traugott Hahn. Ich hörte bei ihm die Einführung in das theologische Studium. Gerade hier verstand er, uns die geistlichen Voraussetzun-
gen für den Predigtdienst zu zeigen und uns in seiner seelsorger-lichen Art zu dienen. Noch besitze ich das Exemplar von Generalsuperintendent Brauns Schrift »Die Bekehrung der Pastoren«, die ich mir auf seine Empfehlung hin als eine der wichtigsten Schriften für den werdenden Theologen kaufte. Für mich waren das neue Töne. Sie unterstrichen meine Ahnung, wo bei mir das Entscheidende fehlte. Einmal war ich zu einem offenen Abend bei ihm eingeladen. Ein englischer Student berichtete von der christlichen Studenten-Welt-Konferenz in Lake Mohonk bei New York. Zum ersten Mal hörte ich von der christlichen Studentenbewegung. Auch der Name John Motts fiel. Mich packte eine große Sehnsucht nach einem Studentenleben unter Christus.
Einmal im Laufe des Semesters schien sich eine Tür für mich aufzutun. Ich erfuhr überraschend, daß bei Hahn eine Studentenbude frei sei. Dann hätte ich gewiß persönlich engere Fühlung mit ihm bekommen und vielleicht sogar den Mut zu der so nötigen seelsorger-lichen Aussprache gefunden. Aber ich unterließ es, mich um das Zimmer zu bemühen. In der studentischen Verbindung fühlte ich mich trotz vieler guter Freunde fremd. Zum Studium fand ich nicht genügend Zeit. Vieles fand ich reichlich trocken, es ging wohl auch über mein Fassungsvermögen. Ich litt an Heimweh, fand aber keinen Mut, einen klaren Schnitt zu tun. Einmal ging ich zu meinem Oldermann (Fuchsmajor), der selbst Theologe war, und erklärte ihm meinen Willen, aus der Verbindung auszutreten. Aber jenem gelang es in wenigen Minuten, meinen Entschluß rückgängig zu machen. Heute glaube ich, daß ich damals einen entscheidenden Ruf Christi überhört habe. Im Buche Hiob heißt es einmal: »Solches tut der Herr zwei-oder dreimal mit einem jeglichen« (33, 29).
Es ging in den Frühling, als mein Vater so ernst erkrankte, daß ich von Dorpat nach Hause gerufen wurde. Bald zeigte sich, daß eine Operation nötig war, und so kam es dann statt einer fröhlichen Sommerreise nach Wien zur Reise über Berlin nach Kopenhagen, wo mein Vater bei einem Spezialisten operiert wurde.
Der Aufenthalt in Kopenhagen zog sich zwei Monate hin. Die Operation verlief günstig, aber eine leichte Embolie führte zu Komplikationen. Unsere Mutter durfte bei Vater in der Privatklinik wohnen. Für uns beide junge Menschen, meine Schwester und mich, wurde eine Pension gefunden. Da eine konkrete Sorge um den Vater nicht mehr bestand, haben wir beide die sonnendurchglühten Wochen dieses Sommers in der so wunderschönen nordischen Hauptstadt restlos genossen.
In dieses idyllische Sommerleben war die furchtbare Nachricht von dem Attentat in Sarajewo geplatzt. Wir waren zwar von Rußland an solche Ereignisse gewöhnt, aber auch ohne tieferes politisches Urteil ahnten wir die Gefahr. Doch die Telegrafenagenturen arbeiteten unvergleichlich langsamer als heutzutage, so daß wir unvorbereitet auf kriegerische Ereignisse Ende Juli in Berlin eingetroffen waren.
Mein Vater war durch den langen Krankenhausaufenthalt körperlich und nervlich geschwächt. Auch die Mutter brauchte nach all den sorgenvollen Wochen eine Erholung. Aber wie wenig konnte ich in diesen schweren Monaten meine Eltern stützen! Wir Balten waren an eine privatisierende Existenzform des Bürgers gewöhnt. Eine Beteiligung an politischen Ereignissen oder auch nur eine Einflußnahme kam in Rußland kaum in Frage. Gewiß sparten wir dadurch viel Kraft. Und die vielgerühmte baltische Geselligkeit, die Freude an guten Büchern und fruchtbarer Unterhaltung hing bei uns auch damit zusammen, daß es bei uns weder politische Vereine noch politische Stammtische gab.
Bis auf das Revolutionsjahr 1905 war unsere Familie von politischen Ereignissen kaum gestreift worden. Das wurde nun anders. Ich erlebte handgreiflich an meinen Eltern, wie das bürgerliche Zeitalter aufhörte. Vierzig Jahre hatte Deutschland im Frieden gelebt. Wir glaubten, es dem Deutschen Reich zu verdanken, daß es ein europäisches Gleichgewicht gab. Auch das hörte nun auf.
Wir waren wochen- und monatelang nur auf Gerüchte angewiesen. Die Postverbindung nach der Heimat hatte aufgehört. Mein ältester Bruder, der das väterliche Geschäft leitete, war zwar nie Soldat gewesen - wurde er etwa einberufen? Wie wurde die russische Politik gegenüber den Deutschbalten sein? Bald kamen Nachrichten von Verbannungen und Verhaftungen. Einiges war wahr, anderes übertrieben und unwahr, wie es in solchen Zeiten zu sein pflegt. Wir saßen tatenlos da und warteten.
An einem der ersten Sonntage machte ich mich auf, um die Stadt-missionskirche zu suchen. Dort sollte Pastor Paul Le Seur predigen, von dem ich schon in Riga gehört hatte. Nun saß ich Sonntag für Sonntag unter der alten Stöckerkanzel. Le Seurs männlicher Ernst und ritterliche Erscheinung, seine klugen Predigten und seine klangvolle Stimme zogen mich an. Vielleicht hätte ich aus seinem Munde das helfende Wort für mich gehört, wenn er nicht nach einigen Wochen schon seine Abschiedspredigt gehalten hätte. Er wurde Garnison-prediger im besetzten Brüssel. Von nun an stand während der näch-
sten Jahre alle vierzehn Tage der bekannte Evangelist Samuel Keller auf seiner Kanzel. Von ihm hatte ich vorher nie etwas gehört. Die
Männer der neueren Erweckungsbewegung waren mir unbekannt. Daß ich nun in der Reichshauptstadt den baltischen Christuszeugen Keller hören durfte, der jahrzehntelang im Süden Rußlands ein Rufer zu Jesus gewesen war, war für meinen Weg zu Gott von großer Bedeutung. Gewiß zog mich zuerst viel Äußeres zu ihm. Da war zuerst sein baltischer Dialekt und seine drastische Sprache. Gelegentlich blitzte sein Humor durch die Predigt hindurch, so daß ein fröhliches Lachen in der Kirche erschallte. Doch uni so eindrucksvoller war der Ernst seines nächsten Satzes. Er sprach keine billige »Sprache Kana-ans«, sondern redete in der Sprache seiner Zeit in immer neuen Gleichnissen. Er rief das Gewissen zur Umkehr und zur Entscheidung für Jesus auf. Ich merkte bald: Hier war, was mir fehlte! Doch hörte ich ihn nicht ganz ohne Bangigkeit, weil ich immer deutlicher den Totalitätsanspruch Jesu erkannte. Immer noch hoffte ich, den vollen Segen Gottes auch ohne Kapitulation zu erlangen.
Im Januar 1915 war es wohl, als Pastor Keller eines Sonntags zum Eintritt in den Kirchenchor aufforderte, zumal in der Kriegszeit die Männerstimmen fehlten. Nach Rücksprache mit den Eltern meldete ich mich und wurde so der zweite Baß im Chor der Stadtmissions-kirche. Diese bescheidene Mitarbeit sollte noch die weitgehendsten Folgen für mein Leben haben. Fürs erste waren die Chorproben für mich die Höhepunkte der inhaltslosen Wochen.
Einige Wochen später saßen wir zum Mittag wieder einmal im »Heidelberger«. Plötzlich sagte mein Vater fast erschrocken: »Sitzt nicht dort Konsul Mantel • aus Riga?« Es war der Schweizerische Icon-sul aus unserer Heimatstadt. Unser Vater war in der ungewohnten Situation eines »feindlichen Ausländers« fast menschenscheu geworden. Doch der liebe Schweizer »Landsmann« kam mit einer herzlichen Begrüßung an unsern Tisch: »Aber, Herr Brandenburg, was machen Sie denn hier?« fragte der freundliche Herr. Unser Vater versuchte, ihm die Tragödie unserer durch den Krieg zerrissenen Familie zu schildern. Konsul Mantel war aber davon keineswegs so stark beeindruckt, sondern redete den Eltern kräftig zu, über Schweden die Heimreise anzutreten, was durchaus statthaft sei.
Wahrscheinlich hätten die Eltern diesen Entschluß nicht gefaßt, wenn der neutrale Schweizer nicht versprochen hätte, sich den Eltern in wenigen Wochen auf der Rückreise nach Riga anzuschließen.
Es folgten Wochen aufregender und anstrengender Vorbereitung. Daß ich als Zwanzigjähriger und »kriegsverwendungsfähig«, wie das schöne Wort lautete, nicht hinausgelassen würde, war uns allen klar. Ein paar tausend Mark für meinen Lebensunterhalt hinterlegte mein Vater bei einem Geschäftsfreund. Durch seine Vermittlung wurde ein
Zimmer bei einer Witwe in Lankwitz, einer gartenreichen Gegend, für mich gefunden. Zahllose Behördengänge, ein langer Papierkrieg und viele Besorgungen waren nötig. Schmerzlich verlief der Besuch auf der Fremdenpolizei auf dem Alexanderplatz, wohin ich meinen Vater begleitete. Obwohl die Beamten korrekt und freundlich waren, regte meinen Vater das alles so auf, daß er einen Weinkrampf bekam. Er klagte darüber, seinen Sohn allein in Berlin lassen zu müssen. Der Beamte tröstete meinen Vater wie ein guter Freund.
»Aber Herr Brandenburg, da brauchen Sie sich wirklich nicht aufzuregen! Wenn ihr Sohn Rat braucht, kann er jederzeit zu mir kommen. Hier ist meine Visitenkarte!« Ich steckte die Karte uninteressiert in meine Jackentasche, weil ich ganz mit meinem Vater beschäftigt und froh war, als er sich beruhigt hatte und wir ins Hotel zurückkehrten.
Schließlich kam jener Tag im April 1915, an dem die Eltern mit meiner Schwester in Begleitung des Freundes auf dem Stettiner Bahnhof den Zug bestiegen, um in einem großen Bogen über Saßnitz Trelleborg - Stockholm - Haparanda - Finnland - Petersburg nach Riga zu fahren.
II. Bekehrt zum Dienst
Nachdem der Zug gen Norden aus der Halle gerollt war, ging ich auf die Polizeiwache, wo der Wachtmeister mir schon lange wohlgesonnen war,
»Heut sehen Sie mich zum letztenmal, Herr Wachtmeister, morgen ziehe ich um nach Lankwitz!«
»Lankwitz? Tut mir leid, Herr Brandenburg, aber det jeht nich so ohne weiteres. Lankwitz jehört nich mehr zum Landespolizeibezirk Berlin. Da müssen Se zuerst ein Jesuch machen, und Se wissen ja, det dauert immer so rund vier Wochen. «
Ich erschrak.
»Herr Wachtmeester, machen Se keene Witze, id< muß morgen hin. Jck hab mein Zimmer schon jekündigt. Wo soll id< auch det Jeld hernehmen für 'nen langen Hotelaufenthalt? Außerdem jeht mir det
ISBN 3-417-00432-3
Kinderkrankheiten des Glaubens - Gesetzlichkeit und Schwärmerei, Hans Brandenburg
EIN WORT ZUVOR
Als Kinder haben wir fast alle den Keuchhusten oder die Windpocken durchgemacht. So quälend für Kinder und Eltern diese Krankheiten auch sein mögen — sie sind meist ungefährlich und nach kurzer Zeit überwunden. Es kann sogar dazu kommen, daß wir nach der Rekonvaleszenz gesünder und kräftiger wurden als vor der Erkrankung. Es ist, als hätte der Kinderkörper im Kampf mit der Krankheit seine Kräfte gestärkt. Etwas Ähnliches geschieht mit dem Glaubenden, der in der Wiedergeburt ein neues Leben erhielt. »Als die neugeborenen Kindlein« - so spricht der erfahrene Apostel Petrus von solchen neu für Jesus gewonnenen jungen Christen.
Wie das neugeborene Menschenkind leicht anfällig ist und vor Erkältung, Infektion, Darmbeschwerden und ähnlichen Dingen bewahrt werden muß, so brauchen Neuerweckte gleichfalls Schutz und Pflege, und es ist eine alte Erfahrung, daß die Seelsorge an ihnen schwieriger ist als an Ungläubigen. Diesen kann man ja nur die Botschaft bringen: Komm und wag es mit Jesus ! Aber jene, die sich üben müssen, bei Jesus zu bleiben wie die Reben am Weinstock, kommen in unzählige gefahrvolle Situationen, Gegenangriffe des Feindes, dem sie entrissen wurden, Versuchungen zur Selbstsicherheit oder auch zum Verzagen usw. Von zwei Gefahren wurden wir fast alle auf den ersten Schritten des Glaubens bedroht:
Entweder wir wurden skrupelhaft ängstlich und eng, um ja das Ziel nicht zu verfehlen. Dann wurden wir gesetzlich. Oder aber wir suchten, mit eigenen Mitteln die Wirkung des heiligen Geistes zu steigern, und hörten begierig auf jene Stimmen, die uns noch mehr versprachen, als der Glaube dem Bußfertigen gibt. Und so gerieten wir in Unnüchternheit und Schwärmerei. Beide Abweichungen sind so naheliegend, daß es überraschend wäre, wenn jemand unangefochten bliebe. Wir wollen die Gefahr nicht dramatisieren.
An Windpocken ist wohl kaum ein Kind gestorben. Aber es können Nebenwirkungen eintreten, und der Körper kann sich den Einwirkungen anderer Bazillen nicht erwehren. Dann wird's gefährlich. Wenn Gesetzlichkeit kein Durchgangsstadium ist, wenn Schwärmerei zu einem chronischen Zustand wird, dann ist die Gefahr allerdings nicht gering. Wie leicht wird das Evangelium Jesu Christi verfälscht. Diese Kinderkrankheiten sind auch ansteckend. Davon zeugt die Kirchengeschichte eindeutig. Auch die Apostelbriefe sprechen davon. Hätten wir mehr geschichtliches Denken, das heute so verpönt ist, so hätten wir auch mehr Abwehrstoffe. Weil das nicht der Fall ist, soll durch dieses Buch der Versuch zur Hilfe gemacht werden. Es geht hier nicht um ein schulmeisterliches Warnen. Wir kennen jene Krankheitsstoffe im eigenen Leben zur Genüge. Wir drücken den gesetzlichen wie den schwärmerischen Christen brüderlich die Hand. Laßt uns miteinander unsere Lage in Ruhe und Nüchternheit zu beurteilen suchen - als die Beschenkten Jesu Christi ! Nur er, der die Quelle des neuen Lebens ist, hat auch die Heilmittel. Und er verheißt, daß sein Vater mit dem Winzermesser die Reben reinigen wolle. Darum heißt unsere Bitte: »Reinige uns, damit wir mehr Frucht bringen!« Für den Anfänger sind die hier behandelten Fragen insofern nicht leicht, als jene beiden Irrwege sich scheinbar auf die Bibel berufen dürfen. Eine gute Bibelkenntnis schützt noch nicht ohne weiteres vor Verirrungen. Haben nicht Jesus und Paulus die Verbindlichkeit des Gesetzes betont? Lesen Sie dazu Matth. 5,17—19; Rom. 2,13; 3,31; 1. Kor. 9,21. Andererseits wissen wir, daß es ohne den heiligen Geist keinen Christenglauben und kein Christenleben gibt. Denken wir an das Wort des Paulus (Eph. 5,18): »Werdet voll Geistes!« Es ist für den Anfänger schwer, auf dem schmalen Wege zu bleiben, ohne nach links oder rechts abzugleiten. Darum tut eine Besinnung uns allen not. Sowohl die Gesetzlichkeit wie auch die Schwärmerei haben den Wunsch, in uns das göttliche Leben durch Christus zu stärken. Daher werden beide Abweichungen gerade bei eifrigen Christen gefunden. Diese aber werden scharf beobachtet, und durch ihr Verhalten kann ihr Zeugnis gefährdet werden. Denn der Unglaube beurteilt nach ihnen das »Christentum« : Ist es das wahre, oder ist es verzerrt? Das ist unsere Frage.
A. Die Gesetzlichkeit I.
Was ist das Gesetz im Alten und und im Neuen Testament? Im weitesten Sinn wird die Bezeichnung »Gesetz« (hebräisch:Thora) für das ganze Wort des Alten Bundes benutzt.* Das Gesetz ist der sich in der Heilsgeschichte offenbarende Wille Gottes. Darum ist das Gesetz ewig, denn Gott ändert sich nicht. Die Ausdrücke und Formen dagegen können sich wandeln. Jesus selbst gibt eine Erklärung für das Ziel aller Gesetze Gottes, wenn er vom Liebesgebot gegenüber Gott und den Nächsten sagt : »In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten« (Matth. 22,40). Darum schreibt Paulus: »Wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt« und »So ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung« (Rom. 13,8.10). * Der Israelit kennt drei Teile seiner Bibel: Das Gesetz (Thora), die Propheten (Nebiim), die Schriften (Ketubim). Die fünf Bücher Mose sind die Thora. Zu den Nebiim rechnet er die prophetisch erzählenden Bücher Josua, Richter, ersten und zweiten Samuel, ersten und zweiten Könige, die sogenannten großen Propheten Jesaja, jeremia, Hesekiel und die zwölf kleinen Propheten. Alle übrigen Schriften gehören zum dritten Teil: Der Psalter, die Sprüche Salomos, Hiob, das Hohelied, Ruth, die Klagelieder, der Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia und die beiden Bücher der Chronik. Die fünf zuletzt Genannten sind in den dritten Teil geraten, weil ihre Niederschrift nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft geschah (vgl. Luk. 24,27). Statt den »Schriften« sagte man auch kurz »die Psalmen«, weil diese am Anfang des dritten Teiles standen. (Vgl.auch Luk. 24,44). Meist aber sagte man für unser Altes Testament: »Das Gesetz und die Propheten« oder auch »Mose und diePropheten« (vgl. Luk.16,29.31; Matth. 5,17; 7,12; 22,40; Joh. 1,45; Apg. 24,14). Doch konnte statt dessen auch nur der wichtigste Teil genannt werden: »das Gesetz« oder »Mose. (vgl. Apg. 6,13; 15,21 ; Rom. 9,4; Gai. 1,14). Wenn in den Pslatnen das Gesetz hoch gepriesen wird, so ist damit das ganze Wort Gottes gemeint (vgl. Ps. 1,2; 94,12; besonders Ps. 119).
Gesetzlosigkeit führt zu Gottlosigkeit
Ohne das Gesetz kennen wir Gottes Willen nicht. Ohne Kenntnis des Willens Gottes erkennen wir auch nicht unsern Ungehorsam und unsere Auflehnung gegen Gott, das heißt unsere Sünde (Rom. 3,20). Deshalb ist das Gesetz »unser Zuchtmeister auf Christushin« (Gai. 3,24). Das Gesetz überführt uns also von der Sünde und macht uns der Gnade Gottes bedürftig. So ist das Gesetz eine große, entscheidende Gabe Gottes an uns. Das Gesetz erinnert uns auch täglich daran, daß es ohne Gehorsam keinen Dienst für den lebendigen Gott gibt. Wer das Gesetz verneint, der ist in dauernder Gefahr, Gott in seinen Dienst zu nehmen, statt seinerseits Gott zu dienen. Darum ist jede Art von Magie und Zauberei dem Herrn ein Greuel. Denn auf diesem Wege -auch Wahrsagerei oder Beschwörung gehören dazu - versucht der Mensch, sich der Gottheit, ihres Wissens und ihrer Macht zu bemächtigen. Dazu gehört auch alle Besprechung von Krankheiten, der Rose, der Blutungen usw. Hier wird nicht nach dem sittlichen Gehorsam, sondern nach der rechten Zauberformel gefragt. Man redet gottlos von Gott und rechnet mit seiner Kraft ohne Buße oder Bekehrung. Aber auch alle Stimmungsfrömmigkeit, die unser Gottesverhältnis von frommen Gefühlen oder Gemütserhebungen abhängig macht, führt leicht zu einer Religiosität ohne Gehorsam. Das war die Gefahr der Romantik. Man denke an den jungen Schleiermacher, der in seiner »Lucinde« den Ehebruch schöngeistig entschuldigt. Das Genie ist danach moralisch frei und nicht an Gottes Gebot gebunden. Und schließlich gilt das Gleiche auch von einer intellektualistischen Frömmigkeit, wo folgerichtiges Denken, Lehrformen oder vernünftige Erklärungen das Entscheidende sind. Man flieht aus der Tat in die Gedanken. Adolf Schlatter nannte das die »griechische Gefahr«.
Die Griechen waren begabte Dialektiker und machten aus dem Glaubensverhältnis zu Gott ein Gedankenspiel. Auch hier konnte auf eine Gewissensbindung an Gottes Gesetz verzich- tet werden. Wenn die Gedanken nur richtig sind ! Vor allen solchen Entgleistungen und Einseitigkeiten bewahrt uns das Gesetz. Mose erzog sein Volk zu sittlichem Glauben, zu einem auf Gehorsam beruhenden Verhältnis zum Schöpfer der Welt und Herrn der Geschichte. Im Neuen Testament ist das nicht anders : »Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote« sagte Jesus (Joh. 14,15 auch 15,10). Das gilt auch für seine Apostel, die in ihren Briefen viele sittlichen Anweisungen bringen. Wie Jesus das Gesetz versteht Jesus sagt an entscheidender Stelle: »Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen« (Matth. 5,17). Es fällt hier auf, daß Jesus die Propheten neben das Gesetz stellt und damit das ganze Buch des Alten Testaments bezeichnet (vgl. Luk. 16,29).
Es geht also nicht nur um Einzelnes, sondern um das Ganze der alttestamentlichen Offenbarung. Allerdings fügt Jesus hinzu : »Ich sage euch wahrlich : Bis daß Himmel und Erde zergeht, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich« (Matth. 5,18.19). Ständen diese Worte allein in der Bergpredigt, so wären Jesu Botschaft und die der Schriftgelehrten sich gleich. Aber nur wenige Verse weiter lesen wir Jesu machtvolle Gegenüberstellung: »Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist... Ich aber sage euch ... « (Matth. 5,21ff. 27ff. 31f. 33ff. 38ff. 43ff).
Wer diese Abschnitte im Zusammenhang liest, wird erkennen, daß Jesus sein Wort nicht nur über die rabbinische Auslegung des Gesetzes stellt, sondern daß er auch die Vollmacht hat, die Vorschriften des Alten Testaments zu übersteigern, ja zu korrigieren. Es scheint, als ob er doch manch »Tüttel« im Gesetz ändere. Aber er beweist damit, wie er jene Worte verstanden haben will. Er liest im Gesetz seines Vaters Absichten, die in allen Geboten auf das größte Gebot zielen, das er in der Antwort an den Schriftgelehrten mit den Worten ausdrückt: »Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemute ! Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich :
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst ! In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten« (Matth. 22,37-40). Wieder nimmt Jesus das alttestamentliche Wort als Einheit, zumal auch viele Prophetenreden auf die Gesetze Moses zurückverweisen oder ihre Bedeutung erklären. Nun darf Jesu Antwort gewiß nicht so verstanden werden, als wäre das übrige Gesetz überflüssig und als genügten diese beiden Gebote. Dem reichen Jüngling hat er auf seine Frage nach dem ewigen Leben geantwortet: »Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. « Und auf die Frage : »Welche ?« antwortete Jesus : »Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen ; du sollst nicht falsch Zeugnis geben ; Ehre Vater und Mutter ; und : du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (Matth. 19,16ff ).
Jesus begnügt sich hier also nicht mit dem letztgenannten Gebot, sondern hält dem Fragenden auch vier Gebote der zweiten Tafel und ein Gebot der ersten Tafel Moses als Beispiele vor. Vom Ehescheidungsgesetz des Mose, das Jesus schon in der Bergpredigt überhöhte, sagt er im selben 19. Kapitel des Matthäus: »Mose hat euch erlaubt zu scheiden von euren Frauen wegen eures Herzens Härtigkeit; von Anbeginn aber ist's nicht also gewesen.« Mithin sieht Jesus in der Vorschrift des sogenannten Scheidebriefs nur eine vorläufige Erlaubnis. Auch hier ein Beispiel, daß es mit der äußerlichen Erfüllung der mosaischen Vorschriften nicht getan ist. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht Eines der wichtigsten Gesetze für das Volk Israel war das Sabbatgebot, auf das auch die Propheten ernst hinwiesen.
Es war wie die Beschneidung ein entscheidendes Kennzeichen des Bundesvolkes Gottes (Jes. 56,2; 58,13; Hes. 20,13). Aber gerade an dieser Vorschrift entzündete sich Jesu Kampf gegen die Pharisäer. Wiederholt hat Jesus am Sabbat geheilt und damit jedenfalls die Auffassung der Pharisäer und Schriftgelehrten verletzt (Matth. 12,10ff ; Luk. 13,15ff ; 14,3ff ; Joh. 5,16). Der Geheilte am Teich Bethesda trägt auf Jesu Geheiß hin sein Lager am Sabbat nach Hause! Auch die Heilung des Blindgeborenen geschieht am Sabbat, und Jesus veranlaßt den Geheilten, sich die Augen am Teich Siloah zu waschen (Joh. 9). Ja, Jesus beansprucht die Vollmacht für sich, über dem Sabbatgebot zu stehen: »Des Menschen Sohn ist ein Herr auch über den Sabbat« (Matth. 12,8). Nach Mark. 2,27 fügt er auch hinzu : »Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen.« Das ist eine neue Stellung zum Gesetz, das dem Menschen einen hilfreichen Dienst tun soll, aber ohne diesen zu versklaven. Die Bindung an Jesus ist stärker als die Bindung an das Gesetz.
Das nähert sich schon der Auffassung des Paulus (Gai. 3,19), von der noch die Rede sein soll. Nach der Meinung der Pharisäer war es auch eine Gesetzesübertretung, daß Jesus »mit den Zöllnern und Sündern« aß (Matth. 9,11 ; Luk. 15,2) oder daß ersieh von der »Sünderin« berühren ließ (Luk. 7,39). Nach Matth. 15,Iff lautet der Vorwurf der Schriftgelehrten und Pharisäer: »Warum übertreten deine Jünger die Vorschriften der Ältesten? Sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen.« Jesu Antwort ist eindeutig: »Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Vorschriften willen ?« Die Vorschriften der damaligen Gesetzesausleger gingen so weit, daß Kinder darüber die Fürsorge für ihre alten Eltern vergessen und sie darben lassen konnten. Ihre Gaben galten statt dessen dem Tempel. Jesus charakterisiert diese Haltung mit dem Wort aus dem Propheten :
»Dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen ; aber ihr Herz ist ferne von mir« (Matth. 15,8 ; Jes.29,13). Nach Jesu Haltung und Urteil gibt es also ein formales Halten des Gesetzes Gottes - im Ungehorsam! Äußerlich geschieht viel, aber das Herz, die persönliche Beteiligung der Liebe, fehlt. Dagegen haben schon die alten Propheten gepredigt und geschrieben (z. B. Jes. l,llff ; Jer. 6,20; Am. 5,22f). Jesus kennt und straft eine Gesetzlichkeit, die eigentlich eine Flucht vor Gott ist. Man kann sich nämlich durch äußere Frömmigkeit dem Bußruf Jesu entziehen. Wie der reiche Jüngling zu reich war, um in die Nachfolge Jesu zu kommen, so ist manch einer zu »fromm«, um sich Jesus anzuschließen. Man kann also formal das Gesetz halten und das zum Vorwand nehmen, um das Ziel des Gesetzes: volle Liebe zu Gott und dem Nächsten, zu umgehen. Christus — das Ziel des Gesetzes
Das hat unter den Aposteln niemand so deutlich erkannt und darauf in seinen Predigten und Briefen hingewiesen wie der ehema- lige Pharisäer Saul von Tarsus, der Apostel Paulus. Er anerkennt Israels Reichtum auch am Gesetz (Rom. 9,4). Er anerkennt auch den Eifer Israels um das Gesetz. Aber er sagt: »Sie eifern um Gott, aber mit Unverstand« (Rom. 10,2). Er schämt sich nicht zuzugeben, daß er einst »zunahm im Judentum über viele seinesgleichen in seinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz« (Gai. 1,14). Und er bekennt, daß er wohl »nach dem Gesetz ein Pharisäer . . . nach der Gerechtigkeit im Gesetz unsträflich« gewesen sei. Er fährt jedoch fort: »Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet« (Phil. 3,5-7). Er hat einen völlig anderen Weg zur Gerechtigkeit gefunden und so das Wohlgefallen Gottes gewonnen.
Der Brief an die Römer, Rudolf Brockhaus
Der Brief an die Römer
Rudolf Brockhaus
Einleitung
Der Brief an die Römer wurde in dem Jahr 58 oder 59 n. Chr. von Korinth aus geschrieben, als Paulus im Begriff stand, nach Jerusalem zu reisen und die „Hilfleistung" der in Achaja und Macedonien wohnenden Gläubigen dorthin zu bringen. (Kap. 15,25—28; vergl. auch Kap.16,1 — „Kenchreä" war eine der Hafenstädte Korinths.) Paulus selbst war bis dahin nie in Rom gewesen, obwohl es ihn schon „seit vielen Jahren" sehnlich verlangt hatte, die Gläubigen dort zu sehen. Wie das Werk in Rom seinen Anfang genommen und welche Mittel Gott gebraucht hat zur Gründung der dortigen Gemeinde, darüber ist uns nichts Sicheres bekannt. Man nimmt gewöhnlich an, daß in Rom wohnende Juden, die auf ihren jährlichen Festreisen nach Jerusalem von den Vorgängen dort unterrichtet worden waren, die Kunde von Jesu in die große Hauptstadt der Welt gebracht haben. Jedenfalls steht fest, daß weder Paulus noch Petrus, der Apostel der Beschneidung, hierbei in Frage kommen können. Beide Männer sind erst wenige Jahre vor ihrem Märtyrertode, der ungefähr um die gleiche Zeit stattfand, nach Rom gekommen.
War es nicht durch die Weisheit Gottes so geordnet, daß gerade Rom sich nicht einer durch apostolische Wirksamkeit gegründeten Versammlung rühmen konnte, gleich anderen, viel unbedeutenderen Städten, wie Ephesus, Korinth, Philipp! usw.? Hat nicht gerade dieser Umstand Anlaß gegeben zu einer so umfassenden schriftlichen Abhandlung über den Zustand des Menschen von Natur, über Gottes mächtige Dazwischenkunft im Evangelium, über die Rechtfertigung des Glaubenden durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi usw.?
Wäre der Apostel früher nach Rom gekommen, wie er es vorhatte, würde er naturgemäß das, was wir jetzt in seinem Briefe niedergelegt finden, den Gläubigen in Rom mündlich mitgeteilt haben. Zugleich hatte Gott die Zustände in Rom inzwischen sich so gestalten lassen, daß sie eine solch eingehende und gründliche Behandlung der Grundwahrheiten des Evangeliums nötig machten. Denn obwohl die Versammlung in Rom vorwiegend aus Christen, die aus den Heiden gekommen waren, bestanden haben wird, gab es doch ohne Zweifel auch ein gut Teil bekehrter Juden in ihrer Mitte, und unter diesen solche, die einen gesetzlichen Geist — „berühre nicht, koste nicht, betaste nicht!" — einzuführen suchten, dem gegenüber die Gläubigen aus den Heiden in Gefahr kamen, ihrerseits einer fleischlichen Freiheit das Wort zu reden. Dadurch waren lieblose Reibereien entstanden, die nicht nur Zwietracht und Spaltung herbeizuführen, sondern auch die Wahrheit zu verderben drohten.
Dem Brief an die Römer ist bei der Feststellung des Kanons der heiligen Schriften die erste Stelle unter allen Briefen der Apostel angewiesen worden, obwohl er der Zeit seiner Abfassung nach keineswegs der erste ist. Die Briefe an die Thessalonicher, Galater und Korinther sind früher geschrieben. Warum man ihm diesen Platz gegeben hat, geht zum Teil schon aus dem eben Gesagten hervor.
In Verbindung mit der Beziehung oder dem Verhältnis des Menschen zu Gott werden in der Schrift zwei große Gegenstände behandelt. Diese sind einerseits der Mensch in seiner Verantwortlichkeit Gott gegenüber, und andererseits der Gnadenratschluß Gottes dem Menschen gegenüber. Der eine hat seine Darstellung gefunden in dem ersten Menschen, Adam, der andere in dem zweiten Menschen, dem letzten Adam, in Jesu Christo, dem Sohne Gottes. Der erste Mensch, aufrichtig und rein erschaffen, wurde in dem Stande der Unschuld in den Garten Eden gestellt, dessen zwei Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, auf die Möglichkeit eines endlosen Lebens für den Menschen und auf die Verantwortlichkeit des Menschen Gott gegenüber hindeuteten. Statt daß der Mensch nun seine Abhängigkeit von Gott bewahrt hätte und so ewiglich auf der Erde hätte leben können, hat er sich gegen Gott erhoben, Sein Gebot übertreten und damit Leben und Unschuld verloren. Und als später in dem Gesetz vom Sinai die Frage bezüglich des Lebens und der Verantwortlichkeit noch einmal erhoben wurde, hat der Mensch das Gesetz gebrochen und ist unter Fluch und Gericht gekommen. Und wenn schließlich Gott in unendlicher Güte in der Person Seines Sohnes in dieser Welt erschien, hat der Mensch seinen hoffnungslos verlorenen Zustand in der Verwerfung der Liebe Gottes und in seiner bitteren Feindschaft gegen Christum geoffenbart. Damit war die Zeit der Erprobung des Menschen vorüber. Er hat sich nicht nur als unheilbar verderbt, sondern auch als ein Feind Gottes und ein Verächter Seiner Gnade erwiesen. So blieb nichts anderes für ihn übrig als G e r i c h t. „Jetzt ist das Gericht dieser Welt", sagte der Herr, als Er zum Kreuze schritt.
Es ist gut, dies klar zu verstehen. Es zeigt uns die Grundlage, auf welcher der ganze Römerbrief aufgebaut ist, und läßt uns wiederum verstehen, weshalb man ihm seinen Platz an der Spitze der Briefe gegeben hat. Er behandelt die vor allen anderen wichtige Frage, wie die, soweit es den Menschen betraf, für immer abgebrochene Beziehung zu Gott auf neuer Grundlage wiederhergestellt werden konnte.
Auf welchem Wege ist nun diese Wiederherstellung geschehen? Nachdem der Mensch, wie eben ausgeführt, in jeder Beziehung seine Schuld, Sünde und Feindschaft wider Gott erwiesen hatte und nun die unabänderlichen Folgen seines Falles tragen mußte, ist Gott ins Mittel getreten. Schon die Ankündigung, daß der Same des Weibes der Schlange den Kopf zertreten sollte, wies darauf hin. Die in späteren Tagen dem Abraham gegebene Verheißung, daß in s e i n e m Samen (Christus) alle Völker der Erde gesegnet werden sollten, ist in Erfüllung gegangen. Das was das Gesetz, obwohl es heilig, gerecht und gut war, unmöglich tun konnte, „tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte" (Kap. 8, 3). Christus begegnete unserer ganzen Verantwortlichkeit, indem Er am Kreuze nicht nur unsere Sünden auf sich nahm, sondern auch, zur Sünde gemacht, Gott im Blick auf die Sünde vollkommen verherrlichte und uns Leben und Herrlichkeit erwarb.
Beachten wir indes von vornherein, daß der Römerbrief, obwohl er uns das Evangelium Gottes in seiner ganzen Fülle vor Augen stellt, doch nicht über die genannten Grenzen hinausgeht. Der vor Grundlegung der Welt gefaßte Ratschluß Gottes, der den Glaubenden heilig und tadellos in Liebe vor Gott hinstellt, ihm jetzt schon in Christo einen Platz in den himmlischen Örtern gibt, das Geheimnis von Christo und Seinem Leibe, der Versammlung, von dem zur Rechten Gottes verherrlichten Haupte der neuen Schöpfung, das was der Apostel, im Unterschiede von den anderen Aposteln, so gern sein Evangelium nennt, finden wir im Römerbrief nur andeutungsweise. Wollen wir diesen Ratschluß kennen lernen, so müssen wir uns zu dem Brief an die Epheser wenden, während der Kolosserbrief mehr das Leben eines im Glauben auferstandenen Menschen beschreibt.
Der Römerbrief betrachtet den Christen als einen auf dieser Erde lebenden Menschen, der das Leben Christi und den Heiligen Geist besitzt, so daß es für ihn, als „in Christo" geborgen, „keine Verdammnis mehr gibt". Seine Schuld ist getilgt, die Sünde ist gerichtet und, gerechtfertigt durch das Werk Christi, hat er Frieden mit Gott und ist berufen, in Neuheit des Lebens zu wandeln, ja, seinen Leib als ein lebendiges Schlachtopfer Gott wohlgefällig darzustellen. Unser Brief betrachtet ihn aber noch nicht als mit Christo auferstanden. Wohl zieht der Apostel die Folgerung: „Wenn wir mit ihm einsgemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein" (Kap. 6, 5), geht aber nicht weiter. Diese Wahrheit finden wir, wie oben bemerkt, im Kolosserbrief. Ich wiederhole: Was uns im Römerbrief vorgestellt wird, ist also das Gnadenwerk Gottes zur Rechtfertigung des gottlosen Sünders durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, sowie die Annahme des Gläubigen in Christo, so daß er als „in Christo" betrachtet werden kann, aber lebend auf dieser Erde, obwohl nicht mehr als ein Mensch, der „im Fleische", sondern der „im Geiste" ist, weil Gottes Geist in ihm wohnt.
Als eine „neue Schöpfung" wird der Gläubige hier nicht gesehen, wenngleich wir aus anderen Schriftstellen wissen, daß er das ist, und daß das neue Leben, welches er besitzt, zu dieser neuen Schöpfung gehört. Die neue Schöpfung bildet einen Teil des Ratschlusses Gottes, und diesen finden wir, wie gesagt, im Römerbrief nicht. Der Mensch ist ein verantwortliches Geschöpf in dieser Welt und wird als solches behandelt. Das Werk Christi ist seiner Verantwortlichkeit begegnet, und nun steht der Gläubige in dieser Welt, indem sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und die Liebe Gottes durch diesen Geist in sein Herz ausgegossen ist. In Hoffnung errettet, steht er in der Gunst Gottes, rühmt sich in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, ist ein Sohn Gottes und als solcher ein Erbe Gottes und Miterbe Christi, aber er erscheint nicht als mit Christo auferstanden, nicht als in Christo mitversetzt in die himmlischen Örter , sondern ist berufen, hienieden mit Christo zu leiden, um am Ende seines Weges dann auch mit Ihm verherrlicht zu werden.
Beschäftigen wir uns jetzt einen Augenblick mit der Einteilung oder dem Aurbau des Briefes. Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Apostel von dem ihm gewordenen Auftrag, „das Evangelium Gottes über Seinen Sohn" zu verkündigen, gesprochen und seiner Liebe zu den Gläubigen in Rom sowie seinem sehnlichen Verlangen Ausdrude: gegeben hat, sie zu sehen, um auch „ihnen etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen", beschreibt er mit wenigen Worten dieses Evangelium selbst. Er nennt es „Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden" und sagt, daß „Gottes Gerechtigkeit darin geoffenbart werde aus Glauben zu Glauben" (V. l—17). So wird hier alles Gott zugeschrieben. Es ist Gottes Evangelium, Gottes Kraft und Gottes Gerechtigkeit.
Mit dem 18. Verse des 1. Kapitels beginnt dann die Beschreibung des verderbten Zustandes des Menschen, seiner Schuldbarkeit. Wieder ist es „Gottes Zorn, der vom Himmel her geoffenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen". Alle, Heiden und Juden, sind schuldig; die einen „gehen ohne Gesetz verloren", die anderen „werden durch Gesetz gerichtet werden". Die ganze Welt, ohne irgendwelche Ausnahmen, ist gerechterweise dem Gericht Gottes verfallen. Jeder Mund ist verstopft. (Kap. 3, 20.)
Diesem furchtbaren Zustand ist Gottes Barmherzigkeit in Christo begegnet. Das einzige Heilmittel lag in dem Blute des Sohnes Gottes. Dieses Blut ist auf Golgatha geflossen, und nun offenbart sich Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesum Christum gegen alle, und auf alle, die da glauben. Gott ist als gerecht erwiesen, sowohl in dem Hingehenlassen der früher geschehenen Sünden unter Seiner Nachsicht, als auch darin, daß Er jetzt den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesum ist. Diese wunderbare Wahrheit wird bis zum 11. Verse des 5. Kapitels näher entwickelt. Sie warf alle Ansprüche der Juden auf vermeintliche, in ihrer Abstammung von Abraham begründete Vorrechte über den Haufen und öffnete allen, auch den für unrein gehaltenen Heiden, die Tür. Waren doch Abraham und David, diese beiden großen Säulen des Judentums, auf demselben Boden, durch Glauben, ohne Werke, gerechtfertigt worden.
Die Berufung auf Abraham führt den Apostel zu einer anderen, überaus wichtigen Wahrheit, nämlich zu der Auferstehung Christi und der Einführung des Gläubigen in einen ganz neuen Stand vor Gott; aus Glauben gerechtfertigt, hat er Frieden mit Gott, steht in Seiner Gunst und hat Zugang zu Seiner Gnade. Die Auferstehung des Herrn ist der vollgültige Beweis seiner Annahme und Rechtfertigung.
Von Kapitel 5, 12 bis zum Ende des 8. Kapitels behandelt dann der Apostel die Frage der Sünde, nicht also der persönlichen Schuld, wie bisher, sondern der Sünde als solcher, des Zustandes des Menschen im Fleische. Im ersten Falle gibt es einen Unterschied in der Größe der Schuld und Verantwortlichkeit, im zweiten Falle nicht: wir alle sind von einem, von einer Natur, von einem Stoff, von einer Masse. Der Apostel redet daher von den Quellen zweier Naturen, oder von den Häuptern zweier Familien, von Adam und von Christo. In Übereinstimmung damit ist in diesem Teil unseres Briefes Christus nicht für unsere Sünden, sondern der Sünde gestorben. (Kap. 6, 10.) Wir werden nicht über das belehrt, was wir getan haben, sondern über das, was wir sind. Wir erfahren, daß in uns, d. 1. in unserem Fleische, Gutes nicht wohnt. Diese Erkenntnis kann einen Menschen, selbst wenn er schon das klare Bewußtsein der Vergebung seiner Sünden hat, tief unglücklich machen. Aber umso tiefer und beständiger ist dann auch der Friede, wenn der Gläubige auf dem Wege der Erfahrung lernt, daß Christus nicht nur für ihn gestorben ist, sondern daß er in Ihm mit-gestorbenist, und daß all die gesegneten Folgen Seines Todes ihm geschenkt sind. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde; sie herrscht nicht mehr über ihn. Als ein Lebender aus den Toten vermag er sich selbst Gott darzustellen und seine Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. (Kap. 6.) Er ist auch dem ersten Ehemann gestorben, dem Gesetz, das ja für den Menschen im Fleische gegeben wurde, und ist eines Anderen geworden, des aus den Toten Auferstandenen. (Kap. 7.)
Während also der erste Hauptteil unseres Briefes durch die Worte Schuld und Vergebung gekennzeichnet werden kann, dürfen wir über den zweiten wohl die Überschrift setzen: Sünde und Befreiung. Verschuldungen, Sünden in Worten und Werken, können vergeben, ein Zustand muß entfernt oder umgewa ndelt werden. In unserem Falle konnte das nur durch den Tod geschehen. Nun, wir sind in Christo unserem alten Zustand gestorben, um fortan, aufrecht gehalten durch die Gnade, in Neuheit des Lebens vor Gott zu wandeln. Sahen wir also im ersten Teile, daß unsere Sünden, als verantwortlicher Wesen im Fleische, durch den Tod Christi ausgelöscht sind, so lehrt uns der zweite Teil, daß wir durch dasselbe Mittel jetzt unseren Platz vor Gott in Christo haben. Das 8. Kapitel entwickelt dann die herrlichen Ergebnisse, die aus dieser Befreiung hervorgegangen sind. Wir sind nicht mehr imFleische, sondern im Geiste, der Geist der Sohnschaft wohnt in uns, und wir erwarten die Erlösung unseres Leibes; Gott ist für uns, und nichts vermag uns zu scheiden von Seiner Liebe, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn.
Wie aber sind diese Gnadenwege Gottes im Blick auf alle Menschen mit den besonderen Verheißungen zu vereinigen, die Gott Seinem irdischen Volke gegeben hat? Diese Frage behandelt der Apostel in den Kapiteln 9—11. Die Verheißungen waren bedingungslos gegeben worden, und nachdem die Juden, obwohl die natürlichen Nachkommen Abrahams, „sich an dem Stein des Anstoßes gestoßen" und durch Ungehorsam und Unglauben alle Ansprüche an jene Verheißungen verloren hatten, war Gott vollkommen frei, Seine in den Schriften der Propheten schon niedergelegten Gedanken im Blick auf die Heiden zur Ausführung zu bringen. Er ist unumschränkt in Seinem Tun, und, in dieser Unumschränktheit handelnd, hat Er einen Überrest aus Israel errettet und errettet heute aus Juden und Heiden, wen Er will. (Kap. 9 u. 10.)
Dennoch hat Gott Sein Volk nicht verstoßen. Seine Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar, und wenn einmal die von Gott bestimmte Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wird ganz Israel errettet werden; denn „aus Zion wird der Erretter kommen, und Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden". Die aus dem Ölbaum der Verheißung ausgeschnittenen Zweige werden wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. (Kap. 11.)
Mit dem 11. Kapitel schließt der belehrende Teil des Briefes. Es folgen Ermahnungen, zunächst zu einem Gott wohlgefälligen Wandel in Erfüllung Seines guten und vollkommenen Willens, dann im Blick auf das Verhältnis der Gläubigen zueinander als Glieder eines Leibes — dies ist die einzige Stelle in unserem Briefe, wo auf dieses Verhältnis hingedeutet wird — und schließlich im Verkehr untereinander, sowie der Obrigkeit gegenüber, die nach Gottes Anordnung und als Seine Dienerin in dieser Welt steht. (Kap. 12 u. 13.) Es ist, mit einem Wort, der Christ im Hause Gottes, in der himmlischen Familie, und der Christ in der Welt.
Nachdem der Apostel dann im 14. und 15 Kapitel die Gläubigen ermuntert hat, hinsichtlich persönlicher Meinungsverschiedenheiten über Essen und Trinken, Halten von Tagen und dergleichen, die wohl durch das Vorhandensein der jüdischen Elemente unter ihnen hervorgerufen waren, sich gegenseitig zu ertragen, mit den Schwachheiten der Schwachen Geduld zu haben und alle „gleichgesinnt, Christo Jesu gemäß", zu wandeln, spricht er noch einmal von seiner Hoffnung, bald nach Rom zu kommen und von dort nach Spanien zu reisen.
Im letzten Kapitel folgt eine ungewöhnlich lange Reihe von Grüßen an Personen, die dem Apostel in Rom persönlich bekannt waren und sich mehr oder weniger durch Treue und Fleiß im Dienst des Herrn ausgezeichnet hatten; verbunden mit einer ernsten Warnung vor Männern, die das liebliche Verhältnis zwischen den Geschwistern zu stören und Zwietracht und Ärgernis anzurichten suchten.
Tertius, der Gehilfe des Apostels und Schreiber des Briefes, — außer dem Briefe an die Galater hat Paulus bekanntlich keinen seiner Briefe mit eigener Hand geschrieben, — und einige andere Brüder fügen ihre Grüße hinzu. Dann schließt der Apostel mit einem Gebetswunsch, der in wunderbarem Einklang steht mit alle dem, was er in dem Briefe entwickelt hat: „Dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen."
Obwohl Paulus, wie wiederholt gesagt, im Römerbrief nicht von dem Ratschluß Gottes redet, kann er doch nicht umhin, in den letzten Versen wenigstens mit einigen Worten seines Evangeliums zu gedenken und des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, aber heute geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, kundgetan worden ist. Dieses Geheimnis, das sein Herz belebte und sein ganzes Sinnen und Denken ausfüllte, das zum Teil auch schon in den Briefen an die Korinther enthüllt worden war, hat er dann zur gegebenen Zeit, unter der Leitung des Heiligen Geistes, in den Briefen an die Epheser und Kolosser näher entwickelt.
Kapitel 1
Kapitel 1. 1-17
Der Gruß oder die Anrede, mit welcher der Apostel seinen Brief einleitet, ist ungewöhnlich lang und inhaltsreich. Paulus nennt sich zunächst einen Knecht (Sklaven) Jesu Christi. Ein Leibeigener Christi zu sein, betrachtete der Mann, der die christliche Freiheit kannte wie kein anderer, als eine besondere Ehre. Immer wieder nennt er sich so, und wahrlich, auch wir sollten es mit Freuden tun.
Aber er war nicht nur „Knecht", sondern auch „Apostel", und zwar ein „berufener Apostel". Nicht daß die übrigen Apostel das nicht gewesen wären, aber doch war er es in besonderem Sinne. Die Zwölfe waren durch den auf Erden lebenden Messias berufen und ausgesandt worden; er hatte Gnade und Apostelamt unmittelbar vom Himmel her empfangen, durch den zur Rechten Gottes verherrlichten Menschensohn, und seine Sendung war dann durch den Heiligen Geist bestätigt worden. (Apstgsch. 9; 13, l—4.) Sein Apostelamt gründete sich auch nicht auf irgend eine Bestimmung oder Ausrüstung seitens der Menschen — „nicht von Menschen, noch durch einen Menschen" (Gal. 1. l) —, sondern allein auf Gott. Schon von seiner Mutter Leibe an durch Gott „abgesondert", war er später durch Gottes Gnade „berufen" worden. (Gal. 1. 15.)
„Abgesondert zum Evangelium Gottes." Gott hat eine gute Botschaft für die ganze Welt, für Juden und Heiden, eine Botschaft, die genau das Gegenteil von dem enthält, was die Menschen gewöhnlich von Gott denken. Denn wo ist der natürliche Mensch, der Ihn als den Gott kannte, welcher allen willig gibt und nichts vorwirft, der am Tode des Gesetzlosen kein Gefallen hat und zum Vergeben bereit ist? Jahrtausende waren allerdings schon dahingegangen, seitdem der Mensch von Gott abgefallen war, ohne daß Gott Sein Evangelium geoffenbart hätte. Aber unmöglich hätte Er in dieser langen Zeit über Seine Gnadenabsichten schweigen können; immer wieder hatte Er durch Seine Propheten in heiligen Schriften Verheißungen gegeben (V. 2), daß Licht aufgehen würde, und daß alle Enden der Erde Sein Heil sehen sollten. Und „als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe" (Gal. 4, 4).
Zu diesem Evangelium war Paulus, wie er hier sagt, abgesondert worden. Der Herr hatte ihn zu einem Diener und Zeugen verordnet, indem Er ihn herausnahm aus dem Volke Israel und den Nationen, zu denen Er ihn senden wollte, um ihre Augen aufzutun und ihnen Vergebung der Sünden zu verkündigen. (Apstgsch. 26, 16—18.) Den einen sollte er Befreiung vom Joche des Gesetzes, den anderen Erlösung aus der finsteren Macht Satans bringen. Und Der ihn berief und aussandte war Jesus, das verherrlichte Haupt Seines Leibes. Auf seine Frage: „Wer bist du, Herr?" war ihm die Antwort geworden: „Ich bin Jesus, den du verfolgst". Alles war in diesem Falle eigenartig: der Berufende, die Berufung und der Berufene. Darum konnte Paulus auch das ihm anvertraute Evangelium sein Evangelium oder das Evangelium der Herrlichkeit nennen. Es stellte ihn und die, welche seine Botschaft annahmen, auf einen ganz neuen Boden. Es nahm sie aus Juden und Heiden heraus und verband sie nicht mit einem lebenden Messias, sondern mit dem auferstandenen Menschensohn in der Herrlichkeit droben, dem Haupte einer neuen Schöpfung. Daher kannte Paulus auch „niemand nach dem Fleische", selbst Christum nicht (2. Kor. 5, 16), obwohl er Ihn in anderem Sinne durchaus als den Sohn Davids anerkannte.
Diese wunderbare Person war Gegenstand und Inhalt des von ihm gepredigten Evangeliums. Es war „das Evangelium Gottes über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist dem Fleische nach" (V. 3). Als solcher, in Erfüllung der Verheißungen, in der Mitte Seines irdischen Volkes erschienen, war Christus verworfen worden. Damit hatte Israel als Volk alle A n r e c h t e an die Verheißungen verloren. Fortan konnte es für die Nachkommen Abrahams wie für die Heiden, die, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, nur einen Boden der Annahme geben, den der bedingungslosen Gnade. Daß Gott, dessen Gnadengaben und Berufung unbereubar sind, dereinst auch Sein irdisches Volk segnen und ihm alle Seine Verheißungen erfüllen wird, ist eine kostbare Wahrheit. Heute aber sammelt Er aus Juden und Heiden ein himmlisches Volk. Der Heilige Geist ist herabgekommen, um den „Sohn" zu verherrlichen und Ihm aus allen Völkern der Erde eine Braut, ein Weib zuzuführen.
So ist denn das, was einst nur als „Verheißung" bekannt war, zur Wirklichkeit geworden. Die Aussprüche der alttestamentlichen Propheten (denn nur diese kommen hier in Frage) sind in Erfüllung gegangen, insoweit sie die Menschwerdung des Herrn, Seinen Tod und Seine Auferstehung, sowie die herrlichen Folgen Seines Werkes betrafen. Die Dinge, welche sie einst für uns bedienten, sind uns jetzt verkündigt worden durch die Boten des Evangeliums in der Kraft des Heiligen Geistes. (Vergl. 1. Petr. 1. 10—12.) Wohl sind auch uns kostbare Verheißungen für unseren Weg durch diese Welt gegeben, aber darum handelt es sich hier nicht. Die hier in Rede stehenden, auf das Evangelium Gottes bezüglichen Verheißungen sind erfüllt.
Der, von welchem dieses Evangelium redet, ist erschienen, ist in die Welt gekommen, und zwar in zweierlei Art oder unter zwei verschiedenen Beziehungen. Er ist der Sohn Davids, dem Fleische nach, das Er in Gnaden angenommen hat; und Er ist der Sohn Gottes, und als solcher „in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung" (V. 4). Als Sohn Davids war Er nicht nur der Gegenstand der Verheißungen Gottes, sondern auch der Erfüller derselben. Wir sagten bereits, daß das Volk Israel, dem die Verheißungen gehörten, durch die Verwerfung seines Messias alle Anrechte an dieselben verloren hat. Aber Gott hat gerade diese Tat dazu benutzt, um größere und herrlichere Dinge ans Licht zu bringen und Seinen ewigen Ratschluß zu erfüllen. Gott hat Den, der auf alle Seine Rechte als Sohn Davids verzichtete und sich in vollkommenem Gehorsam dem Kreuzestode unterzog, aus den Toten auferweckt und Ihm Herrlichkeit gegeben. So ist Er als Sohn Gottes in Kraft erwiesen worden. Gott hatte diese Kraft schon in der Auferweckung des Lazarus geoffenbart; sie wird sich in der Auferweckung aller Heiligen wiederum offenbaren, aber den stärksten Beweis derselben finden wir in der Auferstehung des Herrn Jesus selbst. (Vergl. Job. 12, 28; Eph. 1. 20.) Er, der mit unseren Sünden beladen, für uns zur Sünde gemacht war und als solcher gerechterweise den Tod als Sold der Sünde erleiden mußte, ist als Sieger über Sünde, Tod und Teufel aus den Toten wieder hervorgekommen. Die „überschwengliche Kraft" Gottes hat sich da geoffenbart, wo der Tod als Folge der Sünde eingetreten war. Christus ist auferstanden; Sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen, Seine Seele ist nicht im Hades zurückgelassen worden. (ps. 16, 10; Apstgsch. 2, 27.)
Doch was bedeutet der Ausdruck: „dem Geiste der Heiligkeit nach"? Von dem Propheten Jeremia lesen wir, daß er schon vor seiner Geburt für Gott abgesondert war (Jer. 1,5), und von Johannes dem Täufer wird gesagt, daß er von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geiste erfüllt gewesen sei; aber Christus war, als Mensch, aus dem Heiligen Geist geboren, und Sein Leben war in jeder Beziehung der Ausdruck der Wirkungen dieses Geistes. Seine Worte waren Geist und Leben, und alle Seine Handlungen geschahen in der Kraft des Heiligen Geistes. Mit einem Wort, Er erwies sich in Seinem ganzen Leben als der Heilige Gottes, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern, und schließlich opferte Er sich ohne Flecken Gott durch den ewigen Geist. (Hebr. 7, 26; 9, 14.) Als das vollkommene Speisopfer: Feinmehl, mit Öl gemengt und mit 01 gesalbt, war Er allezeit der Ausdruck und Abglanz der Gottheit, deren Fülle leibhaftig in Ihm wohnte. Erprobt bis in den Tod am Kreuze, im heißesten Feuer geprüft, zeigte sich in Ihm nichts als Vollkommenheit und Wohlgeruch. Er starb (und Er mußte sterben), weil Er unsere Sache übernommen hatte, aber der Tod konnte Ihn nicht behalten. Getötet nach dem Fleische, ist Er lebendig gemacht worden nach dem Geiste, (1. Petr. 3, 18.) Das will sagen: In Seiner Auferstehung war die ganze wunderbare Kraft des Heiligen Geistes wirksam. Das ändert nichts an der Tatsache, daß der Vater es Seiner Herrlichkeit schuldig war, Den aufzuerwecken, der Ihn hienieden verherrlicht hatte, und daß der Sohn die Gewalt besaß, Sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Die Auferweckung des Herrn war das überwältigende, öffentliche Zeugnis von der Kraft, die während Seines ganzen Lebens in Ihm gewirkt und Ihn als das erwiesen hatte, was Er war: der Sohn Gottes.
Der Gegenstand des Evangeliums Gottes ist also Christus, als Sohn Davids gekommen zur Erfüllung der Verheißungen, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung. Von diesem Herrn, der inzwischen mit Ehre und Herrlichkeit zur Rechten Gottes gekrönt worden war und nun als Herr und Christus handelte, hatte Paulus Gnade und Apostelamt empfangen, um alle Völker der Erde in Seinem Namen zum Glaubensgehorsam zu führen. (V. 5.) In derselben Stunde, in welcher die Gnade ihm begegnet war, und Licht von oben in sein finsteres Herz hineingeleuchtet hatte, war er berufen worden, von dem zu zeugen, was er gesehen und gehört hatte und worin der Herr ihm noch weiter erscheinen wollte. (Apstgsch. 26, 16.) So war von vornherein der Inhalt und Bereich seines Dienstes weiter als der der Zwölfe. Darum ist hier auch wohl von Glaubens gehorsam die Rede, der sich willig unter die vom Himmel her gebrachte Botschaft beugt, welche sich jetzt nicht an Israel allein, sondern an die ganze Welt richtet.
Das also war der Apostel. Wie stand es nun mit den Gläubigen in Rom? Sie waren nicht zu Aposteln berufen, und doch waren sie Berufene: „Berufene Jesu Christi, Geliebte Gottes, berufene Heilige", und das alles „durch Jesum Christum, ihren Herrn". Fürwahr, herrliche Titel, die einerseits ihre neuen Beziehungen zu dem Vater und dem Sohne zum Ausdruck brachten, und anderseits darauf hinwiesen, daß ihre Träger, wenngleich Paulus mit der Gründung der Gemeinde in Rom nichts zu tun gehabt hatte, doch seiner Autorität als Apostel der Nationen unterstanden. Als solcher konnte er mit der Machtvollkommenheit Christi an sie schreiben und ihnen seinen gewöhnlichen, aber so tief bedeutsamen Gruß senden: „Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!" (V. 7). Sie waren jetzt Kinder dieses großen Gottes und Knechte dieses reichen und gnädigen Herrn, und es war die Freude des Heiligen Geistes, sie durch den Apostel als solche anzuerkennen.
Nie vorher waren solche Titel bekannt gewesen, weder zur Zeit der Patriarchen, noch unter der glorreichen Regierung eines David oder eines Salomo; nie auch waren Gefühle und Beziehungen kundgetan worden, wie sie uns in den nächsten Versen unseres Briefes entgegentreten. Wohl hatte Gott in mancherlei Weise sich geoffenbart und Seine herrliche Größe oder Seine wunderbare Güte, Geduld und Treue kundgetan, aber solche Titel oder eine ähnliche Sprache, wie wir sie hier finden, suchen wir im Alten Testament vergeblich. Sie waren vor dem Kommen des Herrn in diese Welt einfach unmöglich. Ja, selbst noch während Seines Lebens und Wandeins auf dieser Erde hätten Gedanken und Gefühle, wie sie in den Versen 8—15 zum Ausdruck kommen, in den Herzen der Jünger nicht aufsteigen können. Dafür mußte das Werk auf Golgatha erst die Grundlage schaffen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die Versammlung in Rom zum allergrößten Teil aus Gläubigen bestand, die früher Heiden gewesen waren, staunen wir umsomehr über die innige Herzensverbindung zwischen ihnen und dem Apostel, dessen Angesicht sie noch nie gesehen hatten.
„Aufs erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum euer aller halben, daß euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt" (V, 8). Die Liebe ist stets bemüht, das hervorzuheben und anzuerkennen, was es Gutes in dem anderen gibt. Paulus war in dieser, wie in so mancher anderen Beziehung, ein treuer Nachahmer seines Herrn. Die Lage und Bedeutung der Stadt Rom als Mittelpunkt des gewaltigen Römischen Reiches der damaligen Zeit macht es verständlich, daß die Kunde von der Treue der dortigen Gläubigen unter mancherlei Verfolgungen von außen und Versuchungen von innen in alle Welt gedrungen war, ähnlich dem Glauben der Thessalonicher, der an jedem Orte Macedoniens und Achajas ausgebreitet worden war, so daß der Apostel nicht nötig hatte, etwas zu sagen. Dafür dankte Paulus seinem Gott, und je mehr er das tat und die Gläubigen in Rom (samt so vielen anderen) in brennender Liebe und mit unablässigem Gebet auf seinem Herzen trug, umso tiefer und dringender wurde das Verlangen in ihm, sie zu sehen, um auch ihnen etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen und sie so im Glauben weiter zu befestigen. (V. 9—11.)
Welch eine Veränderung war doch mit diesem Manne vorgegangen! Einst ein fanatischer Vertreter des Gesetzes, ein Verächter und Lästerer des Namens Jesu und ein glühender Feind Seiner Jünger — heute ein liebeerfüllter, unermüdlicher Prediger der in Jesu geoffenbarten Gnade, ein Mann des Glaubens, der durch die Liebe wirkt, ein Sklave Jesu Christi, der in Mühen und Kämpfen, in Leiden und Drangsalen sich völlig für andere „verwandte" und umsomehr lieben wollte, je weniger er geliebt wurde. Das war der Mann — und wie vieles andere könnte noch von ihm gesagt werden! — der sehnlich danach verlangte, „nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich zu sein", auch zu ihnen nach Rom zu kommen. (V. 10.) Fürwahr, wenn es je einen Mann gegeben hat, der mit dem Herzen Jesu Christi für das geistliche Wohl der Herde besorgt war, dann war er es. Unwillkürlich drängt sich das Gebet auf unsere Lippen; „Herr, laß uns von ihm lernen! Laß uns seine Nachahmer sein, gleichwie er der Deinige war !"
Wie müssen solche Worte auch die Herzen der Gläubigen in Rom bewegt haben! Und Paulus konnte Gott selbst zum Zeugen anrufen, daß er die Wahrheit sagte. Ja, Ihm allein diente er „in seinem Geiste in dem Evangelium Seines Sohnes". Es war nicht ein Dienst in nur äußerem Eifer zur Erfüllung einer obliegenden Pflicht, sondern in innerer Widmung für Gott und bedingungsloser, liebender Hingabe an das Evangelium Seines Sohnes. Beachten wir im Vorbeigehen den Wechsel im Ausdruck. Hörten wir im 1. Verse von dem Evangelium Gottes, so hier von dem Evangelium S e i n es Sohnes. Es ist selbstverständlich dasselbe Evangelium, nur daß uns im ersten Falle die Quelle desselben gezeigt wird, im zweiten die Art und Weise, wie Gottes Liebe darin gewirkt hat, der Weg, den Jesus gegangen ist, um Verlorene zu erretten.
Geradezu rührend und zugleich ein eindrucksvoller Beweis von der Demut und Bescheidenheit des Apostels ist der Inhalt des 12. Verses. Wir hörten schon, daß Paulus nach Rom zu kommen wünschte, um den Gläubigen dort etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, um sie zu befestigen, „das ist aber", so fügt er hinzu, „mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der indem anderen ist, sowohl euren als meinen". War es ein einfacher Bruder, einer gleich ihnen, der nach Rom kommen wollte, oder war es der große Apostel der Nationen? (Vergl. Phil. 2, 1—3.)
Die Versammlung in Rom sollte auch wissen, daß der Wunsch, sie zu besuchen, bereits alt war. „Ich will aber nicht, daß euch unbekannt sei, daß ich mir oft vorgesetzt habe, zu euch zu kommen, und bis jetzt verhindert worden bin" (V. 13). Paulus hatte also oft den Vorsatz gehabt zu kommen, aber Gott hatte es in Seiner Weisheit nicht geschehen lassen; über die wahrscheinlichen Gründe haben wir bereits gesprochen. Dennoch war der Wunsch, „auch unter ihnen einige Frucht zu haben, gleichwie auch unter den übrigen Nationen", durchaus berechtigt und Gott wohlgefällig, denn Paulus war ja als Apostel der Nationen ein Schuldner „sowohl Griechen als Barbaren (Fremdsprachigen), sowohl Weisen als Unverständigen". (V. 14.) Und dieser Schuld war er sich bewußt. Darum war er, soweit es ihn betraf, völlig bereit, auch denen, die in Rom waren, das Evangelium zu verkündigen. (V. 15.) Die Weite der Reise, Furcht vor etwaigen Gefahren in der großen heidnischen Weltstadt oder irgendwelche ähnliche Abhaltungsgründe konnten ihn nicht beeinflussen. Der Herr hat denn auch seinen sehnlichen Wunsch erfüllt, allerdings auf einem ganz anderen Wege, als er und die Gläubigen in Rom es damals ahnen konnten, nämlich als „ein Gefangener Christi Jesu für sie, die Nationen" (Eph. 3, l).
Der beglückende Gedanke, auch in Rom das Evangelium verkündigen zu dürfen, führt den Apostel jetzt dahin, näher über den Charakter und Inhalt dieses Evangeliums zu reden und so zu der eigentlichen Lehre des Briefes zu kommen. „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen" (V. 16). Das Evangelium ist Gottes Kraft, nicht eine bloße Lehre, eine Richtschnur für den Menschen, wie das Gesetz es gewesen war; darum ist es auch für „jeden Glaubenden". Es stellt nicht Anforderungen an den Menschen, sondern bringt ihm ein Heil, vollendet in Heiligkeit und Gerechtigkeit, unmittelbar von Gott kommend und Gottes Kraft offenbarend. Es verkündigt dem Sünder, kraftlos wie er ist, ein Werk, das durchaus vollkommen und ein für allemal vollbracht ist. Deshalb ist es, wie gesagt, nur für den Glauben. Das Gesetz forderte, das Evangelium gibt, gibt bedingungslos und umsonst, und zwar jedem, der es annehmen will, ob Jude oder Heide. Der Jude war infolge seiner äußeren Verbindung mit Gott zuerst berufen, wenigstens solang das damalige religiöse System noch nicht endgültig beseitigt war; aber der Heide stand nicht hinter dem Juden zurück. „Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen" (Tit. 2, 11).
Im nächsten Verse beantwortet der Apostel die Frage, warum das Evangelium Gottes Kraft ist. „Denn", sagt er, „Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben." Es ist nicht eine menschliche Gerechtigkeit, die uns aus (oder durch) Glauben, d. 1. auf dem Boden oder Grundsatz des Glaubens, zuteil wird, sondern die Gerechtigkeit Gottes selbst. Was anders als die Kraft Gottes1 hätte so etwas zustande bringen können? Das Gesetz hätte eine menschliche Gerechtigkeit dem gegeben, der es hielt, aber da war niemand, der es halten konnte. Zudem hätte eine auf dem Boden des Gesetzes erlangte Gerechtigkeit dem Menschen nur Leben auf dieser Erde schenken können; denn „wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben", d. h. am Leben bleiben, nicht sterben. Durch Glauben aber wird uns Gottes Gerechtigkeit geschenkt.
Was ist aber Gottes Gerechtigkeit? Diese Frage erscheint angesichts mancher Mißverständnisse, die über den Sinn des Ausdrucks herrschen, wohl berechtigt. Es ist nicht etwa eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie Luther übersetzt hat; denn eine durch das Halten des Gesetzes erlangte Gerechtigkeit würde, wenn sie möglich wäre, tatsächlich Gültigkeit vor Gott haben. Aber die vollkommenste menschliche Gerechtigkeit könnte doch niemals Gottes Gerechtigkeit genannt werden.
Wir müssen uns zu Gottes Wort wenden, um eine Antwort auf unsere Frage zu erhalten, und was sagt dieses Wort? In Johannes 16, 8—10 lesen wir, daß der Heilige Geist, dessen Kommen der Herr dort ankündigt, die Welt überführen würde von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. „Von Sünde", sagt der Herr, „weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe, und ihr mich nicht mehr sehet." Gottes Gerechtigkeit hat sich also darin erwiesen, daß Er Seinen Sohn zu Seiner Rechten setzte, weil dieser Ihn hienieden verherrlicht hatte. (Vergl. Joh. 13, 31. 32.) Mit anderen Worten: sie besteht darin, daß der Vater den Menschen Jesus Christus in die Herrlichkeit erhoben hat, die Er bei Ihm hatte, ehe die Welt war. (Joh. 17, 5.) Die Welt hat Den verworfen, den der gerechte Gott verherrlicht hat. So ist ihre Sünde vollkommen erwiesen, und es bleibt für sie nichts anderes übrig als Gericht.
Das Evangelium nun, welches Paulus predigte, verkündigte diese Gerechtigkeit Gottes, die sich einerseits darin erwies, daß sie Jesum aus den Toten auferweckt und mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hatte, und anderseits darin, daß sie nunmehr jeden an Jesum Glaubenden in dieselbe Stellung versetzt, in welche Er als Mensch eingegangen ist. Denn das, was Christus zur Verherrlichung Gottes getan hat, hat Er zu gleicher Zeit f ü r u n s getan, so daß der Apostel an einer anderen Stelle sagen kann: „Den, der Sünde nicht kannte, hat er (Gott) für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm" (2. Kor. 5, 21). Wie Gottes Gerechtigkeit zunächst in der Verherrlichung Christi erblickt wird, so wird sie heute in uns gesehen, die wir in Christo sind, und bald wird sie zur völligen Darstellung in uns kommen, wenn wir als die Frucht der Mühsal Seiner Seele in derselben Herrlichkeit mit Ihm erscheinen werden.
Wenn das aber so ist, wenn wir der Gerechtigkeit Gottes bedürfen, um vor Ihm bestehen zu können, so ist es offenbar, daß wir nur durch Glauben, auf Grund einer bedingungslosen Gnade, dazu gelangen können. Jedes Tun und Bemühen des Menschen ist hier nicht nur ausgeschlossen, sondern unmittelbar böse. Zugleich war auf diese Weise die Tür für alle Menschen geöffnet. Beide, Juden und Heiden, hatten in gleicher Weise auf dem Boden des Glaubens Anteil daran. Es war „aus Glauben zu Glauben". Der Glaube war das einzige Mittel, um ein solches Heil zu erlangen, und es wurde dem Glauben, wo er sich auch zeigen mochte, zuteil, wie geschrieben steht: „Der Gerechte aber wird aus Glauben leben" (Hab. 2, 4). Und wie es damals war, so ist es heute. Gott sei ewig dafür gepriesen! Gott erweist in der jetzigen Zeit Seine Gerechtigkeit darin, daß Er gerecht ist, wenn Er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesum ist (Kap. 3, 26), ja, wenn Er ihm heute schon einen Platz in Christo gibt in den himmlischen Ortern. (Eph. l.)
Kapitel 1. 18—32
Nach dem bisher Betrachteten verstehen wir, daß der Apostel sich des Evangeliums nicht schämte. Der Träger einer solchen Botschaft Gottes an die Welt hatte wahrlich keine Ursache, mit der Verkündigung derselben zurückzuhalten. Wo und wann war je Ähnliches gehört worden? Gottes Gerechtigkeit wurde frei und umsonst angeboten, und zwar allen Menschen ohne Unterschied, und ohne jedes menschliche Zutun, durch Glauben allein, wurde sie erworben.
Ganz von selbst kommt der Apostel jetzt zur Behandlung der Frage, wodurch eine solch allumfassende Liebestat Gottes notwendig geworden ist. Die veranlassende Ursache ist das hoffnungslose Verderben der ganzen Welt, die Schuldbarkeit aller Menschen, ob Juden oder Heiden. Wollte Gott der verlorenen Welt Seine Liebe beweisen, wollte Er Menschen erretten, deren sündiger, heilloser Zustand sie unrettbar dem Verderben entgegen führte, so mußte Er einen Boden schaffen, auf welchem Er nicht nur unbeschadet, sondern auf Grund Seiner Gerechtigkeit ihnen gnädig sein konnte. So wie die Dinge lagen, konnte der heilige Gott nur Zorn offenbaren.
Wir begegnen deshalb auch im 18. Verse den bedeutungsvollen, obwohl im allgemeinen wenig verstandenen Worten: „Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen."
Beachten wir zunächst die ganz gleichen Ausdrücke im 17. und 18. Verse: „es wird geoffenbart Gottes Gerechtigkeit", und „es wird geoffenbart Gottes Zorn". Beides geschieht in der gegenwärtigen Zeit, und zwar in Verbindung mit dem Evangelium. Gleichzeitig mit der in ihm dargebotenen Gerechtigkeit Gottes wird der Zorn Gottes vom Himmel her geoffenbart. Er wird noch nicht ausgeübt, die Zeit der Ausführung des Gerichts ist noch nicht da, aber der Zorn wird geoffenbart, und zwar neben dem Worte vom Kreuze herlaufend.
Das mag für den Augenblick befremdend klingen, wird uns aber verständlich werden, wenn wir an die durch das Kreuz Christi veränderte Sachlage denken. Auch früher schon hatte Gott zeitweilig ernste Gerichte über die Menschen kommen lassen. Wir brauchen uns nur an die große Flut, an Sodom und Gomorra, an das Rote Meer, an die Rotte Korah usw. zu erinnern. Aber alle diese Gerichte waren irdische Wege der Vorsehung Gottes gewesen, deutliche Zeichen Seiner Regierung, nicht aber eine Offenbarung Seines Zornes vom Himmel her. In diesen Heimsuchungen hatte Gott wohl Zeugnisse davon gegeben, daß Er gerecht und heilig ist und die Sünde haßt, aber Er war doch nie aus Seinem Dunkel hervorgetreten, der Vorhang verbarg Ihn. Erst als der Sohn Gottes Sein Sühnungswerk vollbrachte und darin die Grundlage zu unserer Errettung legte, trat es völlig ans Licht, wer Gott ist, freilich auch was der Mensch und was die Sünde ist.
Das Gesetz und die Wege Gottes im Alten Bunde hatten Teile Seines Wesens geoffenbart, aber niemals hatte Gott so deutlich gezeigt, wie unerträglich die Sünde und alles Böse für Ihn ist, wie es am Kreuze geschah, da, wo Er, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde und den Kelch des Zornes Gottes wider die Sünde trank. Zugleich war niemals Seine Liebe, Sein Erbarmen so ans Licht getreten, wie gerade dort. Mit der erschütterndsten Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes verband sich am Kreuze der höchste Beweis Seiner Liebe.
Noch einmal denn: Wird im Evangelium einerseits Gottes Gerechtigkeit geoffenbart und jedem Glaubenden umsonst geschenkt, so zeigt Gott in Verbindung mit ihm anderseits deutlicher und eindringlicher als je, daß Sein Zorn „alle Gottlosigkeit" (welcher Art sie sein mag) treffen muß; und nicht nur sie, sondern auch „alle Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen". Es ist nicht länger ein einzelnes Volk, an welchem Gott die Missetaten heimsucht, wie einst an Israel (vergl. Amos 3,1.2), das Sein Wort besaß, auch handelte es sich nicht nur um Wege Seiner vergeltenden Regierung an Menschen und Völkern ihres Tuns wegen, sondern Er richtet jetzt alles Böse, alles, was mit Ihm, der Licht ist, im Widersprach steht. Sein Zorn wird vom Himmel her geoffenbart gegen alle Menschen ohne jegliche Ausnahme. Alle stehen ihrer Sünden wegen unter Seinem Zorn und bleiben darunter, wenn sie nicht im Glauben von dem ihnen angebotenen Heil Gebrauch machen. (Joh. 3, 36.) Die Schuldbarkeit der einzelnen mag verschieden groß sein, aber alle sind schuldig, alle sind Kinder des Zorns, die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen.
„Gottlosigkeit" ist die charakteristische Bezeichnung des Zustandes der Heiden. Ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, unwissend und verstockt, verfinstert am Verstande und entfremdet dem Leben Gottes, so lebten und leben sie dahin (Eph. 2, 12; 4, 18.) „Ungerechtigkeit" kennzeichnet mehr den Zustand des Juden, der nicht nur die Verheißungen Gottes besaß, sondern im Gesetz auch mit Gottes gerechten Forderungen an Sein Geschöpf bekannt gemacht worden war. Aber obwohl er die Gedanken Gottes über gut und böse wohl kannte, hat er doch die Ungerechtigkeit geliebt und die heiligen, guten Gebote Gottes tausendfach übertreten. Die Vorzüge, die der Jude vor dem Heiden besaß, haben also nur dazu gedient, seine Verantwortlichkeit und Schuld zu mehren, geradeso wie heute die Schuld der Namenchristenheit infolge der ihr zuteil gewordenen Vorzüge riesengroß geworden ist.
Da die Versammlung oder Gemeinde in Rom zumeist aus früheren Heiden bestand, ist es erklärlich, daß der Apostel sich zunächst, (bis zum 16. Verse des zweiten Kapitels) mit dem Zustand der heidnischen Welt beschäftigt und erst nachher (Kap. 2, 17—3, 20) von der Ungerechtigkeit der Juden redet. Er zählt drei Gründe für die Schuldbarkeit der Heiden vor Gott auf:
1. Sie besitzen das Zeugnis der Schöpfung. Das von Gott Erkennbare, Seine ewige Kraft und Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in den von Ihm gemachten Dingen wahrgenommen. (V. 19. 20.)
2. Sie haben im Anfang die Kenntnis Gottes gehabt. (V. 21.)
3. Sie haben ein (wenn auch irregeleitetes) Gewissen, das in ihrem Innern zeugt, so daß „ihre Gedanken sich unter einander anklagen oder auch entschuldigen" (Kap. 2, 14. 15).
Die Heiden besitzen also viel mehr, als man gewöhnlich meint. Was aber haben sie mit dem ihnen Anvertrauten gemacht? Ach, sie sind ohne „Entschuldigung"! Obwohl sie durch die wunderbaren Werke und Gesetze der Schöpfung immer wieder von Gottes Größe, Macht und Weisheit über-. führt wurden, haben sie doch „weder ihn verherrlicht, noch ihm Dank dargebracht", sondern sind in ihrem Hochmut und Dünkel immer mehr der Torheit und Herzensverfinsterung verfallen. Gericht ist über sie gekommen. Dreimal begegnen wir in unserem Kapitel dem ernsten Wort: „Gott hat sie da hinge geben". In Seiner Güte ließ Er sich nicht an ihnen unbezeugt. Er gab ihnen „vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten und erfüllte ihre Herzen mit Speise und Fröhlichkeit" (Apstgsch. 14, 15—17), aber sie vergalten Seine Güte mit Undank und Verachtung.
Doch nicht nur gab es eine Möglichkeit, in der Schöpfung Gott zu erkennen, die Menschen haben im Anfang tatsächlich auch Gott gekannt. (V. 21.) Bis zur großen Flut hören wir kein Wort von Götzendienst, und wenn auch des Menschen Bosheit groß wurde, hat es doch in jener ganzen langen Zeit, von Adams Erschaffung bis auf Noah, (mehr als 1600 Jahre) nie an einem Zeugnis für Gott gefehlt. Auch als auf der durch das Gericht gereinigten Erde die Geschichte des Menschen von neuem begann, gab es in der Familie Noahs, welche die Kenntnis Gottes besaß, wieder ein Zeugnis für das neuentstehende Menschengeschlecht. Aber anstatt auf dieses Zeugnis zu achten und das göttliche Licht auf Herz und Wege leuchten zu lassen, wandte der Mensch sich von Gott ab, vergaß allmählich, daß es nur einen lebendigen Gott gibt, und verfiel in Narrheit. „Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren" (V. 22. 23).
Mit wenigen Strichen malt der Apostel hier das vielgestaltige Verderben, in welches der Mensch nach der Flut in religiöser Hinsicht geraten ist, um dann den furchtbaren sittlichen Verfall zu beschreiben, der die nie fehlende Folge der Gottentfremdung und des Götzendienstes ist. „Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden; welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer." Wer ein wenig die Schriften der alten heidnischen Völker kennt, weiß, wie sie an vielen Stellen von diesen Schändlichkeiten mit einer Offenheit Bericht geben, die unbegreiflich wäre, wenn wir nicht wüßten, bis zu welch einem Grade die Sünde zu verhärten und jedes Schamgefühl zu töten vermag.
Dabei hat man nicht verfehlt, die Wahrheit Gottes in die Lüge zu verkehren und dem Geschöpf mehr Ehre zu geben als dem Schöpfer. Es ist ja nicht anders möglich. Wenn der Mensch aus der ihm geziemenden, einzig möglichen Stellung eines abhängigen Geschöpfes heraustritt, wird er die Beute seiner Leidenschaften und Lüste, ein Spielball Satans, des Vaters der Lüge, und rasch sinkt er hinab, bis er am Ende weit unter dem Tiere steht. Die Dinge, die in den Versen 26 und 27 genannt werden, können uns nur mit Abscheu und Ekel erfüllen. Und wie ernst ist der Gedanke, daß sie sich heute in der sogenannten christlichen Welt Zug um Zug wiederfinden! Auch das in 2. Tim. 3, 2 ff. gezeichnete prophetische Bild von den „letzten Tagen" der Christenheit gleicht genau dem hier in Vers 28—31 von der Heidenwelt entworfenen. Da fehlt nichts. Wie furchtbar wird das Gericht sein, das in Bälde über ein solches Verderben hereinbrechen muß!
Die Menschen haben es nicht „für gut gefunden, Gott in Erkenntnis zu haben", so lautet das Endurteil des Geistes Gottes. (V. 28.) Darum „hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun was sich nicht geziemt"; und nun folgt jene lange finstere Liste, die mit „Ungerechtigkeit und Bosheit" beginnt und mit „Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige" endet. Was alles hat Gottes heiliges Auge in den vergangenen Jahrhunderten auf dieser Erde geschehen sehen, und was alles sieht es heute!
Und nicht nur hat der unter der verwüstenden Macht der Sünde zu einem Götzendiener und Narren gewordene Mensch an sich selbst den gebührenden Lohn seiner Verirrung empfangen und ist einem verworfenen Sinn übergeben worden, um alles Schändliche mit Gier zu tun, nein, es kitzelt seine Lust, andere es tun zu sehen, ja, es treibt ihn, solche, die noch verhältnismäßig rein geblieben sind, in denselben Schmutz hineinzuziehen, in welchem er sich bewegt. Er „erkennt Gottes gerechtes Urteil, daß, die solches tun, des Todes würdig sind", aber trotzdem übt er es nicht nur selbst aus, sondern hat „Wohlgefallen an denen, die es tun" (V. 32.)
Könnte das herrliche Geschöpf, das einst in dem Bilde Gottes geschaffen wurde, sich noch mehr herabwürdigen, noch tiefer erniedrigen? Fürwahr, seine Schuld (nicht nur seine Sünde) ist aufs unzweideutigste erwiesen, und Gott ist nur gerecht, wenn Er den Schuldigen Seiner Heiligkeit gemäß richtet.
Kapitel 2
Kapitel 2, 1 — 16
Aber waren denn alle Heiden so tief gesunken, daß sie ausnahmslos unter das am Schluß des 1. Kapitels ausgesprochene Urteil fielen? Nein, es gab auch solche unter ihnen, die sich mit Entrüstung von den Schändlichkeiten abwandten, die allgemein im Schwange waren und selbst mit Wohlgefallen betrachtet wurden. Diese Philosophen, Sittlichkeitsapostel usw. verurteilten die traurigen Wege ihrer Mitmenschen und bemitleideten oder verachteten die, welche sie gingen. Sie machten es wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit des Herrn Jesus, die sich hoch erhaben dünkten über die unwissende Volksmenge, ja, sie verfluchten. (Joh. 7, 48. 49.) Aber indem sie schwere und schwer zu tragende Lasten auf die Schultern der Menschen legten, wollten sie selbst sie mit keinem Finger bewegen. (Matth. 23, 4.) Und sich für sehend haltend, waren sie doppelt schuldig — ihre Sünde blieb. (Joh. 9, 40. 41.)
Ähnlich war es mit den hier genannten Menschen. Sie „richteten" andere wegen ihres Tuns, und im verborgenen taten sie dasselbe, machten sich also erst recht verantwortlich. „Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet; denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, der du richtest, tust dasselbe" (Vers l). Bei Menschen mag man sich auf solchem Wege ein gewisses Ansehen verschaffen können, aber wird Gott sich jemals durch Scheinfrömmigkeit täuschen lassen, oder irgendwelche menschliche Gerechtigkeit anerkennen? Nein, „wir wissen, daß das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun" (V. 2). Gott prüft Herzen und Nieren. Unaufrichtigkeit und Heuchelei sind Ihm ein Greuel. Wie töricht also, wenn ein Mensch, der andere wegen ihrer Sünden verurteilt und doch die gleichen Sünden begeht, dem Gericht Gottes entfliehen zu können meint l (V. 3.) Indem er durch sein „Richten" zu erkennen gibt, daß er Gottes Urteil über das Böse kennt und anerkennt, und es dennoch tut, erklärt er sich selbst für doppelt schuldig.
Der Apostel benutzt diese Gelegenheit, um einen wichtigen göttlichen Grundsatz ans Licht zu stellen. Nachdem Gott sich den Menschen auf mancherlei Weise geoffenbart hat, beurteilt und behandelt Er jetzt jeden Menschen nach seinem Verhalten diesen Offenbarungen gegenüber. Der Apostel redet deshalb nicht mehr ausschließlich von Heiden, sondern ganz allgemein von Menschen, „ob Juden oder Griechen" (V. 9. 10), oder Namenchristen, wie wir heute hinzufügen könnten. .Du bist nicht zu entschuldigen, o M e n s c h", sagt er, jeder, der da richtet", und nachher: „Denkst du aber dies, o Mensch usw.?" Nun, für diesen Menschen kommt .ein Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes" (V. 5), wo einem jeden nach seinen Werken vergolten werden wird, denn „bei Gott ist kein Ansehen der Person" (V. 11). Mag Gott auch in der Verfolgung besonderer Ratschlüsse und Gedanken aus den Bewohnern der Erde ein Volk zu Seinem Eigentumsvolk erwählt und ihm Sein Gesetz und Seine guten Verordnungen gegeben haben, im Grunde gab und gibt es doch keinen Unterschied zwischen den Menschen. Ihrer Natur nach sind sie alle gleich, stehen allesamt als unreine, schuldige Sünder vor Gott, und alle haben nötig und werden aufgefordert, Buße zu tun. Wohl ist das Maß des Lichtes und der Erkenntnis verschieden, und Gott in Seiner Gerechtigkeit berücksichtigt das, aber alle müssen einmal vor Ihm offenbar werden, um zu empfangen was ihre Taten wert sind. (V. 6.)
Heute ist indes noch Gnadenzeit, und Gottes Güte ist beschäftigt, die Menschen zur Buße zu leiten. (V. 4.) Zur Buße? Was ist Buße? Buße besteht nicht, wie man meist denkt, in der Verurteilung der Ausflüsse der bösen Natur, obwohl diese selbstverständlich miteingeschlossen ist, sondern ist die völlige Sinnesänderung eines Menschen, die schonungslose Verurteilung des alten Ichs, soweit es jeweils im Lichte Gottes erkannt wird. Buße ist insofern also ein fortschreitendes Werk, ist ein Werk des Geistes Gottes im Innern der Seele, durch welches der aus seinem Sündenschlaf aufgewachte Mensch dahin geführt wird, immer ernster und gründlicher sich selbst und alle seine Wege in Gottes heiliger Gegenwart zu prüfen und zu richten. Wahre Buße bringt die Seele in Übereinstimmung mit Gott. Ohne Buße ist ein echter, errettender Glaube nicht denkbar. Auf dem Wege der Buße und des Glaubens wird der Mensch „in dem Geiste seiner Gesinnung erneuert" und zieht „den neuen Menschen" an, „der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit" (Eph. 4, 23. 24).
Nach dem Reichtum Seiner Gütigkeit, Geduld und Langmut ist Gott heute noch bemüht, den Menschen zur Buße zu leiten. Wehe deshalb einem jeden, der diese Güte Gottes verachtet, oder sich dieser Güte getröstet — man redet ja so gern von dem „lieben" Gott — und so das sichere Gericht zu vergessen sucht! Aber ach! wie viele Millionen von Menschen handeln so! Indem sie nichts von dem kommenden Gericht wissen wollen, versäumen sie den Tag der Gnade und vernachlässigen das große Heil, das ihnen angeboten wird. Ja, mehr noch: „Nach seiner Störrigkeit und seinem unbußfertigen Herzen häuft der Mensch sich selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes." Wenn schon jemand, der das Gesetz Moses verwirft, ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen stirbt, „wieviel ärgerer Strafe wird der wert geachtet werden", der den Sohn Gottes verwirft und die Gnade verschmäht! (Vergl. Hebr. 10, 28. 29.)
Wenn wir den Gedankengang des Apostels erfaßt haben, der an dieser Stelle nicht, wie im ersten Kapitel, von dem Evangelium Gottes über Seinen Sohn redet, sondern die unveränderlichen, gerechten Grundsätze und Wege Gottes den Menschen gegenüber vorstellt, so wird es uns nicht schwer werden, seine weiteren Ausführungen zu verstehen. Der gerechte Gott, bei dem es kein Ansehen der Person gibt, wird „an jenem Tage" einem jeden nach seinen Werken vergelten: „denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben; denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen; Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen" (V. 6—11).
Hat der Apostel im ersten Kapitel die herrliche Botschaft verkündet, daß das Evangelium „Gottes Kraft ist zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen", so stellt er hier, wo es sich um das gerechte Tun Gottes handelt, jeden Menschen, wiederum zuerst den Juden und dann den Griechen, vor ein ernstes Entweder — oder. Ein jeder muß vor Gott nach dem offenbar werden, was er in seinem Wandel und seinem inneren Zustand hienieden gewesen ist. Wer mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit gesucht hat, empfängt ewiges Leben; wer der Wahrheit ungehorsam, der Ungerechtigkeit aber gehorsam gewesen ist, Zorn und Grimm. Daß ein Mensch das erste nur tun kann unter den Gnadenwirkungen des Geistes Gottes, ja, daß das Suchen der genannten Dinge eine Kenntnis der im Christentum geoffenbarten Wahrheiten voraussetzt, ist eine Sache für sich, die hier nicht in Betracht kommt. Es handelt sich nur um die Darstellung der gerechten Wege Gottes mit dem Menschen, wenn Er dessen sittlichen Zustand, sein Sinnen und Trachten vor Sein heiliges Auge stellt. Ähnlich sagt der Herr in Johannes 5, 29, daß „die das Gute getan haben" zur Auferstehung des Lebens aus ihren Gräbern hervorkommen werden, „die aber das Böse verübt haben" zur Auferstehung des Gerichts.
Beachten wir auch die Weise, wie der Apostel hier von dem „ewigen Leben" spricht. Die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit usw. suchen, empfangen am Ende ihres Weges ewiges Leben, gehen in dieses Leben ein. Das ewige Leben wird hier also nicht als der gegenwärtige Besitz des Gläubigen in Christo betrachtet, sondern als das Ziel oder der Ausgang eines Pfades in treuem Dienst für den Herrn. In dieser Bedeutung kommt es auch an anderen Stellen vor. So gehen in Matthäus 25, 46 die Gerechten i n d a s ewige Leben.
Timotheus wird ermahnt, das ewige Leben zu e r g r e i f e n; in dem Briefe an Titus wird von der Hoffnung des ewigen Lebens gesprochen. Der Evangelist und Apostel Johannes redet dagegen fast ausschließlich von dem ewigen Leben in dem erstgenannten Sinne. In unserem Briefe gibt es eine interessante Stelle, in welcher wir beide Bedeutungen vereinigt finden. In Kapitel 6, 22. 23 sagt der Apostel nämlich, daß wir, von der Sünde freigemacht, unsere Frucht zur Heiligkeit haben, als das Ende aber ewiges Leben, und fügt dann hinzu: „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn." Jetzt schon in Christo im Besitz des ewigen Lebens als der Gabe Gottes stehend, gehen wir am Ende unseres Weges in den eigentlichen Bereich desselben, die Herrlichkeit, ein. Welche Gnade!
Weitergehend entwickelt der Apostel die verschiedene Größe der Verantwortlichkeit der einzelnen Menschen. Wenn auch alle verantwortlich sind, und Gottes Gericht in jedem Falle gerecht sein wird, bedingt doch die Höhe der jeweiligen Vorrechte das Maß der Schuld. Es gab Menschen ohne Gesetz (die Heiden) und solche unter Gesetz (die Juden). Daß die ersten schuldig waren, hatte der Apostel in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels klar bewiesen. Darum werden sie „auch ohne Gesetz verloren gehen"; es gibt kein Entrinnen für sie. Aber die unter Gesetz stehenden Juden, die, Gottes Willen kennend, Seine Gebote bewußt übertreten hatten, waren ungleich schuldiger als jene. Darum werden sie „durch Gesetz gerichtet werde n" (V. 12). Gerade ihre bevorzugte Stellung als Gottes Zeugnis unter den Völkern der Erde machte ihr Sündigen umso verhängnisvoller und strafbarer. War nicht sogar der Name Gottes ihretwegen unter den Heiden verlästert worden? (V. 24.) Würde Gott Sein Auge vor Bosheiten, wie sie sie verübt hatten, verschließen? Nein, gerade das Gesetz, dessen sie sich rühmten, würde ihr Richter sein.
An jenem Tage wird also ein jeder nach seiner persönlichen Stellung und den Vorrechten, die er besessen hat, gerichtet werden: der Heide als ohne Gesetz, der Jude als unter Gesetz, der Namenchrist als Besitzer und Bekenner der christlichen Wahrheiten. Wahrlich, der Richter der ganzen Erde wird recht tun. Jeder Mund wird verstopft werden, jede Einrede wird verstummen. Gott schaut, wie gesagt, nach Wirklichkeit aus. Er hat Wohlgefallen an der Wahrheit im Innern. Darum „sind nicht die H ö r e r des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die T ä t e r des Gesetzes werden gerechtfertigt werden" (V. 13). Alles Scheinwesen ist ein Gegenstand des Absehens vor Ihm, an Aufrichtigkeit hat Er Wohlgefallen. Wenn daher Heiden, die kein Gesetz hatten, .von Natur die Dinge des Gesetzes ausübten", so waren sie vor Gott wohlgefälliger als ein Jude, der sich des Gesetzes rühmte und doch nicht scheute, es zu brechen. Sie waren dann, wie der Apostel es ausdrückt, »sich selbst ein Gesetz". Den Mahnungen ihres Gewissens folgend, soweit sie belehrt waren und .ihre Gedanken sich untereinander anklagten oder auch entschuldigten", zeigten sie das Werk des Gesetzes, geschrieben in ihren Herzen (V. 14. 15.) Obwohl sie das Gesetz nie gehört hatten, waren sie Täter des Gesetzes und wurden als solche von Gott anerkannt.
Hier wollen wir indes beachten, daß der Apostel nicht sagt, daß solchen Heiden das gegeben sei, was in Hebräer 10, 15. 16 als ein Zeichen des neuen Bundes erscheint, den der Herr am Ende der Tage Seinem irdischen Volke errichten will: .Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben", und: .Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken". Wir ständen sonst vor einem unlöslichen Widerspruch. Nein, nicht das Gesetz Gottes zeigte sich in den Herzen jener Heiden geschrieben, sondern das Werk des Gesetzes. Nehmen wir z. B. an, ein Heide hätte die Verpflichtung in sich gefühlt, seine Eltern zu ehren oder seinen Nächsten zu lieben, so würde er, dieser Verpflichtung folgend, unbewußt die Gebote Gottes gehalten haben und insofern vor Ihm annehmlich gewesen sein. Ein solcher Heide war, wie wir weiter oben schon sagten, in seiner Unwissenheit und Blindheit vor Gott weit wohlgefälliger, als ein untreuer Jude mit all seinem vermeintlichen Wissen und seinen religiösen Vorzügen. Das stößt aber in keiner Weise den im 12. Verse aufgestellten ernsten Grundsatz um, daß alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, verloren gehen, und alle, die u n t e r Gesetz gesündigt haben, dereinst durch Gesetz gerichtet werden.
Die Strenge des Gerichts wird dem persönlichen Tun und dem Maße der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Menschen entsprechen, er mag Heide oder Jude oder Namenchrist sein, Wahrlich, ein erschreckender Gedanke für jeden Menschen, der den Willen Gottes kennt und doch den Begierden seiner Natur oder den Gedanken seines eigenwilligen, ungläubigen Herzens folgt! Dieses Gericht wird an dem Tage ausgeübt werden, „da Gott das Verborgene der Menschen richten wird durch Jesum Christum" (V. 16). Gott richtet und züchtigt schon heute einzelne Menschen und ganze Völker in den Wegen Seiner Vorsehung und Regierung, aber einmal wird Er „jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen" (Pred. 12, 14). Es kommt ein Tag, an welchem der Herr, auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird" (1. Kor. 4, 5).
Von diesem Tage spricht der Apostel hier, und wenn er von dem dann erfolgenden Gericht Gottes über den Menschen redet, fügt er hinzu: „nach meinem Evangelium". Paulus war der Träger des Evangeliums von Christo, dem gekreuzigten, auferstandenen und zur Rechten Gottes verherrlichten Menschen, der allen Gläubigen zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung geworden ist. Angesichts der wunderbaren, errettenden Gnade, die in diesem Jesus erschienen ist, um allen ohne Unterschied Heil und Leben zu bringen, wird Gottes heiliger Zorn, der heute schon vom Himmel her geoffenbart wird (Kap. 1. 18), sich ergießen über alle, die gesündigt und die ihnen angebotene große Errettung vernachlässigt haben. Jesus selbst, der jetzt als Heiland den Sünder zur Buße ruft, wird dann als „Richter der Lebendigen und der Toten" all die verborgenen Ratschläge und Wege der Menschen ans Licht bringen, und ein jeder wird „empfangen, was er in dem Leibe getan, nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses" (2. Kor. 5, 10). Und das alles wird geschehen in Übereinstimmung mit dem Evangelium, welches Paulus anvertraut war — „nach meinem Evangelium"! Welch eine vernichtende Antwort auf die Träumereien und Torheiten aller derer, welche, auf die Tatsache sich berufend, daß Gott Liebe ist, das ewige Gericht leugnen und die endliche Errettung aller Menschen predigen!
Kapitel 2, 17—29
Nachdem der Apostel im ersten Kapitel den sündigen Zustand der Heiden beschrieben und sich in den ersten 17 Versen des zweiten mit der Verantwortlichkeit des Menschen im allgemeinen (ob Jude oder Heide) dem gerechten Gott gegenüber beschäftigt hat, wendet er sich jetzt zu dem Juden im besonderen. .Wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst usw." (V. 17). Israel erfreute sich ja vor allen übrigen Völkern der Erde einer bevorzugten Stellung. Gott hatte sich ihm als der eine, wahrhaftige Gott geoffenbart, hatte ihm Seine guten, heiligen Gebote gegeben; der Jude war in den Gedanken Gottes unterwiesen und wußte „das Vorzüglichere zu unterscheiden", getraute sich deshalb, ein Leiter der Blinden und ein Lehrer der in Finsternis sitzenden Heiden zu sein. Von seiner vermeintlichen Höhe schaute er mitleidig oder gar verächtlich auf jene herab. Aber wie stand es tatsächlich um ihn? Hatten die ihm geschenkten Vorzüge ihn dahin geleitet, in den Wegen Gottes zu wandeln? Hatte das Licht, das er besaß, dazu gedient, ihn vor den heidnischen Greueln zu bewahren?
Ach! Eine Form der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz besitzend und in der Meinung, „ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen" sein zu können, hatte er genau dasselbe getan wie der Heide, sich so doppelt schuldig gemacht. «Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht? der du p r e d i g s t, man solle nicht stehlen, du stiehlst? der du sagst, man solle nicht ehebrechen, du begehst Ehebruch? der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub? der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes?" (V. 21—23). Niederschmetternde Worte! All das eitle Reden, Meinen und Rühmen ließ die beschämende Lage des Juden nur in einem umso helleren Licht erscheinen. Wenn sein Gewissen noch irgendwie wach war, mußte er sich unter das strenge Urteil des Apostels beugen und seine Sünde und Torheit anerkennen.
Ja, die Juden hatten nicht nur Sünde auf Sünde gehäuft und ihrem Gott die schuldigen Opfer vorenthalten, indem sie sie zu ihrem eigenen Vorteil benutzten, sondern ihre Bosheit hatte eine solche Höhe erreicht, daß der Name Gottes ihrethalben unter den Heiden beständig gelästert wurde. (V. 24.) überall, wohin sie gekommen waren, hatten sie diesen heiligen Namen der Entweihung preisgegeben. (Vergl. Jes. 52, 5; Hes. 36, 20—23.) Konnte ein Gott, der Seine Ehre keinem anderen gibt und ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, zu solchem Tun schweigen?
Er schaut, wie wir sahen, nach Wahrheit und Wirklichkeit aus. Äußere Formen und Zeremonien ohne innere Kraft können Ihm nicht genügen. „Beschneidung ist wohl nütze", fährt der Apostel deshalb fort, „wenn du das Gesetz tust; wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Vorhaut geworden (d. h. du unterscheidest dich in nichts mehr von einem Heiden)." Und umgekehrt: „Wenn die Vorhaut die Rechte des Gesetzes beobachtet, wird nicht seine Vorhaut für Beschneidung gerechnet werden?" Mit anderen Worten: wenn ein Heide die Rechte des Gesetzes beobachtet, so wird er dadurch vor Gott annehmlich, und obwohl ihm die äußeren Vorzüge des Juden mangeln, spricht er durch seine Erfüllung des Gesetzes das Urteil über den Juden, der „mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter ist" (V. 25—27). Beachten wir, daß der Apostel hier, wie in seinen früheren Belehrungen (V. l—16), nicht die Wahrheiten des Evangeliums entwickelt, sondern von den gerechten Wegen Gottes dem Menschen gegenüber redet. Daß diese Wege sich jedem aufrichtigen Gewissen empfehlen und in keiner Weise im Widerspruch stehen mit den Offenbarungen der Gnade Gottes in Seinem geliebten Sohne, braucht kaum hinzugefügt zu werden.
Das Ergebnis der Beweisführung des Apostels ist einfach und klar: „Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleische Beschneidung; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geiste, nicht im Buchstaben; dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist" (V. 28. 29). Immer wieder begegnen wir derselben ernsten Tatsache: Gott hat Wohlgefallen an Aufrichtigkeit, alles Form- und Scheinwesen ist vor Ihm verwerflich. Was nützt alle äußere Religion, was die genaueste Beobachtung von Satzungen, wenn Herz und Gewissen nicht in das Licht Gottes gebracht sind? Beschneidung am inneren Menschen, im G e i s t e, ist notwendig, um ein wahrer Jude zu sein, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist.2
_____________
Kapitel 3
Kapitel 3, 1—20
Wenn Gott aber so ernst nach Wirklichkeit verlangt und jede äußere Form verwirft, war es dann nicht besser, ein unbeschnittener Heide zu sein, dessen Verantwortlichkeit doch ungleich geringer war, als die eines Juden? Ganz von selbst entsteht so die Frage: „Was ist nun der Vorteil des Juden? oder was der Nutzen der Beschneidung?" Der Apostel antwortet: „Viel, in j e d e r Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden" (V. 2). An anderer Stelle (Kap. 9, 4. 5) zählt er noch eine Reihe von weiteren Vorzügen des Juden auf, hier nennt er nur diesen einen, und zwar den hervorragendsten: sie besaßen das geschriebene Wort Gottes. Keinem anderen Volke auf Erden hatte Gott sich in solch unmittelbarer Weise geoffenbart, wie Seinem Volke Israel. Nur ihnen, den Nachkommen Abrahams, der einst durch die Beschneidung von allen anderen Menschen abgesondert worden war, hatte Er Sein gutes Wort gegeben. Aber wie hatten sie diesen Vorzug benutzt?
Israel hatte die Güte Gottes mit Füßen getreten. Es handelt sich hier nicht um die Frage, wie viele oder wenige von dem Volke persönlich bekehrt waren, sondern um die Vorrechte, die Israel als das Eigentumsvolk Gottes vor allen anderen Völkern besaß, und um die Frage, welchen Gebrauch es von diesen Vorrechten gemacht hatte. Nun, die Antwort war bekannt genug: Israel war untreu gewesen. Aber würde seine Untreue die Treue Gottes aufheben und die göttlichen Aussprüche ungültig machen? „Das sei ferne!", erwidert der Apostel. „Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner!" Gott steht unverbrüchlich zu Seinem Wort. Er wird Seine Verheißungen erfüllen, wenn auch Israel durch seine Untreue alle Ansprüche daran verloren hat. Diesen Punkt verfolgt der Apostel hier aber nicht weiter, sondern kommt erst im 11. Kapitel ausführlich darauf zurück.
Gleichwie Gott aber Seine Verheißungen wahr macht, so hält Er auch Sein Urteil über die Sünde aufrecht. Schon David hatte nach seinem schweren Fall seine einzige Hilfsquelle darin gefunden, daß er seine Sünde rückhaltlos bekannt und Gott gerechtfertigt hatte, mochte es ihn selbst kosten, was es wolle. Er sagt: „Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten, und überwindest, wenn du gerichtet wirst" (V. 4; ps. 51, 4). Wie könnte auch jemals in Gottes Reden oder Richten ein Fehler gefunden werden? Am Ende wird alles zu Seiner Verherrlichung und zur Beschämung des Menschen ausschlagen. Gott wird in jeder Beziehung als „Überwinder" dastehen.
Aber — wir werden diesem „Aber", das der Menschengeist Gottes Aussprüchen gegenüber immer wieder erhebt, in unserem Briefe noch oft begegnen — wenn des Menschen Untreue die unfehlbare Treue und Wahrhaftigkeit Gottes nur umso glänzender hervortreten läßt, „wenn unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen?" Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn Er an denen Gericht übt, die durch ihr Tun Seine Treue in ein umso herrlicheres Licht stellen? Der Apostel sagt, daß er „nach Menschenweise" rede, d. h. so wie Menschen in ihrer Unwissenheit unüberlegt sprechen und urteilen. Aber wieder antwortet er: „Das sei ferne!" Denn wenn dieser Einwurf berechtigt wäre, dann könnte Gott überhaupt niemand richten, auch die Heiden nicht. (V. 6.) Daß Gott aber der gerechte Richter der ganzen Erde sei, hatte schon Abraham ausgesprochen (1. Mose 18, 25), und die Juden waren durchaus der Meinung, daß die Gottlosigkeiten der Heiden Gericht verdienten.
Wie töricht und sinnlos also ist der Schluß, daß infolge der Tatsache, daß durch die Untreue des Menschen Gottes Treue sich umso herrlicher erweist, die Sünde und Schuld des Menschen geringer werde, Gott sich gar gehindert sehe, als Richter der ganzen Erde Recht zu üben! Mit anderen Worten:
daß Gott den Sünder nicht bestrafen dürfe, sondern gar noch belohnen müsse, weil seine Lüge die Wahrhaftigkeit Gottes umsomehr ans Licht stellt. Nein, Gott bleibt stets treu, unveränderlich derselbe, „Er kann sich selbst nicht verleugnen" (2. Tim. 2, 13). Seine Verheißungen wie Seine Gerichtsandrohungen werden unausbleiblich in Erfüllung gehen. Trotz aller Einwendungen des Menschen werden Juden wie Heiden dem Gericht des heiligen Gottes verfallen.
Schließlich fragt der Apostel noch einmal: „Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet?" Aber er überläßt jetzt die Antwort den Hörern oder Lesern. Ein natürlich aufrichtiges Gewissen kann bezüglich der Antwort auch nicht in Verlegenheit kommen. Könnten, selbst in menschlichen Beziehungen, die vielleicht günstigen Folgen eines Vergehens den Täter von Schuld und Strafe befreien, oder das Vergehen selbst gar in etwas Lobenswertes verwandeln? Dieser ganz widersinnige Gedanke erinnert den Apostel dann an den bösen Grundsatz, der den Gläubigen von ihren Feinden in den Mund gelegt wurde. Man sagte nämlich, daß sie sprächen; „Laßt uns das Böse tun, damit das Gute komme I" (V. 8). Innerlich entrüstet über eine solche Beschuldigung, die schließlich nur die eigene innere Stellung der Redenden verriet, fügt er hinzu: „deren Gericht gerecht ist". Wer so redet, spricht sich selbst das Urteil. Aber die Gnade wird immer angegriffen und verunglimpft werden, solang das Gewissen nicht von der Sünde überführt ist; wo das aber geschieht, da wird sie verstanden und dankbar begrüßt.
Mit dem 9. Verse nimmt der Apostel seinen Gedankengang wieder auf und fragt, an Vers l anknüpfend: „Was nun? Haben wir einen Vorzug?" Die Antwort lautet: „Durchaus nicht; denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, daß sie alle unter der Sünde seien." Beide Klassen waren widerspruchslos der Sünde überführt. Die Juden, obwohl völlig bereit, das im Blick auf die Heiden zuzugeben, hätten sich selbst gern diesem Urteil entzogen. Darum führt Paulus jetzt eine Reihe von Stellen aus ihren eigenen Schriften an, die in schlagender Weise dartun, daß sie nicht nur selbst Sünder waren, sondern daß sie es in der Sünde weiter getrieben hatten als die Heiden. Diese Beweisführung ist zu Boden schmetternd. Gerade die Aussprüche Gottes, die den Juden anvertraut waren, und deren sie sich, als ihnen allein gehörend, so gern rühmten, entwarfen ein furchtbares Bild von ihrem sittlichen Zustand. Die Schilderung der Sünden und Schändlichkeiten der Heiden im ersten Kapitel ist erschütternd, aber die Täter waren eben Heiden, die ohne Gott in der Finsternis ihrer Herzen dahinlebten. Aber hier handelt es sich um Juden mit ihren mannigfaltigen, großen Vorzügen!
Da war nicht ein Gerechter unter ihnen, nicht einer, der nur nach Gott gefragt hätte. Allesamt waren sie abgewichen und untauglich geworden, keiner war da, der Gutes getan hätte, auch nicht einer. Alle ihre Glieder hatten sie als Werkzeuge der Ungerechtigkeit benutzt; alles an ihnen war verderbt, durch Sünde und Gewalttat befleckt: ihr Schlund, ihre Zunge, ihre Lippen, ihr Mund, ihre Füße, ihre Wege. Keine Furcht Gottes gab es vor ihren Augen. Die Zeugnisse von diesem schrecklichen Verderben sind aus den Psalmen und Propheten zusammengetragen. Was konnten die Juden darauf erwidern? Nichts. Denn „wir wissen, daß alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind". Der Beweis der Schuld, der doppelt großen Schuld der Juden war also unwiderleglich erbracht.
Und nun kommt die geradezu überwältigende Schlußfolgerung. Sie lautet: „auf daß jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei". Jeder Mund, auch der des Juden, verstopft, ja, noch wirkungsvoller verstopft, als der des Heiden; die ganze Welt, Juden und Heiden, unrettbar dem Gericht Gottes verfallen — das ist in der Tat ein Ergebnis, wie man es sich furchtbarer nicht denken könnte. Die gesamte Menschheit dem Gericht Gottes verfallen! Alle, ob religiös oder gottlos, gut oder böse, verstummen vor dem Richterstuhl des heiligen Gottes! Welch eine Demütigung für den Stolz und die Selbstgefälligkeit des eitlen Menschen! Und umsonst lehnt er sich mit aller Macht dagegen auf. So steht es mit der Welt nach Gottes Urteil.
Der Apostel schließt den ganzen Abschnitt mit den Worten: „Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt E r k e n n t n i s der Sünde" (V. 20). Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, durch Werke Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, so wäre sie dem Volke Israel in dem Gesetz vom Sinai gegeben gewesen. Aber genau das Gegenteil war eingetreten: der Zustand der Juden hatte sich, wie wir gesehen haben, so schlimm erwiesen, daß sie zu einem Sprichwort unter den übrigen Völkern geworden waren. Ihre Schuldbarkeit war also durch die Übertretung des Gesetzes, dessen Unverletzlichkeit sie anerkannten, riesengroß geworden.
Doch hätte es anders sein können? Nein; denn das Gesetz überführt nur von der Sünde, läßt sie in ihrer ganzen Häßlichkeit erscheinen — sie wird „überaus sündig durch das Gebot" (Kap. 7, 13) — aber es kann niemals Heiligkeit hervorbringen, niemals den Sünder vor Gott rechtfertigen. Indem es ihn die Sünde in ihrem wahren Charakter erkennen läßt, verurteilt es ihn in seinem Gewissen, so daß nichts anderes für ihn übrigbleibt, als Beugung und Selbstgericht, oder, wenn er die Gnade versäumt, am Ende ein schreckensvolles Verstummen.
Kapitel 3, 21-31
„Jetzt aber" — mit diesem kurzen Wort leitet der Apostel einen ganz neuen Abschnitt ein, der uns mit lieblicheren Gegenständen beschäftigen soll, als der lange, von Kapitel 1. 18—3, 20 sich hinziehende Zwischensatz. Hat er in diesem von dem traurigen Zustand des Menschen gesprochen, von den schrecklichen Folgen seines Falles, die in dem Endergebnis gipfeln, daß die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist, führt er uns jetzt zu dem, was Gott dem hoffnungslosen Verderben des Menschen gegenüber getan hat — zur Offenbarung Seiner Gerechtigkeit im Evangelium. Das Gesetz hatte diese Gerechtigkeit nicht offenbaren, hatte nicht einmal eine menschliche Gerechtigkeit schenken können — denn durch das Gesetz ist nur Erkenntnis der Sünde gekommen. Aber in dem Evangelium der Gnade wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart „aus Glauben zu Glauben".
Damit kommt der Apostel auf den 17. Vers des ersten Kapitels zurück. Diese Gerechtigkeit hat mit dem Gesetz nichts zu tun, obwohl sie durch das Gesetz bezeugt worden ist: „Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten: Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesum Christum gegen alle und auf alle, die da glauben." Welch eine wunderbare Wahrheit, ja, welch eine Fülle von Wahrheit in so wenigen Worten! Wir haben schon weiter oben ein wenig von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen. Sie findet ihren Maßstab nicht in der Verantwortlichkeit des Menschen, sondern in Gott selbst, in Seiner Natur. Gott richtet den Menschen nach dessen Verantwortlichkeit, aber Seine Gerechtigkeit offenbart sich in Seinem Tun; und wo und wie Er sich offenbaren mag, da kann es nur zu Seiner Verherrlichung ausschlagen. Gottes Offenbarung ist immer auch Seine Verherrlichung.
Gottes Gerechtigkeit ist also ohne Gesetz geoffenbart worden. Das Gesetz war dem Menschen und seinem Verhältnis zu Gott angepaßt. Es gebot ihm, Gott über alles zu lieben, aber Gott blieb bei alledem im Dunkel, und das Gesetz erwies nur die Schuld und völlige Hilflosigkeit des Menschen. Wo ein aufrichtiges Gewissen war, mußte es anerkennen, daß die eigene, auf gesetzlichem Boden erwachsene Gerechtigkeit nur aus schmutzigen Lumpen bestand. Gottes Gerechtigkeit steht ganz und gar außerhalb jedes Gesetzes und hat sich, wie wir sahen, zunächst darin erwiesen, daß Er Jesum auf Grund Seines vollbrachten Werkes zur Rechten Seiner Majestät mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat. Wohl haben das Gesetz und die Propheten des Alten Bundes von dieser Gerechtigkeit geredet, sie bezeugt, aber mehr als das konnten sie nicht tun. Wir lesen in Jesaja 46, 13: „Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht, sie ist nicht fern, und mein Heil zögert nicht", und im 56. Kapitel desselben Propheten: „Mein Heil steht im Begriff zu kommen, und meine Gerechtigkeit, geoffenbart zu werden" (V. l; vergl. auch Kap. 51, 5. 6. 8; Dan. 9, 24). So haben diese alten Zeugen Gottes Gerechtigkeit angekündigt, ihre Offenbarung als nahe bevorstehend bezeichnet, damit aber zugleich bekundet, daß sie in ihren Tagen nicht geoffenbart war.
Jetzt aber ist sie geoffenbart worden, und zwar durch Glauben an Jesum Christum, den gekreuzigten und verherrlichten Heiland. Das Gesetz wußte nichts von einem Stellvertreter und Bürgen für den schuldigen Sünder, es konnte nur in schwachen Schatten und Vorbildern auf den Kommenden hinweisen. „Jetzt aber" — Gott sei gepriesen für dieses Wort! — ist in Jesu Christo Gottes Gerechtigkeit g e o f f e n b a r t worden. Die Gnade zeugt von einem Eintreten und Eingreifen Gottes in Seinem geliebten Sohne, dessen Er nicht geschont hat, um unser schonen zu können. Das Kreuz auf Golgatha redet indes nicht nur von dem Vorrecht Gottes, da, wo alle Hoffnung verloren war, in Gnaden eingreifen zu können, sondern auch von Seiner Gerechtigkeit, die sich darin kundgibt, daß Er jetzt jeden rechtfertigt, der des Glaubens an Jesum ist. Anderseits bekennt der Mensch durch sein Glauben an das Zeugnis Gottes über Seinen Sohn, daß er schuldig und sündig ist, jeder eigenen Gerechtigkeit entbehrt und nur durch das Sühnungswerk Christi der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig werden kann.
Stände diese Gerechtigkeit irgendwie mit dem Tun des Menschen in Verbindung, so wäre sie durch Gesetz, könnte also nur für Israel in Betracht kommen. Aber weil es Gottes Gerechtigkeit ist, so findet sie Anwendung auf alle Menschen ohne Unterschied, es ist „Gottes Gerechtigkeit g e g e n a 11 e", d. h. sie ist a 11 e n zugewandt, ist für alle da. Gerade weil es sich um eine Gerechtigkeit handelt, die gegründet ist auf das Werk Christi, der für alle starb, hat sie Bezug auf die ganze Welt, auf alle Menschen, ob Juden oder Heiden. Aber — beachten wir es wohl! — obwohl sie allen zugänglich gemacht ist, kommt sie doch nur auf alle, kommt nur denen zugute, welche glauben. Nur wer in persönlichem Glauben mit Christo in Verbindung kommt, hat teil an ihr und genießt alle die Vorrechte, die mit ihr in Verbindung stehen.
„Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes" (V. 23). Der gefallene Mensch wurde durch die Herrlichkeit Gottes aus dem Garten Eden vertrieben, und seine weitere Geschichte ist nichts als Sünde und wachsende Entfremdung von Gott. Er ermangelt alles dessen, was ihm einen Platz in Gottes heiliger Nähe geben könnte. Die Herrlichkeit Gottes muß ihn verzehren. Und da ist k e i n Unterschied, alle haben gesündigt, keiner erreicht (oder reicht hinan an) die Herrlichkeit Gottes. Aber, Gott sei gepriesen! gerade so wie alle Menschen von Natur in derselben Stellung vor Gott sich befinden, so ist auch für alle ohne Unterschied die gleiche Gnade da alle, die da glauben, „werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist" (V. 24). Alles ist Gottes Werk und deshalb so vollkommen; alles gründet sich auf die Erlösung, die in Christo Jesu ist, und steht deshalb so unerschütterlich fest. Alle Glaubenden standen und stehen auf demselben Boden vor Gott: gestern unterschiedslos Sünder und Verlorene, heute unterschiedslos Gerechtfertigte und Begnadigte.
Doch wie ist die Erlösung zustande gekommen? Selbstverständlich konnte es nur auf einem Wege geschehen, der den Forderungen der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes völlig Genüge leistete. Schon im Alten Bunde hatte Gott diesen Weg vorbildlich dargestellt. Einmal im Jahre, am Versöhnungstag, ging der Hohepriester in das Allerheiligste, um das Blut des Opfertieres auf den goldenen Deckel, der auf der Bundeslade lag, zu sprengen und so Sühnung vor Gott zu tun. Das Blut befand sich nunmehr zwischen den Cherubim, den heiligen Wächtern über die Ausführung der gerechten Regierungswege Gottes, und dem gebrochenen Gesetz, das, von Gottes Finger unauslöschlich eingegraben, auf den beiden in der Bundeslade liegenden Steintafeln stand. So war das Blut gleichsam an die Stelle der Sünde getreten, der Thron des Gerichts auf gerechter Grundlage in einen Gnadenstuhl umgewandelt. Nur das Blut eines von Gott anerkannten und angenommenen Opfers konnte so etwas tun.
Heute ist das Vorbild in Erfüllung gegangen. Gott hat Christum Jesum „dargestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut" (V. 25). Das kostbare Blut des Sohnes Gottes ist in die Gegenwart Gottes gebracht und dort in seinem ganzen Werte vor Gott gesprengt worden. Christus ist sowohl der Hohepriester, der mit Seinem eigenen Blute gekommen und ins Heiligtum eingegangen ist, als auch der von Gott aufgerichtete Gnadenstuhl. Sein Blut hat eine vollkommene Sühnung gebracht. Wer zu diesem Blute seine Zuflucht nimmt, tritt als ein Gerechtfertigter auf den Boden der Erlösung. Seiner Sünden will Gott nie mehr gedenken, und das nicht nur auf Grund Seiner Gnade, sondern „zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, daß er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist" (V.25. 26).
Gott konnte die Sünden der Seinigen in alttestamentlichen Zeiten in Nachsicht tragen, weil Er auf das Opfer vorausblickte, das auf Golgatha gebracht werden sollte. Er sah das kostbare Blut, das von aller Sünde reinigt, und konnte unbeschadet Seiner Gerechtigkeit, nein, zur Erweisung derselben, an diesen Sünden mit Nachsicht vorübergehen. Die spätere Aufrichtung des Gnadenstuhls, die Er voraussah, und die in den Opfern des Alten Testamentes fortwährend vorgebildet wurde, hat Ihn in diesem Tun gerechtfertigt. Doch überdies erweist sich Gottes Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit darin, daß Er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesum ist. Es handelt sich nicht länger um Nachsicht. Die Schuld i s t bezahlt, das Sühnungsblut ist geflossen. Gottes Gerechtigkeit steht nicht länger in Aussicht, sie ist in Christo ans Licht gebracht, geoffenbart worden, so daß Gott heute Seine Gerechtigkeit gerade darin erweisen kann, daß Er jeden Sünder rechtfertigt, der an Jesum glaubt. Er ist nur gerecht, wenn Er das tut.
Wunderbare Wahrheit! In der Tat, sie ist eines Gott-Heilandes würdig, sie verherrlicht Ihn und Den, der da kam, um Gottes Heilsplan auszuführen, während sie für den Menschen keinerlei Raum zu seiner Verherrlichung läßt. Darum fragt der Apostel auch in Vers 27: .Wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden." Gott will Seine Ehre keinem anderen geben, am allerwenigsten dem hochmütigen, eigen gerechten Menschen.
Doch wie ist dem Menschen jeder Ruhm genommen worden? »Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens." Der Leser ist vielleicht erstaunt, das Wort „Gesetz" hier zu finden. Aber er wolle bedenken, daß Paulus dieses Wort oft gebraucht, um eine bekannte Regel, einen durch Erfahrung festgestellten Grundsatz zu bezeichnen. Er denkt bei dem Worte keineswegs immer an das Gesetz vom Sinai. (Vergl. z. B. Kap. 7, 21. 23; 8, 2.) Ähnlich reden wir von Naturgesetzen, vom Gesetz der Schwere usw. Was ist es nun, das im vorliegenden Falle den Ruhm ausgeschlossen hat? Die einfache, klar festgestellte Tatsache, daß kein Mensch durch sein Tun gerechtfertigt werden kann, daß das vielmehr nur auf dem Grundsatz des Glaubens möglich ist. Man sagt zwar oft: .Keine Regel ohne Ausnahme." Aber hier ist eine Regel, die k e i n e Ausnahme zuläßt. Wenn wir urteilen müssen — und da ist kein anderes Urteil möglich — »daß ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke", so fällt unbedingt aller Ruhm Dem zu, an welchen man glaubt. »Das Gesetz des Glaubens" verschließt ein für allemal jedem Selbstruhm die Tür. Das mag tief beschämend und demütigend sein für den eigen gerechten Menschen, aber es ist überaus kostbar für den bußfertigen, verlorenen Sünder.
Ist dies aber der einzige, von Gott bereitete Weg zur Rechtfertigung, so folgt daraus, daß Gott nicht Gott der Juden allein ist, oder auch nur mehr Gott der Juden, als der Heiden. Nein, Er ist der „einige" Gott. Er war das freilich schon im Alten Testament, wenngleich Er, als alle Völker der Erde dem Götzendienst verfallen waren, in Abraham und seinen Nachkommen sich ein Volk erkor, das die Erkenntnis des einen wahren Gottes auf Erden bewahren sollte. Jetzt aber hat Er in Gnaden Seinen Platz als Gott über alle Menschen, Juden und Heiden, eingenommen, und Er rechtfertigt einen beschnittenen Juden nicht etwa auf Grund seiner Werke, auf dem Boden des Gesetzes, sondern nur „aus Glauben", d. h. auf dem Grundsatz des Glaubens, und einen unbeschnittenen Heiden, der kein Gesetz kennt, nur „durch Glauben", d. h. mittels des Glaubens. Ein anderes Mittel der Rechtfertigung gibt es nicht.
So ist denn jeder Unterschied aufgehoben. Alle Menschen sind verlorene, ohnmächtige Sünder, die nur durch Gnade, durch den Glauben an das Werk eines Anderen errettet werden können. „Gott hat", wie der Apostel im 11. Kapitel es ausdrückt, „alle zusammen (Juden und Heiden) in den Unglauben eingeschlossen, auf daß er alle begnadige", oder unter die Begnadigung bringe. ,0 Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes l" (V. 32.33).
Aber, könnte man fragen, wird nicht die Autorität des Gesetzes durch eine solche Lehre geschwächt? Werden nicht seine heiligen Rechte dadurch beiseite gesetzt? „Das sei ferne!" antwortet der Apostel. Anstatt das Gesetz aufzuheben, bestätigen wir es. (V. 31.) Das Gesetz hat niemals eine unzweideutigere Bestätigung gefunden, als gerade durch das Wort vom Kreuz. Das Evangelium lehrt nicht nur die ganze Verdammungswürdigkeit des Menschen, sondern auch die Notwendigkeit einer vor Gott gültigen Gerechtigkeit. Das Gesetz gibt freilich keine Gerechtigkeit, aber es fordert sie. Der „Glaube" erkennt beides an, sowohl das völlige Verderben des Menschen als auch die Notwendigkeit der Gerechtigkeit, und siehe da, anstatt einer menschlichen Gerechtigkeit, wie das Gesetz sie verlangt, empfängt er dankbar die ihm umsonst geschenkte Gerechtigkeit Gottes! Zugleich lehrt das Evangelium, daß Christus uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft hat, indem Er ein Fluch für uns geworden ist. Da der heilige Gott den Grundsatz der Verpflichtung gegen das von Ihm gegebene Gesetz selbstverständlich in keiner Weise schwächen konnte, „sandte er seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf daß er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf daß wir die Sohnschaft empfingen" (Gal. 4, 4. 5).
Wir fragen: Hätte das Gesetz jemals deutlicher bestätigt oder seine Autorität vollkommener festgestellt werden können?
Kapitel 4
Nach Behandlung der Frage, in welcher Beziehung der Glaube zum Gesetz steht, kommt Paulus jetzt ganz von selbst zu der anderen, wie es mit den Gläubigen des Alten Testaments aussah, ehe das Evangelium von Jesu der ganzen Welt gepredigt wurde. Da sind es denn vornehmlich zwei Personen, die für den Apostel in Frage kommen, weil sie, der eine als Empfänger und Träger der Verheißungen Gottes, der andere als Vertreter des von Gott erwählten Königtums, für jeden Juden von besonderer Bedeutung waren. Mit ihnen standen alle Erwartungen Israels in Verbindung. War doch der Messias der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams l (Vergl. Matth. 1. l.) In beiden Männern, vornehmlich aber in Abraham, werden wir die Beweisführung des Apostels bestätigt finden. Er fragt zunächst:
„Was wollen wir denn sagen, daß Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet"." (V. l—3). Abraham erlangte die Gerechtigkeit samt der Verheißung, „daß er der Welt Erbe sein sollte" (V. 13), auf dem Grundsatz des Glaubens. Von einem Tun Abrahams war dabei gar keine Rede. Es gab deshalb nichts darin, dessen er sich hätte rühmen können. Alles war die freie Gabe Gottes. Gott sprach, und Abraham glaubte. Gott verhieß in Gnaden einen Segen, und Abraham verherrlichte Gott, indem er wider Hoffnung auf Hoffnung glaubte. Und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Jakobus scheint im 2. Kapitel seines Briefes dem hier Gesagten zu widersprechen, wenn er fragt: „Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte?" (Jak. 2, 21). Aber wenn wir uns daran erinnern, daß Jakobus an die zwölf Stämme Israels, also an meist unbekehrte Menschen, geschrieben hat, die wohl ein Bekenntnis, aber nicht wahren Herzensglauben besaßen, daß er deshalb auf eine praktische Bestätigung des Bekenntnisses, Glauben zu haben, dringt, so schwindet die Schwierigkeit. Die Opferung Isaaks war ein Beweis des bereits vorhandenen Glaubens. Der Glaube wirkte bei dieser Opferung mit und wurde durch sie vollendet, geradeso wie bei Rahab die Aufnahme und Entlassung der Kundschafter auf einem anderen Wege den Glauben in ihr bewies und das Bekenntnis, das sie den Kundschaftern gegenüber abgelegt hatte, rechtfertigte. In beiden Fällen handelt es sich also nicht um Rechtfertigung vor Gott, sondern vor Menschen, um den allen sichtbaren Beweis, daß das Bekenntnis zu glauben echt war. In der Opferung Isaaks und in dem freien Entlassen der Kundschafter (trotz der damit verbundenen Lebensgefahr für Rahab) zeigte sich ein bewußter und wirksamer Glaube. Beide Taten waren nicht Gesetzes werke — weder Totschlag noch Landesverrat werden vor dem Gesetz gutgeheißen — auch nicht gute Werke in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern Werke des Glaubens, durch welche dieser sich als wahr und lebendig erwies. Denn ein Glaube, der nicht Werke hat, ist tot, ist nur ein Kopfglaube. Das ist die Seite der Wahrheit, die Jakobus vertritt.
Welcher Schluß mußte nun aber aus der Geschichte Abrahams gezogen werden? Wenn Abraham durch Werke gerechtfertigt worden wäre, so wäre etwas dabei auf seine Rechnung gekommen; aber wie wäre das möglich gewesen vor einem heiligen Gott, vor dem selbst die Himmel nicht rein sind? Nein, die Schrift berichtet nichts Gutes von Abraham, keinerlei Werke, auf Grund deren Gott ihn hätte rechtfertigen können. Was sagt sie vielmehr? „Abraham aber glaubte Gott." So steht geschrieben, und so war und ist es in vollem Einklang mit dem Evangelium. Gott handelt auch heute noch so. Nachdem Christus für Gottlose und Sünder gestorben ist, wird jeder Glaubende von Gott in Gnaden angenommen. Gott ist jetzt ein Gott, „der den Gottlosen rechtfertigt", wobei naturgemäß Ihm alle Ehre zufallen muß.
Wenn ein Mensch eine Arbeit verrichtet, so wird ihm Lohn dafür zuteil, kleiner oder größer, je nach dem Wert und Umfang der Arbeit. Er empfängt eine Vergütung, und zwar nicht als Geschenk, sondern als Verdienst, als etwas ihm rechtlich Zukommendes. „Der Lohn wird nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit" (V. 4). Wenn aber jemand „nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt", und dieser Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wird, welch ein einwandfreier und herrlicher Beweis für die Lehre von der freien Gnade! Das ist dann in der Tat das Gegenteil von einer Rechtfertigung auf dem Boden gesetzlicher Werke. Und so hatte Gott einst mit Abraham und den übrigen Gläubigen des Alten Bundes gehandelt.
Der Nicht wirkende, der erkannt hat, daß er vor Gott nichts anderes ist als ein unreiner, verlorener Sünder, und nun im Glauben Gott naht als Dem, der auf Grund des Sühnungswerkes Christi den schmutzigen Sünder reinigen, den Gottlosen rechtfertigen kann, wird auf Grund dieses seines Glaubens gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Gottes, die mit dem Wirken des Menschen durchaus nichts zu tun hat, wird sein aus freier Gnade ihm geschenktes Teil.
So spricht auch David, der königliche Sänger, obwohl er unter Gesetz stand, im 32. Psalm nicht von der Glückseligkeit der Täter dieses Gesetzes — ach! er hatte schmerzlich genug erfahren, daß es eine solche nicht gibt — sondern von der „Glückseligkeit des Menschen, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet". Er preist Menschen glückselig, die das Gesetz verfluchen mußte — Sünder, die das Gesetz nicht beobachtet hatten, deren Gesetzlosigkeiten aber der in Gnade handelnde Gott vergeben, deren Sünde Er zudecken wollte. „Glückselig der Mensch, dem der Herr Sünde nicht zurechnet!" (V. 6—8.) Im Anschluß daran fragt der Apostel weiter:
„Diese Glückseligkeit nun, ruht sie auf der Beschneidung, oder auch auf der Vorhaut? denn wir sagen, daß der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? als er in der Beschneidung oder in der Vorhaut war? Nicht in der Beschneidung, sondern in der Vorhaut" (V. 9. 10).
Daß nicht Werke, sondern der Glaube Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist, stand also ein für allemal fest; aber die Frage blieb noch offen, besonders für die Nachkommen Abrahams, wann diese Zurechnung stattgefunden hatte. War Abraham damals schon beschnitten, oder noch nicht? Nein, erst viele Jahre später, als er bereits in seinem 100. Lebensjahre stand (vergl. 1. Mose 17), empfing er „das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens", den er vorher hatte. (V. 11.) Darum ist Abraham mehr als irgend ein anderer geeignet, Vater aller derer zu heißen, die als Unbeschnittene glauben, „damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet würde". Zugleich ist er aber auch Vater der Beschneidung — beachten wir, daß der Apostel nicht sagt: der Beschnittenen — das will sagen, der Beschneidung in ihrer wahren Bedeutung, als Zeichen einer wirklichen Absonderung für Gott, sei es im Blick auf die a u s der Beschneidung, die gläubigen Juden, oder auf die, welche als Unbeschnittene in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den Abraham vor seiner Beschneidung hatte. (V. 12.) Diese Absonderung hatte für Abraham begonnen, als Gott ihn inmitten des ihn umgebenden Bösen durch die Beschneidung (das Bild des Todesurteils über das Fleisch) für sich beiseite stellte. Er war also nicht durch diesen Akt gerechtfertigt worden, die Beschneidung war nicht ein Mittel rechtfertigender Gnade, sondern das Siegel der unserem Patriarchen schon Jahrzehnte vorher zugerechneten Gerechtigkeit. Die Gläubigen aus den Nationen waren deshalb auch, ihrem Vater entsprechend, in geistlichem Sinne genau so beschnitten wie die Gläubigen aus den Juden. Da war kein Unterschied. Abraham war der Vater aller.
Mit dem 13. Verse beginnt ein neuer Gedanke. Abraham war der Träger der Verheißung Gottes. Stand nun diese, ihm oder seinem Samen gegebene „Verheißung, daß er der Welt Erbe sein sollte", irgendwie mit dem Gesetz in Verbindung? War sie von der Erfüllung desselben abhängig gewesen? Unmöglich! Eine bedingungslos gegebene Verheißung schließt ganz von selbst die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen aus. Gott redet weder im 12. Kapitel des 1. Buches Mose noch im 22., wo Er Seine Verheißung dem Samen Abrahams bestätigt, ein einziges Wort vom Gesetz. Es wäre, wie gesagt, gar keine Verheißung gewesen, wenn ihre Erfüllung von dem Tun dessen abhängig gemacht worden wäre, der sie empfing. Nein, Gott gibt, und Gott erfüllt die Verheißung. Das Erbe wird nicht durch Gesetz erlangt, „sondern durch Glaubensgerechtigkeit". Darum, wenn die vom Gesetz Erben wären, so wäre „der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben" (V. 14).
„Denn das Gesetz bewirkt Zorn; aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung" (V. 15). Die ganze Geschichte Israels beweist die ernste Wahrheit dieses Satzes. Das Gesetz vom Sinai, so gut und gerecht es war, hat in dem Menschen nur dessen Eigenwillen geweckt und die natürliche Feindschaft seines Herzens ans Licht gestellt, die sich in der Übertretung der heiligen Gebote Gottes kundgegeben hat und infolge dessen Gottes Zorn über den Menschen bringen mußte. Wo kein Gesetz ist, da mag wohl Sünde vorhanden sein, aber diese offenbart sich nicht in der Form von Übertretung. Erst wenn ein Gebot gegeben ist, kann es übertreten werden, und gerade aus diesem Grunde kam, wie Paulus in Kapitel 5, 20 sagt, „das Gesetz daneben ein, auf daß die Übertretung (nicht: die Sünde) überströmend würde". Wie könnte also durch Gesetz das Erbe erlangt werden? Zudem war zur Zeit Abrahams das Gesetz noch gar nicht gegeben. Was ihm gegeben wurde, war, ich wiederhole es, eine bedingungslose Verheißung, die völlig unabhängig war von jedem menschlichen Wirken und sich einzig und allein auf die Gnade Gottes gründete.
„Darum ist es aus Glauben, auf daß es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist", sowohl der Gläubigen aus den Juden als auch derer aus den Heiden. (V. 16.) Das stimmt auch mit dem Worte Gottes an Abraham überein: „Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt" (V. 17). Die Gnade ist weit über die Grenzen Israels hinausgegangen und hat sich in Christo, dem wahren Samen Abrahams, allen Völkern der Erde zugewandt. Wir sehen also immer wieder, daß allein der Glaube Anspruch auf das Erbe gibt, und zwar „vor dem Gott, welchem er (Abraham) glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre; der wider Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf daß er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem was gesagt ist: „Also soll dein Same sein"." (V. 17. 18.)
In diesen Worten tritt eine weitere kostbare Wahrheit vor unsere Blicke: die Kraft der Auferstehung, die Kraft, da Leben zu geben, wo alles im Tode liegt, in schöpferischer Weise da zu wirken, wo für Menschen jede Hoffnung ausgeschlossen ist. Diese Kraft war es, auf welche Abraham rechnete, als sein Leib so gut wie tot und der Mutterleib der Sara schon abgestorben war.
Für den Glauben hängt alles von dieser Kraft ab und von dem Gott, in welchem sie ist. Und dieser Glaube war in bewunderungswürdiger Weise in Abraham wirksam: „Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, und war der vollen Gewißheit, daß er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge" (V. 20. 21). Welch ein ermunterndes und erhebendes Beispiel des Glaubens! Für das natürliche Auge Abrahams war alles hoffnungslos, aber Gott hatte gesprochen, und das war genug für ihn. Abraham glaubte dem Worte Gottes und wurde nicht beschämt. Wie schön ist die Steigerung: Abraham zweifelte nicht, sondern wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab, und er war der vollen Gewißheit, daß Gott Sein Wort erfüllen würde: „Also soll dein Same sein"! „D a r u m ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden" (V. 22), und „er wurde Freund Gottes genannt" (Jak. 2, 23). Gott ehrt den, der Ihm die Ehre gibt.
Beachten wir, daß der Glaube hier nicht in Verbindung gebracht wird mit dem Blute Christi, „welchen Gott zu einem Gnadenstuhl dargestellt hat", wie im 25. Verse des vorigen Kapitels, sondern mit Gott, „der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat" (V. 24). Abraham glaubte Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Durch Glauben urteilte er, daß Gott seinen geliebten, eingeborenen Sohn „aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing" (Hebr. 11, 17—19). Der Glaube ließ ihn so urteilen: „Wenn Gott den Isaak von mir fordert, den Er mir gegeben und in welchem Er mir Seine Verheißung bestätigt hat, so muß Er ihn aus dem Tode wiederbringen und das Nichtseiende wieder ins Dasein rufen. Seine Verheißung ist unverbrüchlich." Wiederum möchten wir ausrufen: Bewunderungswürdiger Glaube! Ja, nicht von ungefähr trägt Abraham den Titel „Vater aller Gläubigen".
Abraham kannte also den Gott der Auferstehung. Auch wir kennen Ihn und glauben an Ihn. Doch mit dem Unterschied, daß Abraham und die alttestamentlichen Gläubigen Gott kannten als den allmächtigen Gott, der Verheißungen gegeben hatte, die zu ihrer Zeit sicher und gewiß in Erfüllung gehen würden; während wir Ihn kennen als den Gott, der in triumphierender Macht in den Bereich des Todes eingetreten ist und Den aus den Toten auferweckt hat, der einst für uns im Gericht stand. Abraham glaubte, daß Gott Tote auferwecken könne und Isaak auferwecken werde; wir aber glauben, daß Gott Christum auferweckt hat. Der Unterschied ist groß und wichtig. Der Glaube ist freilich in beiden Fällen derselbe; aber während er sich in dem einen auf ein gegebenes Wort stützt, ruht er in dem anderen auf einem vollbrachten Werke. Die gläubige Seele findet heute vollkommene Ruhe in der Gewißheit, daß Christus, der einmal für ihre Sünden und Übertretungen geopfert wurde, auferstanden ist und nun als der ewig Lebende zur Rechten Gottes sitzt. „Wir wissen, daß Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn" (Kap. 6, 9).
Noch einmal denn: Dem Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden, wie geschrieben steht. „Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, daß es ihm zugerechnet worden, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auf erweckt worden ist" (V. 23—25). Diese Zurechnung der Gerechtigkeit ist also nicht nur für Abraham, sondern auch für alle Glaubenden da. Indem wir an Den glauben, der unsere ganze Sündenschuld auf Jesum gelegt und Ihn nach vollbrachtem Werke aus den Toten auferweckt hat, ergreifen wir die ganze Tragweite dieses Werkes, auf welches die Auferstehung ihr Siegel gedrückt hat. Dieses Werk wird in seiner ganzen Bedeutung und Ausdehnung unser durch den Glauben. Gott ist im Tode Christi vollkommen verherrlicht worden. Was geschehen mußte, um den Sünder zu erretten und Gott hinsichtlich der Sünde zu verherrlichen, ist ein für allemal geschehen, und Gott hat zum Beweise davon Jesum auferweckt. Unsere Übertretungen brachten dem Heiligen und Gerechten den Tod, Seine Auferstehung ist der ewig vollgültige Beweis, daß alle diese Übertretungen für immer getilgt sind. Nie wieder können sie dem Glaubenden zugerechnet werden.
Wieder wird der Leser bemerken, daß wir hier einen Schritt weiter geführt werden, als im 3. Kapitel. Dort wurde uns gesagt, daß Gott gerecht sei, wenn Er den rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist. Hier ist von unserer Rechtfertigung die Rede. Unsere Sünden hatten das gerechte Gericht des heiligen Gottes verdient, und sie mußten entsprechend dieser göttlichen Heiligkeit gerichtet werden, anders konnte Gott den Sünder nicht frei ausgehen lassen. Aber, wie gesagt, hier im 4. Kapitel handelt es sich nicht um die gerechte Befriedigung Gottes und unsere Sicherstellung vor dem Gericht, sondern um unsere Rechtfertigung vor Ihm. Mit anderen Worten: In dem Tode Christi sind wir einerseits dem Gericht entronnen, wie einst Israel durch das Blut des Passahlammes dem Schwerte des Würgengels entging, und andererseits sind wir, infolge des für uns errungenen Sieges über Sünde und Tod, ein gerechtfertigtes, befreites Volk geworden, das mit Israel am anderen Ufer des Roten Meeres stehen und nun, befreit von der Macht aller seiner Feinde, das Lied der Erlösung anstimmen kann.
Es ist wohl kaum nötig, darauf hinzuweisen, daß die Auferstehung Christi hier als eine Auferstehung aus den Toten dargestellt wird, d. h. als das wunderbare Eintreten Gottes, um Den, der Ihn verherrlicht hatte, aus den letzten Folgen der Sünde, dem Tode, in Gerechtigkeit hervorgehen zu lassen. Daß die Auferstehung der Toten im allgemeinen ebenfalls eine Folge der Auferstehung Christi ist, zeigt uns 1. Korinther 15, 21, aber davon redet der Geist Gottes hier nicht.
Kapitel 5
Kapitel 5, 1—11
In triumphierender Schlußfolgerung aus dem bisher Gesagten beginnt das Kapitel mit den Worten: „D a w i r n u n gerechtfertigt worden sind aus Glauben." Kein Zweifel kann mehr bestehen, keine Frage mehr aufkommen. Die Rechtfertigung des an den gestorbenen und auferstandenen Heiland Glaubenden ist etwas Vollendetes, ist eine gegenwärtige Tatsache. Wer an Jesum glaubt. Ist gerechtfertigt. Seine Schuld ist bezahlt, und er steht in dem Auferstandenen in einem ganz neuen Zustand vor Gott. Die Auferstehung Christi ist der ewig gültige Beweis, daß Gott das Werk auf Golgatha angenommen hat als die vollgenugsame Sühnung für unsere Sünden. Es ist die Felsen-Grundlage, auf welcher der gerechte Gott ruhen und jeden rechtfertigen kann, der des Glaubens an Jesum ist.
Daß wir zu dieser Rechtfertigung nichts beigetragen haben, nichts beitragen konnten, braucht kaum noch einmal betont zu werden. Der einzige Anteil, den wir an der ganzen Sache hatten, waren unsere Sünden, das, was unserem Herrn und Heiland die unsagbaren Leiden und das Verlassensein von Gott eintrug. Selbst unser Glaube kann dem Werke unserer Errettung nichts hinzufügen, ebensowenig wie die tiefste Dankbarkeit oder der hingehendste Dienst unsererseits, nachdem wir geglaubt haben. Nein, Gott sei gepriesen! das Werk ist allein vollendet durch Jesum Christum, unseren Herrn. Und nicht nur ist es vollendet, sondern auch als völlig genügend von dem heiligen Gott anerkannt. Der, der auf dem Wege seiner Vollbringung ins Grab sinken mußte, ist aus den Toten auferstanden und sitzt nun, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, zur Rechten Gottes. Mit einem Opfer hat Er auf immerdar vollkommen gemacht, die geheiligt werden. (Hebr. 10, 14.) Wäre das nicht so, dann könnte uns niemals geholfen werden; denn Christus kann nicht noch einmal sterben, und wir wissen, daß ohne Blutvergießung keine Vergebung ist. Darum; entweder i s t das Werk geschehen, oder hoffnungslose Verzweiflung ist unser Teil.
In den ersten 11 Versen unseres Kapitels zieht der Apostel die Folgerungen aus dieser Rechtfertigung und entwirft damit ein Bild von der Gnade Gottes und Seinen Wegen in Gnade, wie es niemals in eines Menschen Herz hätte aufkommen können. Betrachten wir an der Hand unseres heiligen Führers seine einzelnen Züge.
„Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus" (V. l). Drei kostbare Dinge, die allen Gläubigen ausnahmslos gehören: wir sind gerechtfertigt aus Glauben, deshalb haben wir Frieden mit Gott, und der Schlüssel zu beidem ist unser Herr Jesus Christus. Da der Gläubige weiß, daß er in Christo angenommen ist, steht nichts mehr zwischen ihm und dem heiligen Gott, als nur das große Werk und die kostbare Person des Sohnes Gottes. Alles andere ist für immer hinweggetan. Die Anklagen eines schuldigen Gewissens sind verstummt, das Gewissen selbst ist gereinigt, und aus dem einst feindseligen, hassenswürdigen Sünder ist ein geliebtes Kind Gottes geworden, dem keine Sünde mehr zur Last gelegt werden kann, weil sie alle getragen und hinweggetan sind. Infolgedessen herrscht ein beständiger Friede zwischen Gott und dem Gläubigen. Weder die Erinnerung an vergangene Sünden, noch das Bewußtsein des gegenwärtigen Vorhandenseins der Sünde in dem Gläubigen kann, so schmerzlich beides ist, die Grundlage dieses Friedens antasten. Der Friede ist gemacht, für immer gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus, dessen Blut sich allezeit vor Gottes Augen befindet. Nie wieder kann bezüglich der Vergebung unserer Sünden und unserer Annahme bei Gott eine Frage erhoben werden.
Um jedem Mißverständnis von vornherein vorzubeugen, sei hier kurz auf den Unterschied hingewiesen, der zwischen dem Ausdruck „Friede mit Gott" und „Friede Gottes" besteht. Der erste Friede, der Friede mit Gott, ist die Folge oder das Ergebnis der Rechtfertigung auf Grund des Werkes Christi und darum das gemeinsame, unverlierbare Teil aller wahren Gläubigen; der Besitz und Genuß des zweiten Friedens, des Friedens Gottes, hängt davon ab, inwieweit der einzelne Gläubige sich allezeit in dem Herrn freut, um nichts besorgt ist, sondern in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung seine Anliegen vor Gott kundwerden läßt. (Vergl. Phil. 4,4—9.) Wir dürfen den praktischen zustand der einzelnen Seele nicht mit dem für uns und völlig außer uns vollbrachten Werke Christi verwechseln. So schwankend und unbeständig der erste sein kann und oft ist, so fest und unwandelbar ist das zweite. Göttliche Liebe und Gerechtigkeit haben sich miteinander verbunden, um den Boden zu schaffen, auf welchen wir Frieden haben mit Gott. Christus, „unser Friede" (Eph. 2, 14), ist jetzt allezeit in der Gegenwart Gottes, Er, der uns geworden ist „Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung" (1. Kor. 1. 30).
Die nächste kostbare Frucht der Rechtfertigung ist, daß wir durch unseren Herrn Jesus Christus „mittelst des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade (oder Gunst), in welcher wir stehen" (V. 2). Handelte es sich bisher" um die Frage, wie alles das, was wir in unserem feindseligen Zustand gegen Gott gefehlt hatten, hinweggetan worden ist, so redet der Apostel jetzt von der Gnade, die Frieden gemacht hat und nun allezeit im Herzen Gottes für uns ist. Gottes Auge ruht in Christo mit Wohlgefallen auf allen Seinen Kindern. Sie sind geliebt, wie Christus geliebt ist, und durch Ihn dürfen sie nun mit Freimütigkeit mittelst des Glaubens allezeit herzunahen und von der Gnade, in welcher sie stehen, Gebrauch machen. „Diese Gunst genießen wir", wie ein anderer Schreiber in treffender Weise gesagt hat, „in der Gegenwart Gottes. Nicht allein rechtfertigt uns der himmlische Richter, sondern ein himmlischer Vater nimmt uns auf; ein lichtvolles, gnädiges Antlitz voll väterlicher Liebe erleuchtet und erfreut unsere Seele und erquickt unser Herz, so daß wir mit einem völlig ruhigen Herzen in Seiner Gegenwart sind und auf Seinen Pfaden wandeln. Wir haben das köstliche Bewußtsein, daß wir in der Gunst Gottes stehen. Was unsere Sünden betrifft, sie sind alle hinweggetan; was unsere gegenwärtige Stellung vor Gott betrifft, so ist alles Liebe und Gunst, in der hellen Klarheit Seines Angesichts; was die Zukunft betrifft, so wartet unser die Herrlichkeit."
Kostbare Worte, niedergeschrieben von einem hochbetagten Arbeiter des Herrn, kurz vor dem Abschluß eines langen, reichgesegneten Lebens im Dienste Dessen, den seine Seele liebte!3 Sie beweisen, wie wertvoll ihm selbst der Zugang zu dieser Gnade gewesen ist, und wie er im Glauben von ihm Gebrauch gemacht hat. Unwillkürlich erinnern sie uns an die Mahnung in Hebräer 13, 7: „Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach." Dieselbe Gnade, die sie aufrecht gehalten hat, die gleiche Liebe, die sie genossen haben, sind unser Teil geworden, und es liegt nur an uns, inwieweit auch wir nun im Glauben Gebrauch machen von der Gnade, „in welcher wir stehen". Gott sei Dank! wir sind nicht gekommen zu dem Berge des Gesetzes mit seinem Feuer und seiner Finsternis, mit Worten, welche die Hörer nicht zu ertragen vermochten, sondern zu Zion, dem Berge der Gnade, und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, zu einer Gnade, die allen unseren Bedürfnissen begegnet ist und uns täglich in ihrer ganzen Fülle zu Gebote steht.
Auch das dritte Ergebnis der Rechtfertigung, zu dem wir jetzt kommen: „wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit", ist das sichere, unverlierbare Teil aller wahren Gläubigen. Die Herrlichkeit Gottes liegt vor uns. Freilich, wenn es von unserem Ausharren und unserer Treue abhinge, würde keiner von uns sie erreichen. Aber Jesus ist als unser „Vorläufer" in die Herrlichkeit eingegangen, und E r bringt auch uns dorthin. Auch sie ist uns gesichert durch Ihn, der für uns starb und aus den Toten auferstand. Denn könnte Er die Segnungen je wieder verlieren, die Er auf diesem Wege erworben hat? Unmöglich. Ebenso wenig wir, für die Er sie erworben hat. Er ist unser Bürge auch in dieser Beziehung. Deshalb können wir frohlockend in die Zukunft blicken und, während wir noch in Schwachheit und Unvollkommenheit hienieden wandeln, uns in der gewissen Hoffnung der Herrlichkeit rühmen. Derselbe Gott, der Seine Gerechtigkeit und göttliche Kraft im Evangelium geoffenbart, der Seine Liebe und Gunst uns zugewandt hat, will uns auch bei und mit Christo in Seiner Herrlichkeit haben.
Könnte in wunderbarerer Weise, entsprechend dem Werte des Werkes und der Person unseres Herrn Jesus Christus, für unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesorgt sein? Hinsichtlich der Vergangenheit beunruhigt uns nichts mehr: wir haben Frieden mit Gott; im Blick auf die Gegenwart stehen wir in der Vatergunst Gottes, und was "die Zukunft betrifft, so wirft die himmlische Herrlichkeit schon ihre Strahlen auf unseren Weg. Man sollte meinen, dem Gesagten sei nichts mehr hinzuzufügen. Tatsächlich findet sich die ganze gesegnete Stellung eines Christen, sein Weg von den ersten Anfängen bis zum Zielpunkte darin ausgedrückt. Dennoch fährt der Apostel fort: „Nicht allein aber das" (V. 3), und wiederholt dasselbe Wort im 11. Verse.
„Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale." Das Ziel unserer Reise ist noch nicht erreicht. Zwischen Ägypten und Kanaan liegt die Wüste. Sie gehört nicht eigentlich zu dem Ratschluß Gottes, aber wir müssen hindurch, um das Ziel zu erreichen, und hier ist der Ort, wo wir die erziehenden Wege Gottes mit uns erfahren und zugleich kennen lernen, was in unseren Herzen ist. (Vergl. 5. Mose 8, 2.) In der Dürre der Wüste, wo „nicht Frucht noch Quell den Pilger lohnt", werden wir auf die Probe gestellt, ob wir wirklich imstande sind, allein auf Gott zu vertrauen. Unsere Seelen werden geübt, der Feind macht seine Anläufe, Kleinglaube und Unglaube regen sich, die Natur macht ihre Ansprüche geltend, und das arme Herz möchte oft verzagen. Die Wüsten-Erfahrungen sind zwar nicht notwendig zu unserer Errettung, aber gesegnet für unseren inneren Menschen. Sie machen nicht passend oder „reif" für den Himmel, sonst hätte der sterbende Räuber nicht noch am gleichen Tage mit Christo ins Paradies gehen können; aber sie lösen uns von dem Irdischen, belehren uns über unsere völlige Abhängigkeit von Gott und lassen uns Seine Treue erkennen. In den Trübsalen erfahren wir die Liebe und Fürsorge Gottes, das Mitgefühl Seines Vaterherzens in einer Weise, wie es auf anderem Wege, vor allem in der Herrlichkeit, nicht möglich wäre. Der Himmel bietet keine Gelegenheit dazu.
„Die Trübsal bewirkt Ausharren." Gerade das, was den Ungläubigen ärgerlich und mutlos macht, möglicherweise zur Verzweiflung treibt, bewirkt in dem Gläubigen Mut und Ausharren. Anstatt ihm die Zuversicht zu rauben, läßt die
Trübsal ihn mit Vertrauen nach oben blicken. Sie begegnet gerade dem in ihm, was das Ausharren hindern will, zerbricht den eigenen Willen, schafft im Herzen „gebahnte Wege" für Gott, läutert den Glauben von allem Unechten und macht ihn fähig, still auf Gott zu harren. Die Trübsal hat nichts mit unserer Erlösung zu tun. Sie ist dazu bestimmt, unseren Zustand zu prüfen und ans Licht zu stellen, ob wir der Berufung und Stellung gemäß wandeln, in welche die Erlösung uns eingeführt hat. Sie läßt uns erkennen, inwieweit die alte Natur, die noch in uns wohnt, uns beeinflußt, demütigt uns und führt uns zum Selbstgericht.
Bewirkt aber die Trübsal „Ausharren", so bewirkt das Ausharren wiederum „Erfahrung". Wir lernen in den Leiden und Schwierigkeiten einerseits erkennen, was wir sind, und anderseits, was Gott in Seiner Güte und Treue auf dem Wege für uns ist. Und indem so das Herz von dem Irdischen gelöst, das Auge von dem Zeitlichen abgelenkt und auf die himmlischen Dinge gerichtet wird, kommt die Hoffnung, die bereits im Herzen lebt, lebendiger und stärker zur Wirkung. „Die Erfahrung bewirkt Hoffnung." So folgt ein gesegnetes Ergebnis dem anderen, und anstatt uns durch die Schwierigkeiten des Weges zur Ungeduld oder gar zum Murren verleiten zu lassen, lernen wir uns der Trübsale rühmen. Wir besitzen den Schlüssel zu so manchem, was uns anders als ein seltsames Rätsel erscheinen würde, und stärken unsere Hände in dem Gott, der Seine Kinder mit zärtlicher Liebe liebt und a 11 e s zu ihrem Wohl mitwirken läßt.
„Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist" (V. 5). Damit erreichen wir den Höhepunkt der Belehrung unseres Apostels an dieser Stelle. Die Hoffnung, die durch die Erfahrung der nie fehlenden Treue Gottes in uns belebt wird, kann nicht beschämen, kann sich nicht als trügerisch erweisen, denn zwischen Gott und uns ist ein Band geknüpft, das nie und nimmer zerrissen werden kann: Er hat uns Seinen Geist gegeben! Nicht nur sind wir durch die Wirksamkeit dieses Geistes erneuert, „geboren aus Wasser und Geist" (Joh. 3, 5), sondern der Heilige Geist selbst, der beiläufig bemerkt, hier zum erstenmal in unserem Briefe erwähnt wird, ist uns gegeben als Siegel unseres Glaubens und als Unterpfand des durch Christum für uns erworbenen Besitzes. (2. Kor. 1. 11; Eph. 1. 13. 14). Unsere Leiber sind Wohnstätten des Heiligen Geistes geworden. Auf diesem Wege ist, wie der Apostel es hier ausdrückt, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden. An anderen Stellen wird uns gesagt, daß wir durch den Geist "Abba, Vater!" rufen, daß wir durch Ihn wissen, daß wir in Christo und Christus in uns ist usw. (Gal. 4, 6; Job. 14, 16—20.)
Welch eine wunderbare Tatsache: die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, indem der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, in uns Wohnung gemacht hat! Das konnte uns nicht eher mitgeteilt werden, als bis das Werk der Erlösung uns in seiner ganzen Fülle vor Augen gestellt war. Diese Tatsache bildet, wie gesagt, den Höhepunkt der Ausführungen des Apostels. Inwieweit der einzelne Gläubige sie im Glauben erfaßt und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes die Liebe Gottes genießt, inwieweit er persönlich in ihr wandelt, ist ja eine zweite Sache; aber für alle Gläubigen besteht die Tatsache als solche. Infolge dessen kann die Hoffnung niemals beschämen. Gott zieht Seine Augen nicht ab von dem Gerechten. (Vergl. Hiob 36, 7.)
Aber die Liebe Gottes ist nicht nur in unsere Herzen ausgegossen, um i n uns genossen zu werden, sie ist auch außer uns geoffenbart und durch ein Werk erwiesen worden, das, völlig unabhängig von uns, vollbracht wurde, als wir uns noch in einem Zustand der Kraftlosigkeit und tiefsten Erniedrigung befanden. „Denn", so fährt der Apostel fort, „Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben" (V. 6). Ja, nur auf dieser Grundlage war es möglich, daß die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen werden konnte. Und „zur bestimmten Zeit" ist das Werk geschehen, d. h. als „die Fülle der Zeit gekommen war" (Gal. 4, 4) und der Zustand des Menschen sich in seiner ganzen Hoffnungslosigkeit erwiesen hatte. Gerade das zeigt uns aber auch die ganze Reinheit und Vollkommenheit dieser Liebe. Nur sie vermochte sich solcher anzunehmen, in denen es, außer ihrer Schuld und ihrem verderbten Zustande, gar keine Beweggründe dazu gab. Nur Gottes Liebe, das was Er Selbst ist, konnte Quelle und wirkende Ursache sein, wenn Er Seinen Sohn für Kraftlose und Gottlose sterben ließ.
Ein Geschöpf ist außerstande, so zu handeln. So kann ein Mensch nicht lieben, wenn auch sein Herz tiefer und starker Zuneigung fähig ist. Er ist imstande, für einen anderen Menschen, der ihm Güte und Wohlwollen erwiesen hat, sein Leben zu wagen; für einen bloß „Gerechten" wird sich wohl niemand einer Todesgefahr aussetzen. Gerechtigkeit als solche mag sich Wertschätzung und Achtung erringen, niemals aber wird sie todesmutige Liebe wecken. „Kaum wird jemand für einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen" (V. 7). — Doch was hat Gott getan?
„Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist" (V. 8). So kann nur Gott lieben. Der Mensch bedarf eines Beweggrundes, der von außen her auf ihn wirkt, Gott nicht. Er i s t Liebe und bedarf keines Antriebs von außen. Er hat die Welt, die böse, gottlose Welt, also geliebt, daß Er Seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Gegenstände Seiner Liebe waren solch hassenswürdige Sünder, so unrein und alles Guten bar, daß nur die Opferung Seines Geliebten ihnen helfen konnte; aber auch nichts Geringeres als das konnte Seiner Liebe genügen.
Wunderbarer Gott! Diese Liebe überwältigt den Stolzen und Hochmütigen, gewinnt den Armen und Hilflosen und erwärmt kalte, gleichgültige Herzen. Sie schenkt Frieden und Freude dem Herzen des Kindes und erfüllt mit anbetender Bewunderung das Innere des Mannes. Von ihr zu zeugen, zu singen und zu sagen, ist die dankenswerteste Aufgabe des erretteten Geschöpfes. Was sind die höchsten und edelsten Ergebnisse menschlicher Weisheit im Vergleich mit dieser Liebe? Erkältende, finstere Nebel neben den Wärme und Leben gebenden Strahlen der Sonne! Ja, als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns!
Wenn das aber so ist, wenn die Liebe so handelte, als wir noch Sünder waren, wieviel mehr werden wir jetzt, „da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch ihn gerettet werden vom Zorn"! (V. 9). Die Folgerung ist so einfach und überzeugend wie möglich, aber der Apostel vertieft und erweitert sie noch, indem er hinzufügt: „Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden" (V. 10). Wenn der Tod des Sohnes Gottes Feinden Versöhnung mit Gott gebracht und sie von dem Zorn, der über diese Erde und ihre Bewohner kommen wird, gerettet hat, wird dann nicht vielmehr Sein Leben die also Versöhnten, von Christo F r e u n d e und Brüder Genannten, retten? Wenn ein sterbender Christus gottlosen Sündern Heil und Leben gebracht hat, sollte dann ein zur Rechten der Majestät Gottes lebender Christus solche auf dem Wege umkommen lassen, die um den kostbarsten Preis in solch neue, heilige Beziehungen zu Gott gebracht worden sind?
Klarere und entscheidendere Schlüsse, als wie der Heilige Geist sie hier zieht, könnten wir uns gar nicht denken. Nachdem der Fall aufs gründlichste behandelt ist, beseitigen die Worte des Apostels jeden Zweifel und geben dem ängstlichsten Gemüt und dem zartesten Gewissen selige Ruhe. Zuerst wird unser Zustand von Natur rückhaltlos aufgedeckt: wir waren kraftlos, gottlos, Sünder und Feinde, und dann wird uns gezeigt, wie die Liebe Gottes auf dem Boden der Gerechtigkeit dem ganzen Jammer begegnet ist: „Gerechtigkeit hat mein Gericht beendet." Liebe an und für sich hätte uns nicht von dem gerechten Zorn Gottes retten können, sie mußte in der Hingabe des einzigen, geliebten Sohnes erst die gerechte Grundlage schaffen, auf welcher sie in Gnade mit uns zu handeln vermochte. Und das hat sie getan, das Werk ist vollbracht, Gott sei gepriesen in Ewigkeit!
So sind wir denn zu Gott gebracht, haben verstanden, was Erlösung und Rechtfertigung bedeutet, besitzen als solche, die der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, das kostbare Bewußtsein, daß wir in Gott sind, und daß Er in uns wohnt, und erfahren auf dem Wege zu der vor uns liegenden Herrlichkeit täglich Gottes Güte und Treue. Mit anderen Worten: wir kennen Ihn und rühmen uns deshalb nicht nur dessen, was Er für uns getan hat oder tut, was Er uns gegeben hat oder gibt, sondern rühmen uns Seiner selbst.
„Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben" (V. 11). Nicht die Herrlichkeit, nicht die Trübsale und ihre gesegneten Folgen stehen jetzt vor dem Geiste des Apostels, es ist Gott selbst. Ein verständiges, dankbares Kind redet und freut sich nicht nur über das, was es von seinem Vater empfangen hat oder noch zu empfangen hofft, sondern ist vor allem darüber glücklich, daß es einen solch liebevollen, treuen Vater hat, daß es mit ihm verkehren, ihn täglich besser kennen lernen und immer mehr in seine Gedanken eindringen darf. Der Umgang mit dem Vater ist eine tägliche und wachsende Freude. Es rühmt sich seiner.
So dürfen auch wir uns Gottes als unseres Gottes und Vaters rühmen. Welch ein unschätzbares Vorrecht! Je mehr wir es verstehen und verwirklichen, desto tiefer wird unsere Freude, desto inniger der Genuß der Gnade werden. Wir genießen dann schon hienieden etwas von dem, was einst droben den höchsten Charakter unserer Freude ausmachen wird. Wir genießen Gott selbst durch unseren Herrn Jesus Christus als den unendlichen, aber gegenwärtigen Gegenstand der neuen Natur, die zu einem solchen Genuß fähig ist, weil der Heilige Geist in uns wohnt und der Seele Gott offenbart.
Wir genießen dankbar Gottes Gaben, aber höher und herrlicher als sie alle ist der Geber. In Ihm ist unsere höchste und herrlichste Freude. Wohl ist Er der heilige Gott, aber Seine Heiligkeit erschreckt uns nicht; im Gegenteil, wir fühlen uns nur wohl in dem Lichte dieser Heiligkeit. Sie ist unsere Freude.
Und fragen wir nun: Wie ist das Große geschehen, das Unmögliche möglich geworden? so ist die Antwort: „Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben." Das was der erste Adam in seiner Unschuld nie hätte genießen können, ist jetzt in dem letzten Adam das Teil solcher geworden, die einst „Kinder des Zorns waren wie auch die übrigen". Der Herr selbst sagte zu Seinen Jüngern in der Nacht vor Seinem Leiden und Sterben; „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm." So ist es geschehen, das Werk ist vollbracht, und auf ewig sind seine Ergebnisse unser.
Kapitel 5, 12 — 21
Mit dem 12. Verse unseres Kapitels beginnt, wie wir schon in der Einleitung hervorgehoben, der zweite Hauptteil des ganzen Briefes. Der Apostel behandelt fortan nicht mehr die Frage der Schuld des Menschen und deren Vergebung, sondern redet von der Sünde als solcher und von der Befreiung des Gläubigen von ihrer Macht und Herrschaft. So groß und herrlich die Vergebung auch sein mag, sie ist nicht alles. Das Licht Gottes zeigt dem erwachten Gewissen des Menschen nicht nur die vielen Sünden, die auf seinem Wege liegen, sondern auch die Quelle, aus welcher das schmutzige Wasser geflossen ist, den Baum, der die bösen Früchte getragen hat. Die Erkenntnis darüber, mit anderen Worten, die Entdeckung des unheilbaren, inneren Verderbens, unseres hoffnungslosen Zustandes von Natur, ist fast noch erschreckender als das Erwachen des Gewissens betreffs der Schuld; aber umso süßer ist dann auch die Botschaft von dem, was Gott in Christo getan hat, um uns aus diesen Tiefen des Verderbens herauszuführen. Je mehr man auf dem Wege schmerzlicher Erfahrung lernt, was das Fleisch ist, umso größer ist die Freude über die vollen Ergebnisse des Werkes Christi.
Jahrhunderte lang haben die Gläubigen kaum noch etwas verstanden von dem Gericht, das am Kreuz über den „alten Menschen" ergangen ist, und noch weniger von der neuen Stellung des Gläubigen in dem auferstandenen Christus. Man meinte, sich mit dem Vorhandensein der Sünde, so gut oder schlecht es ging, abfinden zu müssen, ohne mehr Hoffnung und Kraft ihr gegenüber zu haben, als irgend ein Mensch, der zur Erkenntnis der Heiligkeit Gottes gekommen ist und sich nun aufrichtig, aber natürlich vergeblich, abmüht, ein besserer Mensch zu werden. Gott sei gepriesen, daß Er in Seiner großen Gnade Licht in das Dunkel hat fallen lassen!
Hören wir jetzt, wie der Apostel seine weitere Belehrung einleitet: „Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben" (V. 12). Beachten wir zunächst, daß der hier ausgesprochene Gedanke erst im 18. Verse wieder aufgenommen wird mit den Worten: „Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch . . . ." Die Verse 13—17 bilden einen Zwischensatz. Die Nichtbeachtung dieses Umstandes hat zu manchen verkehrten Auslegungen der Stelle Anlaß gegeben. Wenn man ihm Rechnung trägt, ist die Gedankenverbindung klar und einfach.
„Darum." Weshalb „d a r u m"? Man ist unwillkürlich versucht zu fragen: Wo ist die Verbindung mit dem Vorhergehenden? Gehen wir fehl, wenn wir den Gedanken des Apostels also deuten: Da die Liebe Gottes als die Quelle, und der Tod und die Auferstehung Christi als das Mittel der Versöhnung mit ihren herrlichen Ergebnissen erwiesen sind, „darum" können wir jetzt zu einer anderen Seite dieses wunderbaren Gegenstandes übergehen? Zu der ErÖrter ung nämlich, wie durch den Ungehorsam eines Menschen (Adam), des gefallenen Hauptes der menschlichen Familie, diese selbst in Sünde und Tod gestürzt wurde, während wiederum e i n Mensch, der zweite Mensch (Christus), durch Seinen Gehorsam zum Haupt einer neuen Familie geworden ist, deren Glieder nun zwei Naturen besitzen, die eine entlehnt von Adam, die andere von Christo.
„Darum, gleichwie durch einen Menschen ..." In den weiteren Belehrungen unseres Briefes ist nicht länger die Rede von Juden und Heiden; der Schaden ist geschehen, die Sünde in die Welt gekommen, lang bevor es ein Volk Israel und ein Gesetz gab. Mag die Sünde auch durch das Gesetz „überströmend" geworden sein, indem der Mensch nunmehr als „Übertreter" der guten und heiligen Gebote Gottes dastand, die Sünde als solche war vor dem Gesetz in der Welt. Sie ist durch den ersten Menschen in die Welt gekommen. Die Folgen treffen deshalb mit ihm seine ganze Nachkommenschaft. „Durch die Sünde kam der Tod, und der Tod ist zu a 11 e n Menschen (ob Juden oder Heiden) durchgedrungen", er herrscht als König der Schrecken über die ganze Menschheit, „weil sie alle gesündigt haben". Es ist nicht bei der einen Sünde im Garten Eden geblieben — alle haben gesündigt. Und darum stirbt der Mensch nicht nur, weil er von einem gefallenen Menschenpaare abstammt und die sogenannte „Erbsünde" in ihm wohnt, sondern weil er sich selbst verschuldet hat. Als unter der Sünde geboren, ist er wohl fähig und g e n e i g t zu sündigen, aber er wird erst schuldig dadurch, daß er mit Bewußtsein die Sünde tut. Wenn Gott daher unmündigen Kindern oder Menschen, die nie ihren Verstand besaßen, also mit Unmündigen auf gleicher Linie stehen, in Gnaden das Werk Christi zurechnet — denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten, und es ist n i c h t der Wille unseres Vaters im Himmel, daß eines dieser Kleinen verloren gehe (Matth. 18, 11. 14) — so ist das ein überaus tröstlicher Gedanke und zeigt uns die Größe der errettenden Gnade Gottes, aber es ändert nichts an der ernsten Tatsache, daß der Mensch dem Tode verfallen ist, weil e r gesündigt hat. Mag auch Adams Fall die erste Veranlassung zu dem furchtbaren Lose des ohne Gott sterbenden Menschen gewesen sein, so ist damit die Bedeutung und Tragweite der Sache doch keineswegs erschöpft. Neben Adams Sünde treten die gerechten Folgen persönlicher Schuld.
Wenn nun aber, wie Gottes Wort es uns immer wieder zeigt, eines Menschen Tun alle seine Nachkommen, ja, die ganze Schöpfung unter das Urteil des Todes gebracht hat, ist es dann ungereimt, oder steht es im Widerspruch mit dem Charakter Gottes, wenn Er durch einen Menschen eine Rechtfertigung des Lebens einführte, die gegen alle Menschen gerichtet ist? (V. 18.) Im Gegenteil! Doch ehe wir auf die ausführliche und interessante Behandlung dieser Frage durch den Apostel näher eingehen, müssen wir uns mit dem Inhalt des Zwischensatzes (V. 13—17) beschäftigen.
„Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist" (V. 13). Das Vorhandensein des Todes war der unwiderlegliche Beweis, daß Sünde da war, denn der Tod ist der Sünde Sold. Eine Tat wird nicht erst dadurch zur Sünde, daß das Gesetz sie verbietet. Das Gesetz verändert allerdings den Charakter der Sünde, indem es sie zur Übertretung eines bestimmten Gebotes macht. Darum: „Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung" (Kap. 4, 15). Oder: „Die Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist." Aber wenn auch das Gesetz im Anfang nicht da war, hatten die Menschen doch ein Gewissen und, wenn auch unklar, ein Pflichtgefühl dem unbekannten Gott gegenüber. „Bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt", und das Gewissen erhob seine anklagende Stimme, wenngleich man nicht sagen kann, daß die Menschen einen gekannten Befehl Gottes übertreten hätten. Sobald ein Gesetz kommt, wird es anders. Gesetz rechnet die Sünde zu, trägt sie gleichsam in seine Schuldbücher ein und „macht die Übertretung überströmend".
„Sünde" ist ein viel allgemeinerer, weitergehender Begriff als „Übertretung". Nicht jede Sünde ist, wie wir gesehen haben, Übertretung. Eine Zurechnung der Sünde als Übertretung kann erst erfolgen, wenn man durch ein Gesetz weiß, daß das, was man tut, böse ist.
„Aber", fährt der Apostel fort, „der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist" (V. 14). Trotzdem also die Sünde bis auf Moses, den Gesetzgeber, nicht zugerechnet wurde, hat der Tod doch immer geherrscht, selbst über die, welche nicht in der gleichen Weise wie Adam gesündigt, d. h. kein bestimmtes Gebot übertreten hatten. Beachten wir den Unterschied: Adam hatte e i n Gebot, nämlich, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, durch Moses wurde das Gesetz, die Gesamtheit der Gebote Gottes, gegeben. Adam übertrat das eine Gebot, Israel brach das ganze Gesetz; beide machten sich also in ähnlicher Weise schuldig. Nicht so die in der Zwischenzeit, vor und nach der großen Flut, lebenden Menschen. Sie besaßen weder ein einzelnes Gebot, noch das ganze Gesetz, aber sie sündigten, und deshalb herrschte der Tod vom Sündenfall an, bis das Gesetz kam.
Der Apostel denkt offenbar an eine Stelle in dem Propheten Hosea, wenn er von der Art der Sünde Adams spricht. Gott läßt dort Seinem irdischen Volke sagen, daß es treulos gehandelt und „den Bund übertreten habe wie Adam" (Kap. 6, 7). Der Bund und die gegebenen Gebote waren in den beiden Fällen verschieden, aber grundsätzlich sündigten Adam und Israel in gleicher Weise. Anders war es, wie gesagt, in der Zeit von Adam bis auf Moses; es gab damals nicht Heiden oder Nationen und ein durch gesetzliche Verordnungen von ihnen getrenntes Volk, sondern nur eine große menschliche Familie, und diese lag unterschiedslos unter Sünde und Tod.
Doch was will der Apostel sagen, wenn er Adam .ein Vorbild des Zukünftigen" nennt? Adam, das Haupt der ersten Schöpfung, wurde erst nach seinem Falle Vater von Söhnen und übertrug somit auf alle seine Nachkommen die Folgen seines Falles. Der Anfang des 1. Buches Mose gibt uns den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Geschichte des Menschengeschlechts bis auf den heutigen Tag. Die Übertretung des Einen (Adam) hat über die Vielen, d. h. über alle, die zu ihm gehören, den Tod gebracht, gleichviel ob sie in Übertretung bestimmter Gebote oder ohne Gebote gesündigt haben. Geradeso hat sich Gottes wunderbare Gnadengabe durch einen Menschen (Christus) wiederum den Vielen, d. h. allen, die Gott Ihm gegeben und unter Ihm als Haupt zu einer Familie zusammengefügt hat, zugewandt. Das macht es uns verständlich, in welchem Sinne Adam ein Vorbild von Christo war. Der erste wie der zweite Mensch sind Häupter einer Familie, eines Geschlechts geworden, der eine als ein gefallenes Geschöpf in Sünde und Tod, der andere als der siegreich auferstandene Mensch in Gerechtigkeit und Leben.
„Ist nicht aber wie die Übertretung also auch die Gnadengabe? Denn wenn durch des Einen Übertretung die Vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, Jesum Christum, ist, gegen die Vielen überströmend geworden" (V. 15). Die Beweisführung ist so einfach wie schlagend. Wenn es gerecht ist, und das konnte kein Jude, ja, kann kein Mensch bestreiten, daß die ganze Nachkommenschaft Adams die Folgen der Übertretung ihres Vaters tragen muß, dann ist es noch vielmehr gerecht, daß die Ergebnisse der in Christo geoffenbarten Gnade Gottes allen zuteil werden, die sich im Glauben Ihm anschließen. Was Adam (als Vorbild des Zukünftigen) im Bösen für alle seine Nachkommen wurde, das ist Christus in überströmender Fülle im G u t e n für alle geworden, die Ihm angehören. Könnte es anders sein angesichts der Quelle, aus welcher diese Gnade kam, und des Kanals, durch welchen sie uns zugeflossen ist? Nein, wenn durch die Übertretung des Einen „die Vielen gestorben sind", so ist durch den Einen, Jesum Christum, „die Gnade Gottes gegen die Vielen überströmend geworden".
Beachten wir hier und in den nächsten Versen den Gebrauch des Wortes „die Vielen". Wir möchten vielleicht meinen, „alle" wäre einfacher und näherliegend gewesen. Aber abgesehen von der beabsichtigten Gegenüberstellung des Einen und der Vielen, ist der Ausdruck offenbar gewählt, um jeder Mißdeutung von vornherein zu begegnen. In Verbindung mit Adam schließt er ganz von selbst alle Menschen ein, weil Adam aller Vater ist und seine Natur ihnen allen mitgeteilt hat; in Verbindung mit Christo aber kann er sich nur auf alle die beziehen, welche zu Christo gekommen und so in Ihm, dem Auferstandenen, der neuen Natur teilhaftig geworden sind. Das Wort „alle" hätte in diesem Falle also zu einer ganz falschen Auslegung Anlaß geben können.
Indes gibt es nicht nur einen Unterschied in dem Maß des Geschehenen, sondern auch in der Art. Standen bisher zwei Parteien, also Personen, vor unseren Blicken, so werden wir jetzt zu den Dingen oder Handlungen geführt, auf welche der Unterschied gegründet ist. „Und ist nicht wie durch Einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe? Denn das Urteil war von einem (d. h. von einer Sache oder Handlung) zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit" (V. 16). Eine Übertretung des Hauptes des Menschengeschlechts hat zur Verdammnis gereicht, während die Gnadengabe Gottes die Glaubenden aus vielen Übertretungen heraus in eine Stellung der Gerechtigkeit führt.
Diesen Gedanken weiter begründend, fährt der Apostel dann fort: „Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesum Christum" (V. 17). Man sollte meinen, dem Vordersatz entsprechend müsse der Nachsatz lauten: „so wird vielmehr das Leben herrschen". Aber nein, wir lesen: „so werden vielmehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade empfangen . . . im L e b e n herrschen". Wie triumphierend, alle Hindernisse überwindend hat sich die Macht der Gnade erwiesen! In der Tat, sie hat die Sünde und ihre Folgen weit „überströmt". Alle, die an Jesum glauben, ob Sünder aus den Heiden oder Gesetzesübertreter, empfangen die freie, überschwengliche Gabe der Gnade, die nicht nur ihre Schuld und Sünde entfernt, sondern ihnen Leben gibt, ewiges Leben durch den Einen, Jesum Christum. Die Sünde des ersten Menschen hat das Kleid der Unschuld zerrissen und den Tod eingeführt; das Blut Jesu Christi schenkt den Glaubenden das Kleid göttlicher Gerechtigkeit, führt sie in eine ganz neue, unendlich herrlichere Stellung ein, als Adam sie vor dem Falle besaß, gibt ihnen ewiges Leben, ja, in diesem Leben einen gebietenden Platz. Sie können das Empfangene nicht nur nicht wieder verlieren, sondern werden im Leben herrschen durch Jesum Christum.
Immer wieder sehen wir, wie unendlich weit die Wirkungen der göttlichen Gnade, der Natur und Herrlichkeit Christi entsprechend, die Folgen der Sünde übersteigen, und wir können verstehen, daß der Apostel, weiter und weiter fortschreitend, schließlich in tiefem, heiligem Staunen in die Worte ausbricht: „Was sollen wir hierzu sagen?"
Wie bereits bemerkt, schließt mit dem 17. Verse der lange Zwischensatz, und der im 12. Verse unterbrochene Gedankengang wird, im Anschluß an die Belehrung der Verse 13—17, jetzt wieder aufgenommen. „Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit (oder Gerechtigkeitstat) gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens." Beachten wir hier zunächst wiederum das Wort „alle Menschen". In beiden Fällen richten sich die Wirkungen des Geschehenen gegen alle Menschen; nicht einer ist ausgeschlossen. Es handelt sich in diesem Verse ausschließlich um die ursprüngliche Richtung oder das Ziel der einen wie der anderen Tat. Die eine gereicht zur Verdammnis, die andere zur Rechtfertigung des Lebens, ganz abgesehen davon, ob Richtung und Ziel durch Gottes Gnade oder durch den Unglauben des Menschen verändert werden, oder mit anderen Worten, ob es solche gibt, die durch Glauben der Verdammnis entrinnen, und anderseits solche, die den Gnadenratschluß Gottes in bezug auf sich selbst wirkungslos machen.
Nachdem uns so die Reichweite der beiden Taten vorgestellt worden ist, kommen wir im 19. Verse zu den tatsächlichen Ergebnissen der Stellung der Häupter der beiden Familien: „Denn gleichwie durch des einen Menschen (Adam) Ungehorsam die Vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen (Christus) die Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden." Da nach den bestimmten, unzweideutigen Belehrungen der Schrift nicht „alle Menschen" durch Glauben gerechtfertigt werden, mußte der Heilige Geist hier wieder den Ausdruck „die Vielen" wählen, d. h. die in beiden Fällen mit ihrem jeweiligen Haupte verbundene Menge von Menschen. Daß dies im ersten Falle (Adam) das ganze Menschengeschlecht (also alle Menschen, wie in Vers 18) umfaßt, ist selbstverständlich, denn alle befinden sich von Natur auf dem Boden ihres Vaters, „in der Stellung von Sündern". Da ist kein Unterschied. Immer wieder wird die ernste Tatsache betont, daß die ganze menschliche Familie — alle, die des Adam sind — durch ihren Stammvater mit ihm in derselben Stellung ist: sündig, von Gott getrennt, ja, feindselig gegen Gott und ohne jedes Verlangen, zu Ihm umzukehren. In dem zweiten Falle handelt es sich ebenso um die Vielen, die mit dem „Einen" verbunden sind, d. h. um alle, „die des Christus sind", die durch den Glauben an Ihn in die Stellung von „Gerechten" gesetzt werden — „die Kinder, die Gott Ihm gegeben hat"; aber obwohl es durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens gereichte (V. 18), so daß der Evangelist in die ganze Welt gehen und die frohe Botschaft über Gottes Sohn aller Schöpfung verkündigen kann, ist die tatsächliche und endgültige Wirkung des errettenden Werkes doch nur auf die Menschen beschränkt, welche die Botschaft annehmen. Es sind gleichsam die bekannten „Vielen", die in jedem Fall unter den Folgen des Tuns der einen bestimmten Person stehen: die eine Klasse „Sünder" durch den Ungehorsam Adams, die andere „Gerechte" durch den Gehorsam Christi.
Nach dieser eingehenden Behandlung der Lehre von den beiden Familien und ihren Häuptern bleibt dem Apostel noch übrig, ein Wort über einen Gegenstand zu sagen, den er schon wiederholt berührt hat, das Gesetz. Zu welchem Zweck ist das Gesetz überhaupt gegeben worden? Der religiöse Mensch möchte denken, um eine, wenn auch nur menschliche Gerechtigkeit vor Gott hervorzubringen. Verhieß es nicht dem, der es halten würde, Leben? Ach, wie ganz anders lautet die Antwort, die der Apostel hier gibt! Er sagt: „Das Gesetz aber kam daneben ein" — trat gleichsam wie eine nebenherlaufende Sache zwischen den ersten und den zweiten Menschen — „auf daß die Übertretung überströmend würde" (V. 20). Fürwahr, für den Stolz des Menschen könnte es kein demütigenderes und niederschmetternderes Ergebnis geben. Die Sünde als solche war da, ehe das Gesetz gegeben wurde, aber sie sollte sich durch das Gesetz in ihrer ganzen Furchtbarkeit offenbaren, d. h. als unmittelbare Empörung gegen Gottes heilige Gebote und als Verachtung Seiner göttlichen Autorität. Gott hätte unmöglich ein Gesetz geben können, damit dadurch die Sünde überströmend würde. Wie könnte Er in irgend einer Weise der Urheber der Sünde sein? Wohl aber konnte Er eine vollkommene Richtschnur für den Wandel des Menschen geben, um ihm dadurch zu zeigen, wie es wirklich um ihn stand. Das Gesetz kam daneben ein, auf daß die Übertretung überströmend würde, oder, wie wir an anderer Stelle lesen, daß „die Sünde als Sünde erschiene", ja, daß sie „überaus sündig würde durch das Gebot" (Kap. 7, 13). Das Gesetz hat erst den Zustand des gefallenen Menschen völlig ans Licht gebracht, indem es seinen Eigenwillen und Hochmut samt den Leidenschaften der in ihm wohnenden Sünde zum Aufleben und zur schrankenlosesten Entfaltung brachte.
„Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwenglicher geworden, auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn" (V. 20. 21). Anbetungswürdige Antwort der Gnade Gottes auf die Schuld und Verderbtheit des Menschen! Sie handelt unumschränkt und feiert ihre herrlichsten Triumphe da, wo für den Menschen jede Hoffnung verloren ist und nur ein schonungsloses Gericht seiner wartet. Und sie feiert sie nicht etwa auf Kosten der Gerechtigkeit Gottes, nein, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit, kraft des vollbrachten Werkes Jesu Christi, zu ewigem Leben. Ein gesetzestreuer Jude hätte im besten Falle — der aber niemals eintrat — Leben auf dieser Erde als Lohn seines Tuns erwarten können, aber der Gläubige empfängt heute ewiges Leben, weil Gott ihn auf Grund des Werkes Seines geliebten Sohnes in einer ganz neuen, Seinen ewigen Ratschlüssen entsprechenden Stellung vor sich sieht. Gerade darin hat sich ja Gottes Gerechtigkeit erwiesen, daß sie Seinem Sohne, der als Mensch Ihn vollkommen verherrlicht hat, einen" Platz zu Seiner Rechten gab, und sie offenbart sich heute darin, daß sie die, welche an Jesum glauben, nicht nur von allen ihren Sünden rechtfertigt, sondern ihnen auch ein Leben schenkt, dessen Ziel die Herrlichkeit droben ist.
Gleichwie denn die Sünde geherrscht hat im Tode, so herrscht heute die Gnade in triumphierendem Leben. Es kommt einmal die Stunde, da die Gerechtigkeit herrschen wird, aber wehe dann allen, welche die Zeit der Gnade versäumt haben l Gott ist gerecht und muß Seine Gerechtigkeit aufrecht halten. Unmöglich kann Er die Sünde für immer vor Seinem Auge dulden. Aber wie furchtbar muß die Vergeltung sein, wenn die Zeit der errettenden und rechtfertigenden Gnade Gottes vorüber ist und Sein Gericht alle erreicht, die Sein Heil vernachlässigt oder gar verachtet haben! Glückselig darum alle, die unter der Herrschaft der Gnade dem kommenden Zorn entrinnen!
Kapitel 6
In diesem Kapitel leitet der Heilige Geist den Apostel zu der Beantwortung einiger Einwürfe, die seitens des Fleisches oder des Unglaubens angesichts der soeben geschilderten Gnade Gottes erhoben werden konnten, und die uns wiederum die Abgründe des menschlichen Herzens zeigen, zugleich aber auch den Schreiber zur Entwicklung neuer wunderbarer Gedanken führen.
Der erste Einwurf lautet: „Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, auf daß die Gnade überströme?" (V. l). Was? Ist das die Folgerung, die wir aus dem Evangelium Gottes ziehen sollen? Sollten wir Sünde auf Sünde häufen, damit die Gnade in deren Vergebung sich nur umso reicher entfalten könne? Wir antworten entrüstet mit dem Apostel: „Das sei ferne!" Was würden wir von einem Sohne sagen, der immer rücksichtsloser die Gebote seiner Eltern übertreten und ihre Herzen verwunden wollte, um ihnen dadurch Gelegenheit zu geben, ihm immer mehr zu vergeben! Welch eine Bosheit und Verhärtung würde das offenbaren! Doch die Frage des Apostels beweist, daß eine solche Entartung dem Menschenherzen nicht fremd ist. 0 wer könnte die Tiefen dieses Herzens kennen, wer seine Arglist verstehen!?
Indes gründet der Apostel die Beantwortung der Frage nicht auf die offenbare Gottlosigkeit eines solchen Grundsatzes; er führt uns vielmehr zu dem Ausgangspunkt des Weges eines jeden Menschen, der sich zu Christo bekennt, indem er die Gegenfrage stellt: „Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben?" (V. 2). Der Christ, der einst in der Sünde lebte, hat in dem Tode Christi weit mehr gefunden, als nur die Vergebung seiner Sünden und Übertretungen. Er ist mit Christo gestorben und damit aus der alten Stellung, in welcher er sich befand, ein für allemal herausgenommen worden. Er ist „d e r Sünde gestorben" und steht fortan nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Indem Christus am Kreuze für ihn zur Sünde gemacht wurde, ist mit dem alten Menschen, der sich als unveränderlich schlecht erwiesen hat, für immer ein Ende gemacht worden, und ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, ist ans Licht getreten, ein völlig neues Leben ist geoffenbart und dem Glaubenden geschenkt worden. Wie sollte, wie könnte er nun noch in der Sünde verharren, die ihn für ewig von Gott getrennt hätte, und die seinem Herrn und Heiland den Tod gebracht hat? Wie unfaßlich und jedem sittlichen Gefühl hohnsprechend wäre ein solches Tun!
Zudem hatten die Gläubigen zu Rom ja schon durch ihre Taufe bekannt, daß sie mit dem Tode Christi einsgemacht worden waren. „Oder wisset ihr nicht, — mit anderen Worten: seid ihr so unbekannt mit der sinnbildlichen Bedeutung der Taufe? — daß wir, so viele auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind?" (V. 3). Die Taufe, die am Anfang des Weges eines jeden Gläubigen liegt, ist nicht nur das Zeugnis von dem für uns erfolgten Tode Christi, sondern auch von unserem Gestorbensein mit Ihm. Indem der Täufling in das Wasser hinabgesenkt wird, verschwindet er (im Bilde) nach seiner alten Natur; er wird gleichsam begraben, um als ein neuer Mensch aus dem Wasser wieder heraufzusteigen. „So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln" (V. 4). Der Christ ist nicht mit einem auf Erden lebenden Christus in Verbindung gebracht worden — eine solche Verbindung war infolge seines hoffnungslosen Zustandes unmöglich (vergl. Joh. 12, 24) — auch setzt er seine Hoffnung nicht, wie der Jude, auf einen kommenden, auf Erden regierenden Messias; er bekennt im Gegenteil in der Taufe zugleich mit dem Tode Christi seinen eigenen Tod, das Ende seines hoffnungslosen Zustandes im Fleische, um fortan, gleichwie Christus nicht im Grabe geblieben, sondern aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, als ein mit Ihm auferstandener Mensch in Neuheit des Lebens zu wandeln.
Wiederum müssen wir sagen: Die Belehrung des Apostels ist einfach und von unwiderstehlicher Beweiskraft, und doch, welch törichte Dinge sind im Laufe der Jahrhunderte in Verbindung mit der Taufe gelehrt worden l Wie bedeutungsvoll ist diese Handlung, und wie ernst die aus ihr hervorgehende Folgerung für alle, die sich einfältig durch den Geist Gottes belehren lassen! Der Christ ist nicht berufen, allmählich der Sünde abzusterben und so nach und nach in eine neue Stellung der Heiligkeit hineinzuwachsen; nein, der Ausgangspunkt seines Weges und Lebens ist die Tatsache, daß er mit Christo gestorben ist und sich nun in Ihm, dem Auferstandenen, in einer ganz neuen Stellung vor Gott befindet. Und diese Tatsache wird in der Taufe bezeugt. Ein gestorbener .Christus ist das Ende des alten Verhältnisses; der alte Mensch ist für immer gerichtet, und ein auferstandener Christus ist jetzt das Leben und die Gerechtigkeit des Gläubigen vor Gott.
Ganz naturgemäß und folgerichtig ergibt sich daraus ein Wandel in Neuheit des Lebens. Der Apostel sagt nicht, daß wir in Neuheit des Lebens wandeln müssen oder sollen, mit anderen Worten, er stellt uns nicht wieder unter ein Gebot, sondern betont nur die völlig veränderte Sachlage: „auf daß wir in Neuheit des Lebens wandeln". Daß es in diesem Wandel ein Wachstum, ein praktisches Fortschreiten gibt, entsprechend der Treue des einzelnen, braucht kaum betont zu werden. Aber von diesem Teil der Wahrheit wird hier nicht gesprochen. Andere Stellen belehren uns ausführlich darüber.
Der Ausdruck „durch die Herrlichkeit des Vaters" bedarf noch einer kurzen Erklärung. Er bedeutet wohl nicht einfach, daß Gott sich in der Auferweckung Jesu verherrlicht habe. Es ist der Vater, der als dem Sohne gegenüber handelnd hier eingeführt wird. Der Vater war, in aller Ehrfurcht sei es gesagt, es Seiner eigenen Herrlichkeit schuldig, den Sohn, der Ihn in allem verherrlicht hatte, nach vollendetem Werke aus den Toten aufzuerwecken. Alle die Ratschlüsse des Vaterherzens standen und stehen ja in Verbindung mit diesem Werke, und so kam gleichsam alles, was in Ihm ist, in dieser Verherrlichung Seines Sohnes zur Auswirkung.
Beachten wir indes, daß der Römerbrief das Auferwecktsein des Gläubigen mit Christo nicht als eine vollendete Tatsache betrachtet, sondern aus dem Gestorbensein mit Ihm nur die entsprechende Folgerung zieht: „Denn wenn wir mit ihm einsgemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein" (V. 5). Es findet dies wohl seine Erklärung darin, daß der Heilige Geist die Gläubigen in diesem Briefe als auf der Erde lebende Menschen betrachtet, nicht, wie z. B. im Epheserbrief, als in Christo in den Himmel mitversetzt. Nur der erste Teil der kostbaren Wahrheit von unserer Vereinigung mit Christo in Tod und Auferstehung wird hier entwickelt, der zweite nur gefolgert. Wenn wir teilhaben an dem Tode Christi, muß auch das daraus hervorgegangene Leben unser sein. Unser altes Ich ist tot, unser neues Ich ist Christus. Darum ist es nur folgerichtig für uns, in Neuheit des Lebens zu wandeln; als begraben mit Christo in der Taufe, geziemt es uns, nicht mehr uns selbst, sondern Gott zu leben, „indem wir dieses wissen4, daß unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf daß der Leib der Sünde — unser ganzer früherer Zustand — abgetan sei, daß wir der Sünde nicht mehr dienen" (V. 6).
Der natürliche Mensch dient der Sünde, das ist sein Wesen, seine Art; des Gläubigen Wesensart ist, der Sünde nicht zu dienen. „Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde" (V. 7). Für einen Gestorbenen kann ein Sündigen nicht mehr in Frage kommen, er ist ja tot! Das ist die überaus wichtige Lehre, welche der Heilige Geist hier den Gläubigen gibt, eine Lehre allerdings — und das wird so wenig verstanden — die genau so im Glauben erfaßt werden muß, wie die Wahrheit von der Errettung. Es handelt sich dabei um eine Tatsache, die sich außer uns vollzogen hat, um eine Befreiung, die dem Glaubenden von Gott ebenso bestimmt bezeugt wird wie die Vergebung seiner Sünden. Unsere praktischen Erfahrungen scheinen ihr freilich fortwährend zu widersprechen, sie stimmt aber mit der Weisheit und Heiligkeit Gottes ebenso überein, wie sie den einstigen Sklaven der Sünde die Gnade darreicht, fortan den heiligen Willen Gottes zu tun.
Im 8. Verse wird die Schlußfolgerung, die wir bisher behandelten, auf die Zukunft ausgedehnt.
Auch unsere Leiber werden an der Auferstehung aus den Toten teilhaben. „Wenn wir aber mit Christo gestorben sind, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, daß Christus, aus den Toten auf erweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn." Indem wir auf Grund der innersten Überzeugung unserer Seelen wissen (vergl. die Anmerkung auf Seite 81), daß Christus, einmal aus den Toten auferweckt, aus der Macht des Todes für immer herausgetreten ist, sie besiegt hat, haben wir die volle Glaubensgewißheit, daß wir auch mit Ihm leben werden. Dieses Auferstehungsleben, das jetzt schon seinen Ausdruck findet in einem neuen Wandel, der sich — wenn auch selbstverständlich immer unvollkommen — dem Wandel Christi gemäß gestaltet, wird erst vollendet sein in der Herrlichkeit, wenn wir »nach Leib, Seele und Geist tadellos" vor Gott stehen werden.
Einen Augenblick schien freilich der Tod unseren Herrn und Heiland in seiner Gewalt zu haben. Sollte Gott verherrlicht, die Sünde gerichtet, Satans Macht zerstört und unsere Befreiung zur Tatsache werden, so mußte Er in Tod und Grab hinabsteigen. Aber „was (nicht „daß") er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott" (V. 10). Schien Satan auch für eine kurze Zeit zu triumphieren, der Sieg ist ein für allemal auf selten unseres Herrn. Aus den Toten auferweckt, stirbt Christus nicht mehr, der Tod herrscht nicht mehr über Ihn, und wir ernten die Frucht Seines Sieges.
Aber ach! was hat dieser Sieg Ihn gekostet! Wie erschütternd ist der Gedanke, daß der vollkommen Sündlose und Heilige, indem Er unsere Sache in Seine Hand nahm, auch voll und ganz an unsere Stelle treten, zur Sünde gemacht werden mußte! Nicht daß Er persönlich je etwas anderes hätte werden können, als was Er war; aber indem Er sich freiwillig in Gnade für uns verantwortlich machte, mußte Er seitens des göttlichen Richters so behandelt werden, als wäre Er in demselben Zustand gewesen, in welchem wir von Natur uns befinden, als Sünde. Das war das Furchtbare, das in Gethsemane vor Seine heilige Seele trat: Er mußte als unser Stellvertreter der Sünde sterben, den Tod in seiner ganzen Schrecklichkeit als Sold der Sünde schmecken.
Gott sei gepriesen! das große Werk ist vollbracht. Der einmal um unsertwillen von Gott Verlassene thront jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes. „W a s er aber lebt, lebt er Gott", und wir dürfen frohlockend sagen, daß wir mit Ihm teilhaben an diesem Leben. Auf Grund dessen kann der Apostel uns auch zurufen: „Also auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Je s u" (V. 11). Wir würden, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein schweres Unrecht an dem Tode und der Auferstehung unseres Herrn begehen, wenn wir uns nicht in Ihm der Sünde für tot, Gott aber in Ihm lebend betrachten würden. Wir sind nicht nur berechtigt, sondern auch berufen, das zu tun und in der gläubigen Verwirklichung dieser Wahrheit zu wandeln. Ach, wenn die Kinder Gottes diese Wahrheit nur mehr im Glauben erfassen und ihre befreiende Kraft im Leben und Wandel erfahren möchten! Wie würde es Gott verherrlichen, Seinen Sohn ehren und ihre eigenen Herzen mit Dank und Freude erfüllen! Wer diese Wahrheit wirklich verstanden hat und darin wandelt, ist ein glücklicher, befreiter Christ, der die nunmehr folgende Ermahnung des Apostels dankbar begrüßt und eine innige Befriedigung darin findet, sie in all seinem Denken und Tun zur praktischen Wirklichkeit werden zu lassen.
„So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen; stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit" (V. 12. 13).
Betonen wir noch einmal, daß der Christ nicht der Sünde noch sterben muß, sondern daß er ihr, als mit Christo gekreuzigt, gestorben i s t. Er ist nicht von einzelnen Sünden oder bösen Neigungen befreit, sondern der ganze alte Mensch ist beseitigt, am Kreuze gerichtet. Beachten wir aber zugleich, daß dieses Gestorbensein mit Christo nicht etwa die Entfernung der alten Natur, des alten Menschen, aus uns zur Folge hat. Die Sünde ist und bleibt in uns, solang wir in diesem Leibe wallen. „Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf daß die Überschwenglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns" (2. Kor. 4, 7). Wenn es anders wäre, brauchte uns nicht gesagt zu werden: „H a 1-
t et euch der Sünde für tot", oder: „So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe". Aber obwohl die Sünde noch in uns ist, sind wir nicht mehr ihrer Herrschaft unterworfen, ihre Kraft ist gebrochen. Ein Christ kann sündigen, aber er m u ß nicht sündigen; er ist nicht gezwungen, auch nur einen unreinen Gedanken zu haben. Er wird sündigen, wenn er nicht wachsam ist, wenn aber das neue Leben und die Kraft des Heiligen Geistes in ihm wirken, braucht er der alten Natur in keiner Weise mehr zu dienen, nicht einmal, wie gesagt, in Gedanken.
Welch eine Befreiung! Aber erinnern wir uns noch einmal daran, daß sie nur im Glauben erfaßt und i n h e i l i g e r Furcht verwirklicht werden kann. Doch wie gut: derselbe Mensch, der einst das Licht haßte, liebt es jetzt! Von seinem alten Herrn befreit, ist der Christ nicht nur fähig, sondern auch frei, sich einem neuen Herrn zu widmen. Und wen wird er wählen, wem sich widmen? Er sagt: „Die vergangene Zeit ist mir genug, den Willen des Fleisches getan zu haben." (Vergl. 1. Petr. 4, 3.) An Satans Stelle ist Gott getreten, an die Stelle der Sünde die Gerechtigkeit. Früher ein Sklave Satans, ein williger Diener der Lüste seines sterblichen Leibes, kann er jetzt sich selbst Gott darstellen als ein aus den Toten Lebendiggemachter, und seine Glieder: Auge, Ohr, Zunge, Hand, Fuß usw., die er früher als Werkzeuge der Ungerechtigkeit benutzte, darf er jetzt als Werkzeuge der Gerechtigkeit mit Freuden in Gottes Dienst stellen. Wunderbarer Wechsel! Wir verstehen freilich, daß geradeso wie nur die Macht der Gnade ihn herbeiführen konnte, auch nur die Gnade uns praktisch in der Verwirklichung der neuen Stellung erhalten und wachsen lassen kann. Aber diese Gnade ist für uns da, und wir dürfen täglich, stündlich aus ihrer Fülle nehmen.
Beachten wir indes, daß die hier (wie bei vielen anderen ähnlichen Ermahnungen) gebrauchte griechische Zeitform des Wortes „stellet dar" im zweiten Falle nicht ein gegenwärtiges, gewohnheitliches Tun, sondern eine geschehene, aber in ihrer Wirkung fortdauernde Tatsache andeutet. Das will sagen: es handelt sich nicht, wie man im allgemeinen so gern meint, um eine allmählich fortschreitende Verbesserung oder Veredlung der menschlichen Natur, sondern darum, daß wir in einer einmaligen, aber in ihrer Bedeutung stets fest gehaltenen Handlung uns selbst Gott übergeben haben als Lebende aus den Toten, und unsere Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten; Jene Tatsache ist der Boden, auf den wir in Christo gebracht sind, und den wir unausgesetzt im Glauben einzunehmen und zu bewahren haben. „Denn", fährt der Apostel fort, „die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade" (V. 14). Gott sei Dank für dieses Wort, besonders am Schluß eines Abschnittes, der so ernst vor einem Mißbrauch der Güte Gottes und der Freiheit des Christen warnt!
Unserem menschlichen Denken und Empfinden würde es freilich mehr entsprechen, wenn der Apostel an dieser Stelle von dem ganzen Ernst der heiligen Gebote Gottes reden würde. Aber nein, so wie Gnade allein errettet, so gibt auch Gnade allein Kraft zu einem Gottes würdigen Wandel. Das Gesetz gibt weder Leben noch Kraft. In 1. Korinther 15, 56 wird es gar „die Kraft der Sünde" genannt, weil es bekanntlich gerade durch seine Verbote die Lüste und Leidenschaften des Fleisches anreizt. Wären wir unter Gesetz gestellt, so würde die Sünde nach wie vor ihre Herrschaft über uns ausüben; aber Gott sei gepriesen! wir sind unter Gnade. Darum kann uns zugerufen werden: „So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe", und das herrliche Trostwort folgen: „Die Sünde w i r d n i c h t über euch herrschen." Dieselbe Gnade, die uns von der Sünde freigemacht hat, gibt uns Kraft, nicht mehr den Lüsten des Fleisches zu dienen, sondern fortan in Neuheit des Lebens zu wandeln. Der Christ ist frei, sich Gott hinzugeben und Ihm zu dienen. Das ist die einfache und kostbare, aber vielfach leider so wenig verstandene und beachtete Belehrung des Wortes an dieser Stelle.
Doch man wendet ein; „Was nun? sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind?" (V. 15). Der Apostel antwortet wieder zunächst mit seinem entschiedenen „Das sei ferne!" Aber dann widerlegt er den Einwurf, nicht, wie bei der ersten Frage (V. l), durch den Hinweis auf unser Gestorbensein mit Christo, sondern dadurch, daß er zeigt, welch eine böse, niedrige Gesinnung eine solche Handlungsweise verraten würde. „Wisset ihr nicht,
daß, wem ihr euch darstellet als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet? entweder der Sünde zum Tode, oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit?" (V. 16). Es gibt für den Christen nur ein ernstes Entweder oder, keinen Vergleich, keinen Mittelweg. Einst ein Sklave der Sünde, ist er jetzt berufen, festzustehen in der Freiheit, zu welcher Christus ihn berufen, dem Beispiel zu folgen, das sein Herr ihm hinterlassen hat. Ein dankbares Herz begrüßt das auch mit Freuden, die Liebe wünscht es nicht anders. Aus der Sklaverei der Sünde, die zum Tode führte, befreit, nennt der Christ sich jetzt mit Lust einen Sklaven Jesu Christi, oder, wie der Apostel es hier ausdrückt, „des Gehorsams zur Gerechtigkeit". Welch ein Leben, welch ein Ertrag desselben! Es ist genau das, was wir in Vollkommenheit bei unserem geliebten Herrn, dem wahren und einzig vollkommenen Diener, erblicken. So unvollkommen alles bei uns bleiben mag, Seinem Vorbilde folgend gehorchen wir, damit praktische Gerechtigkeit, ein Wandel dem Willen Gottes entsprechend, daraus hervorkomme.
Freudig stimmen wir deshalb ein in den Ausruf: „Gott aber sei Dank, daß ihr Sklaven der Sünde wäret, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid!" (V. 17). Wir sind in unserer neuen Stellung nicht auf uns selbst angewiesen. Als Geschöpfe können wir niemals unabhängig sein, uns nicht selbst genügen; wir bedürfen eines Gegenstandes, nach dem wir uns bilden, eines Vorbildes, dem wir nacheifern können. Dieser Gegenstand, dieses Vorbild ist Christus, so wie Gott sich in Ihm geoffenbart hat, samt allem, was uns in Ihm geschenkt ist. Der Heilige Geist, durch den wir mittelst des Wortes wiedergezeugt sind, ist allezeit bemüht, Christum vor unsere Blicke zu stellen, indem Er uns zugleich die Dinge genießen läßt, die Er uns im Worte mitgeteilt hat. So Christum anschauend und das Begehren im Herzen tragend, dem Bilde der christlichen Lehre, dem wir übergeben worden sind, zu gehorchen, wird Geist und Gesinnung, der ganze Mensch, diesem im Worte uns gegebenen Bilde gemäß umgewandelt und gestaltet.
„Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen, der Schwachheit eures Fleisches" (V. 18. 19). Der Herr sagt: „Niemand kann zwei Herren dienen." So ist es auch in diesem Falle. Von dem ersten Herrn freigemacht, sind wir mit dem zweiten in ein nie wieder zu lösendes Verhältnis getreten. Was das Gesetz, wie schon so oft betont, nicht zu tun vermochte, das tut die Gnade, indem sie in dem praktischen Leben des Christen das hervorbringt, was in Christo in Vollkommenheit gesehen wird. Obwohl völlig frei, ist der Gläubige doch ein williger Knecht Christi, ein gleichsam mit Leib und Seele der Gerechtigkeit verschriebener Mensch. Anstatt die Freiheit, zu der er gebracht ist, zu mißbrauchen, benutzt er sie, um gerade das (und mehr) zu tun, was das Gesetz mit allen seinen Drohungen und Verheißungen nicht hervorzubringen vermochte.
Hat er einst seine Glieder dargestellt zur Sklaverei der Unreinigkeit und Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt er sie jetzt dar zur Sklaverei der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. (V. 19.) Der Apostel redet menschlich oder nach Menschenweise, wenn er so spricht, um des schwachen geistlichen Zustandes und Verständnisses der Römer willen. Würden sie vielleicht doch noch falsche Schlüsse aus seinen Belehrungen gezogen haben, wenn er sie nicht so eindringlich an ihre heilige und unverbrüchliche Verpflichtung zu einem heiligen Wandel erinnert hätte? Sie waren Freie und doch Gebundene, freigemacht von der Sünde, nicht aber um jetzt zu tun, was ihnen beliebte, sondern in heiliger Unterwürfigkeit und Furcht der Gerechtigkeit zu dienen. In beiden Zuständen gibt es ein Ziel, ein Wachstum. Das Ziel des einen war stets zunehmende Gesetzlosigkeit, Trennung von Gott in Hochmut und Eigenwille; das des anderen ist wachsende Heiligkeit, Absonderung für Gott in Demut und Gehorsam. Der natürliche Mensch liebt das Böse und haßt das Licht, der geistliche haßt das Böse und liebt das Licht.
„Denn als ihr Sklaven der Sünde wäret, da wäret ihr Freie von der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämet? denn das Ende derselben ist der Tod" (V. 20. 21). Die Sklaverei, in welcher die Gläubigen sich einst befanden, hatte jeden Dienst der Gerechtigkeit, ja, jegliche Beziehung zu ihr völlig ausgeschlossen. Und welche Frucht hatten sie damals von ihrem Tun gehabt? Was hatten die Dinge, die sie getrieben hatten, ihnen eingetragen? Nichts als Beschämung und Trauer. Und das Ende derselben war der T o d !
Fürwahr, wenn es Beweggründe zu einem Wandel in Heiligkeit gibt, dann sind sie hier mit bewunderungswürdiger Kraft und Weisheit zusammengestellt. Konnten die Gläubigen in Rom sich ihnen entziehen? Wollten sie, nachdem die Gnade sie um einen so hohen Preis aus ihrem früheren Zustande befreit hatte, wieder zu dem alten Leben mit seinen beschämenden Begleiterscheinungen und seinem furchtbaren Ende zurückkehren, sich wieder unter die Herrschaft der Sünde begeben? Unmöglich! Nein, „von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden", hatten sie jetzt ihre „Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber e w i g e s L e b e n" (V. 22).
„Gottes Sklaven geworden", damit erreicht der Apostel wohl den Höhepunkt seiner Belehrung an dieser Stelle. Wir sind nicht nur dahin gebracht, die Gerechtigkeit zu lieben und ihr nachzustreben, sondern sind zu Gott selbst in die nächsten Beziehungen getreten. Ihm dürfen und sollen wir unverkürzt alle Kräfte des Leibes und der Seele weihen. Nicht eine Reihe von Geboten ist uns als Richtschnur für unser Handeln gegeben, nein, wir sind Ihm selbst unterworfen, wie Er sich in Seinem ganzen Worte geoffenbart hat, Ihm, dessen wohlgefälligen Willen wir durch Seinen Geist immer klarer zu verstehen und durch die Gnade zu tun lernen. So ist der Bereich, in welchem wir unseren Gehorsam offenbaren können, ohne Schranken und Grenzen, und indem wir in ihm wandeln, haben wir „unsere Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben".
Seliger Wechsel! Einst kennzeichneten uns die finsteren Werke des Fleisches, heute dürfen wir die Frucht des Geistes bringen, lauter liebliche Dinge, wider die es kein Gesetz gibt. (Lies Gal. 5, 19—23.) Früher hatten wir k e i n e Frucht, nur böse Gedanken, Worte und Werke, jetzt Frucht zur Ehre Gottes und zum Wachstum in der Heiligkeit. Als aus Gott geboren, sind wir unserer Stellung nach geheiligt durch das Opfer Jesu Christi, durch das Wort Gottes und durch die Inwohnung des Heiligen Geistes. Wir können deshalb „Heilige und Geliebte" genannt werden. Aber wir bedürfen praktischerweise der Heiligung. Sie geschieht dadurch, daß wir unsere Herzen von Ihm erfüllen lassen, der das ganze Herz des Vaters ausfüllt, weil Er allezeit, bis zum Tode am Kreuze, das vor Gott Wohlgefällige tat.
„Gottes Sklaven !" 0 möchten wir das Wort immer besser verstehen und verwirklichen lernen, damit unsere Frucht wachse, und daß wir auf dem Wege zur Herrlichkeit mehr und mehr in das Bild Dessen verwandelt werden, der selbst einst hienieden gewandelt und den Vater verherrlicht hat, und den wir mit aufgedecktem Angesicht jetzt droben anschauen in Seiner Herrlichkeit! (2. Kor. 3, 18.)
„Als das Ende aber ewiges Leben." Das kostbare Ziel eines so gesegneten Pfades, die Krone, die unser wartet, ist diese Herrlichkeit selbst. Bald wird auch unser Leib, das „irdene Gefäß", Seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet werden, und wir werden dann voll und ganz, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Bild Dessen tragen, der uns geliebt und das ewige Leben für uns erworben hat. (Kap. 8, 29.)
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn" (V. 23). Damit schließt der Schreiber seine wunderbaren Gedankengänge. Mit einem Wort stellt er noch einmal die Ergebnisse auf des Menschen und auf Gottes Seite vor unsere Blicke. Wir hatten den Tod verdient, als traurigen Lohn für traurige Arbeit; die Gnade hat uns das ewige Leben, Gottes freie, unverdiente Gabe, durch Jesum Christum, unseren Herrn, geschenkt. Wir besitzen es heute schon „im Sohne". In Ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und wer den Sohn hat, hat das Leben. Anders wären wir völlig unfähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber ewiges Leben bedeutet im Ratschluß Gottes noch mehr als das. Es ist vollkommene Gleichheit mit dem droben verherrlichten Menschensohne. Dort wird dieses Leben bald in Herrlichkeit völlig geoffenbart werden.
Das also liegt vor uns! „Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn."
Kapitel 7
Kapitel 7, 1—11
Nachdem der Apostel in dem Vorhergehenden die beiden großen Fragen der Rechtfertigung und der Befreiung behandelt und die Wirkung des Todes und der Auferstehung Jesu hinsichtlich beider entwickelt hat, kommt er jetzt zu einem neuen Gegenstand von größter Wichtigkeit. Gott hatte einst Seine Gebote dem Menschen gegeben. Sie waren unverbrüchlich und fanden ihre Anwendung — ich rede natürlich nur von dem Sitten-, nicht von dem Zeremonial-Gesetz — auf alle Menschen ohne Unterschied. Wenn auch zunächst nur für das Volk Israel bestimmt, enthielten sie doch die gerechten Forderungen Gottes an Sein Geschöpf, an den Menschen in seinem natürlichen Zustande. Jeder Mensch, der mit ihnen bekannt wurde, war verpflichtet, ihnen zu gehorchen, und sie bestehen heute noch für den Menschen als solchen in ihrer vollen Kraft. (Vergl. 1. Tim. 1. 8. 9.) Der heilige Gott kann Seine Forderungen nicht mildem, Seine Ansprüche nicht verringern.
Nun aber hatte der Apostel kurz vorher gesagt, daß die Gläubigen „nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade" seien. Wie war dieser scheinbar unlösliche Widerspruch aufzuklären? Daß sie nicht „gesetz l o s" geworden waren, d. 1. nicht ihrem eigenen Willen, ihren Neigungen und Lüsten folgen durften, hatte er schon aufs deutlichste bewiesen. Wie waren sie nun von den Flüchen des Gesetzes befreit worden, wie seiner Botmäßigkeit entronnen? Die Antwort ist kurz und einfach. Sie lautet, wie im 5. und 6. Kapitel: durch den Tod.
„Oder wisset ihr nicht, Brüder, (denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen,) daß das Gesetz über den Menschen herrscht, s o l a n g e e r l e b t ?" (V. l). Wenn ein zum Tode verurteilter Mörder hingerichtet ist, so hat er mit dem Gesetz, das ihn zum Tode verurteilt hat, nichts mehr zu tun; die Forderung desselben ist befriedigt, sein Recht erfüllt. Was könnte das Gesetz überhaupt noch mit einem toten Menschen anfangen? So ist auch der Gläubige gestorben, und zwar i n und m i t Dem gestorben, der am Kreuze für ihn zur Sünde gemacht wurde und den Fluch eines gebrochenen Gesetzes für ihn trug. Er ist also tot, dem Gesetz gestorben, und an die Stelle des Gesetzes ist Christus getreten. In Ihm, dem Auferstandenen, besitzt der Gestorbene ein neues Leben, in welchem er durch den Glauben das stets zur Sünde neigende Fleisch für gerichtet und sich selbst der Sünde für tot halten darf.
Ehe wir indes weitergehen, müssen wir uns einen Augenblick mit dem Wort „Gesetz" beschäftigen. Wir begegnen ihm in unserem Kapitel in verschiedenartiger Bedeutung. Im 2. Verse lesen wir z. B. vom „Gesetz des Mannes", oder dem Ehegesetz, im 21. und 23 Verse von einem „anderen Gesetz", dem „Gesetz der Sünde", das dem „Gesetz des Sinnes" in den Wiedergeborenen widerstreitet. Ferner sagt der Apostel im 1. Verse: „Ich rede zu denen, die Gesetz kennen." Er spricht nicht von dem Gesetz (vom Sinai), sondern von „Gesetz" in allgemeinem Sinne. Er sagt mit anderen Worten: „Ich rede zu Leuten, die da wissen, was das Wort Gesetz bedeutet." „Gesetz" in diesem allgemeinen Sinne ist eine unveränderliche Regel, ein feststehender Grundsatz, dem Dinge oder Menschen unterstellt sind. Der Ausdruck „Naturgesetze" ist uns allen geläufig, aber es gibt auch mancherlei andere Gesetze, die zu dem Menschen als solchem in Beziehung stehen, Gesetze, die ihm Verpflichtungen auferlegen oder Forderungen an ihn stellen, denen er sich nicht entziehen kann.
Nun, wer da weiß, was „Gesetz" ist, der weiß auch, daß ein toter Mensch außerhalb des Bereichs aller Gesetze steht. Auch das Gesetz (das Gesetz vom Sinai) kann nur über den Menschen herrschen, solang er lebt. Der Tod hebt jede Verbindung, jede Verpflichtung ihm gegenüber auf. Der Apostel erklärt das noch näher durch das Beispiel von dem Ehegesetz, indem er sagt: „Denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solang er lebt; wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird; wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so daß sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird" (V. 2. 3).
Der Gedanke ist so verständlich und einfach, daß er keinerlei Erklärung bedarf. Man fragt sich unwillkürlich: Wie war und ist es möglich, daß man trotzdem immer wieder versucht hat, schon zur Zeit der Apostel, den Christen unter das Gesetz zu stellen, oder Christum und das Gesetz miteinander zu verbinden, d. h. also neben der Rechtfertigung durch Christum noch eine solche durch Gesetz zu fordern? Zwei Männer zu gleicher Zeit haben, ist Ehebruch. Irgend eine andere Verbindung neben Christo eingehen, heißt Ihm untreu werden. War das Gesetz einst mein Ehemann, so ist das jetzt für mich als Christ nicht mehr der Fall. Der Eintritt des Todes hat die alte Verbindung für immer gelöst, so daß ich einem anderen Manne angehören darf, und dieser Mann ist Christus. So elend und arm ich mich unter der alten Verbindung gefühlt habe, — denn je mehr ich versuchte, mein Möglichstes zu tun, umsomehr verurteilte und strafte mich der erste Ehemann, — so wohl und reich fühle ich mich in dem neuen Verhältnis, unter Christo, dem zweiten Ehemann. Diese neue Verbindung wird im achten Kapitel durch zwei kostbare Dinge gekennzeichnet: in ihr gibt es „keine Verdammnis mehr" (V. l), und jede ,,Scheidung" ist unmöglich. (V. 35 — 39.)
„Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf daß wir Gott Frucht brächten" (V. 4). Die Gnade nimmt also den Christen, selbst wenn er ehedem ein Jude war, aus dem alten Verhältnis heraus und bringt ihn in eine ganz neue Verbindung, die auf den Tod Christi gegründet ist, und in welcher er Gott Frucht bringen kann, was vorher ganz ausgeschlossen war.
Beachten wir indes, daß der Apostel bei der Anwendung das Bild umkehrt: nicht der alte Ehemann, das Gesetz, ist gestorben, was ganz unmöglich wäre, sondern w i r sind als solche, die einst ihr Leben im Fleische hatten, durch den Leib des Christus, d. h. in Seinem Tode, dem Gesetz getötet worden. Als gestorben mit Ihm sind wir von unserer alten Verpflichtung gelöst, um nun Ihm allein anzugehören, und zwar nicht wieder in irgend einem gesetzlichen Geiste, vielleicht unter einer anderen Form, sondern in alleiniger Unterwerfung unter Christum, Ihm gleichsam angetraut, auf Ihn schauend, von Ihm lernend. Der Christ kann und darf in keiner Weise zwei Herren dienen, weder Christo und der Sünde (Kap. 6), noch Christo und dem Gesetz. (Kap. 7.) Zu leben ist für ihn Christus. (Phil. 1. 21.) Nur so kann er wirklich fruchtbar sein für Gott; ja, indem er nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandelt, tut er mehr, als was das Gesetz fordert. (Vergl. Kap. 8, 4.)
Wird aber, so könnten wir wieder fragen (vergl. das zu Kap. 3, 27 Gesagte), auf diesem Wege das Ansehen des Gesetzes nicht geschwächt, seine Autorität geradezu vernichtet? Keineswegs. Den Ansprüchen des Gesetzes ist voll und ganz Genüge geschehen, denn die Sünde wurde in Christo am Kreuze bestraft, und ich, der Schuldige, bin in Seinem Tode mitgetötet worden. Das Urteil des Gesetzes ist also zur Vollziehung gekommen. Der Gläubige ist, wie der Apostel es in Galater 2, 19 ausdrückt, „durchs Gesetz dem Gesetz gestorben". Gott selbst hat diesen rechtmäßigen Weg der Befreiung vom Gesetz bereitet, einen Weg, der uns völlig und auf immerdar außer seinen Bereich stellt. Das Gesetz bleibt selbstverständlich nach wie vor in seiner unantastbaren Heiligkeit und Gerechtigkeit bestehen, aber w i r sind nicht mehr für dasselbe vorhanden.
Das ist die Lehre bezüglich der Stellung, in welche der Gläubige gebracht ist. Was aber sagt unsere Erfahrung dazu? Nun, anstatt das Gesagte umzustoßen, bestätigt sie vielmehr den wichtigen Grundsatz unseres Gestorbenseins mit Christo und der aus ihm hervorgegangenen Befreiung der Seele von dem Gesetz. „Denn als wir im Fleische waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden, so daß wir dienen in dem Neuen des Geistes und nicht in dem Alten des Buchstabens" (V. 5. 6).
„Als wir im Fleische waren." Was will der Ausdruck „im Fleische sein" sagen? Wir werden ihm noch wiederholt begegnen. „Im Fleische sein" heißt: auf dem Boden oder in der Stellung des ersten Adam vor Gott stehen und Ihm dieser Stellung gemäß verantwortlich sein. Es handelt sich dabei nicht um das geringere oder größere Maß der persönlichen Schuld, sondern um den sündigen Zustand, in welchem wir uns von Natur ausnahmslos befinden, um das Joch der Sünde, unter dem wir alle stehen. Wir waren einst (um in der Sprache des Bildes zu reden) ehelich mit dem Gesetz verbunden; aber wie uns sattsam bekannt, verbietet das Gesetz wohl die Sünde und rechnet sie dem Übertreter zu, aber es gibt keine Kraft zum Halten seiner Gebote; im Gegenteil, es gibt der Sünde Anlaß, in mir wirksam zu werden. Indem es uns sagt; „Laß dich nicht gelüsten", bringt es gerade „die Leidenschaften der Sünden" in uns zum Aufwachen und Wirken. So verstehen wir es, wenn der Apostel sagt, daß diese Leidenschaften „durch das Gesetz" sind. Doch übersehen wir nicht: Die Quelle jener Leidenschaften ist nicht etwa das Gesetz; die Quelle liegt in uns, aber das Gesetz wirkt auf sie und setzt sie in Tätigkeit. Wenn ein Lehrer seinen Schülern verbietet, die Wände des Schulzimmers zu bekritzeln, so wird in vielen, die früher vielleicht nie an so etwas gedacht haben, die Lust erwachen, das Verbotene zu tun. Oder wenn ich etwas in einer Schublade verschließe und sage; „Niemand darf wissen, was in dieser Schublade ist", so wird groß und klein die Lust verspüren, die Schublade zu öffnen.
Das also war unser Zustand, unsere traurige Lage. Aber Gott sei gepriesen! wir „waren einst im Fleische", sind es aber nicht mehr. Wir sind vielmehr, wie wir später belehrt werden, „im Geiste". (Kap. 8, 9.) Das ist unsere neue Stellung vor Gott. Wohl ist das Fleisch noch „in uns", und deshalb können wir dem Fleische noch Raum geben, ja, selbst „fleischlich" sein (1. Kor. 3, 1. 3), aber wir sind nicht mehr „im Fleische". Und obwohl das Fleisch noch in uns ist, stehen wir nicht mehr unter seiner Herrschaft, noch stellt das Fleisch, wie früher, unsere Stellung vor Gott dar.
Damals wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, und die Frucht, die wir brachten, galt dem Tode; das Gesetz kann einmal nicht anders, es wird sich immer als „ein Dienst des Todes und der Verdammnis" erweisen. Nachdem wir aber dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden, dienen wir nicht mehr „in dem Alten des Buchstabens, sondern in dem Neuen des Geistes". Auch hier gilt das kostbare Wort des Apostels in 2. Korinther 5, 17: „Wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden." Unser Dienst besteht nicht mehr in der Erfüllung buchstäblicher gesetzlicher Forderungen in eigener Kraft, sondern in der Nachfolge Christi in der Kraft des Heiligen Geistes. Als solche, die der göttlichen Natur und des Lebens Christi teilhaftig geworden sind, vermögen wir, durch den Geist geleitet und gestärkt, in alledem zu wandeln, was Gott wohlgefällig ist.
Wenn aber das Gesetz eine so verhängnisvolle Wirkung hat, daß unter ihm nur dem Tode Frucht gebracht werden kann, und man völlig von ihm losgemacht sein muß, um in Christo Jesu Gott dienen zu können, was soll man dann sagen? Ist dann das Gesetz nicht etwa selbst Sünde? (V. 7.) Der Gedanke liegt nahe, aber der Apostel beweist in den folgenden Versen, daß das nicht nur nicht der Fall ist, sondern daß gerade das Gesetz die Tatsache ans Licht gebracht hat, daß Sünde in uns wohnt; zugleich hat es uns gezeigt, was Sünde ist. Ein natürlich aufrichtiges Gewissen weiß, daß Fluchen, Lügen, Stehlen usw. böse ist, und verurteilt diese Dinge; aber die Sünde als solche, die böse Quelle in unserem Innern, unseren sündigen Zustand, hätte niemand von uns erkannt, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: .Laß dich nicht gelüsten!" So hat sich denn auf diesem Wege einerseits der wahre Charakter des Gesetzes geoffenbart, andererseits die Sünde in ihrer ganzen Häßlichkeit gezeigt.
Der vorliegende Abschnitt hat indes Anlaß zu den widersprechendsten Erklärungen gegeben, da die Ausleger, die wahre Stellung des Christen nicht kennend, mit seiner Befreiung von Sünde und Gesetz nichts anzufangen wußten. Die Hauptschwierigkeit liegt aber wohl darin, daß die eine Klasse der Erklärer von dem Standpunkt ausgeht, daß der Apostel von einem aufrichtigen, aber noch nicht bekehrten Menschen rede, die andere, daß er die Erfahrungen eines Christen beschreibe. Noch andere meinen, er berichte über seine eigenen Erfahrungen vor und nach seiner Bekehrung.
Es mag vielleicht anmaßend klingen, wenn ich der Meinung Ausdruck gebe, daß alle drei Erklärungsweisen irrig sind; aber wenn meine Leser ohne Voreingenommenheit die Worte des Apostels auf sich einwirken lassen wollen, so glaube ich, daß sie mir recht geben werden. Daß der Apostel zunächst nicht von sich selbst redet, geht klar aus dem 9. Verse hervor. Wie könnte er, der einstige Pharisäer und glühende Verteidiger der Ansprüche des Gesetzes, von sich sagen: „Ich aber lebte einst ohne Gesetz"? Weiter beweist eine Vergleichung des 14. Verses unseres Kapitels mit Kapitel 6, 14 und 18, sowie des 19. Verses mit dem ganzen 6. Kapitel und Kapitel 8, 4 unwiderleglich, daß er unmöglich die regelrechten Erfahrungen eines Christen beschreiben kann. Daß er selbst für eine Weile ähnliches erlebt hat, dürfen wir annehmen, da wohl nur der, welcher selbst in dem beschriebenen Zustand gewesen ist, ihn so schildern wird, wie der Apostel es tut. Jedenfalls aber beschreibt er nicht Erfahrungen, die er in seinem späteren Leben gemacht hat, und die deshalb als Regel für den Christen dienen könnten oder sollten. Von einem natürlichen Menschen kann er schließlich auch nicht reden, denn ein solcher kann unmöglich sagen: „Ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen" (V. 22). Wohl mögen wir ähnlich klingenden Ausdrücken in menschlichen Schriften, ja, selbst schon bei heidnischen Philosophen begegnen, aber eine unbekehrte Seele, deren Sinn und Wille noch nicht erneuert sind, weiß nichts von einem inneren Menschen, der Lust hat an den Geboten des Herrn.
Von wem spricht der Apostel denn? Er redet von einer wiedergeborenen oder (im Sinne der Schrift) bekehrten Seele, die Leben aus Gott besitzt, aber die im Evangelium geoffenbarte Gerechtigkeit Gottes und die kostbaren Folgen des Werkes Christi noch nicht erkannt und im Glauben ergriffen hat, deshalb auch noch nicht durch den Heiligen Geist versiegelt ist — von einem Menschen, dessen Gewissen ins Licht Gottes gebracht ist, und der nun für Gottes gerechte und heilige Ansprüche eifert, aber keine Kraft hat, ihnen gerecht zu werden.
Vielleicht wird man einwenden: Aber einen solchen Menschen kann man doch nicht bekehrt nennen! Nein, in dem Sinne, wie w i r von einem Bekehrten zu reden gewohnt sind, nicht. Wenn wir sagen: „Der und der ist bekehrt", so meinen wir damit: er ist ein Mensch, der errettet und sich seiner Errettung und Gotteskindschaft bewußt ist. Aber die Schrift redet nicht so: Bekehrung ist nach der Schrift Umkehr, aber noch nicht bewußte Errettung. Der verlorene Sohn war bekehrt, als er sich aufmachte, um zu seinem Vater zu gehen und zu ihm zu sagen: „Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig usw.". Aber er wollte ein „Tagelöhner" werden. Daß der Vater f ü r i h n war, trotz des hinter ihm liegenden traurigen Lebens, und, wenn er ihn aufnahm, ihn nur als „Sohn" ins Haus führen konnte, davon hatte er keine Ahnung. Das Bewußtsein der Annahme und der Vergebung seiner Sünden kam ihm erst, als er in den Armen des Vaters lag. So liegt zwischen der Bekehrung oder der Erweckung, wie wir sie zu nennen pflegen, und der Erlangung der Gewißheit des Heils meist (nicht immer) eine kürzere oder längere Übergangszeit. Von dieser Zeit oder richtiger von einem diese Zeit durchlebenden, wahrhaft oder göttlich erweckten, d. h. nicht nur in seinen Gefühlen angefaßten, sondern von seinem bisherigen Wege umgekehrten Menschen redet der Apostel. Sobald man das verstanden hat, lösen sich die Hauptschwierigkeiten unseres Kapitels ganz von selbst.
Doch wieder wird man einwenden: Haben denn nicht viele wahre Christen, jüngere und ältere, die ihrer Errettung und Gotteskindschaft völlig gewiß waren, Erfahrungen durchgemacht, wie Römer 7 sie beschreibt? Ist es nicht selbst den meisten von uns so ergangen? Die Frage muß bejaht werden, aber nur aus dem einfachen Grunde, weil infolge der fast unausrottbaren gesetzlichen Neigung unserer Herzen die meisten von uns sich nur auf diesem schmerzlichen Wege belehren lassen. Man weiß und bekennt, daß man in und mit Christo gestorben ist, ist aber trotz alledem nicht befreit, sondern tut, als lebe man noch in dem alten Zustande, und als wäre noch irgend etwas Gutes von dem Fleische zu erwarten. Zugleich lassen sich viele durch die Erwägung leiten, daß so wie Römer 7 auf 5 und 6 folge, so auch die im 7. Kapitel beschriebenen Erfahrungen auf die Rechtfertigung (Kap. 5) und die Befreiung (Kap. 6) folgen müßten. Sie halten das für die in diesen Kapiteln festgelegte und darum göttliche Reihenfolge. Aber diese Folgerung ist falsch. Mit dem 7. Kapitel ist es ähnlich wie mit dem Gesetz selbst, das „daneben einkam", um einen gewissen Zweck zu erfüllen. Jene Folgerung bringt manche aufrichtige, aber
noch nicht in der Wahrheit befestigte Seelen in Verlegenheit. Indem sie nicht so wandeln, wie sie gern möchten und wie Gott es auch mit Recht von ihnen erwartet, fangen sie an zu zweifeln und zu fragen, ob sie nicht Heuchler sind, ob sie sich nicht getäuscht haben und wohl noch gar nicht bekehrt sind. In dem ernsten Verlangen, daß es anders werden möchte, nicht selten auch von anderer Seite belehrt, daß dies der richtige Weg sei, verlassen sie unbewußt den Boden der Gnade und betreten den des Gesetzes, und machen nun alles abhängig von ihrem Tun und von dem, was sie i n sich selbst vor Gott sind. Wer die Lehre von Römer 5 und 6 wirklich verstanden hat, wird nicht leicht in die Gefahr kommen, in nutzlosen Anstrengungen sich abzumühen, um aus eigener Kraft eine Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Ein solcher weiß, daß der Leib der Sünde abgetan ist, daß die Gnade jetzt herrscht durch Jesum Christum und ihn von dem freigemacht hat, in welchem er einst festgehalten wurde.
Doch noch eins: wir sagten uns schon, daß nur ein Mensch, der in dem schmerzlichen Zustande von Römer 7 w a r, aber sich nun außerhalb desselben befindet, ihn so, wie es hier geschieht, beschreiben wird. Es ist schon von anderer Seite darauf hingewiesen worden, daß jemand, der noch im Sumpfe steckt, unmöglich mit solcher Ruhe erzählen kann, wie es ihm dabei zumute ist. In dem furchtbaren Gefühl, daß er rettungslos versinkt, kann er nur um Hilfe schreien. Jede Mühe ist umsonst, jede Bewegung verschlimmert seine Lage. Hebt er einen Fuß auf, um auf festen Boden zu gelangen, so sinkt er mit dem anderen nur umso tiefer ein. Sein verzweiflungsvoller Schrei: »Ich elender Mensch ! wer wird mich retten?" ist darum mehr als verständlich.
Beachten wir hier auch, daß in diesem ganzen Kapitel weder von Gnade die Rede ist, noch von Christo, noch endlich von dem Heiligen Geist, sondern nur von dem Gesetz, von der Kraft der Sünde, von der Ohnmacht und Verderbtheit des Fleisches und von den vergeblichen Anstrengungen, aus der jammervollen Stellung, in der man sich befindet, herauszukommen. Christus wird erst im Schlußverse, nachdem der Verzweiflungsschrei ertönt ist, als die alleinige Zuflucht und Rettung des von dem Gesetz der Sünde und des Todes hoffnungslos Gefangenen eingeführt. Er ist die einzige, aber auch die völlig genügende Antwort auf die Frage: „Wer wird mich retten?"
Kapitel 7, 12—25
Doch wir sind dem Gang unseres Kapitels vorausgeeilt. Kehren wir zu den Versen 7—11 zurück: An die ernste Ablehnung des Gedankens, daß das Gesetz Sünde sei, knüpft der Apostel die Worte: „Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewußt, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: „Laß dich nicht gelüsten"." So ist gerade die Vortrefflichkeit des Gesetzes verhängnisvoll für den Sünder. Schon im 3. Kapitel hatte der Apostel gesagt: „Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde" (V. 20). Hier: Die Sünde hätte ich nicht erkannt, von der Lust nichts gewußt, wenn nicht das Gesetz mir die Augen darüber geöffnet hätte. Durch das Gesetz werden Sünde und Lust in ihrem wahren Charakter erwiesen und erkannt.
Die Sünde wird hier gleichsam personifiziert. Sie erscheint als eine im Fleische wohnende Macht, die Gott und Seinem Gesetz feindlich gegenübersteht. Sie wirkt, und zwar gerade das, was das Gesetz verbietet und weil es dasselbe verbietet. Die Lust ist die im Fleische aufsteigende Neigung oder Begierde. Da es sich hier nicht darum handelt, die Schuld des Menschen festzustellen, sondern seine böse, widerspenstige Natur ans Licht zu bringen, wählt wohl der Heilige Geist das letzte Gebot: „Du sollst nicht begehren", oder: „Laß dich nicht gelüsten" als das am meisten geeignete, um das Vorhandensein jenes bösen Grundsatzes, der Sünde im Menschen, zu beweisen. Denn „ohne Gesetz ist die Sünde tot", aber „durch das Gebot Anlaß nehmend, bewirkte sie jede Lust in mir" (V. 8).
Das Gesetz hat nicht nur die bleibenden Pflichten des Menschen Gott und seinem Nächsten gegenüber festgestellt, sondern ihm auch durch die Forderung: „Laß dich nicht gelüsten" einen untrüglichen Prüfstein für seinen Zustand in die Hand gegeben. Vor dem Gesetz war die Sünde da, aber sie war tot. Solang ein Mensch nichts tat, was sein natürliches Gewissen ihm verbot, hatte er kein Bewußtsein von ihr, kannte auch den Urteilsspruch des Todes nicht. Ebensowenig wußte er etwas von dem Vorhandensein der Lust in seinem Innern. Erst durch Gesetz lernte er ihr Vorhandensein und das Verdammliche der Begierden seines Herzens kennen; zugleich aber erfuhr er auch, daß gerade das Gebot das leidenschaftliche Begehren in ihm weckte, das Verbotene zu tun, mit anderen Worten, daß seine Natur böse und eine Quelle des Bösen ist.
Wir verstehen jetzt auch die weiteren Worte des Apostels: „Ich aber — d. 1. der Mensch in seinem natürlichen Zustande — lebte einst ohne Gesetz; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf" (V. 9). Anstatt dem Menschen Kraft zu geben, die Lust zu unterdrücken, das Fleisch zu verbessern, deckte das Gesetz nur sein völliges Verderben auf. Was der Mensch bedarf, ist eine neue Natur und ein ihn völlig umwandelnder Gegenstand, aber das Gesetz gibt weder die eine, noch offenbart sie den anderen. Die Gnade tut beides in Christo.
„Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, dasselbe erwies sich mir zum Tode" (V. 10). Das Gesetz sagte: „Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben." (Vergl. Gal. 3, 12.) Da ich sie nicht getan habe, im Gegenteil, das Gebot erst recht die Lust in mir geweckt hat, den Begierden meines Fleisches zu folgen, so hat sich das Gesetz für mich als ein Werkzeug des Todes erwiesen. Es hat gerechterweise Tod und Verdammnis über mich gebracht, und mein aufgewachtes Gewissen kann sein Urteil nur bestätigen. „Ich aber starb."
Welch ein Ergebnis! Wer trägt die Schuld daran? Das Gesetz? Nein, sondern „die Sünde, durch das Gebot Anlaß nehmend, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe" (V. 11). So ist das Gesetz wohl, wie vorhin gesagt, ein Werkzeug des Todes für mich geworden, aber die U r s a c h e von allem ist die in mir wohnende Sünde. Sie brachte mir durch das Gesetz den Tod.
Diesen Gedanken führt der Apostel vom 12. Verse bis zum Schluß des Kapitels noch weiter aus, indem er an den praktischen Erfahrungen eines wohl bekehrten, aber noch nicht befreiten Menschen, der das Gute will und das Böse haßt, in ergreifender Weise zeigt, wie das Gesetz sich in Wirklichkeit dem Menschen zum Tode erweist, aber auch wie Gottes Gnade ihm Erlösung und Befreiung bringt.
„So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut" (V. 12). Das Gesetz steht völlig gerechtfertigt da, alle seine Gebote sind heilig und gut. Nicht an ihm liegt es, wenn es nichts zur Vollendung bringen kann, sondern an der Natur des Menschen, an die es sich wendet.
„Gereichte nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne! sondern die Sünde, auf daß sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, auf daß die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot" (V. 13). Immer wieder erhebt die Torheit des Menschen ihre Fragen. Nein, der Zweck des Gesetzes war nicht, mich zu töten, so gerecht sein Urteilsspruch über mich lauten mag. Es bezweckte etwas ganz anderes. Wir hörten schon in Kapitel 5, 20, daß es „daneben einkam, auf daß die Übertretung überströmend würde", hier:
auf daß die Sünde in ihrem vollen Charakter offenbar würde, daß sie „als Sünde" erschiene, ja, „überaus sündig würde" durch das Gebot; denn an und für sich böse, wird sie durch das Tun des Verbotenen zu unmittelbarem Ungehorsam: überaus sündig. Beachten wir immer wieder, daß es sich hier nicht handelt um Tatsünden, sondern um die Sünde als solche, die als ein feststehender Grundsatz in uns wirkt.
Die schmerzliche Wahrheit des Gesagten beweist der Apostel an den vom 14. Verse an beschriebenen praktischen Erfahrungen eines erneuerten Menschen, die ihn zu der niederschmetternden Erkenntnis führen, daß in ihm, d. 1. in seinem Fleische, „nichts Gutes wohnt" (V. 18). Er beschreibt diese Erfahrungen so, wie sie sich ihm darstellen als einem Manne, der, selbst völlig frei, mit Ruhe die Kämpfe einer unter Gesetz stehenden Seele betrachtet, und der diese Kämpfe richtig beurteilen kann, weil er, von Gott belehrt, weiß, was „Gesetz", „Sünde" und „Fleisch" ist. Er beginnt mit den Worten: „Denn wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft" (V. 14).
Von vornherein sei hier auf den großen Unterschied zwischen den Ausdrücken: „Wir wissen" und „ich bin" hingewiesen. Das erste ist, kurz gesagt, allgemeine christliche Erkenntnis, das zweite persönliche Erfahrung. Wir, d. 1. alle Christen, wissen mit Paulus, daß das Gesetz geistlich ist. Aber was sagt die Erfahrung des einzelnen dazu? Es heißt in unserer Stelle nicht; „Wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist, und daß wir fleischlich sind", oder: „w i r aber sind fleischlich", sondern: „i c h bin fleischlich, unter die Sünde verkauft". Die einzelne Seele, die sich unter das Gesetz stellt, und zwar nicht nur unter seine unmittelbaren Gebote, sondern auch unter seine Verurteilung der Quellen des Bösen im Herzen, eine solche Seele wird zu der bitteren Erkenntnis geführt, daß sie, obwohl sie die Sünde haßt und Gottes Gesetz liebt, gleich einem Sklaven „unter die Sünde verkauft ist". Das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich; das Gesetz fordert mich auf: „Laß dich nicht gelüsten!" und ich liege in solch einer Sklaverei der Sünde, daß das Gebot nur die böse Lust in mir weckt. Welch unversöhnliche Gegensätze! Die Seele erkennt sie rückhaltlos an. Was sie dahin bringt, sind die Erfahrungen, die sie auf dem in den Versen 15—23 beschriebenen Wege macht.
„Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht; denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus" (V. 15). Die Enttäuschung ist groß. Anstatt nach der erfolgten Umkehr Erleichterung, Frieden und Freude zu finden, muß der Arme entdecken, daß in ihm eine Macht wirkt, von der er sich nicht befreien kann, und die ihn hindert, das Gute, das er tun möchte, zu vollbringen. Er stimmt „dem Gesetz bei, daß es recht ist" (V. 16), indem es das Gute fordert und den verurteilt, der das Böse tut. Aber was nützt ihm diese Erkenntnis, was hilft's, daß er dem Guten beistimmt, wenn er das Gegenteil tut? Sein Wille ist zwar erneuert, er liebt das Gute und macht die größten Anstrengungen, es zu tun, aber er muß erfahren, daß er keine Kraft dazu hat, daß vielmehr die Sünde über ihn herrscht. Er möchte auch die Forderungen des Gesetzes keineswegs schwächen oder einschränken, sie sind ja gerecht, heilig und gut, aber er steht ihnen kraftlos gegenüber. Der Fehler liegt nicht in dem Gesetz, sondern in der Sünde des Menschen.
Nun ist es freilich wahr: wenn ich nach meinem neuen Menschen das Gute tun möchte und doch das Böse tue, so „vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde" (V. 17); aber was für ein Trost liegt für mich darin? Diese Erkenntnis beweist ja gerade die Größe der Sklaverei, in welcher ich mich befinde: wenn ich selbst auch das Böse nicht mehr ausübe, sondern die in mir wohnende Sünde, so lasse ich mich doch gegen meinen Willen von ihr gebrauchen und vermag mich nicht von ihrer Gewalt freizumachen. Obwohl ich erkenne und bekenne, daß die Sünde überaus böse und häßlich ist, bin ich ihr doch völlig unterworfen. Ich möchte gern Gott dienen und setze alle meine Kräfte ein, um dieses Ziel zu erreichen; aber alle meine guten Vorsätze und Bemühungen scheitern an der unwiderstehlichen Macht der Sünde, die mich in ihren Banden hält. Je aufrichtiger ich es meine, und je ernster meine Anstrengungen sind, umso klarer tritt mein trostloser Zustand ans Licht, umso greller zeigt sich die Häßlichkeit der Sünde und mein hoffnungsloses Verkauftsein unter ihre Macht.
So komme ich auf Grund meiner Erfahrungen zu einem klaren, aber erschreckenden Bewußtsein: „Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische (als von Adam stammend), nichts Gutes wohnt." Denn obwohl ein ernstes, aufrichtiges Wollen bei mir vorhanden ist, „finde ich das Vollbringen dessen, was recht ist, nicht". Der Wille ist, wie schon mehrfach gesagt, da, aber die Kraft fehlt. „Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich" (V. 18. 19). Wenn das aber so ist, „wenn ich dieses, was i c h nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr i c h dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde" (V. 20). Das im 17. Verse bereits Gesagte hat seine volle Bestätigung gefunden. Der Gläubige hat auf dem Wege der Erfahrung, außer der Wahrheit, daß nichts Gutes in ihm wohnt, und daß er ohne Kraft ist, das Gute zu tun, gelernt, daß er unterscheiden muß zwischen sich als dem erneuerten Menschen, der das Gute will, und der in ihm wohnenden Sünde; mit anderen Worten, daß es zwei Naturen in ihm gibt, zwei „Ich". Zunächst ist da ein fleischliches „Ich", das unter die Sünde verkauft ist, und dann ein zweites „Ich", das nicht sein Fleisch ist, sondern der erneuerte innere Mensch, der die Sünde haßt. Damit ist er zugleich zu der Erkenntnis gekommen, daß nicht dieses zweite „Ich" das Böse tut, sondern die in ihm wohnende Sünde5.
_____________
Die kostbare Wahrheit, daß er mit Christo gestorben, daß das erste „Ich" am Kreuze unter das Urteil des Todes gebracht worden ist, nicht kennend oder doch nicht verstehend, hat der Gläubige, in der Hoffnung, doch noch irgend etwas Gutes in seinem Fleische zu finden, nur an Gesetz und an sich selbst gedacht. Die Wörtlein „ich, mir, mich" kommen in den Versen 7—24 etwa vierzigmal vor, während der Name Christi im 25. Verse zum erstenmal genannt wird.
Es ist eine große Sache, so schmerzlich es anderseits ist, zu lernen, was das eigene Ich ist, was es heißt, als ein Mensch, der gar keine Kraft besitzt, unter Gesetz zu stehen, und so endlich dahin zu kommen, von dem elenden alten Ich abzublicken, alle eigenen Anstrengungen aufzugeben und das Auge allein auf Christum zu richten. Das ist der gesegnete Prozeß, durch den in der letzten Hälfte unseres Kapitels der Gläubige geführt wird, in welchem aber leider, leider so viele teure Kinder Gottes Zeit ihres Lebens stecken bleiben und deshalb nie zu wahrer Freiheit und ungestÖrtern Frieden gelangen. Frieden zu finden auf dem Wege eines allmählichen Fortschritts, so daß man schließlich mit sich selbst zufrieden sein kann, ist unmöglich. Nein, nicht Zufriedenheit mit sich selbst, sondern die Entdeckung, daß man der Befreiung durch das Werk eines anderen bedarf, ist das Ergebnis des Prozesses. Glücklich die Seele, die sich dahin führen läßt! An die Stelle der größten Not, ja, einer hoffnungslosen Verzweiflung tritt selige Ruhe, Freude und jubelnder Dank.
Doch wir müssen uns noch ein wenig eingehender mit dem Inhalt der Verse 21 — 23 beschäftigen. „Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, daß das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; aber ich sehe ein anderes Gesetz (ein Gesetz von anderer Art) in meinen Gliedern." über die verschiedene Bedeutung oder Anwendung des Wortes „Gesetz" haben wir im Anfang unseres Kapitels schon ausführlich geredet, so daß wir wohl nicht noch einmal darauf zurückzukommen brauchen. Der Gläubige ist also auf dem Wege der Erfahrung zu der Erkenntnis gelangt, daß er unter einem Grundsatz, einer Regel oder Norm steht, die unausweichbar bestimmend für ihn ist, der nämlich, daß bei ihm, der das Gute tun will, das Böse vorhanden ist, dem er trotz aller Kraftanstrengung nicht entrinnen kann.
Er hat Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes und an Seinen heiligen Geboten, ist auch fest entschlossen, sie zu tun, aber er sieht in seinen Gliedern ein anderes Gesetz, das dem Gesetz seines (erneuerten) Sinnes widerstreitet und ihn in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in seinen Gliedern ist. (V. 23.)
Immer wieder finden wir bestätigt, daß unser Kapitel nicht von der Schuld frage redet, sondern von der Sünde als Grundsatz oder Macht, sowie von dem völligen Mangel an Kraft, ihr zu widerstehen. Zugleich aber auch, daß wir nicht einen Menschen in der Finsternis seines natürlichen Zustandes vor uns haben, sondern eine erneuerte Seele, die mit aller Kraft kämpft, um den Sieg über das Böse zu erringen, aber sehen muß, daß alles in hilfloser „Gefangenschaft" für sie endet. (V. 23.) Sie muß erkennen, daß in den Gliedern des Menschen, trotzdem er wiedergeboren ist, eine Macht wirkt, der er nicht zu widerstehen vermag, so sehr er sie haßt und sich von ihren Einflüssen freizumachen sucht. Trotzdem macht die Seele Fortschritte, wenn auch die Finsternis um sie her immer dichter zu werden scheint. Mit dem Heißerwerden des Kampfes wächst die innere Erkenntnis, und das Licht dämmert. Aber wie immer, so geht auch hier dem Anbruch des Tages das tiefste Dunkel voraus.
Völlig zu Boden geworfen, keinen Ausweg mehr sehend, macht der Mensch seiner Seelenqual endlich Luft in dem Schrei: „Ich elender Mensch! wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes?" (V. 24). Die Wortstellung im Grundtext gibt hier dem Worte „Mensch" besonderen Nachdruck. Der elende Zustand des Menschen ist der Seele zum Bewußtsein gekommen. Trotz der Erneuerung seines Willens und der Erkenntnis dessen, was er nach dem Gesetz sein sollte, ist der Gläubige doch nur ein Mensch, das ist ein gefallenes Wesen, mit bösen Lüsten und Begierden, unter die Sünde verkauft und ohne jegliche Kraft, das Böse zu überwinden! Der Ausdruck: „dieser Leib des Todes" kennzeichnet treffend den hilf- und hoffnungslosen Zustand, in welchem er sich befindet. Aber wenn die Gnade — denn sie ist es, die sich mit dem Armen hier beschäftigt, ohne daß er es ahnt — ihn zu der klaren Erkenntnis dessen gebracht hat, was er ist, überläßt sie ihn nicht sich selbst, sondern vollendet ihr Werk, indem sie seinen Blick von
seiner Person ab auf Gott richtet und ihm den Retter zeigt, nach welchem er verzweiflungsvoll ausschaut.
„ Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn l" So kommt es mit einemmale über die Lippen des eben noch mit Angst und Schrecken Erfüllten. Wie ist diese wunderbare Wandlung bewirkt worden? Durch die einfache, aber so wichtige Tatsache, daß der Mensch nicht mehr auf das blickt, was er für Gott ist, und darin Befriedigung sucht, sondern daß sein Auge sich auf das richtet, was Gott f ü r i h n i s t, und zwar was Er für ihn ist durch Jesum Christum! Wie durch einen Schlag ist alles verändert. Nicht daß der Gläubige jetzt wäre, was er gern sein möchte, oder daß fortan jeder Kampf für ihn aufhörte. Keineswegs! Aber anstatt, wie bisher, mit sich selbst beschäftigt zu sein, beschäftigt er sich mit Gott und — dankt!
Wir möchten noch einmal sagen: Welch eine Wandlung! Und wie unmittelbar ist sie erfolgt! Das Herz ist auf die göttliche Liebe hingelenkt, die den eingeborenen Sohn für solch elende Wesen dahingab und die Quelle der Befreiung für sie wurde, der Blick auf das Werk gerichtet, welches die Befreiung vollbracht hat, und damit auf Ihn, den Befreier selbst. Hat der Mensch früher gefragt: Wie kann ich mich bessern? Was kann ich tun, um Gott zu befriedigen und Ruhe für meine Seele zu finden?, so lautet jetzt seine Frage:
Wer wird mich, den Elenden, Kraftlosen, retten? Wer mich befreien von diesem Leibe des Todes? Zusammenbrechend unter der furchtbaren Last der Entdeckung, daß trotz alles Seufzens, Betens, Flehens und Ringens nur Fehler über Fehler, Enttäuschung über Enttäuschung sein Teil waren, gibt er endlich sich selbst als hoffnungslos böse auf und erkennt in Christo Den, der nicht nur seine Schuld getragen hat, sondern auch sein Erretter geworden ist aus dem furchtbaren Todeszustand, in welchem er lag.
Es ist in der Tat eine Rettung, Dessen würdig, der sie vollbracht hat. Aber ist mit ihr das Fleisch in dem Gläubigen verändert oder gar aus ihm entfernt? Trägt er die beiden Naturen, von denen wir hörten, nicht mehr in sich? Es wäre eine verhängnisvolle Täuschung, so etwas zu denken, und der Geist Gottes hat Sorge getragen, uns vor ihr zu bewahren, indem Er den Apostel sogleich die Worte hinzufügen läßt: „Also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz" (V. 25). Das will selbstverständlich nicht sagen, daß diese beiden Dienste bei dem Gläubigen nun stets nebeneinander herlaufen sollten, daß das sein regelrechter Zustand wäre, sondern vielmehr daß die beiden Naturen mit ihren entsprechenden charakteristischen Neigungen nach wie vor bei ihm vorhanden sind und in ihm bleiben werden bis ans Ende. Im Himmel werden wir die alte Natur (das Fleisch) nicht mehr an uns tragen, wir werden auf immer und ewig von ihr befreit sein; aber solang wir noch in diesem Leibe sind, geht sie mit uns, und so oft wir ihr zu wirken erlauben, „dienen wir mit dem Fleische der Sünde Gesetz." Gott sei gepriesen, daß wir in Christo heute schon von ihrer Macht befreit sind und als gestorben mit Ihm nicht länger unter Gesetz stehen! Ja, daß wir mit Petrus sagen können: „Die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben"; was wir wünschen, ist, die im Fleische noch übrige Zeit dem Willen Gottes zu leben. (Vergl. 1. Petr. 4, 1—3.)
Da wo göttliches Leben wirkt, kann es nicht anders sein. Das Verlangen der neuen Natur, ihr sehnliches Begehren geht dahin, Gottes Gesetz zu dienen, Seinen Willen zu tun. Und wie schön: das ist es, was der Gläubige jetzt als sein eigentliches Ich anerkennt und anerkennen darf! „Also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz." Freilich, der Kampf hört nicht auf. Es wird immer wahr bleiben, daß „das Fleisch wider den Geist gelüstet, und der Geist wider das Fleisch, und daß diese einander entgegengesetzt sind"; wenn wir aber im Geiste wandeln, werden wir die Erfahrung machen dürfen, daß wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Statt der traurigen Werke des Fleisches wird die liebliche Frucht des Geistes hervorkommen zur Ehre Gottes. Denn „wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, s o seid ihr nicht unter Gesetz", d. h. nicht in dem traurigen Zustand, der in Römer 7 beschrieben wird; und: „die des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten". (Vergl. Gal. 5, 16—25.)
Von der Kraft, die den Gläubigen nunmehr befähigt, mit seinem Sinne Gottes Gesetz zu dienen, ist in dem Schlußverse unseres Kapitels indes keine Rede. Er macht uns nur mit der Befreiung der Seele aus dem Zustande, in welchem sie lag, bekannt, und beschreibt den völlig veränderten
Boden, auf welchen sie durch die Gnade gekommen ist, sowie den Charakter und die Gesinnung der neuen Natur in ihr.
Rufen wir uns zum Schluß noch einmal kurz die Wahrheiten ins Gedächtnis, die wir in diesem interessanten 7. Kapitel gelernt haben:
1. Die Befreiung vom Gesetz durch den Tod. (V. l—6.)
2. Die Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz. (V. 7—13.)
3. Den Zustand und die Erfahrungen einer erneuerten, aber noch nicht befreiten Seele unter Gesetz auf ihrem Wege zur Befreiung.
In Verbindung mit Punkt drei haben wir dann noch drei andere wichtige Dinge gelernt:
1. Daß in unserem Fleische nichts Gutes wohnt; 2. daß wir unterscheiden müssen zwischen uns selbst, die wir das Gute wollen, und der in uns wohnenden Sünde; 3. daß es in uns, solang wir die Befreiung in Christo nicht im Glauben erfaßt haben, keine Kraft gibt, um die Sünde im Fleische zu überwinden, daß wir vielmehr immer wieder durch sie überwunden werden.
Wir könnten als viertes, obwohl es eigentlich schon in der letztgenannten Wahrheit enthalten ist, noch hinzufügen, daß wir selbst uns nicht aus diesem elenden Zustand befreien konnten, sondern durch einen anderen befreit werden mußten.
Kapitel 8
Kapitel 8, 1—11
„Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind" (V. l). Mit diesen triumphierenden Worten beginnt der Apostel das 8. Kapitel seines Briefes. Es ist gleichsam der Schlußstrich, den er jubelnden Herzens unter seine Ausführungen setzt, das herrliche Ergebnis aus den Belehrungen der drei vorhergehenden Kapitel. Keine Verdammnis mehr für alle, die i n Christo Jesu sind! Welch ein Wort! Der Apostel redet nicht von etwas, das erst nach und nach erlangt werden kann, von einer Sache, auf die nur treue oder gereiftere Christen Anspruch machen dürfen, sondern von einer Tatsache, die sich auf alle erstreckt, die an diesen Platz der Annahme „in Christo Jesu" gebracht sind. Sie ist in ihrer unbedingten Form einigen Abschreibern der neutestamentlichen Handschriften so unfaßlich erschienen, daß einer den Schluß des 4. Verses; „die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln", zunächst wohl nur als eine vermeintlich heilsame Einschränkung herausgenommen und neben den Text geschrieben hat, während spätere Abschreiber ihn dann in den Text selbst eingeschoben haben. (Vergl. die Übersetzung von M. Luther.) Aber Gott sei gepriesen! Sein Heil ist bedingungslos, die Befreiung von jedem Verdammungsurteil steht fest für alle, die „in Christo Jesu sind". Ich brauche kaum hinzuzufügen, daß dadurch die Pflicht eines jeden Gläubigen, in unermüdlicher Wachsamkeit und ernstem Selbstgericht zu wandeln, in keiner Weise berührt wird; aber es ist ein verhängnisvoller Fehler, ja, im Grunde eine große Anmaßung, wenn man die Sicherheit dieser Stellung in Christo von dem Wandel und der Gesinnung des Gläubigen abhängig macht.
Wie diese kostbare Stellung erreicht wurde, ist uns bekannt. Die Sünde im Fleische, die uns unter das Urteil des Todes und der Verdammnis brachte, ist in Christo ein für allemal gerichtet worden. Alle, die in Christo Jesu sind, wurden am Kreuze „mit ihm einsgemacht in der Gleichheit seines Todes" (Kap. 6, 5), sind mit Ihm gekreuzigt, mit Ihm gestorben; darum kann es keine Verdammnis mehr für sie geben. Was an Christo geschehen ist, ist an ihnen geschehen. So unmöglich es für den auferstandenen Christus eine Verdammnis geben kann, so unmöglich auch für die, welche in Ihm sind. Immer wieder begegnen wir derselben großen Wahrheit, daß am Kreuze neben der Tilgung aller Sünden der Gläubigen auch die Sünde im Fleische, die ihnen so viel Not und Qual bereitet, gerichtet wurde. Sie sind nicht mehr Menschen in dem ersten Adam, sondern stehen jetzt vor Gott als „Menschen in Christo"; sie sind, wie wir gleich nachher hören werden, „im Geiste", nicht mehr „im Fleische". Das ist der Platz, welchen die Gnade ihnen gegeben hat, eine Stellung, die wohl ernste, heilige Pflichten für sie mit sich bringt, aber in keiner Weise von dem Grade ihrer Erkenntnis oder der Höhe ihres Wandels abhängt. Der Gläubige wandelt treu, nicht um diese Stellung zu erlangen, sondern weil er in ihr steht.
„Denn", so lesen wir weiter, „das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes" (V. 2). Wieder begegnen wir dem Worte „Gesetz" in dem uns aus dem 7. Kapitel bereits bekannten Sinne, als einem Grundsatz, der unabänderlich in der gleichen Weise wirkt und seinem Ziele zustrebt. (Vergl. auch die Ausdrücke „Gesetz der Werke" und „Gesetz des Glaubens" in Kapitel 3, 27.) Der Ausdruck „Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu" weist wohl hin auf das immer gleiche, mächtige Wirken des Geistes des Lebens in unserem geliebten Herrn, der nach vollendetem Werke als Sieger über Tod und Grab in der Mitte Seiner Jünger erschien, um ihnen dieses Leben und den Geist als Quelle und Kraft desselben — „Leben in Überfluß" (Joh. 10, 10) — mitzuteilen.
Ähnlich nun wie in Christo dieses Gesetz gewirkt hat, bildete in uns „das Gesetz der Sünde und des Todes" den alles beherrschenden Grundsatz, dem wir nicht zu entrinnen vermochten. Das vorige Kapitel hat uns den armseligen Zustand und die völlige Hilflosigkeit, worin wir waren, zur Genüge gezeigt. Erst als der Mensch, von dem wir dort lesen, aufhörte, die in ihm wohnende Sünde durch gesetzliche Anstrengungen zu besiegen, und sich rückhaltlos der Gerechtigkeit Gottes unterwarf, trat die Befreiung ein. Doch beachten wir, daß dieser Wahrheit hier nicht in einer alle Gläubigen umfassenden Form, als einer für alle in gleicher Weise gültigen Regel, Ausdruck gegeben wird, sondern daß der Apostel noch einmal, und zwar zum letztenmal in dieser Abhandlung, sich der persönlichen Form bedient. Nach dem Inhalt des 1. Verses würden wir hier statt des „mich" ein „sie" oder ein „uns" erwarten, wie im 4. Verse. Aber obwohl das „Keine Verdammnis mehr" allen Christen gemeinsam gehört, heißt es im 2. Verse: „Denn das Gesetz des Geistes . . . hat mich freigemacht von dem Gesetz usw."; das will sagen: obwohl der 2. Vers unlöslich mit dem Inhalt des ersten verbunden ist, handelt es sich hier doch um eine Sache der persönlichen Erfahrung, zu der wohl für alle die Grundlage gelegt ist, die allen bekannt sein sollte, die aber vielfach nicht verstanden und infolge dieses mangelhaften Verständnisses, leider auch oft infolge Untreue, nicht praktisch verwirklicht wird.
Es ist in der Tat etwas unsagbar Großes, dem Apostel nachsprechen zu können: „Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht" — nicht „wird midi freimachen", sondern „hat mich freigemacht", um fortan nicht mehr „dem Gesetz der Sünde und des Todes" unterworfen zu sein, sondern in der glückseligen Freiheit eines aus schweren Banden Erlösten dem Herrn zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, als ein Mensch „in Christo". Unwillkürlich möchte der Schreiber für sich und alle seine gläubigen Leser dem Wunsche Ausdruck geben, daß wir den Inhalt unseres Verses nicht nur als eine Sache kennen, die in Christo für uns alle zur Wahrheit geworden ist, sondern daß wir auch in praktischer Verwirklichung derselben das Fleisch in uns im Tode halten und so beweisen, daß wir wirklich von seiner Herrschaft freigemacht sind.
Die Grundlage von allem ist, wie schon so oft betont, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Dieses herrliche Erlösungswerk wird im 3. Verse noch einmal der ganzen Kraftlosigkeit des Gesetzes vom Sinai gegenübergestellt. „Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte." Die völlige Unzulänglichkeit des Gesetzes, helfen zu können, ist uns im 7. Kapitel in erschreckender Deutlichkeit vor die Augen getreten. Das Gesetz konnte fordern, verurteilen, verfluchen, aber nicht retten. Nun, was das Gesetz nicht zu tun vermochte, das hat Gott getan. Er ist ins Mittel getreten, indem Er Seinen eingeborenen Sohn sandte, um die Frage der Sünde zu ordnen. Um das aber tun zu können, mußte Christus als ein wahrhaftiger Mensch, nicht nur einem Menschen ähnlich, nein, als ein Mensch in Fleisch und Blut, vom Weibe geboren, selbst ohne Sünde, rein und heilig, aber in Gleichgestalt des sündigen Fleisches, auf dieser Erde erscheinen. Und das ist geschehen. „Das Wort ward Fleisch." „Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden."
Und nicht nur mußte Christus so erscheinen und auf Seinem ganzen Wege hinsichtlich Seiner Vollkommenheit als Mensch erprobt werden — die Frage der Sünde konnte nur im Tode entschieden, die Sünde selbst nur durch ein heiliges Sündopfer entfernt werden. Das sündlose, heilige Leben unseres Herrn konnte uns nicht retten; es zeigte ,uns nur die ganze Größe unseres traurigen, hoffnungslosen "^Zustandes. Das Weizenkorn mußte in die Erde fallen und sterben; anders wäre es auf ewig allein geblieben. (Joh. 12, 24.) So lesen wir denn auch in Hebräer 9, 26, daß Er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden ist zur Abschaffung der Sünde durch Sein Opfer. Einen anderen Weg, die Sünde hinwegzutun, gab es nicht. Aber diesen Weg hat Gott betreten und so die anders unlösliche Frage zu Seiner eigenen ewigen Verherrlichung gelöst. Die Sünde im Fleische ist nach Wurzel und Zweig gerichtet, mit dem alten Zustand ist für immer ein Ende gemacht worden, und der Gläubige, von der Macht und Herrschaft der in ihm wohnenden Sünde freigemacht, ist nun nicht mehr gezwungen, „nach dem Fleische" zu leben, sondern darf und soll „nach dem Geiste wandeln" (V. 4). Die Sünde ist freilich noch i n ihm, aber sie kann kein Gericht mehr über ihn bringen, weil sie in Christo bereits gerichtet ist; zugleich bezeugt der Gläubige dadurch, daß er selbst sie in sich richtet, daß er mit Gott und nicht mit ihr eins ist. Das Vorhandensein der Sünde in ihm an und für sich kann ihn also nicht beunruhigen, noch ihn verhindern, mit Gott in innigster Verbindung zu sein; erst wenn er der Sünde zu w i r k e n erlaubt und nach dem Fleische zu w a n d e l n beginnt, wird die praktische Gemeinschaft mit dem heiligen Gott unterbrochen und bleibt es so lang, bis er seine Sünde aufrichtig bekennt, und der Vater ihm nach Seiner Treue und Gerechtigkeit wieder vergibt und ihn von aller Ungerechtigkeit reinigt, (1. Joh. 1. 9.)
Die Möglichkeit zu fehlen hat also nichts mit der Stellung des Gläubigen vor Gott zu tun. So schmerzlich und demütigend es ist, wenn ein Christ sündigt, und so ernst die daraus hervorgehenden Folgen sein mögen, beides berührt nicht die Frage seiner Erlösung. Er ist „in Christo", und weil er i n Ihm ist, kann es ebensowenig eine Verdammnis, ein Gericht für ihn geben, wie für Christum selbst; in dem Auferstandenen befindet er sich jenseits der Macht Satans, jenseits der Stätte, wo das Fleisch für den Glauben im Gericht beseitigt worden ist und der alte Mensch sein Ende gefunden hat. Als mit Christo gekreuzigt, lebt nicht mehr er, sondern Christus lebt in ihm. (Gal. 2, 20.)
Es ist höchst interessant, die Beziehung zu sehen, in welcher die drei ersten Verse unseres Kapitels zu den drei vorhergehenden Kapiteln des Briefes stehen. Belehrte uns die erste Hälfte des 5. Kapitels über die Tatsache, daß wir als aus Glauben Gerechtfertigte Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott usw. haben, hörten wir in der zweiten Hälfte von dem sündigen Zustand, in welchem wir uns als Nachkommen des ersten Adam befanden, und von der „Stellung von Gerechten", in die wir durch den Gehorsam des letzten Adam gebracht sind, so sagt uns der erste Vers des 8. Kapitels, daß wir jetzt „in Christo Jesu" sind und als solche nicht nur keinen Zorn mehr zu fürchten haben, sondern daß es überhaupt keine Verdammnis mehr für uns gibt. Unterwies uns dann das 6. Kapitel über die Herrschaft der Sünde, unter der wir lagen, und wie diese Herrschaft in dem Tode Christi gebrochen worden ist, so lesen wir hier im 2. Verse, daß „das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu mich freigemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes". Machte uns endlich das 7. Kapitel mit den Erfahrungen eines Menschen bekannt, der, die Gerechtigkeit Gottes nicht kennend, eine gesetzliche Gerechtigkeit aufzurichten trachtet, so weist uns der 3. Vers unseres Kapitels auf die Tatsache hin, daß Gott das dem Gesetz Unmögliche durch die Sendung Seines geliebten Sohnes vollbracht hat, indem der Hochgelobte sich nicht nur mit den Früchten des faulen Baumes beschäftigte, um es uns dann zu überlassen, mit dem Baume selbst vor Gott fertig zu werden, sondern indem Er für den ganzen Zustand eintrat, in welchem wir uns von Natur befanden: der Baum ist gerichtet, die Sünde im Fleische ist verurteilt und für den Glaubenden auf immerdar aus Gottes Auge entfernt.
Fürwahr, der Gläubige darf jetzt getrost sein Haupt erheben, aber er darf und soll auch den Trieben und Wirkungen der in ihn gepflanzten neuen Natur, des Geistes des Lebens in Christo Jesu, durch Gottes Gnade folgen. Der 4. Vers leitet zu diesem praktischen Ergebnis über. Indem der Christ weiß und im Glauben verwirklicht, daß er in einer neuen Natur vor Gott steht, ist das neue „Ich" in ihm frei (mag auch das alte Ich immer wieder seine feindlichen Einflüsse geltend machen wollen), nach dem Geiste und nicht mehr nach dem Fleische zu wandeln. Und in demselben Maße, wie er das tut und die Ergebnisse des Todes und der Auferstehung Jesu Christi in seinem Leben zur Darstellung kommen läßt, wird das Recht (d. h. die gerechte Forderung) des Gesetzes in ihm erfüllt. (V. 4.) Solang ein Mensch praktisch unter Gesetz steht und sich abmüht, das Fleisch zu bessern und die von ihm als gerecht anerkannten Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, erlebt er nur bittere Enttäuschungen. Wenn aber die Seele die Fülle der Gnade erkannt hat, die ihr in dem gestorbenen und auferstandenen Heiland erschlossen ist, und ihr Blick nun von dem armen alten Ich ab auf Christum sich richtet, so erfüllt sie in der Kraft des Heiligen Geistes nicht nur die Forderungen des Gesetzes Gott und dem Nächsten gegenüber, sondern sie geht noch über dieselben hinaus: der Gläubige vermag sich Gott darzustellen als ein Lebender aus den Toten, seine Feinde zu lieben, die ihm f l u c h e n zu segnen usw. Der Charakter Gottes, wenn auch selbstverständlich immer nur ganz unvollkommen, kommt durch die Gnade in ihm zur Darstellung. Gott selbst wird gesehen, oder, mit anderen Worten, nicht nur das, was ein Mensch sein sollte, sondern was Christus, der Mensch Gottes, hienieden war. Sein Bild wird, wenn auch schwach und mangelhaft, in ihm gestaltet.
Im Anschluß an die letzten Worte des 4. Verses entwickeln die nächsten vier Verse (5 — 8) noch näher den Gegensatz zwischen den Menschen, die nach dem Fleische, und denen, die nach dem Geiste wandeln. In beiden Fällen ist eine Natur wirksam, die ihre besonderen Neigungen und Ziele hat. „Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist" (V. 5). Es handelt sich hier nicht um ein größeres oder kleineres Maß von Früchten, sondern um die grundsätzliche Gesinnung der beiden Naturen: jede sinnt auf das, was ihr eigen ist, was sie (Fleisch oder Geist) kennzeichnet, und liebt und haßt dementsprechend. Die neuen Grundsätze und Kräfte, die in den Christen wirken, werden denen aller anderen Menschen gegenübergestellt. Der natürliche Mensch, die von Gott abgefallene und Ihm entfremdete Natur, ist „nach dem Fleische" und folgt dessen bösen Regungen und Lüsten; der Christ oder die ihm geschenkte neue Natur ist „nach dem Geiste", unter dessen Einflüssen er steht, ja, der in ihm wohnt. Eine völlig neue Gesinnung ist in dem Gläubigen geweckt, die Gesinnung einer Natur, die aus dem Geiste geboren ist und das sucht, was des Geistes ist — eine heilige Natur, die das Heilige liebt und, vom Joche der Sünde befreit, alledem nachstrebt, was „geistlich" ist.
„Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden; weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht Untertan, denn sie vermag es auch nicht" (V. 6. 7). Fleisch und Geist sind und bleiben einander entgegengesetzt. Fleisch kann niemals Geist und Geist niemals Fleisch werden. Die Gesinnung des Fleisches ist auf das Sichtbare gerichtet, bringt den Tod, sowohl jetzt als auch ewiglich. „Kein Friede den Gesetzlosen! spricht Jehova." Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden, eine Quelle in uns, die ins ewige Leben quillt und die Seele mit Friede und Freude erfüllt. In Christo war es vollkommen so, bei dem Christen ist die Verwirklichung, wie schon oft betont, unvollkommen; aber davon redet der Apostel hier nicht, er entwickelt nur Grundsätze.
Die Gesinnung des Fleisches ist aber nicht nur der Tod, sie lehnt sich auch gegen Gott auf, erkennt Seine Oberhoheit nicht an, ist mit einem Wort „Feindschaft gegen Gott". Dem Gesetz, dem der Mensch naturgemäß unterstellt ist, weil es die Richtschnur der Verantwortlichkeit des Geschöpfes Gott gegenüber bildet, unterwirft sie sich nicht. Sie ist „dem Gesetz Gottes nicht Untertan, denn sie vermag es auch nicht". Welch ein niederschmetterndes Urteil von selten Dessen, der recht richtet! „Sie vermag es nicht", so verderbt ist sie. Sobald Gott ein Gebot gibt, regt sich in ihr der Geist der Empörung. Der eigene böse Wille ist ihre Richtschnur; sie will unabhängig sein und haßt alles, was Gott gefällt. Darum bedarf eben der Mensch einer völlig neuen Natur, welche Gott und die himmlischen Dinge liebt. „Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist" (Joh. 3, 6).
„Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen" (V. 8). Wie wäre es möglich, daß Gott mit Wohlgefallen auf Leute herabschauen könnte, wie wir sie soeben beschreiben hörten? Menschen „im Fleische" oder „aus dem Fleische geboren", d. h. Menschen, die als Nachkommen des gefallenen Adam sich in dessen Stellung vor Gott befinden und in seinen Spuren, „nach dem Fleische", wandeln. „Im Fleische sein" bedeutet also nichts anderes als hoffnungsloses Verderben, verbunden mit Auflehnung und Feindschaft gegen Gott. Gott sei deshalb ewig dafür gepriesen, daß der Gläubige sich nicht mehr in dieser Stellung befindet!
„Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt" (V. 9). Die Inwohnung des Heiligen Geistes in dem Gläubigen ist der unwiderlegliche Beweis, daß er nicht mehr „im Fleische", sondern „im Geiste" ist. Schon in Kapitel 7, 5 lasen wir: „Denn als wir im Fleische waren usw.", und das ganze 6. Kapitel hat uns Menschen gezeigt, die, von der Herrschaft der Sünde befreit, Gott leben und Ihm ihre Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit darstellen können. Der in der zweiten Hälfte des 7. Kapitels beschriebene Mensch vermag das noch nicht. Er ist zwar, wie der verlorene Sohn, umgekehrt und auf dem rechten Wege, aber er hat noch nicht im Glauben erkannt, was der Vater ist, und wie Er sich in Christo Jesu geoffenbart hat. Das persönliche Bewußtsein der völligen Vergebung und der Annahme bei dem Vater ist in der Seele noch nicht vorhanden.
Dieses klare Bewußtsein kann nur in einem Menschen leben, in welchem der Heilige Geist Wohnung gemacht hat. Erst wenn man in den Armen des Vaters geruht hat und sich mit dem besten Kleide bekleidet sieht, hört man auf, sich selbst zu betrachten, von sich zu reden, sich mit sich abzumühen; der Vater und das, was Er ist und tut, füllt dann den ganzen Gesichtskreis der Seele aus. Sie „dankt Gott durch Jesum Christum," indem sie sich selbst völlig vergißt und in dem ruht, was Jesus für sie getan hat; und nun ist sie passend für das Vaterhaus und seine Freuden. Nicht so, als ob sie fernerhin nicht verantwortlich wäre; sie bleibt das selbstverständlich — aber ihre Verantwortlichkeit trägt einen ganz neuen Charakter, ist von ganz neuer Art. Wir wollen es uns immer wieder sagen: Der Gläubige ist ein Mensch „in Christo" und ein Mensch „im Geiste", der nicht unter Gesetz steht, aber auch nicht gesetzlos ist, sondern dem die Gnade alles Nötige darreicht, um dieser seiner neuen Stellung gemäß zu wandeln.
Auch dies sei noch einmal wiederholt: es handelt sich in der vorliegenden Stelle nicht um einen veränderlichen Zustand, um ein Zu- und Abnehmen, ein Auf- und Niedergehen je nach der geistlichen Gesinnung und Treue des einzelnen Christen, sondern um eine Sache, die jedem wahren Gläubigen gehört, die nicht nur wahr ist von einigen besonders bevorzugten Seelen, sondern von jedem, der des Glaubens an Jesum ist, und zwar nicht nur zeitweilig wahr, sondern auf seinem ganzen Wege bis ans Ziel. Er w a r einst in der einen Stellung, „im Fleische", und er i s t jetzt in der anderen, „im Geiste". Das findet eine weitere Bestätigung in dem Schluß unseres Verses: „ Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht Sein", oder „der ist kein Christ", wenigstens nicht in des Wortes wahrer Bedeutung. Wohl kann eine Seele schon Leben aus Gott haben, ohne durch den Geist versiegelt zu sein, wie der Mensch im 7. Kapitel; aber als Regel gilt, daß Gott den Geist einem jeden gibt, der das Wort der Wahrheit im Glauben aufnimmt. Wer heute das Evangelium des Heils hört und daran glaubt, wird nach Epheser 1. 13 versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. In einer nur erweckten Seele ist das göttliche Werk noch nicht vollendet, sie glaubt noch nicht wirklich.
Warum aber spricht der Apostel hier von Christi Geist? Gibt es einen Geist Gottes und einen anderen Geist Christi? Nein, der Geist ist nur einer, aber doch ist der Wechsel im Ausdruck gewiß nicht bedeutungslos, und wir dürfen nach der Ursache desselben forschen. Liegt sie nicht darin, daß der Geist Gottes sich in Christo in einem Leben geoffenbart hat, das bis zum letzten Atemzuge Gott vollkommen geweiht war, so daß wir in Ihm sehen und beurteilen können, was ein solches Leben ist? Und wer nun die Spuren dieses Lebens nicht offenbart, keine Beweise gibt, daß derselbe Geist in ihm wirkt, der einst in Christo war, der ist, trotzdem er das schönste äußere Bekenntnis haben mag, nicht wirklich „Sein", ist kein Christ.
„Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen" (V. 10). Im ersten Verse hörten wir, daß wir als Gläubige „in Christo" sind, hier, daß „Christus in uns" ist, und aus dieser Tatsache wird die Folgerung gezogen, daß der Leib zwar tot ist der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Der Leib ist das irdene Gefäß, in welchem die Sünde wohnt und wirkt. Lasse ich ihm seinen Willen, so wird nichts als Sünde hervorkommen. Was habe ich nun zu tun als ein Mensch, in welchem Christus ist, in dem Er lebt? Ich bin berufen, das Todesurteil, das in Christo über mich ergangen ist, stets auf mich anzuwenden, „nicht den Lüsten meines sterblichen Leibes zu gehorchen", sondern „die Handlungen des Leibes zu töten". (Vergl. Kapitel 6, 12; 8, 13.) In demselben Maße, wie ich das tue, wird die Sünde ihre Kraft über mich verlieren, und der Geist ungehindert in mir wirken können in einem Leben, das die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringt. Wenn Christus in mir ist, so erhebt sich die Frage: Soll fortan mein Wille gelten oder der Wille Christi? Das neue „Ich" antwortet ohne Zögern: der Wille Christi. Gut, das kann aber nur geschehen, wenn ich meinem Leibe nicht erlaube, sich als lebend zu offenbaren, sondern indem ich dem nachstrebe, was des Geistes Gottes ist, was Ihm gefällt. Vergessen wir nicht, daß die Früchte praktischer Gerechtigkeit nur da wachsen können, wo man sich selbst für tot hält, Gott aber lebt in der Kraft des Heiligen Geistes.
Ist aber ein solches Leben nicht ein knechtisches Leben? Im Gegenteil, es ist ein Leben der Freiheit, des Nichtmehrgebundenseins an den Leib und seine Lüste, ein Leben der beglückenden Nachfolge Christi, unter der Leitung Seines Geistes. Möchte es Schreiber und Leser mehr geschenkt sein, also zu wandeln, bis wir diesen Leib der Niedrigkeit mit dem Leibe der Herrlichkeit vertauschen dürfen, in welchem die Sünde nicht mehr wohnt! Auch von dieser dritten und letzten Art der Befreiung redet der Apostel in dieser wunderbaren Stelle.
„Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes" (V. 11). Die Wirkung des Todes und der Auferstehung Christi erstreckt sich also auch auf unsere sterblichen Leiber. Nicht nur gibt es keine Verdammnis mehr für mich, nicht nur darf sich meine Seele der kostbaren Befreiung von der Herrschaft der Sünde und des Todes erfreuen, nein, auch mein armer Leib, dem die Sterblichkeit anhaftet, der den Keim des Todes in sich trägt, wird einmal die mächtigen Folgen des Erlösungswerkes Christi erfahren. Er wird, wenn er ins Grab hinabsinken sollte, wieder auferstehen. Jetzt schon ein Tempel des Heiligen Geistes, wird er wieder hervorgerufen, wieder lebendig gemacht werden, um dann der befreiten Seele zur ewigen, herrlichen Wohnstätte zu dienen. Beachten wir also wohl: es wird nicht, wie man oft sagen hört, ein neuer Leib geschaffen und uns gegeben, sondern der alte wird auferweckt, verwandelt. „Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden" (1. Kor. 15, 51). Der Heilige Geist, der ihn jetzt schon bewohnt, weil der Gläubige in Christo des ewigen Lebens teilhaftig geworden ist, wird Seine Ansprüche an diesen Leib niemals fahren lassen. So gewiß Gott Jesum aus den Toten auferweckt hat und der Geist Gottes infolge dessen in uns wohnt, so gewiß werden auch unsere sterblichen Leiber auferweckt werden. Satan hat keine Ansprüche mehr an sie; auch sie sind um einen Preis erkauft und gehören Christo. So wird unsere Befreiung eine vollständige werden. Die Freiheit der Gnade ist durch den Heiligen Geist heute schon unser Teil in der Stellung, die wir in Christo haben; die Freiheit der Herrlichkeit ist noch zukünftig, aber sie ist uns völlig gewiß, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wie Er das Unterpfand unseres Erbes ist (Eph. 1. 14), so verbürgt Er uns auch die Auferstehung unseres Leibes.
Im Vorbeigehen sei auf den Wechsel des Namens unseres Herrn im 11. Verse aufmerksam gemacht. Zuerst wird Sein persönlicher Name als Sohn des Menschen genannt: Jesus; nachher Sein amtlicher Titel als der Gesalbte Gottes: Christus, und zwar in Verbindung mit dem in uns wohnenden Geiste. Der Heilige Geist kann gleichsam nicht von Christo getrennt werden. Da wo die Ergebnisse des Erlösungswerkes gefunden werden, da muß auch der Geist sein, um die Herrlichkeit Christi zu verbürgen.
Indem wir jetzt zu der Betrachtung des nächsten Abschnittes übergehen, wollen wir uns noch einmal der drei verschiedenen Gesichtspunkte oder Charaktere erinnern, unter denen der Geist in dieser Stelle vor uns tritt. Er ist zunächst der Geist Gottes, der in uns wohnt und die kraftvolle Quelle alles Guten in uns ist, der uns ermuntert, zurechtweist, mahnt, warnt usw. Dann ist Er der Geist Christi, der sich in dem Leben und Wandel Christi hienieden geoffenbart hat und nun unser Leben und unseren Wandel kennzeichnen soll. Und drittens ist Er der Geist „dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat" und nun dafür bürgt, daß dieselbe Macht, die sich in der Auferstehung Christi erwiesen hat, auch unsere sterblichen Leiber „umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit" (Phil. 3, 21).
Kapitel 8, 12 — 30
Der Apostel zieht in den folgenden Versen die praktische Folgerung aus dem bisher Gesagten: „So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben" (V. 12. 13). Als solche, die sich nicht mehr „im Fleische" befinden, haben wir keinerlei bindende Beziehungen mehr zu dem Fleische, können es vielmehr durch den Geist überwinden, indem wir es als gerichtet kennen und für tot halten.
„Wir sind Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben." Unwillkürlich hat man das Gefühl, es fehle etwas an dem Satze. Man erwartet einen mit „sondern" eingeleiteten Nachsatz. Aber das Wort Gottes ist immer richtig und vollkommen. Der Nachsatz würde nach unserer Meinung etwa so lauten müssen: „sondern wir sind Schuldner dem Geiste, um nach dem Geiste zu leben". Ein solches Wort stände auch durchaus im Einklang mit den gesetzlichen Neigungen unserer Herzen. Aber der inspirierte Schreiber spricht nicht so. Es würde uns ja die kostbare Freiheit, in die wir durch unseren Erlöser gebracht sind, wieder rauben und uns, wenn auch in veränderter Form, von neuem unter ein Gesetz stellen, dessen Erfüllung uns genau so unmöglich wäre wie die des alten.
Aber gehen nicht aus unserer neuen Stellung ernste Verpflichtungen hervor? Ist nicht eine heilige Verantwortlichkeit mit ihr verbunden? Immer wieder antworten wir; Ja, ganz gewiß! Aber diese Verpflichtungen lasten nicht wie ein Gesetz auf uns, sondern ergeben sich ganz von selbst aus dem neuen Leben, das uns geschenkt ist, stehen in Übereinstimmung mit den Neigungen unserer neuen Natur und werden in der Kraft des Geistes erfüllt. Jakobus redet in dieser Beziehung von dem vollkommenen Gesetz, dem der Freiheit, weil der Wille des neuen Menschen in jeder Beziehung im Einklang steht mit dem Willen Gottes. (Jak. 1. 25.) Es ist die L u s t des neuen Menschen, diesen Willen zu tun. Tatsächlich bleibt der schroffe Gegensatz zwischen den beiden in uns wirkenden Grundsätzen, Fleisch und Geist, stets bestehen; darum fügt der Apostel auch hinzu: „wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr s t e r b e n, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben."
In beiden Fällen ist das Ergebnis sicher, im ersten als eine naturgemäße und notwendige Folge, im zweiten als etwas von Gott selbst Verbürgtes. Im ersten Falle ist der Tod, im zweiten Leben und Herrlichkeit unser Los. Im Geiste höre ich hier den Leser einwenden: „Dann kann ein Kind Gottes also doch noch verloren gehen!" Ich antworte: Um diesen Punkt handelt es sich hier gar nicht. Wir haben es hier nicht mit der göttlichen, sondern mit der menschlichen Seite der Frage zu tun. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, und dieses Leben lebt nicht nach dem Fleische, kann gar nicht danach leben. Wenn ich also trotzdem nach dem Fleische lebe, so trete ich dadurch auf den Boden der alten Natur, des Fleisches, zurück, und, soweit es an mir liegt, werde ich sterben, denn die Frucht, der gerechte Lohn eines Lebens nach dem Fleische ist der Tod. Unmöglich könnte Gott mir sagen, daß ein solcher Weg im Leben ende. Wenn ich aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töte, so werde ich leben, für immer leben vor und mit dem Gott, der mir das Leben gegeben hat, und dessen Geist in mir wohnt und in diesem Leben wirkt.
Die bedingungslose Errettung des Gläubigen auf Grund des Werkes Christi ist eine Wahrheit, seine Verantwortlichkeit, den Weg der Nachfolge Christi bis ans Ende treu zu gehen, eine andere. Lassen wir jede da, wo Gott sie hingestellt hat, so ist alles einfach und klar; vermengen wir sie, wie man es leider so oft tut, so ist Verwirrung die unausbleibliche Folge.
„Denn so viele durch Gottes Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes" (V. 14). Damit kommen wir zu dem wunderbaren Verhältnis, in welches wir als solche gebracht sind, die nicht mehr durch das Fleisch geleitet werden, die aber auch nicht, wie einst Israel, in der Stellung von Knechten oder Sklaven stehen. Wir werden heute durch den in uns wohnenden Geist Gottes nicht in knechtischer Furcht, sondern in Frieden geleitet. Wenn das aber so ist, dann ist der Beweis erbracht, daß wir Söhne Gottes sind. Der Geist, den wir empfangen haben, ist eben nicht „ein Geist der Knechtschaft, wiederum zur Furcht", sondern „ein Geist der Sohnschaft, in welchem wir rufen; A b b a, V a t e r!" (V. 15). Wo dieser Geist ist, da ist Freiheit. Unter dem Gesetz gab es nur Knechtschaft und Furcht. Obwohl der Heilige Geist in den Gläubigen des Alten Testaments wirkte und sie als Zeugen und Boten der Wahrheit benutzte, konnte Er doch in keinem von ihnen wohnen. Selbst die Jünger konnten vor der Auferstehung und Himmelfahrt ihres Herrn das bestimmte Bewußtsein, Söhne Gottes zu sein, nicht haben, obwohl Er ihnen den Vaternamen geoffenbart hatte. Dieses Bewußtsein ist jetzt aber unser kostbares Teil, nachdem der Heilige Geist in Person herniedergekommen ist und als der Geist der . Sohnschaft Wohnung in uns gemacht hat. Ähnlich schreibt
Paulus an die Galater: „Weil ihr Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater!" (Gal. 4, 6). Wir stehen nicht unter einem Zuchtmeister, sind nicht Unmündige, die den Geboten eines Vormundes oder Verwalters zu folgen haben, sondern werden als Söhne Gottes, die sich dieses Verhältnisses bewußt sind, durch den Geist geleitet.
Welch ein Verhältnis, welche Beziehungen für solche, wie wir einst waren! Und nun lesen wir weiter: „Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben — Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden" (V. 16. 17). Aus dem Verhältnis, in das wir gebracht sind, entspringen wunderbare Segnungen. Nicht nur hat der Geist uns neues Leben mitgeteilt und die Gefühle und Zuneigungen von Kindern in uns geweckt, sondern Er zeugt auch mit unserem Geiste (eben diesem neuen, in uns gewirkten Leben), daß wir Kinder Gottes s i n d, daß wir zu der Familie Gottes gehören und darum an alledem teilhaben, was diesem Verhältnis eigen ist. Es handelt sich hier also nicht um das von außen an uns ergehende Zeugnis Gottes bezüglich unserer Errettung durch den Glauben an Christum, sondern um ein Zeugnis i n u n s, um das klare Bewußtsein der Seele, ein Kind Gottes zu sein. Und ich möchte fragen: Haben wir dieses Zeugnis, dieses Bewußtsein nicht? Rufen wir nicht mit Kindeszuversicht: „Abba, Vater"? Und warum können wir so rufen? Weil der Geist selbst mit unserem Geiste zeugt, daß wir Kinder Gottes sind. Wir würden so nicht rufen können, wenn das Zeugnis nicht in uns wäre.
Ehe wir weitergehen, noch ein kurzes Wort über die Titel „Söhne" und „Kinder". Erinnert der Titel „Söhne" mehr an unsere Stellung und an die mit ihr verbundenen Vorrechte, im Gegensatz zu „Knechten" oder „Sklaven", so weist der Name „Kinder" auf die innige Beziehung hin, in welcher wir, als aus Gott geboren, zum Vater stehen. Wir sind nicht nur als Söhne angenommen, in die Stellung von Söhnen versetzt, sondern sind auch als Kinder in die Familie Gottes hineingeboren, um so jetzt schon die Freuden dieses Verhältnisses zu genießen und bald mit Christo in den Besitz alles dessen eingeführt zu werden, was Gott selbst gehört. Wir sind Kinder Gottes mit all den wunderbaren und ewigen Segnungen, die aus diesem Verhältnis hervorgehen.
„Wenn aber Kinder, so auch Erben — Erben Gottes und Miterben Christi." Israel war einst das Erbteil Jehovas — ein gesegneter Platz! Aber unendlich höher und herrlicher ist der unsrige: wir sind Erben Gottes, Sein Besitz ist u n s e r Besitz. Wie das möglich geworden ist, zeigt uns der zweite Titel: „Mit erben Christi". Mit Ihm nur können und sollen wir alles teilen, mit Ihm, der als der Erstgeborene aller Schöpfung und der Erstgeborene aus den Toten, als Schöpfer und Erlöser ein unbestrittenes Recht auf alle Dinge hat und uns nun in wunderbarer Gnade an diesem Recht teilnehmen läßt. Selbstverständlich gebührt Ihm als Mensch immer und „in allem der Vorrang" (Kol. 1. 18), und wenn wir an Ihn als Gott denken, so ist es klar, daß wir an Seiner Gottheit niemals teilhaben können, wiewohl wir als Kinder der göttlichen Natur und als Söhne der ganzen Segensfülle teilhaftig geworden sind, die mit diesen Titeln in Verbindung steht.
Der Weg zu dem herrlichen Ziele, das vor uns liegt, führt indes durch Leiden. Kein Christ kann ihnen entgehen; darum der Nachsatz: „wenn wir anders mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden." Diese Bedingung hat schon manchen Leser stutzig gemacht, aber wohl nur deshalb, weil man nicht genau genug gelesen hat. Es geht uns oft so mit dem Worte Gottes: wir lesen zu schnell oder zu oberflächlich, tragen auch gern unsere Gedanken in das Wort hinein, anstatt ohne Voreingenommenheit und unter Gebet nach Gottes Gedanken zu forschen.
So ist es gekommen, daß man, obwohl ganz deutlich dasteht: „wenn wir anders mit- (also mit Christo) leiden", an Leiden für Christum gedacht hat. Daß Leiden für Christum, Leiden um des Namens unseres Herrn willen, ein Vorrecht sind, das nicht jedem Christen geschenkt wird, wissen wir aus Philipper 1. 29 und auf Grund unserer Erfahrung. Aber den Leiden mit Christo kann kein wahrer Christ entgehen. Unser Herr und Heiland war in der Welt, auch bevor Er zum Kreuze schritt, „ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut". Eine Welt der Sünde und des Todes, der Leiden und der Tränen, wo die Gesinnung und die Grundsätze des Fleisches herrschen, konnte für Seine heilige Natur und für Sein liebendes Herz nur eine stete Quelle des Schmerzes und der Trauer sein. Ganz allein, als ein einsamer Fremdling, den selbst die Jünger so oft nicht verstanden und durch Eigenliebe, Unglaube, Unverstand und ähnliche Dinge in Seinen innersten Gefühlen verwundeten, schritt Er einher. Was Er sah und hörte beleidigte Sein Auge und Ohr, verwundete Sein Herz und erweckte zugleich Sein inniges Mitgefühl. Dabei fand Er für sich selbst kein Verstehen, kein Mitgefühl, keinen Tröster. Für Seine Liebe erntete Er Haß, für Seine Hilfe Undank, für Seine Güte Hohn und Spott.
So fühlt auch der geistliche Mensch auf seinem Gange durch die Welt die Dinge, wie Christus sie fühlte, wenn auch selbstverständlich nicht in der gleichen Kraft. Auch seine Natur steht im Gegensatz zu allem, was ihn umgibt, und so kann es nicht anders sein: er leidet da, wo Christus gelitten hat; er ist beschwert, er leidet mit Christo. Seine Liebe zu Gott und Menschen, seine Gefühle für Reinheit und Heiligkeit, seine Ehrerbietung vor dem Namen und den Rechten Gottes und Seines Gesalbten, ja, alles, was in ihm als einem Teilhaber der göttlichen Natur wohnt, wird zu einer Quelle der Leiden für ihn. Die Folgen der Sünde um ihn her, verbunden mit dem Unglauben, der Gleichgültigkeit und Halsstarrigkeit der Menschen, bereiten ihm Schmerz, jede Verunehrung Christi, jedes häßliche, unreine oder lästernde Wort tut ihm weh. Selbst der Räuber am Kreuz verwies seinem Genossen die Schmähung des Herrn; sie schmerzte ihn. Aber Gott sei gepriesen! es wird nicht so bleiben. Gerade dieses Teilnehmen an den Leiden Christi verbürgt uns die Teilnahme an Seiner Herrlichkeit droben. Bald werden alle, die hier mitleiden, dort m i t - verherrlicht werden. Wer nicht in irgend einem Maße, und sei es auch nur für Tage oder selbst Stunden (wie der Räuber) m i t leidet, beweist, daß er nicht aus Gott geboren, daß er nicht ein Christ ist. Denn wie könnte der Geist Christi erneuernd in einem Herzen wirken, ohne die Gesinnung hervorzurufen, die in Christo selbst war?
Doch obwohl wir Kinder Gottes und darum auch Erben Gottes und Miterben Christi sind, besitzen wir die Erbschaft doch noch nicht, und zwar nicht nur aus dem Grunde, weil wir noch in diesem Leibe sind, sondern auch weil die Erbschaft selbst noch verunreinigt und dem Verderben unterworfen ist. So wie die Schöpfung jetzt ist, paßt sie nicht für die Erben, weder für den Herrn noch für die Seinigen. Darum sitzt E r noch wartend zur Rechten Gottes, und wir warten, bis die Stunde für die Offenbarung der zukünftigen Herrlichkeit gekommen ist. Im Blick auf diese Herrlichkeit konnte der Apostel, der mehr als irgend einer von uns mit Leiden vertraut war, den Römern schreiben: „Denn ich halte dafür, daß die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes" (V. 18. 19). Der Geist Gottes, der unseren Mut beleben und uns zum Ausharren ermuntern möchte, lenkt unseren Blick auf diese Herrlichkeit und sucht die Überzeugung in uns zu wecken, daß die Leiden, durch welche wir. heute gehen, so drückend sie sein mögen, nicht wert sind, irgendwie in Vergleich gestellt zu werden mit der Herrlichkeit, die vor uns liegt. Inwieweit es Ihm gelingt, Sein Ziel bei der einzelnen Seele zu erreichen, ist ja eine zweite Präge, die mit der persönlichen Herzensstellung zusammenhängt. Der Apostel konnte im Blick auf sich selbst sagen: »Ich halte dafür." Er wußte nicht nur, sondern war der vollen Überzeugung, er hielt dafür, daß die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind usw. In Vers 22 und 28, wo es sich um ein allen Gläubigen gemeinsames Teil handelt, sagt er: „Wir wissen."
Unser Leben ist jetzt mit dem Christus verborgen in Gott. Wenn aber der Christus, unser Leben, geoffenbart wird, dann werden auch wir mit Ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. (Vergl. Kol. 3, 3. 4.) Auf diese Offenbarung der Söhne Gottes wartet die ganze Schöpfung mit sehnsüchtigem Harren. Sie leidet und seufzt, denn „sie ist der Nichtigkeit unterworfen worden, (nicht mit Willen — sie hat ja keinen Willen —, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat — des ersten Adam) auf Hoffnung, daß auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt" (V. 20—22).
Die Schöpfung seufzt unter den Folgen des Sündenfalles, der sie unter die Knechtschaft des Verderbnisses oder der Vergänglichkeit gebracht hat. Als der Mensch, das Haupt der niederen Schöpfung, fiel, teilte die Schöpfung sein Los. W i e herrlich sie vor dem Falle war, wissen wir nicht. Wir wissen aber, daß nach dem Urteil Gottes „alles sehr gut war" (1. Mose 1. 31). Die Sünde des Menschen hat alles verdorben. Aber wie köstlich ist der Gedanke, daß die Schöpfung, die durch unsere Schuld der Knechtschaft des Verderbnisses verfallen ist, nun auch auf unsere Verherrlichung wartet, um von dieser Knechtschaft wieder befreit zu werden! Und wie wunderbar sind die Wege und Ratschlüsse Gottes l In Seiner unergründlichen Gnade beschäftigt Er sich zunächst mit den Schuldigen, mit denen, die durch ihren Abfall von Ihm all den Jammer herbeigeführt haben, und erwählt sie zu solchen, an denen E r den ganzen Reichtum Seiner Liebe und Barmherzigkeit groß machen will, um dann auch die durch sie (ohne eigene Schuld) ins Verderben geratene Schöpfung in den kommenden Zeitaltern an der Herrlichkeit teilnehmen zu lassen! Von dieser „Wiederherstellung a 11 e r Dinge", der „Wiedergeburt", wie der Herr sie in Matthäus 19, 28 nennt, hat Gott durch die Propheten von jeher geredet. (Vergl. Apstgsch. 3, 19—21.)
Auf dem Wege zur Offenbarung dieser Herrlichkeit bilden wir, die wir durch unseren Leib noch zu dieser Schöpfung gehören, gleichsam den Mund derselben. Wir geben durch unser Seufzen dem Seufzen der leidenden Schöpfung in Gott wohlgefälliger Weise Ausdruck, und wir tun das umsomehr, je mehr wir erkennen, was die Sünde ist, und praktisch abgesondert von ihr wandeln. Weil unser geliebter Herr völlig frei war von der Sünde, die alle diese Leiden veranlaßt hat, war Sein Mitgefühl mit den Folgen derselben auch vollkommen. Er seufzte tief im Geiste, und Er erschütterte sich, als Er auf dem Wege zum Grabe des Lazarus die Maria und die sie begleitenden Juden weinen sah. Die Juden meinten, Er vergieße Tränen, weil Er den Verstorbenen so lieb gehabt habe. Ach! sie ahnten nicht, worin Seine Erschütterung ihre wahre Ursache hatte.
Der Apostel vergleicht die Schöpfung mit einem gebärenden Weibe, das sehnsüchtig auf die durch die Wehen angekündigte Geburt ihres Kindleins wartet. Sie kann sie nicht beschleunigen, sie kann nur seufzen und harren. So die Schöpfung. Sie seufzt und harrt auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Noch unterscheiden diese sich äußerlich nicht von den übrigen Menschen, sie sind schwach, vielleicht arm oder gar körperlich mißgestaltet, leiden und sterben wie sie. Aber so wird es nicht bleiben. Bald werden sie, aus den Toten auferweckt oder als Lebende verwandelt, als Miterben Christi mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen, und dann wird auch die Schöpfung freigemacht werden zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ihre Befreiung von der Knechtschaft des Verderbnisses hängt ab von dieser Offenbarung der Herrlichkeit, wenn Gott alles unter ein Haupt zusammenbringen wird in Christo. (Eph. 1. 10.)
Heute ist Gnadenzeit, und niemand kann in die Freiheit der Gnade eintreten, es sei denn durch Glauben. Auf diesem Boden kann es darum keine Verbindung zwischen der Schöpfung und uns geben, einmal weil die Schöpfung nur körperlich ist und keinerlei Einsicht besitzt, dann aber auch weil sie nicht durch ihre Schuld in ihren gegenwärtigen Zustand gekommen ist, also auch nicht der Vergebung bedarf. Wenn aber die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes erscheinen wird, dann werden die gesegneten Folgen des Erlösungswerkes Christi auch an der Schöpfung offenbar werden. War es doch das Wohlgefallen der ganzen in Christo wohnenden Fülle, „durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes" (Kol. 1. 20). Die Dinge sind heute noch nicht versöhnt, aber das Sühnungsblut Christi, auf Grund dessen sie der Versöhnung teilhaftig werden sollen, ist geflossen, das dafür nötige Werk ist vollbracht.
Aber nicht nur seufzt die Schöpfung noch, „auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft; die Erlösung unseres Leibes" (V. 23). Wir seufzen nicht etwa, weil das Schwinden und Vergehen der zeitlichen Dinge uns drückt, sondern weil wir durch den Geist den Gegensatz zwischen unserem gegenwärtigen Zustand und der vor uns liegenden Herrlichkeit fühlen und durch unseren noch nicht erlösten Leib fortwährend daran erinnert werden. Denn „die Sohnschaft" in der vollen Bedeutung des Wortes — dazu gehört auch ein verherrlichter Leib, der die Kraft Christi an sich erfahren hat — ist uns noch nicht zuteil geworden. Wir „besitzen diesen Schatz in irdenen Gefäßen" und „sehnen uns, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden" (2. Kor. 4 u. 5). Indem wir mit der Hoffnung der Herrlichkeit erfüllt sind, werden wir durch das Anschauen der Dinge um uns her zu jenem Seufzen gebracht, das der Kanal des Seufzens der Schöpfung genannt werden kann. Dieses Seufzen ist, wie bereits gesagt, nicht die Frucht von Unzufriedenheit oder Ungeduld, sondern die Wirkung des in uns wohnenden Heiligen Geistes, dessen „Erstlinge"6 wir haben. Das Seufzen des Christen geschieht also im Geist der Liebe, und je mehr er die in sein Herz ausgegossene Liebe Gottes durch den Geist in sich wirken läßt, je mehr er fühlt, wie alles um ihn her Gott entgegen ist, umso tiefer und inniger wird sein Seufzen werden.
„Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren" (V. 24. 25). In seinem Gewissen vollkommen gemacht und durch die Kraft des Heiligen Geistes geleitet, verwirklicht der Christ das vor ihm Liegende, noch nicht zu Sehende in einer „Hoffnung, die nicht beschämt". Er weiß zwar nicht, wann das Schauen kommen wird, aber er weiß gewiß, d a ß es kommt, und so wartet er mit freudigem Ausharren, indem die Hoffnung ihn das Zukünftige gleichsam als schon gegenwärtig genießen läßt. Auf Dinge, die man sieht, braucht man nicht mehr zu hoffen, sie sind da.
„Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern" (V. 26). Welch eine wunderbare Gnade! Wir haben früher gehört, daß der Geist in uns wohnt, uns leitet und mit unserem Geiste Zeugnis gibt, daß wir Kinder Gottes sind; hier wird uns gesagt, daß Er sich dazu herabläßt, sich mit den Gläubigen in ihrem gegenwärtigen Zustande der Schwachheit einszumachen. Wir sind Menschen von Fleisch und Blut, schwach, kurzsichtig, unterliegen gern den Einflüssen, die von innen und außen her auf uns wirken, sind von Natur vielleicht ängstlich und zaghaft, ermatten leicht und lassen dann mutlos die Flügel sinken. Nun, während wir so durch die Welt gehen und in Liebe derer gedenken, die gleiche Erfahrungen machen wie wir, dürfen wir uns einerseits des innigen Mitgefühls unseres Hohenpriesters droben erfreuen, der einst in allem versucht worden ist wie wir, Er freilich ohne Sünde, und haben anderseits in uns den erhabenen göttlichen Gast, der sich allezeit für uns verwendet in unaussprechlichen Seufzern.
In den Dingen, die mit dieser Schöpfung zusammenhängen, in den Versuchungen, Krankheiten, Schwierigkeiten usw., die uns und unseren Geschwistern auf dem Gange durch diese Welt begegnen, ja, selbst im Blick auf die ganze Lage der Dinge um uns her wissen wir sehr oft nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Wir kennen weder ein Heilmittel für sie, noch den Willen oder die Absicht Gottes in ihnen. Wir können dann nur seufzen, aber der Geist, der dieses Seufzen selbst in uns bewirkt, verbindet sich darin mit uns in Seufzern, die sich in Worte nicht kleiden lassen, und unser Gott und Vater droben, der uns sieht und hört, „weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß" (V. 27). Welch eine Gnade, daß wir überzeugt sein dürfen, daß der Gott, „der die Herzen erforscht" —' ein wichtiger Zusatz! — in unserem Seufzen die Gesinnung des Geistes entdeckt. Denn wenn unsere Herzen aufrichtig sind vor Gott, dann ist es der Geist, der unseren Gefühlen als Menschen, die noch dieser seufzenden Schöpfung angehören und an ihren Leiden teilnehmen, Ausdruck verleiht, und Gott versteht Ihn.
Aber nicht nur das. Wir wissen zu gleicher Zeit, „daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind" (V. 28). Wir wissen aus Mangel an Erkenntnis nicht immer, wie wir gebührend beten sollen (denken wir z. B. an den Apostel Paulus selbst in 2. Korinther 12), aber das eine wissen wir, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Fürwahr, ein kostbarer Trost! Beachten wir indes den Ausdruck: „denen, die Gott lieben". Es heißt nicht, „die Gott liebt", obwohl das selbstverständlich immer wahr ist. Es handelt sich um Menschen in einer von Gott entfremdeten Welt, auf denen Sein Auge mit Wohlgefallen ruht, denen Er „das bereitet hat, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist" (1. Kor. 2, 9; vergl. Jak. 1. 12; 2, 5), um Menschen, die Er nach Seinem göttlichen Vorsatz aus der Welt berufen und Seinem geliebten Sohne geschenkt hat, die nun ihr Verhältnis als Kinder zum Vater kennen. Mit anderen Worten, wenn Gottes Auge auf diese Erde herabschaut, erblickt Er inmitten der Kinder dieser Welt, deren Gesinnung Feindschaft ist wider Ihn, solche, die Ihn lieben, so schwach es sein mag. Daß sie das nur deshalb zu tun vermögen, weil Er sie zuerst geliebt hat, und daß ihre Liebe immer nur schwach und gering bleiben wird, ändert nichts an der Tatsache, daß sie die Gegenstände des liebenden Interesses Gottes sind, zu deren Bestem Er alles, das Kleinste wie das Größte, mitwirken läßt. Zu diesem kostbaren Bewußtsein kommt noch hinzu, daß die Gläubigen schon vor Grundlegung der Welt Gegenstände des Vorsatzes Gottes waren, daß Er sie zuvorerkannt hat, ja, „zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein" (V. 29). Wunderbare Mitteilungen! Sie leiten hinüber zu der in dem letzten Teil unseres Kapitels ganz bestimmt ausgesprochenen Behauptung, daß Gott für uns ist, und daß deshalb keine Macht in der Höhe oder in der Tiefe uns von Seiner Liebe zu scheiden vermag.
„Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht" (V. 29. 30). In dieser herrlichen Kette von Gedanken und Wegen Gottes, die, von Ewigkeit zu Ewigkeit reichend, den göttlichen Vorsatz mit unserer Verherrlichung im Vaterhause verbindet, erstrahlt die Gnade Gottes in unvergleichlichem Glänze. Es ist die einzige Stelle in unserem Briefe, die von dem Ratschluß Gottes vor den Zeiten der Zeitalter redet, aber sie ist überwältigend in ihrer Wirkung, und wir verstehen jetzt voll und ganz den Ausruf des Schreibers: „Was sollen wir nun hierzu sagen?"
Der Inhalt der beiden letztgenannten Verse (29 und 30) zeigt uns, daß Gottes Wirken hinsichtlich der von Ihm Berufenen nimmer aufhört. Es beginnt in der Ewigkeit und schließt mit der Ewigkeit. Welche Er zuvorbestimmt hat, diese hat Er auch berufen, und welche Er berufen hat, diese hat Er auch gerechtfertigt und . . . bestimmt, dem Bilde Seines Sohnes gleichförmig zu sein — diese, keine anderen, aber diese auch ausnahmslos. Seine Gnade wird nicht ruhen, bis Seine Liebesabsicht erreicht ist, bis Er alle diese Berufenen verherrlicht vor sich stehen sieht, „dem Bilde seines Sohnes gleichförmig".
Gottes Auge ruht mit Wonne auf dem Manne Seiner Rechten, auf dem in Auferstehungs-Herrlichkeit droben thronenden Menschensohne, und zu der nämlichen Herrlichkeit hat Er uns zuvor bestimmt. Nichts Geringeres als das sollen diejenigen besitzen, die Er Ihm aus der Welt gegeben hat. Schon hier auf Erden gibt es in geistlichem Sinne, und je nach der Treue des einzelnen, eine mehr oder minder große Gleichförmigkeit mit Christo; aber als Söhne der Auferstehung und Söhne Gottes sollen wir vor des Vaters Auge stehen in Leibern, die dem Herrlichkeitsleibe des geliebten Sohnes gleichgestaltet sind. Doch trotz der innigsten Verbindung mit Ihm werden wir stets anbetend zu Ihm emporschauen und mit tiefer Freude Ihn Herr nennen, der allein würdig ist, Ehre und Herrlichkeit und Segnung zu empfangen. Obschon Er, der Heiligende, und wir, die Geheiligten, alle „von einem" sind, so daß Er sich heute schon nicht schämt, uns Brüder zu nennen (Hebr. 2, 11), wird Er doch, zur Freude des Vaters und in Erfüllung Seines Ratschlusses, in alle Ewigkeit als „der Erstgeborene unter vielen Brüdern" den strahlenden Mittelpunkt jener seligen Scharen bilden, die, in Sein Bild verwandelt, Ihn sehen werden, wie Er ist. (1. Joh. 3, 2.) Und s i e? Jubelnd werden sie niederfallen und ihre Kronen vor dem Throne Dessen niederwerfen, der sie geliebt und Sich Selbst für sie hingegeben hat.
Kapitel 8, 31—39
Es bleibt uns noch übrig, einen Blick auf den Schluß unseres wunderbaren Kapitels zu werfen. Die eben betrachteten Ausführungen des Apostels leiten ihn, in Verbindung mit der ganzen Lehre des Briefes, zu der schon erwähnten Folgerung, die er im Namen aller Gläubigen zieht, daß Gott nicht nur durch Seinen Geist i n uns wohnt, sondern daß Er auch für uns ist, d. h., daß Er Seine ganze Liebe uns zugewandt hat. Und ein Gott, der so liebt, „ein solcher Gott versagt nichts mehr". So lesen wir denn: „Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?" Die Dahingabe des Sohnes ist eine Tatsache, und die größte Gabe schließt alle kleineren von selbst mit ein. Wenn Gott um unseretwillen Den nicht verschont hat, der Seines Herzens Freude und Wonne, der der Mittelpunkt aller Seiner Gedanken war, wenn Er Ihn für uns dahingab, als wir noch Gottlose und Feinde waren, wie könnte Er, nachdem wir Heilige und Geliebte geworden sind, uns je etwas Gutes vorenthalten?
Und weiter, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Wer will dem ewigen Gott entgegentreten, wer uns Seinen allmächtigen Händen entreißen? Wer oder was könnte uns Seine Gunst rauben oder Seine Liebesabsicht mit uns durchkreuzen? Glückselig darum alle, die in kindlichem Glauben sagen können: Gott ist für mich!
Abgesehen von dem schon früher Gesagten gibt uns der Apostel hier drei Beweise für die Tatsache, daß Gott wirklich für uns ist. Der erste ist eben die Dahingabe Seines Sohnes, der zweite, daß Gott selbst uns rechtfertigt, der dritte, daß nichts uns von Seiner Liebe zu scheiden vermag. In dem ersten Beweis tritt uns vor allem die Liebe Gottes entgegen. Sie ist die Quelle von allem übrigen. Nicht alle Gläubigen verstehen das. Viele sehen in Gott vornehmlich den gerechten Richter, dessen Zorn durch das Werk Christi zwar abgewendet ist, der aber doch stets wie ein kalter, strenger Richter auf Seinem Richterstuhl sitzt. Daß Gott Liebe und darum Ursprung und Grundlage unseres Heiles ist, kommt ihnen nie klar zum Bewußtsein; sie sehen nur die Heiligkeit in Gott und die Liebe in Christo. So war es fast allgemein in den Tagen der Reformation, wie herrlich diese auch anderseits waren, und so ist es vielfach noch in unserer Zeit. Aber Gott sei gepriesen! nicht Gerechtigkeit herrscht heute — sie wird einmal herrschen, wenn der Tag des Gerichts gekommen ist, und wehe dann allen, die ihr begegnen müssen! — nein, Gnade herrscht durch Gerechtigkeit. (Kap. 5, 21.) Es ist von überaus großer Wichtigkeit für den Frieden unserer Herzen, diesen Punkt klar zu verstehen und so die richtigen Gedanken über Gott zu haben. Es ist freilich wahr, daß Christus alles getan hat, um die Gerechtigkeit Gottes zu befriedigen, aber es ist ebenso wahr, daß die Liebe Gottes das „Lamm" zuvorbestimmt hat, um für uns in den Riß zu treten. Wir bedurften der Gerechtigkeit Gottes, um vor Ihm stehen zu können, aber Seine Liebe war in Christo tätig, um sie uns zu erwerben. „G o t t war in Christo, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend." Und indem E r Christum für uns zur Sünde machte, sind wir Seine Gerechtigkeit geworden in Ihm. (2. Kor. 5, 19. 21.) Unser Glaube und unsere Hoffnung gründen sich also auf Gott selbst. (Vergl. 1. Petr. 1. 21.) Auf Grund der ewigen, unveränderlichen Gerechtigkeit Gottes wissen wir, daß Er nach Seiner unendlichen Liebe für uns ist. Und nun dürfen wir mit aller Zuversicht darauf rechnen, daß Er uns mit Christo auf unserem Wege auch alles Gute und am Ende die Herrlichkeit selbst schenken wird.
Bleibt aber Gott nicht stets der Heilige und Gerechte? Ganz gewiß. W i r mögen uns verändern und dem, was wir zu sein bekennen, untreu werden. E r aber bleibt treu, immer sich selbst gleich, Er kann sich nicht verleugnen. (2. Tim. 2, 13.) Das ist gewiß eine ernste Wahrheit, aber sind wir nicht Gottes Auserwählte,7 die Er mit dem kostbaren Blute Seines fehl- und fleckenlosen Lammes so teuer erkauft hat? Und wenn das so ist, wer wird dann „wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt; wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet" (V. 33. 34).
Wenn Gott selbst für uns eintritt, so dürfen wir wahrlich getrost sein. Und warum k a n n Er für uns eintreten und den Mund jedes Anklägers verschließen? Die Antwort ist Christus, der gestorbene und auferstandene und jetzt zur Rechten Gottes sitzende Menschensohn.
Vor dem Lamm auf Gottes Thron Geht der Kläger stumm davon. Satan wird der Verkläger der Brüder genannt (Offbg. 12, 10), aber was kann er tun, wenn der Richter selbst rechtfertigt? Er hätte seiner Zeit besser getan, den Hohenpriester Josua, den Vertreter der sündigen Stadt Jerusalem, nicht zu verklagen. (Sach. 3.) Sein Angriff endete für ihn in einer völligen Niederlage und schlug aus zur Verherrlichung der Gnade und Gerechtigkeit Gottes. So wird es immer sein. Hatte Jehova Jerusalem nicht erwählt? Und war Josua nicht wie ein Brandscheit aus dem Feuer gerettet? Was wollte Satan darauf erwidern, was sagen, als der Engel befahl, Josua die schmutzigen Kleider auszuziehen, ihm Feierkleider anzulegen und einen reinen Kopfbund auf sein Haupt zu setzen? Dabei ist jener wunderbare Vorgang nur ein schwaches Vorbild von der heutigen Wirklichkeit. Viel näher und inniger ist unsere Beziehung zu Gott, als Israel sie je kennen wird, und viel klarer und deutlicher treten Gottes Gnade und Gerechtigkeit in unserem Falle ans Licht, nachdem Christus gestorben und auferstanden ist und Seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat.
Noch einmal denn: Gott selbst erscheint hier als der Rechtfertigende, wir sind nicht nur durch Glauben vor Ihm gerechtfertigt. Das was durch den Geist der Prophezeiung von Christo selbst gesagt wird: „Nahe ist der mich rechtfertigt: Wer will mit mir rechten? . . . Siehe, der Herr, Jehova, wird mir helfen; wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte?" (Jes. 50, 8. 9) — wird hier durch den Apostel den Gläubigen in den Mund gelegt. Welch eine wunderbare, gesegnete Einsmachung!
Aber mehr noch. Nicht nur rechtfertigt uns Gott auf Grund des Werkes Seines Sohnes, dieser Sohn selbst verwendet sich als der Auferstandene und verherrlichte Mensch allezeit für uns, solang wir in diesem Leibe sind. Könnte es einen mächtigeren Trost geben? Hienieden verwendet sich der Heilige Geist für uns, und droben tut es der Sohn Gottes! In der Erkenntnis dieser beiden Tatsachen verstehen wir gut, daß auch die Schwierigkeiten des Weges das starke Band, das uns mit Christo und durch Ihn mit Gott verbindet, nimmermehr zu zerreißen vermögen.
„W er wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?" (V. 35). Nicht daß diese Dinge nicht vorhanden wären. Sie sind da und werden in ihrer ganzen Schwere von uns gefühlt. Aber der Sohn Gottes selbst hat als Mensch alle diese Prüfungen und Leiden durchlebt, hat alles das erfahren, wodurch der Feind den Menschen Gottes auf seinem Wege der Absonderung und des Gehorsams zu Fall zu bringen sucht. Es gibt keine Leiden, keine Schmerzen, keine Glaubensprüfungen, die Er selbst nicht durchgemacht hätte — und Er fühlte sie alle unendlich tiefer, als wir es je vermögen — aber aus allen ging Er siegreich als Überwinder hervor. Darum, mochte der Apostel und mögen andere die Wahrheit des Wortes erfahren haben:
„Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden", mochten und mögen alle die Schwierigkeiten und Leiden, die im 35. Vers aufgezählt werden, auf dem Wege gelegen haben oder liegen, der Glaube konnte und kann todesmutig sagen: „Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat" (V. 36. 37).
Die letzten Worte sind an dieser Stelle von besonderer Kraft und Lieblichkeit. Was war es, das unseren Herrn den schweren Weg durch diese Welt gehen ließ? Warum hat Er neben den Leiden um unserer Sünden willen auch alle diese Drangsale und Leiden auf sich genommen? War es nicht wunderbare, unvergleichliche Liebe, die Ihn trieb? Liebe zu uns, den Armen und Hassenswürdigen? Es ist also nicht nur Seine bewährte Kraft, die in uns Schwachen mächtig ist und uns durch alles hindurchbringt, es ist vor allem Seine Liebe, die uns trägt, ermuntert, aufrichtet und unseren Blick auf die Herrlichkeit richtet, deren Unterpfand gerade diese Leiden sind. (Vergl. 2. Kor. 4, 17. 18.) Ja, wer wird uns scheiden von dieser Liebe?!
Angesichts derselben schließt der Apostel mit dem triumphierenden Jubelruf: „Denn ich bin überzeugt, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn" (V. 38. 39). Bisher handelte es sich um Schwierigkeiten und Feinde in dieser irdischen, sichtbaren Welt; nunmehr zählt der Apostel alle jene unsichtbaren Mächte und Gewalten auf, die geeignet erscheinen könnten, uns von der Liebe zu trennen, die uns zur Herrlichkeit führen will. Aber mag man sie alle der Reihe nach aufzählen, Tod oder Leben, gegenwärtige oder zukünftige Dinge, Gewalten in der Höhe oder in der Tiefe, was sind sie alle? Nichts anderes als geschaffene Dinge, ein Nichts vor dem allmächtigen Schöpfer und gegenüber Seiner nie endenden, alles überwindenden Liebe.
Hörten wir in Verbindung mit den sichtbaren Dingen von der Liebe Christi, hier, wo es sich um die u n s i c h t b a r e n handelt, wird unser Blick gelenkt auf die Liebe G o t t e s, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. „Eine jede ist", wie ein anderer Schreiber gesagt hat, „genau an ihrem Platze. Die Liebe Christi hat sich darin geoffenbart, daß sie hienieden bis zum äußersten für uns gelitten hat, und sie entfaltet sich heute droben in Seiner Verwendung für uns, die jetzt noch da leiden, wo Er gelitten hat; die Liebe Gottes, die uns zwar weniger sichtbar entgegentritt, aber von derselben Unermeßlichkeit und Unveränderlichkeit ist wie jene, hat alles für uns zuvorverordnet, hat uns alles gegeben, alles in Gnaden vergeben, erhält und umgibt uns auf dem Wege und wird uns trotz aller feindlichen Mächte, die sich ihr entgegenstellen mögen, zu jener Fülle von Liebe, Freude und Herrlichkeit bringen, die allein einen solchen Gott befriedigen und dem Erlösungswerke eines solchen Heilandes entsprechen kann."
In der wenn auch schwachen Erkenntnis dieser Liebe, mit diesem Schatz von unerschöpflichen Reichtümern im Herzen, mögen wir wohl in die Siegesrufe des Apostels einstimmen, mit denen er dieses Kapitel beginnt und schließt. Keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind — kein Feind, keine Gewalt, die uns von der Liebe Christi und von der Liebe Gottes zu scheiden vermag! Mag auch alles um uns her in Staub zerfallen, mag alles den Stempel der Sünde und der Entfremdung von Gott tragen, der Glaube schaut über alles hinweg auf die unsichtbaren Dinge, ruht in der Liebe Gottes und steht fest in Kampf und Leid. Durch die Nebel, welche ihm die Aussicht versperren wollen, blickt er hin auf Den, der, nach vollendetem Werke mit Ehre und Majestät gekrönt, sich gesetzt hat zur Rechten Gottes und nun die Seinigen dort erwartet, um sie an Seiner Freude und Herrlichkeit teilnehmen zu lassen mit Frohlocken. 0 das wunderbare Wort: Gott ist für uns!
Kapitel 9-11
Wir sind an einem Wendepunkt in unserem Briefe angelangt. Der Apostel hat uns bisher von den finsteren Tiefen des menschlichen Verderbens bis zu den lichten Höhen der göttlichen Gnade geführt. Das 8. Kapitel, das in ergreifender Zusammenfassung die ganze christliche Stellung, das Ergebnis des wunderbaren Wirkens Gottes in Liebe und Gnade, uns noch einmal vor Augen malte, schloß mit der Aufzählung all der Segnungen, die dem Glaubenden heute in Christo zuteil geworden sind. Gott hat Seines Eingeborenen nicht geschont, um uns mit Ihm alles schenken zu können.
Die nächsten drei Kapitel (9—11) leiten uns nun auf ein neues Gebiet, auf dem wir nicht länger mit Dingen beschäftigt werden, die uns zu unserem Frieden und ewigen Heil zu wissen nottun, sondern wo der Geist uns in göttliche Gedanken und Ratschlüsse einführt. Wir betreten jetzt den Pfad der „Weisheit" und der „Erkenntnis", und so klingt denn auch. dieser Abschnitt nicht aus in einem Lobgesang zum Preise der Liebe Gottes, sondern schließt mit den Worten: „O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, und wer ist sein Mitberater gewesen?" (Kap. 11, 33. 34). Der Glaube blickt triumphierend zurück auf die wunderbaren Wege Gottes, über welche die Mitteilungen des Geistes ihn belehrt haben. Ja, Gott will nicht nur, daß Seine Kinder in dem vollen Heil ruhen, das ihnen in Seinem Geliebten geschenkt ist, Er will sie auch zu Mitwissern Seiner Gedanken machen, sie Seinen Sinn erkennen lassen. Wunderbare Gnade!
Die Belehrungen des Apostels in der ersten Hälfte seines Briefes, die in dem unterschiedslosen Verderben von Juden und Heiden, aber auch in dem unterschiedslosen Gnadenruf an beide gipfeln, mußten unwillkürlich zu der Frage führen: Wenn Gott Juden und Heiden in sittlicher Beziehung auf einen Boden stellt und nun in der Macht Seiner Liebe und dem Reichtum Seiner Gnade alle Glaubenden errettet und „in Christo" zur Sohnschaft bringt, was wird dann aus den bedingungslosen Verheißungen, die Er Seinem auserwählten Volke gegeben hat? Wie sind diese mit der unterschiedslosen Berufung von Heiden und Juden zu den neutestamentlichen Segnungen in Einklang zu bringen? Wenn Israel unter dem Gesetz auch alle Ansprüche an die Segnungen, die mit der Erfüllung des Gesetzes verbunden waren, verloren hatte, waren jene Verheißungen doch vor dem Gesetz und ohne Bedingung gegeben worden. (Vergl. 1. Mose 15. 17. 18.) Hatte Gott sie ganz vergessen? Hatte Er Sein Volk für immer verstoßen?
Die Beantwortung dieser Fragen unter der Leitung des Heiligen Geistes erfüllt das Herz des Schreibers selbst mit solcher Bewunderung, daß er am Ende des 11. Kapitels ganz hingerissen in die Worte ausbricht, die wir bereits angeführt haben. Auch wir werden bei näherer Betrachtung überwältigende Eindrücke empfangen, einerseits von der Gerechtigkeit und dem heiligen Ernst der Wege Gottes, anderseits aber auch von Seiner unwandelbaren Treue und der unerschütterlichen Wahrheit Seines Wortes. Laßt uns denn an der Hand des Geistes, der „alles erforscht, auch die Tiefen Gottes" (1. Kor. 2, 10), mit Ehrfurcht diesen neuen Weg betreten!
Kapitel 9
Ehe der Apostel in die eigentliche Behandlung seines Gegenstandes eintritt, gibt er „seinen Verwandten nach dem Fleische" einen ebenso rührenden wie ergreifenden Beweis von seiner durch nichts auszulöschenden Liebe zu Israel. Man warf ihm, dem Apostel der Nationen, vor, daß er ein Abtrünniger sei, der aus unedlen Beweggründen seine Beziehungen zu Israel abgebrochen habe und nun, Gottes Gedanken in Verbindung mit dem „Samen Abrahams" vergessend, sein eigenes Fleisch und Blut verachte.
0 wie wenig kannten die Menschen, die also dachten und redeten, das Herz dieses wunderbaren Mannes! Dieses Herz, das im Anschauen des Zustandes seines geliebten Volkes und der göttlichen Gerichte, die seines Unglaubens und seiner Halsstarrigkeit wegen über Israel gekommen waren, wie aus tausend Wunden blutete! Mit Ausdrücken, wie sie stärker nicht gedacht werden können: „Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste" — versichert er seine Volksgenossen seiner unveränderten glühenden Zuneigungen zu ihnen, und zwar nicht etwa aus der Zeit, da er noch als eifriger, gesetzestreuer Pharisäer in ihrer Mitte gelebt und gewirkt hatte, sondern aus den Tagen nach seiner Berufung zum Apostel Jesu Christi. Anstatt seine „Brüder" zu verachten oder gar zu hassen, anstatt die ihnen von Gott geschenkten Vorrechte aus dem Auge zu verlieren, war sein Herz im Blick auf sie mit „großer Traurigkeit und unaufhörlichem Schmerz" erfüllt. (V. 2.)
Ja, er hatte, ähnlich wie einst Mose gelegentlich der Aufstellung des goldenen Kalbes Gott gebeten hatte, seinen Namen aus Seinem Buche auszulöschen, gewünscht, für seine Brüder, „durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein". Jene große Traurigkeit und jener unaufhörliche Schmerz hatten ihn einmal so überwältigt, daß er einem Wunsche Ausdruck gegeben hatte, der gar nicht erfüllt werden konnte, dessen Erfüllung seinem Volke auch nichts hätte nützen können (genau wie bei Mose), der aber bewies, wie tief und innig er seine Verwandten nach dem Fleische liebte. Es war göttliche Liebe, die sich selbst aufopfernde Liebe Christi, die in ihm, wie einst in Mose, wirkte und beide Männer bereit machte, a l l e s, selbst das Unmögliche, zu tun, um ihren Gegenständen zu dienen.
Dieselbe Liebe läßt den Apostel dann alles aufzählen, was er zum Vorteil seiner Volksgenossen sagen konnte. Wer andere haßt, benutzt jede Gelegenheit, um sie herabzusetzen und das Gute, das sie besitzen mögen, zu verkleinern; die Liebe tut das Gegenteil. Zunächst waren die „Brüder" des Apostels Israeliten, also Nachkommen jenes Mannes, der mit Gott und Menschen gerungen und obgesiegt hatte. (1. Mose 32, 28.) Ihnen gehörte (selbstverständlich nicht in dem heutigen christlichen Sinne) die Sohnschaft, denn Jehova hatte dem Pharao entbieten lassen: „Mein Sohn, mein erstgeborener, ist Israel", und: „Laß meinen Sohn ziehen!" Ferner die Herrlichkeit (vergl. 2. Mose 29, 43) und die Bündnisse und die Gesetzgebung (wo war ein Volk gleich ihm, das Gott „aus allen Geschlechtern der Erde erkannt", und dem Er solch gute, gerechte Satzungen gegeben hätte?) und der Dienst (zunächst in der Stiftshütte und später im Tempel) und die Verheißungen und die V ä t e r l Und schließlich, als herrliche Krone des Ganzen: aus Israel war, „dem Fleische nach, der Christus (der Messias), welcher über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit"!
Mit welch einer Wucht mußten solche Worte auf die Herzen und Gewissen derer fallen, die dem Apostel solch bitteres Unrecht taten! In der Tat, wenn es einen Mann gab, der das irdische Volk Gottes liebte, so war er es. Er war der letzte, dem man vorwerfen konnte, daß er die Vorrechte Israels unterschätze. Viel eher stand es i h m zu, einen solchen Vorwurf zu erheben, denn wer von seinen ungläubigen Verwandten nach dem Fleische kannte und erkannte das höchste aller ihrer Vorrechte, nämlich daß Christus Jesus, „Gott, geoffenbart im Fleische", „aus Israel" war? Wer von ihnen trug solches Leid über die Verwerfung Israels, wie Paulus es tat?
Deshalb war er auch der Mann, der Israel darüber belehren konnte, daß Gott Sein Volk nicht „verstoßen" habe, wenn es auch unter den Schlägen Seiner Gerichte so schwer litt und heute noch leidet: weiter aber auch, daß nur die unumschränkte Gnade Gottes die Grundlage zu ihrer Wiederherstellung bilden könne, dieselbe Gnade, die den Heiden zuteil geworden war, und die sich ihnen zuwenden wollte, um eine viel herrlichere Erfüllung der ihnen gewordenen Verheißungen herbeizuführen, als sie es je hätten erwarten können. In ihrem Streben, eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, hatten sie die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, nicht erlangt, sondern waren zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volke geworden, nach welchem Gott Seine Hände umsonst ausstreckte. (Kap. 10, 3. 21.)
Was konnte ihnen Hilfe bringen? Wir sagten es schon: allein die Unumschränktheit Gottes, die trotz allem in Gnaden handeln und einen „Überrest nach Wahl der Gnade" erretten konnte. Mochte auch das Volk als Ganzes, statt zu erlangen was es suchte, dem gerechten Zorn anheimfallen, nach Gottes Vorsatz gab es doch noch eine „Auswahl", die das Heil erlangte, während die übrigen verstockt wurden. (Kap. 11, 3—7.)
Im weiteren Verlauf unseres Kapitels besteht dann der Apostel immer wieder auf der Unumschränktheit Gottes und beweist den Juden aus ihrer eigenen Geschichte, daß Gott von jeher nach dieser Unumschränktheit gehandelt hatte. Und wie gut für sie, daß es so gewesen war, und daß Er es immer noch tat! Nur so gab es noch eine Hoffnung für sie; anders wären sie rettungslos verloren gewesen. War aber Sein Wort nicht dadurch „hinfällig geworden" (V. 6), daß Er den Heiden die Gnadentür öffnete? War Er Seinen Verheißungen an die Väter nicht untreu geworden? Nein, Gottes Wort hat noch stets seine Kraft behalten und sich als zuverlässig und treu erwiesen, nur der Mensch, und vor allem der Jude, hat sich als unzuverlässig erwiesen.
Ähnlich wie man es heute macht, suchten die Juden aus den Verheißungen, die Abraham empfangen hatte, eine „Verpflichtung" für Gott herzuleiten, die ganze natürliche Nachkommenschaft des Patriarchen zu segnen (der Ausschluß der Heiden war dabei selbstverständlich). Aber, sagt der Apostel, „nicht alle, die aus Israel sind", sind deshalb Israel, auch sind nicht alle deshalb Kinder, weil sie „Abrahams Same" sind. (V. 6. 7.) Schon hatte der Herr selbst (vergl. Job. 8, 37—39) die Juden auf diesen ernsten Unterschied zwischen Abrahams „Same" und Abrahams „Kindern" aufmerksam gemacht. Die natürliche Abstammung von Abraham gab niemand ein Anrecht auf die Verheißungen. Und wenn die Juden dies dennoch festhalten wollten, dann mußten sie auch die Wüstensöhne Arabiens, die Beduinen, als gleichberechtigt anerkennen, denn sie waren Söhne Ismaels, des Sohnes Abrahams. Und mit noch größerem Recht die E d o m i t e r, waren sie doch die Nachkommen Esaus, des Zwillingsbruders Jakobs! Das aber wollten sie natürlich nicht. Wie hätte ein Jude mit unreinen Heiden, mit „Hunden", gemeinsame Segnungen haben mögen? Das war völlig ausgeschlossen. Die Verheißungen gehörten nur der Linie Isaaks bzw. Jakobs: „In Isaak wird dir ein Same genannt werden" (V. 7).
Wenn das aber so war, dann hatte die natürliche Abstammung gar wenig Wert. Was zunächst Ismael angeht, so war er wohl ein wirklicher Sohn Abrahams, aber er war, „nach dem Fleische geboren" (Gal. 4, 23), und das Fleisch nützt vor Gott nichts. „Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet" (V. 8). Ähnlich hatte der Apostel schon am Ende des 2. Kapitels gesagt; „Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch die äußerliche Beschneidung im Fleische Beschneidung." Nein, die Entscheidung steht Gott allein zu, und es hat Ihm gefallen, Isaak zu berufen, nicht Ismael. Die Berufung gründete sich auf einen freien Entschluß, auf den „V o r s a t z" Gottes, und war „nach Auswahl" geschehen. „Denn dieses Wort ist ein Verheißungswort: „Um diese Zeit will ich kommen, und Sara wird einen Sohn haben"." (V. 9).
Der Kraft dieser Beweisführung konnte sich kein Jude entziehen, er hätte denn, wie gesagt, die Nachkommen Ismaels und Esaus als gleichberechtigt mit Israel anerkennen müssen. Aber eine andere Einwendung konnte gemacht werden. Die Mutter Ismaels war eine ägyptische Magd, eine Sklavin, Isaak aber war von Sara, dem rechtmäßigen Weibe Abrahams, geboren. Doch wie stand es mit Rebekka? Sie war nicht nur keine Magd, sondern entstammte der Familie Abrahams, und sie gebar ihrem Manne Zwillingssöhne. Man könnte sich keinen Fall denken, der für die Beweisführung des Apostels passender gewesen wäre. Esau und Jakob waren Söhne eines Vaters, von derselben Mutter zu derselben Zeit geboren — und doch sagt Gott zu Rebekka, noch ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, was einen Unterschied zwischen beiden hätte errichten können: „Der Größere wird dem Kleineren dienen", oder mit anderen Worten; das Erstgeburtsrecht des älteren wird auf den jüngeren übergehen. Warum? Weil Gott es so beschlossen hatte. Es war Sein Vorsatz, Sein unumschränkter Wille bezüglich des kleineren oder jüngeren, „auf daß", wie der Apostel ausdrücklich hervorhebt, „der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden" (V. 11). Die Werke der beiden Kinder hatten gar nichts mit der Berufung zu tun; noch ehe sie geboren waren, also bevor sie irgend etwas getan hatten, was vielleicht den einen für den Empfang der Segnungen passend, den anderen unpassend hätte erscheinen lassen können, traf Gott Seine Wahl.
Aber, könnte man einwenden, lesen wir nicht gleich nachher, daß Gott den Jakob geliebt, den Esau aber gehaßt habe? Ja, so steht geschrieben, und es steht uns nicht zu, dieses Wort im geringsten abzuschwächen. Es liegt aber auch kein Grund dafür vor. Beachten wir zunächst, daß Gott jene 10 Worte nicht (wie die anderen) ausgesprochen hat, ehe die Kinder da waren, sondern daß sie sich bei Maleachi, dem letzten aller alttestamentlichen Propheten, finden, der etwa 1400 Jahre nach der Geburt des Zwillingspaares lebte, zu einer Zeit also, als Esau längst seine böse, „ungöttliche" Gesinnung, und seine Nachkommen, die Edomiter, ihre unversöhnliche Feindschaft gegen Israel geoffenbart hatten. Wenn Gott also sagt, daß Er den Jakob geliebt, den Esau aber gehaßt habe, so fand die Liebe ihre Quelle in Seinem Herzen — sie war frei und unverdient —, während der Haß seine Grundlage in dem sittlichen Verhalten Esaus hatte. Beide Kinder waren in Sünde geboren und sind auch zweifellos beide in Sünden aufgewachsen; aber an dem einen erfüllten sich die Gnadenratschlüsse Gottes, während der andere die gerechte Strafe für seine bösen Wege fand.
Da der Ausspruch des Propheten Maleachi gerade in der hier vorliegenden Verbindung manchem Leser Schwierigkeiten bereitet und schon oft zu falschen Auslegungen geführt hat, möchte ich nochmals ausdrücklich betonen, daß er erst lange nach dem Tode der beiden Söhne Isaaks gefallen ist. In 1. Mose 25 finden wir nichts davon. Es kann also aus ihm nicht der Schluß gezogen werden, daß Gott i m v o r a u s den einen Sohn geliebt, den anderen gehaßt und so das ewige Los beider von vornherein bestimmt habe; auch nicht, daß Er in Seiner göttlichen Kenntnis vorausblickend so geredet habe. Beides ist falsch; aber der Mensch schließt so gern aus der Auswahl des einen die Verwerfung des anderen. Nein, die Sache liegt so: wenn Gott von zwei Menschen, die beide keinerlei Ansprüche an Ihn machen können, den einen, wie es hier geschieht, zu einem bevorzugteren Platz erwählt als den anderen, so ist das Sein unumschränkter Wille, und wer kann zu Ihm sagen: „Warum tust du also?" Wenn es Ihm gefällt, sich in Seiner Gnade an einem Menschen zu verherrlichen, wer hat ein Recht, Ihm einen Vorwurf daraus zu machen? — Zugleich bedingt die Erwählung des einen keineswegs die Verdammnis des anderen.
Aber nun wird ein zweiter Einwurf laut: „Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne!" (V. 14).
Der Mensch, die fleischliche Vernunft, fragt allerdings: Wenn Gott von zwei gleich sündigen Menschen den einen errettet, den anderen verloren gehen läßt, handelt Er dann nicht ungerecht? Die Frage an und für sich beweist schon die Überhebung des menschlichen Herzens, indem sie für den Menschen das Recht in Anspruch nimmt, Gott beurteilen und richten zu können, anstatt sich von Ihm beurteilen zu lassen und sich Seinem Gericht zu unterwerfen. Es kann nicht anders sein: sobald ich die Unumschränktheit Gottes in Frage ziehe, werfe ich mich zum Beurteiler und Richter Gottes auf. Nicht Er richtet, sondern ich richte. Die natürliche Gesinnung des Menschen empört sich allerdings gegen eine Wahrheit, die gerade der göttlichen Natur entspringt, sich auf sie gründet. Ist Gott Gott, so m u ß Er souverän sein in all Seinem Tun. Jede Lehre, die Gottes unumschränkte Majestät leugnet, oder Ihn als gleichgültig der Sünde und dem Elend des Menschen gegenüber hinstellen will, ist der Wahrheit entgegen und Gottes unwürdig. Gott ist Licht, und das Licht kann sich unmöglich mit der Finsternis im menschlichen Herzen vereinigen; Gott ist Liebe, und die Liebe ist frei, in Heiligkeit ihrer Natur nach zu handeln.
Der Mensch, unwissend über sich selbst und Gott, leugnet freilich sein völliges Verderben, lehnt sich auf gegen Gottes Wort und kritisiert Seine Wege. Aber indem er das tut und sich Gott gegenüber sogar auf den Boden der „Gerechtigkeit" zu stellen wagt, spricht er sich selbst das Urteil und rechtfertigt Gott, wie wir es in dem vorliegenden Falle in der Geschichte Israels sogleich sehen werden. Auf die Frage der Juden: »Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott?" und das „das sei ferne l" des Apostels, folgt unmittelbar das Wort: „Denn er sagt zu Moses: „Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme"."
Auf den ersten Blick möchte uns diese Anführung seltsam erscheinen, aber wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, bei welcher Gelegenheit die Worte gesprochen wurden, werden wir (wie so oft bei der Betrachtung des Wortes) die Entdeckung machen, daß gerade das vermeintliche Nichtangebrachtsein sich ins Gegenteil verwandelt. Der scheinbare Mißklang wird zum herrlichsten Wohlklang. Je näher wir die Umstände ins Auge fassen, die zu jenem Ausspruch führten, desto klarer erkennen wir die schlagende Beweiskraft der Antwort des Apostels. Wir erkennen, daß in der ganzen Bibel sich keine Stelle findet, die in diesem Falle mehr angebracht gewesen wäre, als gerade diese.
Israel hatte am Berge Sinai, bis wohin Gottes Gnade sie auf Adlers Flügeln getragen hatte, auf die von Gott gestellte Bedingung: „Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet", geantwortet: „Alles, was Jehova geredet hat, wollen wir tun." Anstatt sich auch weiterhin jener Gnade anzuvertrauen, maßten sie sich an, trotz all der beschämenden Erfahrungen, die sie bereits gemacht hatten, in eigener Kraft die Gebote Gottes zu erfüllen.
Die Folge war das Bündnis des Gesetzes, die Mitteilung der gerechten und heiligen Forderungen Gottes an den Menschen im Fleische. Damit begann die eigentliche Geschichte Israels als Volk. Mose stieg auf den Berg, um die Gebote Gottes entgegenzunehmen. Als er verzog, wurde das Volk ungeduldig und veranlaßte Aaron zur Anfertigung und Aufstellung des goldenen Kalbes. Indem Israel so das erste und größte Gebot gröblich brach, blieb nichts anderes als ein unmittelbares, vernichtendes Gericht für sie übrig. Kaum hatte seine Geschichte als Volk begonnen, so büßte es schon mit einem Schlage alles ein, worauf es unter der Bedingung eines willigen Gehorsams Anspruch hatte. Der Gott, der die Verheißungen gegeben hatte und sie allein erfüllen konnte, war aufs schwerste beleidigt worden. Sein Bund war gebrochen. Was blieb für Israel übrig? Wenn Gott mit Seinem Volke in Gerechtigkeit handeln wollte, und auf dem Boden des Gesetzes konnte Er nicht anders, so mußten alle getötet werden. Ein Entrinnen war unmöglich.
Alle Juden, die die Geschichte jener Tage kannten, mußten die Richtigkeit der Beweisführung zugeben. Wollten sie also auf „Gerechtigkeit" Gott gegenüber bestehen, so wäre das Los Israels damals für immer entschieden gewesen, wie Gott denn auch zu Mose sprach: „Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk; und nun laß mich, daß mein Zorn wider sie entbrenne und ich sie vernichte" (2. Mose 32, 9. 10). Wahrlich, nicht „um ihrer Gerechtigkeit willen" hatte Gott ihnen das gute Land gegeben (5. Mose 9, 6), sondern weil Er der Fürbitte Moses (eines Vorbildes von Christo) Gehör schenkte und sich auf den Boden Seiner unumschränkten Gnade zurückzog:
„Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen . . . und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde usw." (2. Mose 33, 19). Nur so konnte Er sich des Übels gereuen lassen, das Er geredet hatte (Kap. 32, 14), nur so die Missetat vergeben. Ja, mehr noch; gerade in der Hartnäckigkeit des Volkes, die auf dem Boden der Gerechtigkeit das Gericht herbeiführte, konnte die Gnade einen Beweggrund für Gott finden, in der Mitte des Volkes hinaufzuziehen: „Wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr", so betete Mose in Kapitel 34, 9, „so ziehe doch der Herr in unserer Mitte; denn es ist ein hartnäckiges Volk".
Wie wunderbar ist das alles! Wenn der Mensch hoffnungslos verloren ist auf Grund seines Tuns, wenn die Gerechtigkeit Gottes nur Zorn und Gericht über ihn bringen kann wegen seines Ungehorsams und seiner Sünde, wenn das Gesetz ihn verfluchen und zum Tode verurteilen muß, hat Gott doch noch Hilfsquellen in sich, zu denen Er Zuflucht nehmen kann. Vorausblickend auf den kommenden großen Mittler, der hier in Mose ein so liebliches Vorbild findet, konnte Gott Gnade und Erbarmen üben, und zwar, beachten wir es wohl, an wem Er wollte, nach dem Vorsatz Seiner freien, bedingungslosen Gnade.
„Also nun liegt es nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott" (V. 16). Doch wenn Gott begnadigen will, wie groß sind dann die Sünden eines Menschen, der sich diesem Begnadigungswillen widersetzt und Gottes Absichten zu durchkreuzen sucht! Auch diese Seite muß hervorgehoben, und es muß gezeigt werden, wie Gott mit einem solchen Menschen handelt. Gott muß auf der ganzen Erde bekannt werden als der Gott, der sich nicht ungestraft spotten läßt. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, verstehen wir gut das nun folgende Wort: „Denn die Schrift sagt zum Pharao: „Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde." So denn, wen er will begnadigt er, und wen er will verhärtet er" (V. 17. 18).
Der Pharao sollte für alle Zeiten als ein Beispiel dafür dastehen, was Jehova, der Gott Israels, mit einem Menschen zu tun vermag, der auf Sein Gebot: „Laß mein Volk Israel ziehen, daß sie mir ein Fest halten in der Wüste", in maßloser Überhebung zu sagen wagte; „Wer ist Jehova, auf dessen Stimme ich. hören soll? . . . Ich kenne Jehova nicht, und ich werde Israel nicht ziehen lassen", und der im Anschluß an diese lästerlichen Worte befahl, den ohnehin schon so harten Dienst der Israeliten noch zu erschweren und Unmögliches von ihnen zu fordern. (2. Mose 5, 1 ff.) In dem an und für sich schon hochmütigen und grausamen Menschen rief Gottes Botschaft nur den Entschluß wach, sich dem Willen Gottes zu widersetzen und Seine Pläne zunichte zu machen. Beachten wir zugleich, daß sein Zustand immer böser wurde, je länger Gott mit ihm redete. Siebenmal lesen wir: „Das Herz des Pharao verhärtete (oder verstockte) sich", oder: „Der Pharao verstockte sein Herz"; schließlich erst, nachdem die schwersten Plagen über ihn gekommen waren, und sogar seine eigenen Weisen und Zauberkünstler hatten eingestehen müssen: „Das ist Gottes Finger!" wird gesagt: „Und Jehova verhärtete das Herz des Pharao." Und als er endlich seine Zustimmung zum Auszug Israels gegeben hatte, offenbarte sich die unverbesserliche Bosheit seines Herzens wiederum darin, daß er wutschnaubend mit einem gewaltigen Heere dem Volke nachzog, immer noch wähnend, Jehovas erhobenem Arm widerstehen zu können. Ist's ein Wunder, daß Gott ihn endlich in richterlicher Weise verhärtete und für alle Zeiten als ein warnendes Beispiel hinstellte? Gott bestimmt nie einen Menschen zur Verhärtung, Er macht nie einen Menschen böse, nein, der Mensch, durch seinen Fall unter die Gewalt der Sünde gekommen, schreitet von Bösem zu immer Böserem.
Was hat also Gott in dem Falle des Pharao getan? Er hat diesen Mann zu der gewaltigen Höhe, auf der er stand, emporsteigen lassen, damit sein kläglicher Untergang im Schilfmeere für alle Zeiten kundtue, was es ist, seinen Nacken gegen Gott zu verhärten. Seine Geschichte redet heute noch zu den Gewissen der Menschen.
Ganz ähnlich wie dem Pharao ist es dem Volke Israel ergangen, nur mit dem Unterschied, daß dieses Volk hier und so oft in späteren Tagen der Gegenstand der errettenden oder wiederherstellenden Gnade Gottes gewesen ist. Diese Tatsache macht seine Verantwortlichkeit umso größer und seinen Fall umso tiefer. Anstatt auf die ernsten Mahnungen Gottes zu hören, empörten sie sich gegen Ihn, warfen Sein Gesetz hinter ihren Rücken und verübten große Schmähungen. Ja, sie „verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und äfften seine Propheten (geradeso wie der Pharao), bis der Grimm Jehovas gegen sein Volk stieg, daß keine Heilung mehr war". (Vergl. Neh. 9, 26—29; 2. Chron. 36, 14—16.) Wieder möchten wir fragen: Ist es ein Wunder, wenn Gott endlich Seinem Propheten Jesajas die Worte zuruft: „Mache das Herz dieses Volkes fett, und mache seine Ohren schwer, und verklebe seine Augen: damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde"? Geistliche Verblendung und Verhärtung kam von seilen Gottes über ihre bösen, widerspenstigen Herzen, und als der Herr Jesus später in ihre Mitte trat, da „glaubten sie nicht an ihn", ja, sie „konnten nicht glauben, weil Jesajas gesagt hat: „Er hat ihre Augen verblendet usw."." (Jes. 6, 8—l0; Joh. 12, 37—40). In ähnlicher Weise schreibt der Apostel Petrus von den „Ungehorsamen" unserer Tage, daß sie gesetzt worden sind, sich an dem Worte zu stoßen. (1. Petr. 2, 7. 8.) Gott hat diese hochmütigen Menschen, gleich dem Pharao vor alters, gesetzt, um als warnende Beispiele für andere zu dienen. Er hat sie nicht ungehorsam gemacht, aber Er hat sie, vielleicht nach zahlreichen vergeblichen Mahnungen, der Härte ihrer Herzen hingegeben.
So liegt denn in beiden Fällen, ob Gott den Menschen begnadigt oder verhärtet, die Ungerechtigkeit nicht auf Gottes, sondern auf des Menschen Seite, der, soweit es ihn betrifft, unverbesserlich böse und verderbt ist; und in beiden Fällen, sei es in Gnade oder in Gericht, handelt Gott zur Verherrlichung Seines großen Namens. Alle, die auf Gottes Wort achten und geistliches Verständnis haben, werden hierin auch kaum eine Schwierigkeit finden; nur die menschliche Vernunft zieht immer wieder ihre verkehrten Schlüsse. Indem der Apostel, durch den Geist Gottes geleitet, diese Schlüsse einen nach dem anderen aufzählt, begegnet er ihnen zugleich in einer Weise, die unsere ungeteilte Bewunderung wachruft. Wir kommen jetzt zu dem letzten derselben:
„Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden?" (V. 19). Mit anderen Worten: Wenn Gott begnadigt, wen Er will, was kann ich dann dazu beitragen? und wenn Er verhärtet, w e n E r will, was kann ich dagegen tun? Ist Er der unumschränkte Gott, so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich Seinem Willen zu unterwerfen.
Der Einwand scheint begründet zu sein. Warum tadelt Gott noch? Wenn alles sich schließlich Seinem Willen und Ratschluß unterwerfen muß, so kann der Mensch für das Endergebnis doch nicht verantwortlich gemacht werden! Der Ausgang des Weges seines Lebens steht ja bei Gott! Das erinnert uns unwillkürlich an die Entschuldigungen des ersten Menschenpaares nach dem Sündenfall. Auch damals suchten Adam und Eva die Verantwortlichkeit für das Geschehene Gott zuzuschieben. Warum hatte Er der Schlange den Zugang zu dem Garten Eden gestattet? Warum dem Manne das Weib gegeben, das ihn betrügen sollte? — In Römer 9 lauten die Fragen ja anders, aber der Grundsatz ist derselbe: Gott ist schuldig, nicht der Mensch. Warum errettet Er den einen und verwirft den anderen? Was kann der Mensch dazu, wenn Gott ihn verhärtet?
Noch einmal sei es gesagt, daß alle diese Fragen und Schlußfolgerungen einerseits die Herrlichkeit Gottes außer acht lassen und andererseits die Verantwortlichkeit des Geschöpfes vergessen. Gottes unumschränkter Vorsatz — und wie wäre Er Gott, wenn Er nicht unumschränkt wäre? — hebt die Verantwortlichkeit des Menschen nicht auf. Nehmen wir als erläuterndes Beispiel das Kreuz. Der bestimmte Ratschluß, daß der Geliebte Gottes leiden sollte, war schon vor Grundlegung der Welt gefaßt; Gott hatte Jesum nach Seiner Vorkenntnis zuvorbestimmt, das Lamm zu werden, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber verminderte das irgendwie die Schuld des Menschen? Nicht im geringsten! Juden und Heiden fanden sich an jenem Tage zusammen und wurden Freunde in ihrer gemeinsamen Feindschaft gegen Gott und Seinen Gesalbten; und obwohl ihr Tun die Stimme der Propheten erfüllte und Gott Gelegenheit gab, Sein heiliges Urteil über die Sünde zu vollziehen und das wunderbare Werk Seiner Gnade auszuführen, waren und blieben sie doch schuldig der Verwerfung und Ermordung des Sohnes Gottes. (Vergl. Apstgsch. 2, 22. 23.) Beide Dinge gingen nebeneinander her.
Die Schlußfolgerung, aus welcher die Frage: „Warum tadelt Er noch?" herauswächst, ist also durchaus trüglich. Wenn Gott in der Größe Seiner Weisheit und dem Reichtum Seines Erbarmens das böse Tun des Menschen zur Erfüllung Seiner Ratschlüsse ausschlagen läßt, so ist das eben Sein unumschränktes Walten, läßt aber den Willen des Menschen immer als das bestehen, was er ist: böse und unentschuldbar. Freilich, wenn es wahr wäre, was die streng calvinistische Theologie lehrt, daß Gott die, welche verloren gehen, zur Verdammnis zuvorbestimmt habe, so läge der Fall schwierig. Aber Gott sei gepriesen! Es ist nicht wahr. Die Schrift redet niemals so, wenngleich es einige Stellen geben mag, die jene Meinung zu stützen scheinen.
Wie liegen denn die Dinge? Ehe der Apostel dazu übergeht, die gestellte Frage zu beantworten, betont er, wie schon wiederholt bemerkt, die Unumschränktheit Gottes, das erste Seiner Rechte, und zeigt dem Fragenden die Verkehrtheit seines Herzens. Würde wohl ein Mensch, dessen Gewissen irgendwie wach und tätig ist, so reden können, wie es hier geschieht? Nimmermehr wird eine bußfertige Seele Gott Ungerechtigkeit zuschreiben oder Ihn beschuldigen, Er sei verantwortlich für das Verlorengehen eines Menschen. Wer eine solch böse Sprache führt, beweist damit nur die natürliche Blindheit und den Hochmut seines Herzens. „Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst wider Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich also gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen?" (V. 20. 21). Wenn aber das Geschöpf schon solche Macht hat — und wer will das bestreiten? — wieviel mehr dann der Schöpfer!
„Warum hast du mich also gemacht?" Diese Frage im Munde eines Menschen Gott gegenüber, sagt letzten Endes nichts anderes als dies: Gott hat kein Recht, das Böse zu richten, und wenn Er nicht alle begnadigen und retten will, so darf Er wenigstens niemand bestrafen. Jede gerechte Regierung und Vergeltung ist damit beseitigt, und Gott ist gezwungen, das Böse in einer Weise zu dulden, wie es kein ehrbarer Mensch in seinem Hause oder in seiner Umgebung dulden würde. Daß Gott den Menschen gut und aufrichtig geschaffen und ihn ernst und eindringlich vor der Sünde und ihren Folgen gewarnt hat, daß aber der Mensch der Versuchung unterlegen ist und nachher Sünde auf Sünde, Gewalttat auf Gewalttat gehäuft hat — alles das wird absichtlich übersehen oder entschuldigt.
Aber man könnte fragen: Liegt in den Worten des Apostels, daß der Töpfer nach seinem Belieben aus demselben Ton ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen vermag, nicht doch eine Bestätigung dessen, was man Gott zum Vorwurf macht? Tatsächlich ist die Sprache des Apostels kühn, und selbst verständige Männer und einsichtsvolle Ausleger des Wortes Gottes sind an dieser Stelle irre geworden, indem sie vergaßen, daß dem Schreiber zunächst nur daran lag, die Unumschränktheit Gottes in ihrer ganzen Unverletzlichkeit aufrecht zu halten, und es weiter übersahen, daß Gott von Seinem Rechte gar nicht in der Weise Gebrauch gemacht hat, wie man es nach dem Bilde von dem Töpfer erwarten sollte. Die beiden nächsten Verse werden uns darüber belehren, wie Gott gehandelt hat; aber es war Gott gegenüber geziemend und für den Menschen nützlich, vorher die unumschränkten Rechte Gottes festzustellen. Wie selten denken gerade solche, die immer wieder von „Rechten" reden, daran, daß Gott auch Rechte hat! Ja, wenn es überhaupt Rechte gibt, so müssen die Seinigen als Schöpfer die höchsten, ja, unumschränkt sein, vor allem wenn wir uns daran erinnern, daß wir nicht nur Geschöpfe, sondern g e f a 11 e n e Geschöpfe, Sünder, sind, die notwendigerweise die Früchte ihres bösen Tuns ernten müssen.
Doch hören wir, wie der Apostel die schwierige Frage beantwortet: „Wenn aber Gott, willens, seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben, — und auf daß er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat . . . ? uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen" (V. 22—24).
Wir haben weiter oben schon darauf aufmerksam gemacht, daß Gott notwendigerweise einmal Seinen Zorn über all das Böse, das in dieser Welt geschehen ist und geschieht, erweisen und an den hochmütigen, eigenwilligen Menschen Seine Macht kundtun muß, wenn Er anders Seinen Charakter als der heilige Gott aufrecht halten will. Wie nun, wenn Er bis heute diesen Zorn und diese Macht nicht kundgetan, sondern statt dessen, „mit vieler Langmut" die Gefäße des Zorns ertragen hat — kann man Ihm dann mit irgendwelchem Recht den Vorwurf der Unbarmherzigkeit oder der Ungerechtigkeit machen? Könnte der dreimal heilige Gott dem Bösen gegenüber gleichgültig bleiben oder gar Gemeinschaft mit ihm haben? Unmöglich! Und doch hat Er, trotzdem der Mensch, solang seine Geschichte währt, nicht aufgehört hat, Ihn durch die Verachtung aller Seiner Rechte zu reizen und Ihn durch seinen unglaublichen Hochmut, durch Sitten-losigkeit, Götzendienst, Fluchen und Lästern herauszufordern, bis heute gezögert, das tausendfach verdiente Gericht auszuführen. Wie gnädig und langmütig ist Er also gewesen! Er hat „die Gefäße des Zorns", d. h. die Menschen, an denen Er Seinen Zorn erzeigen will, in wunderbarer Güte und Nachsicht getragen, ja, hat ihnen nichts als Gnade erwiesen, indem Er immer wieder zu ihnen redete, „früh sich aufmachend", wie einst bei Israel. Aber was haben sie demgegenüber getan? Sie haben all Seinen Rat verworfen und Seine Zucht nicht gewollt! Tut Er recht, wenn Er sie essen läßt von der Frucht ihres Weges und sie sich sättigen läßt von ihren Ratschlägen? (Vergl. Spr. 1. 24—33.)
Der Apostel nennt diese Menschen, im Anschluß an das Bild von dem Töpfer, „Gefäße des Zornes", wie er auf der anderen Seite diejenigen, welche sich Gott unterwerfen und Seinem Worte glauben, als „Gefäße der Begnadigung" bezeichnet. Beide sind auf dem Wege zu ihrem endlichen Ziele, zum Verderben oder zur Herrlichkeit. Beide sind dazu „bereitet". Aber übersehen wir nicht den großen Unterschied in der Art der Zubereitung! Viele haben ihn übersehen und dadurch den Sinn oder doch die Kraft der Beweisführung des Apostels nicht erfaßt. Von den Gefäßen des Zornes sagt er nur: „zubereitet zum Verderben", von den Gefäßen der Begnadigung aber: „die e r (Gott) zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat". Von den Gefäßen des Zornes wird weder hier noch an irgend einer anderen Stelle gesagt, daß Gott sie zum Verderben zubereitet habe; nein, sie selbst haben es getan durch ihre Sünden und vor allem durch ihren Unglauben und ihre Auflehnung gegen Gott. Die Gefäße der Begnadigung aber hat Gott bereitet, und zwar z u v o r-bereitet und zur Herrlichkeit bestimmt. S i e haben nichts dazu beigetragen, alles ist G o 11 e s Werk, ausgeführt „nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben worden ist" (2. Tim. 1. 9).
So ist denn wiederum das Böse nur auf des Menschen, nicht auf Gottes Seite, und anderseits kommt das Gute nur von Gott, nicht von uns. Ferner bestätigt sich wieder, daß der Vorsatz Gottes nach Auswahl besteht, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden. (V. 11.) Die Gefäße der Begnadigung sind nicht etwa zur Herrlichkeit bestimmt, weil sie sich vor anderen durch besondere Vorzüge oder geistliche Tugenden ausgezeichnet haben, sondern Gott hat sie nach Seiner unumschränkten Auswahl, „nach Wahl der Gnade", bedingungslos zur Herrlichkeit zuvorbereitet. Daß sie im Laufe der Zeit berufen, gerechtfertigt usw. werden mußten (vergl. Kap. 8, 29. 30), und daß Gott das eine Gefäß mit mehr geistlichen Kräften und Gnadengaben füllt, als das andere, ist gewiß so, aber alle sind von Ihm zuvorbereitet worden, ehe eines von ihnen da war, und zwar bereitet für Seine eigene Herrlichkeit. Darum, wie wir schon wiederholt betonten, werden sie alle dereinst nur Gottes unergründliche, nie fehlende Gnade rühmen. Voll und ganz wird das Wort in Erfüllung gehen: „Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!"
Wenn diese Fülle der Gnade vor die Seele des Apostels tritt, kann er nicht anders, als auf ihre herrlichste Darstellung hindeuten, wie sie sich in der Berufung der Gläubigen „nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen" (V. 24) erwiesen hat. Hat die Erprobung des meistbegünstigten Volkes dieser Erde nur in hoffnungsloser Verschuldung und unheilbarem Verfall geendet, so daß nichts anderes als Zorn und Gericht übrigblieb, so haben sich die Schleusen der göttlichen Barmherzigkeit geöffnet, um aus Judenund Heiden ein Volk für die himmlische Herrlichkeit zu berufen. Je größer die Not, je tiefer das Verderben, desto weiter öffnet sich das Feld für Gott, um die Herrlichkeit Seiner Gnade zu offenbaren.
Der Apostel führt jetzt zwei Stellen aus dem Propheten Hosea an, Kapitel 1. 10 und 2, 23, um zu zeigen, daß Gott schon in jenen alten Tagen durch Seinen Geist auf diese Dinge hingewiesen hatte. Petrus, der ausschließlich an Gläubige aus Israel schreibt, beschränkt sich auf die Anführung der zweiten Stelle, (1. Petr. 2, 10.) In Verbindung mit dem Gedanken an die Einführung der Heiden, nennt der Apostel der Nationen beide. Im 25. Verse betont er zunächst, daß Gott Seines Ratschlusses im Blick auf Israel gedenken und das Volk, das jetzt den Namen „Nicht-mein-Volk" trägt, am Ende der Tage wieder „Mein Volk" und „die Nicht-Geliebte Geliebte" nennen wird. Im 26. Verse lenkt er dann unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß die zweite angeführte Stelle eine Anspielung auf die Heiden enthält: „Und es wird geschehen, an dem Orte, da zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, daselbst werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden." Dieser Titel ist das besondere Vorrecht der Gläubigen aus den Nationen, nicht der Juden als des irdischen Eigentumsvolkes Gottes.
Die Beweisführung des Apostels ist also einfach und klar. Die im 23. Verse ausgesprochene Gnadenberufung Gottes aus Juden und Heiden war nicht ein neuer, dem Alten Testament völlig fremder Gedanke, sondern stimmte mit dessen Belehrungen durchaus überein. Schon durch Hosea hatte Gott davon gesprochen, daß Er sich Seiner unumschränkten Gnade zu Gunsten von Juden und Heiden bedienen wolle.
Aber auch andere Propheten hatten ähnliches bezeugt. So hatte Jesajas mit der Ankündigung der ernsten Gerichte, die über Israel kommen sollten, den Ruf verbunden, daß ein Überrest errettet werden würde. Denn Gott würde eine abgekürzte Sache auf Erden tun und die Sache vollenden in Gerechtigkeit. Ja, schon in Kapitel 1. 9 hatte Jesajas geweissagt: „Wenn nicht der Herr Zebaoth uns Samen übriggelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden." Auf Grund Seiner Gerechtigkeit hätte Gott das ganze Volk vernichten müssen, aber hinblickend auf Seine bedingungslose Verheißung konnte und kann Er in Gnaden mit ihm handeln und ihm „einen Samen übriglassen". Die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht.
Ach, wenn Israel nur auf diese mit der Androhung vernichtender Gerichte verbundenen Hinweise auf Gottes Handeln in Gnade gehört hätte! Aber sie hatten ihre Ohren verschlossen und ihre Herzen verhärtet und taten es immer noch.
„Was sollen wir nun sagen?" Oder: Zu welchem Ergebnis sind wir gelangt? Zu dem, „daß die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist; Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist" (V. 30. 31). Die vergangene Geschichte Israels und die Lage des Volkes in jenen Tagen bewiesen deutlich, wie wahr die Propheten geredet hatten. Warum war Israel nach Assyrien und Babel weggeführt worden? Weshalb standen sie zur Zeit unter der Herrschaft eines heidnischen Tyrannen? Und mehr noch: was war in sittlicher Beziehung aus ihnen geworden? Auf dem Boden des Gesetzes stehend, hatten sie nach einer äußeren, gesetzlichen Gerechtigkeit gestrebt und keine Gerechtigkeit erlangt. Dagegen war auf gerechter Grundlage die Gnade Gottes gegen solche überströmend geworden, die fern von Gott in der Finsternis ihrer Herzen dahingingen. Heiden, die „ohne Hoffnung" in der Welt standen und der Gerechtigkeit nicht nachstrebten, hatten umsonst Gerechtigkeit erlangt, und zwar eine Gerechtigkeit aus Glauben, erreichbar also für alle, die ohne Gesetz lebten, aber auch für alle aus Israel, die in der Erkenntnis ihres traurigen Zustandes bereit waren, zu der Gnade ihre Zuflucht zu nehmen.
Und warum waren die Juden nicht zur Gerechtigkeit gelangt? Eben weil sie ihr „nicht aus Glauben, sondern als aus Werken" nachgestrebt hatten. (V. 32.) In ihrem Hochmut wähnend, den heiligen Gott mit ihren gesetzlichen Werken befriedigen zu können, ja, stolz auf ihre nationalen Vorzüge und ihre vermeintliche Gerechtigkeit, hatten sie sich an Christo, dem Stein, den Gott in Gnaden in Zion gelegt hat, gestoßen. Hätten sie nicht einen solchen Heiland dankbar begrüßen sollen? Statt dessen war Er ein „Stein des Anstoßes" für sie geworden. Anstatt an Ihn zu glauben und so Seiner „Kostbarkeit" teilhaftig zu werden, hatten sie sich an Ihm geärgert, wie geschrieben steht: „Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden."
Es ist interessant zu sehen, wie der Heilige Geist durch den Apostel die beiden Aussprüche des Propheten Jesajas in Kapitel 8, 14 und 28, 16 hier miteinander verbindet.
Kapitel 10
Der Apostel setzt in diesem Kapitel die Behandlung der angeregten Frage fort. Wenn die Masse des jüdischen Volkes dem Gericht verfallen war und nur ein Überrest mit den Gläubigen aus den Nationen gesegnet werden sollte, lag dann vielleicht eine endgültige Verwerfung Israels in Gottes Gedanken? Hatte Er gar Sein Volk verstoßen? Indem er die eingehende Antwort dieser Frage erst im nächsten Kapitel bringt, betont der Apostel hier, wie im Anfang des 9. Kapitels, zunächst seine eigene Stellung zu diesem Volke. Die ernsten Wege Gottes mit Israel hatten nicht etwa seine Gefühle für seine Brüder erstickt, sie hatten im Gegenteil dazu gedient, in seinem Herzen ein heißes, dringendes Flehen für sie wachzurufen, „ein Flehen zu Gott um ihre Errettung". Die Liebe läßt sich nicht erbittern. Sie sucht nach Gründen, um das Tun des anderen im mildesten Licht darzustellen, und handelt so in Übereinstimmung mit Gott, der „den ganzen Tag seine Hände ausbreitet zu einem widerspenstigen Volke" (Jes. 65, 2).
„Brüder! das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, daß sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, daß sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis" (V. 1. 2). Danach waren also nicht Unglaube und Bosheit die Ursache ihres traurigen Zustandes, nein, die Liebe erkennt in ihrem Tun einen Eifer für Gott, der allerdings nicht mit Erkenntnis verbunden war. Und gerade dieser Eifer verdoppelte die Gefühle des Apostels für sie und vertiefte seine um sie sorgende Liebe. „Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen" (V. 3). Wie wunderbar sind doch die Wege, welche die Liebe findeti Wie zart ist sie bei aller Treue und Wahrheit!
Doch der Apostel geht hier einen Schritt weiter als am Ende des vorigen Kapitels. Hörten wir dort, daß Israel vergeblich nach Gerechtigkeit gestrebt habe, so wird uns hier gesagt, daß sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannt und sich ihr nicht unterworfen hätten. Wir haben uns in den früheren Kapiteln mit der Gerechtigkeit Gottes, dem großen Thema unseres Briefes, schon so eingehend beschäftigt, daß ich hier wohl nur kurz zu wiederholen brauche: diese Gerechtigkeit hat sich darin geoffenbart und erwiesen, daß Gott Christum, nachdem Er am Kreuze zur Sünde gemacht war, und Gott im Blick auf Seine eigene Person, auf die Sünde und das Verhältnis des sündigen Menschen zu Ihm völlig verherrlicht worden ist, aus den Toten auferweckt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und uns Ihm geschenkt hat als Frucht der Mühsal Seiner Seele. Wir erinnern uns auch an das Wort:
„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm" (2. Kor. 5, 21). Indem die Juden nun eine eigene, menschliche Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, hatten sie bewiesen, daß sie mit der Gerechtigkeit Gottes völlig unbekannt waren und sich nicht vor ihr gebeugt hatten. Sich stützend auf eine Religion des Fleisches, auf äußere Vorzüge als Gottes irdisches Volk, gründeten sie ihre Hoffnungen auf eigenes Verdienst und verwarfen damit den einzigen Weg, auf welchem Gott gerecht sein und sich doch als der errettende und rechtfertigende Gott dem verlorenen Sünder gegenüber offenbaren kann. Der törichte, ruhmsüchtige Mensch gefällt sich darin, einer eigenen Gerechtigkeit nachzustreben, sich mit selbstverfertigten Lumpen zu behängen, anstatt das ihm von Gott umsonst angebotene Kleid der göttlichen Gerechtigkeit anzunehmen und sich so S e i n e r Gerechtigkeit dankbar zu unterwerfen.
„Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit" (V. 4). Christus hat mit dem Gesetz als einem Mittel, Gerechtigkeit zu erlangen, ein für allemal ein Ende gemacht. Dem Glaubenden wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Bis „der Sohn" (Christus) kam und das ganz neue, auf den rechtfertigenden Glauben an Ihn gegründete Verhältnis zu Gott einführte, war der „Zuchtmeister" oder „Vormund" durchaus am Platze für alle, die seiner Sorge anvertraut waren. (Vergl. Gal. 3 u. 4.) Nachdem nun aber Christus an die Stelle des Gesetzes getreten ist und die Ansprüche Gottes, das was Sein Gesetz gerechterweise über uns bringen mußte, Tod und Verdammnis, auf sich genommen hat, ist Er zugleich für jeden, der von Herzen an Ihn glaubt, „Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung" geworden. Welch ein Wechsel! Gerechtigkeit hat den Platz des Gesetzes eingenommen, „Gerechtigkeit aus Glauben an Christum". Der Grundsatz der Verantwortlichkeit des Menschen im Fleische Gott gegenüber hat im Tode Christi sein Ende gefunden. Obwohl das Gesetz als solches seine Gültigkeit nicht verloren hat, nicht verlieren kann, konnte es doch nicht länger als Regel und Maßstab der Gerechtigkeit für den Menschen festgehalten werden.
Naturgemäß weiß das Gesetz von Glauben nichts. Moses beschreibt vielmehr die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, also: „Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben" (V. 5). Das Gesetz kennt nur ein Tun, ein Erfüllen seiner Gebote. Und es ist recht so; denn „das Gesetz ist heilig, und das Gebot heilig, gerecht und gut" (Kap. 7, 12). Jeder Mensch ist verpflichtet, die Gebote des Gesetzes zu halten, und wer eines von ihnen übertritt, macht sich der Übertretung des ganzen Gesetzes und damit des Todes schuldig.
Wie ganz anders aber spricht die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist! Indem der Apostel das näher ausführt, bezieht er sich auf eine Stelle im 5. Buche Mose, mit der wir uns ein wenig näher beschäftigen müssen. In den Kapiteln 28 und 29 dieses Buches kündigt Moses dem Volke Israel an, welch reiche Segnungen Jehova über sie kommen lassen wolle, wenn sie fleißig Seiner Stimme gehorchen würden, aber auch welch ernste Gerichte sie treffen müßten, wenn sie nicht darauf achten würden, alle Seine Gebote und Satzungen zu tun. Die Geschichte Israels ist uns bekannt. Das Volk hat der Stimme seines Gottes nicht gehorcht, hat infolge seines Ungehorsams sein Land verloren und ist unter die Völker der Erde zerstreut worden. Und nun beschreibt Moses im 30. Kapitel in prophetischem Vorausblick das, was Gottes Barmherzigkeit tun würde, wenn einmal die Gnade sie zur Umkehr und Buße geleitet hätte. Die Erfüllung des Gesetzes ist für Israel in einem fremden Lande nicht möglich, aber deshalb sind die Hilfsquellen der Gnade nicht erschöpft. Wenn das Volk mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Seele zu Jehova umkehren würde (V. 10), so sollten ihm Vergebung und Segen zuteil werden, nicht auf Grund seines Tuns, sondern auf dem Boden des Glaubens. Die damals noch verborgenen Wege der Gnade Gottes (Kap. 29, 29) sollten sich an ihnen erfüllen, „Jehova würde sich wieder über sie freuen zum Guten". „Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist nicht fern. Es ist nicht im Himmel, daß du sagen könntest: Wer wird für uns in den Himmel steigen und es uns holen und es uns hören lassen, daß wir es tun? Und es ist nicht jenseit des Meeres, daß du sagen könntest: Wer wird für uns jenseit des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, daß wir es tun? sondern sehr nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, um es zu tun" (5. Mose 30, 11—14).
Israel mag noch so weit von Gott entfernt sein, es darf wieder zu Ihm zurückkehren. Das Gebot ist nicht zu wunderbar, nicht zu fern von ihm. Sie brauchen es nicht aus dem Himmel herabzuholen oder es jenseit des Meeres zu suchen, es ist ihnen sehr nahe, in ihrem Mund und ihrem Herzen. Auf dem Boden des Gesetzes ist freilich nur Gericht ihr Teil, aber auf dem Boden der Gnade gibt es mittelst des Glaubens noch Hoffnung für sie. Trotz ihrer Untreue, trotz des gebrochenen Gesetzes will Gottes Güte sich ihnen zuwenden, sobald ihr Herz aufrichtig zu Ihm umkehrt. Doch wie kann Gott so handeln? Weil Sein Auge allzeit auf Christum blickt, dessen Person auch hier unter den Schatten des Gesetzes verborgen liegt. In Ihm, dem Gerechten, ist Hoffnung für Israel, auch wenn es, fern von seinem Lande, fern von Tempel und Altar, die Frucht seiner Sünde erntet.
Das Wort nun, das dem Überrest aus Israel am Ende der Tage so nahe sein wird, war, wie der Apostel im 8. Verse sagt, das Wort des Glaubens, das er predigte; und anknüpfend an die Mitteilungen Gottes in den Tagen Moses" und dem „Buchstaben" seine wahre geistliche Bedeutung gebend (vergl. 2. Kor. 3, 6), schreibt er: „Die Gerechtigeit aus Glauben aber sagt also: Sprich nicht in deinem Herzen: „Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?" das ist, um Christum herabzuführen; oder; „Wer wird in den Abgrund hinabsteigen?" das ist, um Christum aus den Toten heraufzuführen" (V. 6. 7). Dem Menschen ist beides unmöglich. Und wenn er es tun könnte, würde es doch weder die Gerechtigkeit Gottes befriedigen, noch seinen eigenen Bedürfnissen entsprechen. Nein, hier konnte nur die Fülle der Gnade helfen. Der Vater mußte den Sohn herabsenden, und die Herrlichkeit des Vaters mußte Ihn aus den Toten auferwecken. Beides ist, Gott sei gepriesen! geschehen, und die Kunde davon wird uns in dem Evangelium nahe gebracht. Denn was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben weiter? „Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen; das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen, daß, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst" (V. 8. 9). „Errettet" — nicht nur der Vergebung teilhaftig, nein, für immer und ewig errettet. (Vergl. Kap. 5, 10.)
Es bedarf keiner großen Anstrengungen oder umfassenden Vorkehrungen, nicht mühsamer Reisen und dergleichen, um Christum zu finden. Das Wort vom Kreuz wird allen umsonst gepredigt, wird uns sozusagen ins Haus gebracht, und es fragt sich nur, ob wir es gläubig aufnehmen wollen oder nicht. Irgendwie Rühmenswertes kommt dabei für den Menschen allerdings nicht heraus. Es bedarf keines großen Verstandes oder Wissens, keiner hervorragenden Eigenschaften oder Fähigkeiten, um mit dem Munde Jesum als Herrn zu bekennen und im Herzen zu glauben, daß Gott Ihn aus den Toten auferweckt hat. Das vermag selbst der Einfältigste und Schwächste, ja, ihm wird es meist leichter als dem Begabten und Geistesstärkeren. Aber um errettet zu werden, gibt es für alle nur den einen Weg, den Gottes Liebe bereitet hat. „Ich bin der Weg", sagt Jesus; nicht einer von vielen, sondern der eine, der einzige! Glücklich ein jeder, der diesen Weg betreten hat!
Beachten wir die beiden hier genannten notwendigen Stücke: Bekenntnis und G l a u b e! Im 9. Verse wird das Bekenntnis zuerst genannt, nicht weil es das Wichtigste wäre, sondern wohl deshalb, weil es für die Verherrlichung des , Herrn Jesus zunächst in Betracht kommt. Ein bloßes Lippen- l bekenntnis ohne wahren Herzensglauben ist selbstverständlich für den Menschen weniger als wertlos, denn es vermehrt nur seine Verantwortlichkeit; darum fügt der Apostel, die beiden Dinge umstellend, im 10. Verse sogleich hinzu: „Denn ] mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit ^ dem Munde wird bekannt zum Heil." Der Glaube des Herzens ), muß dem Bekenntnis des Mundes vorangehen. Der Mensch muß aus seinem Todesschlafe aufgeweckt werden, das wirk- j same Wort Gottes muß unter der Wirkung des Heiligen { Geistes sein überführendes und reinigendes Werk in der Seele tun, ehe sie in Wahrheit zu Gott schreit. Aber dann wird ihr Blick auf das Kreuz gelenkt; sie hört und ergreift im Glauben die erlösende Botschaft, nicht nur daß Jesus für sie in den Tod gegangen, sondern auch, daß Er durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. Und indem sie nun „mit dem Herzen" zur Gerechtigkeit glaubt, lernt sie Christum kennen als Den, der im Tode war, aber nun lebt zur Rechten Gottes, Ihn, „des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit".
Jetzt darf sie Ihn dankbar und freudig mit ihrem Munde bekennen „zum Heil". Inwiefern „zum Heil"? Ist es nicht so, daß jedes Bekenntnis Seines Namens, wenn es auf den Glauben im Herzen gegründet ist, die innere Freudigkeit, das Glück des Herzens, bewirkt und vermehrt? Der Glaube offenbart sich in einem solchen Bekenntnis, beweist dadurch seine Aufrichtigkeit und wird wiederum selbst belebt und gestärkt. Solang eine Seele sich scheut, Christum als ihren Herrn zu bekennen, solang sie zögert, sich auf Seine Seite zu stellen, bleibt sie ängstlich und verzagt. Schon mancher Gläubige hat die Erfahrung machen müssen, daß erst mit dem offenen Bekenntnis des Namens Jesu wahre Freudigkeit und Heilsgewißheit in sein Herz einzogen.
Damit nun aber niemand mit der Frage sich beschäftige, ob er auch wohl den rechten Glauben oder Glauben genug habe, wie wir es so gern tun, indem wir in u n s, in unseren Gefühlen, in unserer Liebe usw. eine Heilsgrundlage suchen, fügt der Apostel hinzu: „Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden." Darum darf jeder, der im Lichte Gottes sein natürliches Verderben erkannt und seine Zuflucht zu Jesu genommen hat, seiner Errettung gewiß sein. Sie gründet sich nicht auf irgend etwas i n oder von ihm, sondern einzig und allein auf das Werk Christi und auf das Zeugnis Gottes, und wahrlich, da ruht sie auf sicherer Grundlage.
Wenn das aber so ist, wenn diese wunderbare Segnung einem jeden gehört, der an Jesum glaubt, dann muß sie auch für alle Menschen, ob Juden oder Heiden, da sein. Und so ist es in der Tat: „Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen" (V. 12). Tat der Apostel nun unrecht, wie die Juden ihn beschuldigten, wenn er die frohe Botschaft von Jesu aller Welt verkündigte? Nein, schon die Schriften des Alten Testaments rechtfertigten ja, wie wir gesehen haben, seinen Dienst, wieviel mehr das Zeugnis des Herrn selbst! Schön ist es, hier demselben Worte zu begegnen, das im 3. Kapitel gebraucht wird, um das Verlorensein aller Menschen zu bezeugen. „Es ist kein Unterschied", lasen wir dort, „denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes." Hier heißt es: „Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen." So ernst und niederdrückend die Ursache des „kein Unterschied" in dem ersten Falle ist, so herrlich und erhebend ist sie in dem zweiten. Der in dem Evangelium geoffenbarte Reichtum der Gnade ergießt sich, alle Folgen der Sünde überströmend, unterschiedslos zu allen hin, die sich zu Jesu, dem reichen Herrn, wenden. Eine Anführung aus dem Propheten Joel bezüglich der Tage, in welchen ganz Israel errettet werden wird, beschließt dann triumphierend das Ganze. „Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden" (V. 13).
Als die glücklichen Gefäße dieser reichen Gnade werden in jenen Tagen die Bewohner Jerusalems samt den über die ganze Erde hin zerstreut wohnenden gläubigen Israeliten die gute Botschaft des Friedens überallhin tragen, und das Wort des Propheten Jesajas wird sich erfüllen: „Wie lieblich sind die Füße derer, welche das Evangelium des Friedens verkündigen, welche das Evangelium des Guten verkündigen!" (V. 15). Aber glücklicherweise sollen nicht erst dann diese Segensströme fließen, der Heilige Geist wendet die Stelle aus Jesaja 52 (indem Er den Schluß: „der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König!" wegläßt) schon auf unsere Tage an, auf die Zwischenzeit, in welcher die Gemeinde, das Weib des Lammes, aus allen Völkern der Erde gesammelt wird. Alle, die zu dieser bevorzugten Schar gehören, müssen auch durch die Verkündigung des Evangeliums dahin gebracht werden, den Herrn anzurufen. Denn „wie werden sie den anrufen, an welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von welchem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind?" (V. 14. 15).
Unter dem Gesetz, „der Handschrift in Satzungen, die wider uns war" (Kol. 2, 14), konnten unmöglich solche Friedensboten zu den Völkern der Erde ausgehen. Israel wird erst dann ein Missionsvolk werden, wenn es für sich selbst die heilbringende Gnade Gottes in Dem kennen lernt, den es ans Kreuz geschlagen hat. Hat aber einmal das Licht der Gnade in diese finsteren Herzen hineingeleuchtet, so werden die Sendboten aus Israel, die „Brüder" des Herrn (Matth. 25, 40), einen Eifer in der Verkündigung des Evangeliums entfalten, wie er nie vorher gesehen worden ist. Was die christliche Kirche während ihres Jahrtausende alten Bestehens nicht zu tun vermocht hat, wird in verhältnismäßig kurzer Zeit durch diese „Geringsten" zur Ausführung kommen: „Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis" (Matth. 24, 14). Die ganze Erde wird so voll werden von der Erkenntnis des Herrn, daß nicht ein Fleckchen unberührt und ungesegnet bleiben wird. (Vergl. Jes. 11, 9; Hab. 2, 14.)
Der Gnadenratschluß Gottes hat also schon für unsere Tage die Verkündigung der guten Botschaft vorgesehen, und zwar nicht des Evangeliums „des Reiches", sondern des Evangeliums „der Gnade Gottes" und „der Herrlichkeit des Christus" (Apstgsch, 20, 24; 2. Kor. 4, 4). Und wie die Träger der Heilsbotschaft am Ende der Tage, so werden auch heute die wahren Prediger des Evangeliums von dem Herrn selbst ausgesandt. „Wie werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind?" fragt der Apostel. Mögen auch in bester Meinung und guter Absicht überall Missionsgesellschaften für das In- und Ausland errichtet werden, so liegt doch in ihnen allen letzten Endes eine Einmischung des Menschen in die unumschränkten Rechte des Herrn, der allein Evangelisten, Hirten und Lehrer zu geben vermag und zu geben verheißen hat. (Eph. 4,11—14.) Ihn, den Herrn der Ernte, sollen wir bitten, Arbeiter in Seine Ernte auszusenden; wir sollen aber nicht selbst Hand anlegen, um solche für ihren Dienst vorzubereiten, auszurüsten und schließlich auch zu bevollmächtigen. Das Wort und der Wille des Herrn sind in dieser wie in jeder anderen Beziehung klar genug; was wir bedürfen, ist ein einfältiges Auge und ein unterwürfiges Herz. Daß Menschen die Boten des Evangeliums sein sollen, ist offenbar, aber es ist nicht unsere Sache, sie auszuwählen, ebensowenig wie es in unserer Macht steht, ihnen die nötigen Fähigkeiten dazu darzureichen.
Wenn nun aber Gott in Seiner Gnade Seine gute Botschaft verkündigen läßt, so ist jeder, der sie hört, verantwortlich, sie aufzunehmen und dem Evangelium zu gehorchen. Aber geschieht das? Hat vor allem Israel es getan? Ach nein! schon Jesajas ruft klagend: „Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt?" — „Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort" (V. 16. 17). Und diese Verkündigung war an Israel ergangen. Die Juden hatten das Wort Gottes gehört, aber nicht angenommen; sie waren also ohne Entschuldigung.
„Aber ich sage: Haben sie etwa nicht gehört? Ja freilich. „Ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde, und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises" " (V. 18). Wieder entnimmt der Apostel den Beweis für seine Behauptung den eigenen Schriften der Juden, auf die sie so stolz waren. Der 19. Psalm, in welchem die angeführten Worte sich finden, redet von zwei Zeugnissen Gottes, von Seiner Schöpfung und von Seinem Wort; das eine äußerlich und allgemein, das andere innerlich und für die bestimmt, welche das Wort, die Gebote Jehovas, besaßen. Israel hatte beide Zeugnisse nicht angenommen. Indes ist das nicht der Hauptpunkt, den Paulus hier hervorheben will. Die Heiden besaßen das Wort Gottes nicht, aber das Zeugnis Gottes in der Schöpfung ist auch für sie bestimmt. Der Himmel, der die Herrlichkeit Gottes erzählt, wölbte sich nicht nur über Kanaan; Sonne, Mond und Sterne samt den anderen Wundern der Schöpfung waren nicht nur für e i n Volk bestimmt. Das in der Schöpfung und durch sie abgelegte Zeugnis war ganz allgemein, galt Juden und Heiden. (Vergl. Kap. 1. 20; Apstgsch. 14, 17.) Mochte Israel auch die heidnischen Völker verachten, Gott hatte von jeher bewiesen, daß Er in Seinem Erbarmen auch ihrer gedenken und von ihnen erkannt werden wollte.
„Aber ich sage: Hat Israel es etwa nicht erkannt?" Wahrlich, sie hätten es erkennen können, es hätte kein Geheimnis für sie zu sein brauchen. Denn Gott hatte, wie der Apostel weiter zeigt, noch viel deutlicher zu ihnen geredet, als durch den 19. Psalm. „Zuerst spricht Moses: „Ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nicht-Volk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern" " (V. 19). Ihr hochgeachteter Gesetzgeber hatte also schon von der Absicht Gottes geredet, durch Seine Gnadenwege mit einem „Nicht-Volk" und „einer unverständigen Nation" — nicht mißzuverstehende Anspielungen auf die Heiden — Sein Volk Israel zur Eifersucht zu reizen. Aber noch mehr. Jesajas, der größte ihrer Propheten, hatte sich sogar erkühnt zu sagen, daß Gott sich finden lassen wolle von denen, die Ihn nicht suchten, und sich offenbaren wolle denen, die n i c h t nach Ihm fragten, während er von Israel gesagt hatte: „Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volke" (V. 20. 21). So war denn aus dem Gesetz, aus den Psalmen und den Propheten, den drei großen Teilen des Alten Testaments, der Beweis erbracht, daß Israel sich verhärten würde, und daß Gott von jeher beschlossen hatte, den Heiden gnädig zu sein. Der Beweis war unwiderieglidi. Kein aufrichtiger Jude konnte sich der Kraft desselben entziehen.
Was aber folgte daraus? Hatte Gott sich von Seinem Volke endgültig abgewandt? Die ausführliche Beantwortung dieser Frage bringt uns das 11. Kapitel.
Kapitel 11
„Ich sage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, vom Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat" (V. 1. 2). Wie in den ersten Versen der beiden vorhergehenden Kapitel, so weht uns auch hier wieder der warme Hauch der Liebe des Apostels zu seinen Volksgenossen wohltuend entgegen. War Israel trotz all seines Unglaubens nicht das von Gott zuvorerkannte Volk? Gehörten ihm nicht die Verheißungen, die Abraham, ihrem Vater, im Anfang gemacht worden waren? Und als Gott Israel „zuvorerkannte", waren Ihm da nicht alle die bösen Wege, die das Volk gehen würde, all seine Halsstarrigkeit und Bosheit bekannt gewesen? Gewiß! Trotzdem hatte Er es erkannt und berufen und wohl oft und ernst gezüchtigt, aber nie verworfen. Sollte Er es nun jetzt verstoßen haben?
Unmöglich! Für diese Unmöglichkeit führt der Apostel drei Beweise an. Der erste war er selbst. Denn auch er war „ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamme Benjamin". In vermeintlichem Eifer für Gott hatte er sogar die Versammlungen verfolgt und die Gläubigen gezwungen, zu lästern. Und doch hatte Gott den ganzen Reichtum Seiner Gnade und Langmut an ihm erwiesen und ihn, „den Lästerer und Verfolger und Gewalttäter", den bittersten Feind des Namens Jesu, errettet und in Seinen Dienst gestellt. Hätte Gott Sein irdisches Volk verstoßen, so hätte dieses Gericht zuallererst ihn treffen müssen.
Aber Paulus war nicht das einzige Denkmal der göttlichen Gnade. Schon in früheren Zeiten hatte Gott ähnlich gehandelt. „Oder wisset ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elias sagt? wie er vor Gott auftritt wider Israel: „Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übriggeblieben, und sie trachten nach meinem Leben." Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? „Ich habe mir übrigbleiben lassen siebentausend Mann, welche dem Baal das Knie nicht gebeugt haben" " (V.2—4). Der entmutigte Prophet hatte damals auch gemeint, Gott habe Sein Volk dahingegeben, und er sei als der einzige und deshalb bis zum Tode verfolgte Anbeter Jehovas übriggeblieben. Aber wie rührend war die göttliche Antwort! Gerade das Zeugnis des Propheten gegen das Volk rief das Zeugnis Gottes für Israel wach. Noch sieben tausend Mann, eine vollkommene Zahl, hatte Gott übrigbleiben lassen, die ihre Knie vor den Götzen nicht gebeugt hatten. Seine Liebe und unumschränkte Gnade hatten diesen vollzähligen Überrest bewahrt.
Und so wie es in den Tagen einer Isebel gewesen, so war es heute: „Also ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest n a c h W a h l d e r G n a d e" (V. 5). Mochte der allgemeine Zustand des Volkes heute wie damals der der Verhärtung und Verblendung sein, dennoch gab es einen Überrest, „die Auswahl", wie der Apostel ihn im 7. Verse nennt. Israel als solches hatte das, was es suchte, nicht erlangt (vergl. Kap. 9, 31), die Masse des Volkes war verstockt, aber ein von Gott erwählter Überrest hatte es erlangt; freilich nicht auf dem Boden eigenen Tuns, gesetzlichen Wirkens — der Apostel benutzt jede Gelegenheit, um den Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade zu betonen — sondern auf dem Grunde freier, bedingungsloser Gnade. „Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade" (V. 6).
Von dem Gericht der Verhärtung, das über Israel als Volk kommen sollte, hatte Moses schon am Ende der Wüstenwanderung gezeugt. Der Apostel verbindet hier anscheinend ein Wort des Propheten Jesajas (Kap. 29, 10) mit 5. Mose 29, 4, wenn er sagt: „wie geschrieben steht: „Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag"," und fügt dann in den beiden nächsten Versen noch einen überaus ernsten Ausspruch Davids über die Gottlosen in Israel hinzu. Es ist beachtenswert, daß wir so wiederum ein dreifaches göttliches Zeugnis (aus dem Gesetz, den Psalmen und den Propheten) über Israels traurigen Zustand vor uns haben, umso beachtenswerter, als der Apostel im Begriff steht, in dem Folgenden die unausspürbaren Wege Gottes mit Seinem irdischen Volke zu beschreiben.
Doch bevor er dazu übergeht, macht er uns mit dem zweiten der oben erwähnten Beweise bekannt. „Ich sage nun: Haben sie etwa gestrauchelt, auf daß sie fallen sollten? Das sei ferne! sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen" (V. 11). Während der ganzen Dauer der Geschichte des Volkes Israel wechselten lange dunkle Zeiten mit kurzen Wiederbelebungen, ernste Züchtigungen mit Gnadenerweisungen ab, bis endlich Gott Seinen geliebten Sohn sandte. Aber ach! Der, den Er als einen kostbaren Eckstein in Zion legen wollte, wurde zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Fels des S t r a u c h e l n s für die beiden Häuser Israels. Die prophetische Ankündigung, daß viele unter ihnen straucheln würden, war in Erfüllung gegangen. Aber war dieses Straucheln etwa deshalb erfolgt, damit sie fallen sollten, um nicht wieder aufzustehen? War das die Absicht Gottes im Blick auf sie gewesen? Nein, Gott hatte auf diesem Wege andere Gnadenratschlüsse ans Licht gebracht. Der Fall Israels war zum Anlaß geworden, den Heiden das Heil zuzuwenden. Wiederum aber sollte diese Begnadigung der Nationen die Juden zur Eifersucht reizen (Vergl. 5. Mose 32, 15—21.) Der Gedanke an den Verlust des bevorzugten Platzes, den sie einst eingenommen und nun an die Nationen verloren hatten, sollte das eifersüchtige Verlangen in ihnen wecken, diesen Platz wieder zu erlangen.
Wird das denn geschehen? Wird Israel je wieder „das Haupt" und die Nationen „der Schwanz" sein? Ja, „der Überrest wird umkehren", und dann „wird ganz Israel errettet werden". Wenn nun aber ihr Fall (Fehltritt) zum Reichtum der Welt und ihr Verlust zum Reichtum der ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt lebenden Nationen ausgeschlagen ist, was wird dann erst ihre Vollzahl bewirken! (V. 12.) Was wird geschehen, wenn Gott einmal Sein Antlitz Israel wieder zuwenden und Seine Herrlichkeit über Zion aufgehen lassen wird! Dann werden „alle Enden der Erde Jehova fürchten", und „alles Fleisch wird kommen, um vor ihm anzubeten". „Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein, als Leben aus den Toten?" (V. 15).
So groß und herrlich heute, infolge der Verwerfung des Messias durch Israel, die Gnade Gottes sich erweist in der Anbietung des Heils an die ganze Welt, an alle Menschen ohne Ausnahme, noch reichere Segensströme werden fließen, wenn „die Wiederherstellung aller Dinge" kommen, wenn Israel unter dem Zepter seines Friedensfürsten wieder im Lande wohnen und „die ganze Erde" auffordern wird, „Jehova mit Freuden zu dienen, vor sein Angesicht zu kommen mit Jauchzen, in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang"! (Vergl. ps. 100.) Ja, dann wird „nichts anders als Leben aus den Toten" gesehen werden, wie der Apostel in bewunderndem Vorausblick sich ausdrückt.
Da Paulus an die Gläubigen in Rom schrieb, die der Mehrzahl nach aus den Heiden gesammelt worden waren, fügt er, gewissermaßen zu seiner Rechtfertigung, daß er sich so weit über die Wege Gottes mit Israel verbreitet hat, die Worte hinzu: „Denn ich sage euch, den Nationen: Insofern ich nun der Nationen Apostel bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgend eine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge" (V. 13. 14). Paulus war als der Apostel der Nationen vom Herrn unmittelbar zu diesen gesandt worden, um ihre Augen aufzutun, auf daß sie sich bekehrten von der Finsternis zum Licht usw. (Vergl. Apstgsch. 26, 17. 18.) Ehrte er nun seinen Dienst nicht gerade dadurch, daß er durch die Bekehrung so vieler Heiden sie, die sein Fleisch waren — wie hätte er das je vergessen können? — zur Eifersucht zu reizen suchte, damit auch etliche aus ihnen errettet werden möchten?
Geleitet durch den Geist und in Verfolgung der bisher behandelten Gedanken bedient sich der Apostel in der zweiten Hälfte unseres Kapitels des Bildes eines Ölbaumes, der „Zweige" hat, und zwar Zweige, die auf Grund ihrer natürlichen Verbindung mit der „Wurzel" der Fettigkeit des ganzen Baumes teilhaftig waren, aber infolge ihres Unglaubens ausgebrochen worden sind, um anderen Zweigen Platz zu machen, die von Natur gar keine Verbindung mit dem Ölbaum hatten, aber aus Gnaden eingepfropft werden. Von vornherein sei darauf hingewiesen, daß wir es hier nicht mit Gottes ewigen Ratschlüssen bezüglich der Versammlung, des Leibes Christi, zu tun haben, sondern mit Seinen Regierungswegen in Verbindung mit Seinem Zeugnis auf dieser Erde. Der Ölbaum, ein Bild der Fettigkeit, ist der Baum der Verheißungen Gottes, die einst dem Abraham, dem „Erstling" der Masse oder der „Wurzel" dieses Baumes, geschenkt wurden. In dem Leibe Christi kann es nie Glieder geben, die entfernt werden, um für andere Raum zu machen. In ihm gibt es auch keinen Unterschied zwischen Jude und Heide — alle sind einer in Christo.
Ebensowenig wie um den Leib Christi, handelt es sich hier um die Wege der errettenden Gnade, um den Besitz des Lebens oder um die Frage der Echtheit des persönlichen Bekenntnisses. Indem man diese und ähnliche Fragen in dieses Kapitel einzuführen suchte, hat man die ganze Belehrung des Apostels verwirrt, der nur die Stellung von Juden und Heiden hinsichtlich der Linie der Verheißung und des Zeugnisses Gottes in dieser Welt darstellen will. Doch dies bedarf noch einer näheren Erläuterung. In den Tagen nach der großen Flut, als die Menschen infolge ihres vermessenen Hochmuts über die ganze Erde hin zerstreut worden waren und sich nun, Gott immer mehr vergessend, dem schändlichsten Götzendienst hingaben, berief Gott den Abraham von jenseits des Euphrat, wo auch er mit seinen Vätern anderen Göttern diente, und brachte ihn in das Land, das Er ihm und seinem Samen geben wollte. In Kanaan angelangt, wurde Abraham der Vater einer Familie, welcher dem Fleische nach die Verheißungen Gottes gehörten, die später in besonderer Weise durch die in Christo geoffenbarte Gnade dem ganzen Samen zugewandt werden sollten. War Adam der Vater des sündigen Menschengeschlechtes gewesen, so wurde Abraham der Vater des Samens Gottes in der Welt, d. h. zunächst Israels und dann, im weiteren Sinne, aller in und mit ihm Gesegneten. In Abraham ließ Gott zum erstenmal die kostbaren Wahrheiten von der Auserwählung, Verheißung und Berufung oder Absonderung ans Licht treten, zunächst in ihm persönlich, aber dann auch in ihm als Erstling der späteren „Masse", als Wurzel des Baumes der Verheißungen. Abraham war, wie schon gesagt, beides: Erstling und Wurzel. Der Stamm des Baumes, oder „die natürlichen Zweige", wie der Apostel sie nennt, war Israel. Von diesen Zweigen mögen nun wohl einige ausgebrochen und andere an ihre Stelle eingepfropft werden, aber der Baum als solcher, die ursprüngliche Stätte der dem Abraham gegebenen Verheißungen, erleidet keine Veränderung; er b l e i b t, und mit ihm seine Fettigkeit. Wenn daher Paulus auch hier von einem „Geheimnis" spricht (V. 25), so ist das nicht etwa „das Geheimnis des Christus, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist". (Vergl. Eph. 3 u. a. St.) Dieses, den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments geoffenbarte und der besonderen Verwaltung des Apostels Paulus anvertraute Geheimnis muß bestimmt und klar von dem hier entworfenen Bilde des Ölbaumes unterschieden werden, anders ist Verwirrung unausbleiblich.
Betrachten wir jetzt die Einzelheiten des Bildes ein wenig näher. „Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse; und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige" (V. 16). Abraham wurde, wie wir bereits gehört haben, von Gott berufen und abgesondert, um fortan als Sein Zeuge und als der Träger Seiner Verheißungen hienieden zu wandeln Abraham hat das getan. Der Erstling, die Wurzel war heilig man hätte deshalb erwarten können, daß auch die „Masse" von welcher der Erstling abgehoben war,8 die „Zweige" die der Wurzel entsproßten, heilig gewesen wären. Die Fortsetzung hätte dem Anfang entsprechen sollen. Aber ach, was war geschehen! Unglaube und hartnäckige Bosheit hatten Israel gekennzeichnet und in der Verwerfung des Messias ihren Gipfelpunkt erreicht, und so hatte Gott in ernster Vergeltung einige der Zweige ausgebrochen. Mit anderen Worten, das in Abraham gesegnete, aber ungläubige Israel war beiseite gesetzt worden, und „ein wilder Olbaum", die Nationen oder Heiden, war an seiner Stelle in „den edlen Olbaum" eingepfropft und der Wurzel und Fettigkeit desselben mitteilhaftig geworden. (V. 17). Sie, die bis dahin „wild", fern von jeder Verbindung mit dem Baum der Verheißung, gewachsen waren, genossen jetzt die Segnungen dieses Baumes. Der Segen Abrahams war in Christo Jesu zu den Nationen gekommen. (Gal. 3, 14.)
Hatten diese deshalb Ursache, „sich wider die Zweige zu rühmen"? In keiner Weise. Die Juden, die Nachkommen Abrahams dem Fleische nach, befanden sich auf Grund ihrer Geburt in dem Baume der Verheißung und hatten diesen Platz durch den Unglauben verloren. Als ihnen die Erfüllung der Verheißungen in Christo angeboten wurde, wiesen sie dieselbe zurück und verachteten, gestützt auf ihre vermeintliche eigene Gerechtigkeit, die Güte Gottes. Daraufhin hatte Gott die Heiden an ihren Platz gestellt. Sollten diese sich nun besser dünken als die ausgebrochenen Zweige und sich wider sie rühmen? Nein, zunächst sollten sie bedenken, daß die Wurzel s i e trug, nicht etwa sie die W u r z e l (V. 18), mit anderen Worten, daß nur Gottes bedingungslose Gnade sie an diesen Platz geführt hatte. Wohl konnten sie dagegen einwenden, daß die natürlichen Zweige ausgebrochen worden seien, um sie einpfropfen zu können; aber lag darin ein Verdienst für sie? Diese Einpfropfung war doch nicht geschehen auf Grund irgendwelchen Tuns ihrerseits, sondern einzig und allein auf Grund ihres Glaubens an den von Israel verworfenen Christus. Nur der unumschränkten Güte Gottes hatten sie diesen neuen Platz zu verdanken, sie standen durch den Glauben. Von einem Anlaß, sich zu rühmen, konnte also gar keine Rede sein. Darum schließt der Apostel diesen Abschnitt mit den Worten; „Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich; denn wenn Gott der natürlichen Zweige nicht geschont hat, daß er auch deiner etwa nicht schonen werde" (V. 20. 21). Nicht törichte Ruhmrederei, sondern Furcht, heilige Furcht geziemte sich für sie, damit es ihnen nicht ähnlich erginge, wie es Israel ergangen war. Denn würde Gott etwa ihrer, der nachträglich eingepfropften Zweige, schonen, nachdem Er der natürlichen nicht geschont hatte?
„Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes: gegen die, welche gefallen sind, Strenge; gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst; sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Und auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wiederum einzupfropfen" (V. 22. 23). Wie eindringlich redeten diese Worte zu den Herzen der Gläubigen aus den Nationen! Die Güte und die Strenge Gottes stand vor ihnen. Güte hatten sie erfahren, Strenge war Israel zuteil geworden. Jetzt galt es für sie, an der Güte zu bleiben, damit nicht auch sie das Los Israels teilten.
Ist die ernste Ermahnung beachtet worden? Sind die heidnischen Pfropfreiser an der Güte Gottes geblieben? Die Blätter der Kirchengeschichte beantworten diese Frage in erschütternder Weise. Was wird nun das Ende sein? Auch s i e werden ausgeschnitten werden, genau so wie es mit den Juden geschehen ist.
Aber obwohl der Ölbaum so im Laufe der Zeit seine äußere Gestalt, sein Aussehen ändern mag, er selbst bleibt, was er ist, und „auch jene — die natürlichen Zweige — wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wiederum einzupfropfen" (V. 23). Gottes Ratschlüsse werden durch die Untreue des Menschen nicht beeinflußt oder gar aufgehoben. Seine Gnadengaben und Seine Berufung sind unbereubar. (V. 29). Israel wird auf völlig neuer Grundlage wieder an seinen alten Platz zurückgeführt werden — ich betone noch einmal, an seinen alten Platz, nicht etwa in die christliche Kirche eingefügt, denn da waren die Juden nie. Die Bildung der Versammlung (Gemeinde) war im Gegenteil gleichbedeutend mit dem Abbruch der Beziehungen Israels zu Gott. „Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wider die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wievielmehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden l" (V. 24). Das Gericht über die heidnischen Zweige, um mich kurz auszudrücken, wird der Wiedereinpfropfung der Juden in den Ölbaum Bahn machen; denn sie werden nicht im Unglauben bleiben, und der Baum ist und bleibt, was so vielfach von den Erklärern übersehen wird, „ihr eigener Ölbaum". So wie einst das jüdische System, zu seinem gerichtlichen Abschluß gekommen ist, um die Heiden zuzulassen, so wird auch das heidnische System, die Christenheit, auf gerichtlichem Wege zu seinem Ende kommen, um dem Volke Israel die Rückkehr zu dem verlorenen Platz der Verheißung und des Segens zu ermöglichen.
„Denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf daß ihr nicht euch selbst klug dünket: daß Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird; und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: „Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde"." (V. 25—27.)
Damit sind wir zu dem dritten und wohl schlagendsten Beweise von der Tatsache gekommen, daß Gott Sein sündiges Volk nicht verstoßen hat, sondern es in Seinem Erbarmen am Ende der Tage zu sich zurückrufen und ihm tiefe Buße und wahre Herzensumkehr zu dem einst verworfenen Messias schenken wird. Auch das hier Gesagte gehört zu den vielen im Neuen Testament geoffenbarten „Geheimnissen". Israel ist zum Teil Verstockung von selten Gottes widerfahren als Gericht über seine Sünde und Treulosigkeit, aber diese Verstockung soll nicht immerdar währen. Wenn einmal „die Vollzahl der Nationen", d. h. alle, die aus den Völkern der Erde durch das Evangelium in wahre, lebendige Verbindung mit Christo kommen sollen, eingegangen sein wird, mit anderen Worten, wenn das letzte Glied der Versammlung oder Gemeinde, die vor der über den ganzen Erdkreis kommenden Stunde der Versuchung in den Himmel entrückt werden soll, hinzugefügt ist, dann wird ganz Israel, d. h. Israel als Volk, das dann freilich nur aus einem Überrest besteht, errettet werden. Solang die Geschichte der wahren Kirche hienieden fortdauert, solang der Leib Christi, in welchem es weder Jude noch Grieche gibt, gesammelt wird, kann so etwas selbstverständlich nicht geschehen. Ja, selbst nach der Entrückung der wahren Gläubigen wird Gottes Langmut noch eine Zeitlang zusehen, bis die bekennende Christenheit voll und ganz bewiesen hat, daß sie nicht an der Güte geblieben ist, und daß nichts anderes für sie übrigbleibt als ein erbarmungsloses Gericht, d. h. die endgültige Entfernung des ganzen verderbten Systems von dem Platze der Segnung und des Zeugnisses, den es so viele Jahrhunderte eingenommen hat.
Wieder sehen wir deutlich, daß es sich in unserem Kapitel nicht handelt um Gottes Gnadenwege mit Seinem himmlischen Volke, sondern um Seine irdischen Regierungswege mit denen, die nacheinander an den Platz der Verheißung und Segnung geführt werden — zunächst Israel, dann die Nationen und schließlich wieder Israel. Alle, welche — ganz abgesehen von der Frage der persönlichen Errettung oder des Besitzes des Lebens aus Gott — diesen Platz einnehmen, sind verantwortlich für das, was sie zu besitzen bekennen. Bleiben sie an der Güte Gottes, gut; wenn nicht, so werden sie abgeschnitten werden.
Auch die Masse des jüdischen Volkes wird in den Gerichten am Ende der Tage umkommen, aber „ein Überrest nach Wahl der Gnade" wird dastehen, und für ihn wird der Erretter aus Zion kommen, nicht aus dem Himmel, um ihn (wie die Gläubigen der Jetztzeit) in den Himmel zu versetzen, sondern aus Zion, um die Gottlosigkeiten von Jakob abzuwenden und das um der Väter willen geliebte Volk in die Segnungen des Reiches einzuführen. Denn der Bund Gottes, um Israels Sünden wegzunehmen, ruht auf sicherer Grundlage, auf der bedingungslosen Gnade, die sich in dem „Erretter aus Zion" offenbaren wird. Ihn, den ihre Väter einst ans Kreuz geschlagen haben, wird der Überrest kommen sehen, und zwar mit den Wundenmalen in Seinen Händen, die ihnen Frieden und Vergebung verkündigen. Und so wird ganz Israel errettet werden und die unbereubaren Gnadengaben Gottes genießen; denn Israel als Volk ist für immer Gottes Eigentum auf Grund Seiner Berufung und der den Vätern gegebenen Verheißungen.
„Hinsichtlich des Evangeliums" hatten die Juden sich freilich als Feinde erwiesen. Sie hatten die frohe Botschaft feindselig zurückgewiesen und damit den Heiden eine Tür der Begnadigung geöffnet. „Hinsichtlich der Auswahl aber waren sie Geliebte um der Väter willen" (V. 28). Als Same Abrahams blieben sie Gegenstände der unveränderlichen Liebe Gottes, nicht etwa auf Grund des Bundes am Sinai — auf diesem Boden war alles für sie verloren —, sondern in Verbindung mit ihren Vätern, Abraham, Isaak und Jakob. Diese hatte Gott einst aus Gnaden berufen, ihnen hatte Er bedingungslose Verheißungen gegeben. Diese Berufung und die damit verbundenen Gnadengaben sind deshalb unbereubar. (V. 29.) Am Ende der Tage wird Er sich ihrer erinnern, und die in der Auswahl der Väter kundgegebene Liebe wird sich den Söhnen gegenüber als treu erweisen. Indem Er das steinerne Herz aus ihrem Innern wegnimmt und ihnen ein fleischernes Herz gibt, wird Er sie für den Empfang Seiner unumschränkten Gnade zubereiten.
In diesem allen offenbart sich neben der unwandelbaren Treue Gottes auch Seine unergründliche Weisheit, und diese entfaltet der Apostel in den nächsten Versen. Israel besaß Verheißungen, wenn sie ihm auch aus Gnaden geschenkt worden waren; wäre das Volk nun auf Grund dieser Verheißungen wieder zu den Segnungen zugelassen worden, so hätte man gewissermaßen von einem berechtigten Anspruch seinerseits reden können. Doch was war inzwischen geschehen? Die Juden hatten Den, in welchem die Verheißungen allein Ja und Amen für sie werden konnten, verworfen und waren damit auf einen Boden gekommen, auf welchem ihnen nur noch Gnade helfen konnte, also genau dahin, wo auch die Nationen standen. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und den Nationen. „Denn gleichwie auch i h r (Nationen) einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch den Unglauben dieser, also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, auf daß auch sie unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf daß er alle begnadige" (V. 30—32).
Die Heiden hatten einst in Finsternis, fern von Gott gelebt. Sie hatten Gott nicht geglaubt, waren aber jetzt durch den Unglauben der Juden unter die Begnadigung gekommen. Eine Gnade, auf welche sie keinerlei Anspruch hatten, war ihnen zuteil geworden. Ähnlich stand es mit den Juden: ungläubig wie die Heiden, hatten sie selbst die Gnade verworfen und wiesen auch den Gedanken, daß sie sich jetzt den Heiden zugewandt habe, mit Abscheu zurück. Infolgedessen hatten sie alle Ansprüche an die Erfüllung der Verheißungen verloren, und gleich den Heiden konnte auch sie nur eine bedingungslose Gnade retten. Für beide blieb nur noch das freie Erbarmen Gottes übrig. Jeder Ruhm, jedes Vertrauen auf eigenes Tun war ausgeschlossen. Alle (Juden wie Heiden) standen auf demselben Boden, alle zusammen waren von Gott in den Unglauben eingeschlossen, und Gott hatte das getan, auf daß Er allen (Juden wie Heiden) Seine Gnade zuwende.
Fürwahr, es ist mehr als verständlich, wenn der Apostel am Ende seiner Behandlung der wunderbaren Wege Gottes in Gnade und Gericht, angesichts der unwandelbaren Treue, Weisheit und Heiligkeit Gottes, die sich in ihnen kundgeben, den Gefühlen seines Herzens in der ergreifenden Lobpreisung Ausdruck gibt, mit welcher unser Kapitel schließt. „O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege l Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvorgegeben, und es wird ihm vergolten werden?" Ja, wo ist ein Gott wie unser Gott? Wie unausspürbar sind Seine Wege! Wer hat Ihm beratend zur Seite gestanden, als Er sie in Seinem Herzen erwog und feststellte? Wege, auf welchen Er die Treue Seiner Verheißungen denen gegenüber aufrecht halten konnte, die alle Ansprüche an dieselben verloren hatten und nun mit anderen, die solche Ansprüche nicht besaßen, auf dem gleichen Boden der Reichtümer Seiner Gnade gesegnet werden. Ja, wer hätte des Herrn Sinn erkannt? Und doch sind schwache, sterbliche Wesen, wie wir sind, eingeführt in das Erkennen dieses Sinnes und der unausspürbaren Wege Dessen, von dem und durch den und für den alle Dinge sind. 0 Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Ihm sei die Herrlichkeit in EwigkeitI Amen.
Kapitel 12-15
Mit Kapitel 11 schließt der belehrende Teil unseres Briefes. Es folgen Ermahnungen, die sich auf das bisher Gesagte stützen und den Gläubigen durch die Erbarmungen Gottes zu einem Wandel in hingebender Treue Gott und Menschen gegenüber auffordern. Demut und Liebe, verbunden mit einer Gnade, die sich in praktischer Gerechtigkeit offenbart, sollen ihn kennzeichnen. Der Christ ist ein Mensch unter Menschen, aber, entsprechend dem Charakter des Briefes, ein erlöster, befreiter, von der Welt abgesonderter Mensch, der sich als solcher nach Gesinnung und Wandel offenbaren soll in den verschiedenen Beziehungen, in denen er gefunden werden mag, sei es im Hause Gottes oder in der Welt. Was ihm geziemt ist Einfalt, eine friedliebende Gesinnung, die dem anderen entgegenkommt, nie sich selbst sucht oder gar rächt, sondern das Böse mit dem Guten zu überwinden trachtet.
Während das 12. Kapitel den Gläubigen mehr in seiner Stellung als Glied des Leibes, als Kind im Innern des Hauses betrachtet, zeigt uns das 13. Kapitel ihn gleichsam außerhalb des Hauses, in seiner Beziehung zu den Regierungen dieser Welt, zu den obrigkeitlichen Gewalten, die von Gott verordnet sind. Worin sie auch bestehen oder welche Form sie annehmen mögen, der Christ soll sich ihnen nicht widersetzen, sondern ihnen Untertan sein und einem jeden die Ehre geben, die ihm gebührt; und das umsomehr, weil die Nacht weit vorgerückt und der Tag nahe ist, in dessen Licht er wandeln soll, und der einmal alles ans Licht bringen wird.
Im 14. Kapitel folgen dann Ermahnungen zu brüderlicher Geduld und Tragsamkeit, die für die Empfänger des Briefes von besonderer Bedeutung waren, da in Rom sich stets viele Christen aus Juden und Heiden zusammenfanden, und Fragen über Speisen und Getränke, Halten von Tagen und dergleichen wohl immer wieder auftauchten. Das Gewissen des einzelnen mußte berücksichtigt werden, und der „Starke" sollte nicht den „Schwachen" verachten, noch umgekehrt der „Schwache" den „Starken" richten. Diese im Anfang des 15 Kapitels (V. l—7) noch weitergeführten Ermahnungen schließen mit dem Hinweis auf Ihn, der nie sich selbst gefallen, sondern die Schmähungen derer, die Ihn schmähten, auf sich genommen hat. In den Versen 8—12 desselben Kapitels faßt der Apostel dann die Wege Gottes im Evangelium, die durch Anführungen aus dem Alten Testament gerechtfertigt werden, noch einmal kurz zusammen. Schließlich, in der letzten Hälfte des Kapitels, redet er von seinem Dienst unter den Nationen, sowie von einigen Reisen in den Westen, die er, nach einem Besuch in Jerusalem, noch hoffte ausführen zu können.
Kapitel 12
„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist" (V. l). Unwillkürlich erinnern uns diese Worte an das 6. Kapitel unseres Briefes, wo wir aufgefordert werden, uns selbst Gott darzustellen als Lebende aus den Toten und unsere Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. (V. 13.) Dort hörten wir zum erstenmal davon, daß wir als mit Christo Gestorbene nun auch in Neuheit des Lebens wandeln sollten. In den späteren Kapiteln sind wir dann mit den Tiefen und Höhen der Erbarmungen Gottes bekannt gemacht worden. Auf Grund derselben ermahnt uns nunmehr der Apostel, unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer Gott darzustellen. Er nennt das unseren „vernünftigen" (logischen) oder einsichtsvollen, den Belehrungen des Heiligen Geistes entsprechenden „Dienst" (Gottesdienst). Nicht nur unsere Seele ist erlöst und gehört Gott an, auch unser Leib ist teuer erkauft, und wenn wir seine „tatsächliche" Erlösung auch noch erwarten (Kap. 8, 23), so ist doch schon jetzt „unser ganzer Geist und Seele und Leib" Gott zur tadellosen Bewahrung anvertraut, (1. Thessalonicher 5, 23.)
Nicht gesetzliche Gebote oder Forderungen sind also der Boden, auf den wir gestellt sind. Auf ihm würde heute wie immer ein völliges Mißlingen das Endergebnis sein. Nur Gnade und göttliches Erbarmen sind imstande, den Gläubigen innerlich und äußerlich umzugestalten; nur durch sie vermag er seinen Leib mit Herzensentschluß Gott darzustellen, heute, morgen, ja, bis an das Ende seines Lebens. Der Apostel nennt diese Darstellung ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer — lebendig im Gegensatz zu den Schlachtopfern im Alten Bunde, die getötet wurden, h e i l ig im Vergleich mit dem weltlichen und gesetzlichen Charakter jener Opfer, und Gott wohlgefällig, weil Gott Seinen wahren Platz darin empfängt und auch der Mensch den seinigen nach Gottes Gedanken einnimmt. Daß ein solcher Gottesdienst, der mit allen Übungen einer menschlichen Religion, der Beobachtung fleischlicher Satzungen und Gebräuche für immer abgeschlossen hat, unser vernünftiger (folgerichtiger) Dienst genannt wird, ist verständlich.
„Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, daß ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist" (V. 2). In diesen Worten fügt der Apostel der persönlichen Weihung für Gott noch ein zweites Element hinzu, ein Sichbewahren vor den bösen Einflüssen der Welt, des gewaltigen Systems, das Satan aufgerichtet hat, und das wir durchschreiten müssen. Es genügt nicht, äußerlich von der Welt getrennt zu wandeln, wir bedürfen der fortwährenden Erneuerung unseres Sinnes (vergl. Eph. 4, 23), indem wir uns unbefleckt erhalten von dem Geist unserer Tage, von den Gewohnheiten und herrschenden Meinungen der Menschen, die Gott nicht kennen und in der Finsternis ihrer Herzen dahinleben. Nur so können wir in die Erkenntnis des „guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willens Gottes" hineinwachsen, wie sie uns im Christentum dargeboten ist. Abgesehen von der Steigerung, die offenbar in den drei Worten liegt, erkennen wir in ihnen sogleich den großen Unterschied zwischen der Stellung eines Christen und der eines religiösen Menschen, sei er Jude oder Namenchrist. Wie in allen anderen, so ist auch hier unser hochgelobter Herr unser vollkommenes Vorbild. Er kam in diese Welt, um den Willen Gottes zu tun, und in all den Widerwärtigkeiten und Prüfungen Seines mühevollen Pfades tat Er allezeit „das dem Vater Wohlgefällige", indem Er in dem, was Er litt, den Gehorsam lernte. So sind auch wir berufen, in einer Welt, in welcher alles Gott entgegen ist, den Willen Gottes zu tun, und indem unser geistliches Verständnis in der steten Erneuerung unseres Sinnes wächst, prüfen wir, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das Ergebnis dieser geistlichen Energie ist eine stets sich vertiefende Absonderung von den Grundsätzen der Welt. Wir machen Fortschritte. Indem das eigene Ich immer klarer erkannt und gerichtet wird, tritt der vollkommene Weg des himmlischen Menschen auf Erden immer deutlicher vor unser Auge, und wir vernehmen Seinen Ruf: „Komm, folge mir nach!"
In dieser Nachfolge, die eine stete Selbstverleugnung unserseits in sich schließt, kommt eine hohe Meinung von der eigenen Person nicht auf. Zufrieden mit dem Platz, den Gott zuteilt, mit dem Wege, den Er anweist, bemüht man sich, „nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken . . ., wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat" (V. 3). Der Unglaube trachtet immer nach hohen oder großen Dingen und übersieht dabei gerade das, was am Wege liegt und was Gott anweist. Das Bewußtsein, von Gott selbst einen Auftrag empfangen zu haben, verleiht dem Herzen Festigkeit und weckt das Gefühl der Verantwortlichkeit, diesen Auftrag nun auch nach bestem Vermögen auszuführen. Obwohl man den Bruder und das ihm Anvertraute freudig anerkennt, sucht man den selbst empfangenen Dienst zu tun in dem süßen Bewußtsein, darin Gottes Willen zu folgen.
Dies leitet den Apostel dahin, zum ersten und einzigen Male in diesem Briefe von dem „Leibe" zu reden, einem Gegenstand, der uns aus dem 1. Korintherbrief und aus den Briefen an die Epheser und Kolosser so gut bekannt ist. Er tut es hier auch nur unter einem praktischen Gesichtspunkt, um die Wichtigkeit des Verhaltens der verschiedenen Glieder zueinander zu beleuchten. „Denn", so beginnt er, „gleichwie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die Vielen, e i n Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander" (V. 4. 5).
Das ist alles, was er an dieser Stelle als Lehre von Christo, dem Haupte, und Seinen Gliedern sagt. Er geht dann unmittelbar zu den Pflichten über, die auf den einzelnen Gliedern des Leibes als solchen ruhen. Wir sind nicht nur Gläubige, die da, wo Gott einem jeden persönlich seinen Platz in dieser Welt angewiesen hat, als Lebende aus den Toten Ihm dienen, sondern wir, die Vielen, gehören auch zusammen, bilden in Christo einen Leib, ja, sind „einzeln Glieder voneinander". Es würde etwas fehlen in unserem Briefe, wenn nicht auch von diesem Verhältnis und von der Verantwortlichkeit geredet wäre, die wir als Ganzes, als e i n Leib, im Zeugnis auch der Welt gegenüber tragen; denn der Leib ist in dieser Welt.
„Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben" — betreffs der Frage, w i e diese Gaben uns mitgeteilt worden sind, müssen wir andere Stellen zu Rate ziehen — „nach der uns verliehenen Gnade: es sei Weissagung, so laßt uns weissagen nach dem Maße des Glaubens" (V. 6). Dem letzten Ausdruck begegneten wir schon einmal im 3. Verse. A 11 e s ist „verliehene Gnade", nichts ist aus uns, alle Gaben sind „Gnaden gaben", und doch liegt uns die Gefahr so nahe, mehr von uns zu halten, als recht ist, und über das zugeteilte Maß des Glaubens hinauszugehen. Vor allem ist dies bei dem Dienst am Worte der Fall. Weissagung war nach 1. Korinther 14, 1 die begehrenswerteste aller Gaben zur Erbauung, denn sie war es, die den Hörer am unmittelbarsten mit Gott in Berührung brachte. Aber was wurde daraus, wenn der Redende über das hinausging, was Gott ihm gegeben hatte, wenn er die Leitung des Geistes nicht beachtete? Und was wird heute daraus, wenn der Mensch auf den Schauplatz tritt? —
Doch es gibt verschiedene Gnadengaben, und alle sind nötig. Kein Glied kann zu dem anderen sagen: „Ich bedarf deiner nicht." Da hat einer die Gabe des Dienstes, ein zweiter die der Lehre, ein dritter die der Ermahnung. (V. 7. 8.) Alle sind nötig „für das Wachstum des Leibes, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe", alle sind nützlich und den Gliedern dazu gegeben, sich gegenseitig damit zu dienen. Der Apostel redet selbst von einer Gabe des Mitteilen s, des Vorstehens (vergl. 1. Thess. 5, 12; 1. Tim. 5, 17), ja, des Übens von Barmherzigkeit. (V. 8.) Der da mitteilt wird ermahnt zur Einfalt, der da vorsteht zum Fleiß, der Barmherzigkeit übt zur Freudigkeit. Die Ermahnungen sind so einfach, daß sie keiner Erklärung bedürfen; was uns not tut ist uns zu prüfen, inwieweit wir ihnen nachkommen, ein jeder an seinem Teile und Platze. Wie zeigt uns diese Stelle auch wiederum die Torheit des schon so bald aufgekommenen und in seinen Auswirkungen so verhängnisvollen Priester- und Laientums!
In den jetzt folgenden Ermahnungen betritt der Apostel einen breiteren Boden, indem er alle Arten von christlichen Verpflichtungen berührt, und das nicht nur im Blick auf das uns darin geziemende äußere Verhalten, sondern auch auf den Geist und die Gesinnung, die uns dabei beseelen. Zwei können dasselbe tun, und doch ist es nicht dasselbe. Die Art des einen wirkt wohltuend, die des anderen abstoßend.
Den ersten Platz, allen anderen voran, hat die Ermahnung: „Die Liebe sei ungeheuchelt." Die Liebe ist aus Gott, darum sollte sie stets echt und ungeheuchelt sein. Wer aus Gott geboren ist, ist der göttlichen Natur teilhaftig geworden und kann als solcher ermahnt werden, ein „Nachahmer Gottes" zu sein. Liebe ist, wie schon oft gesagt wurde, die Tätigkeit der göttlichen Natur in Güte, und sie soll in den aus Gott Geborenen in dieser Welt zur Darstellung gebracht werden. Ohne Liebe haben die schönsten Gaben wenig Wert.
Aber welch eine Aufgabe! Ach, wie leicht kann ein schöner, täuschender Schein als Wirklichkeit erscheinen wollen! Wie nötig ist da 'Aufrichtigkeit, verbunden mit einem steten Selbstgericht!
Und siehe da, als zweite Ermahnung folgt deshalb unmittelbar: „Verabscheuet das Böse, haltet fest am Guten." Gott ist Liebe, aber die erste Botschaft, die Er uns hören läßt, lautet, „daß er Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist" (1. Joh. 1. 5). Wie reden solche Worte besonders ernst zu uns in Tagen des allgemeinen Sichgehenlassens, laodicäischer Sattheit und Lauheit! Freilich, da wo ein Herz in wahrer Liebe für Gott schlägt, wird auch diese entschiedene Absonderung von allem Unreinen, dieses Verabscheuen alles Bösen gefunden werden. Eine solche Seele wandelt im Licht, gleichwie Gott im Licht ist. Mit geringerem kann sie sich nicht zufrieden geben.
„In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend. In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret aus; im Gebet haltet an; an den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil; nach Gastfreundschaft trachtet" (V. 10—13). Bruderliebe ist nicht dasselbe wie Liebe. (Vergl. 2. Petr. 1. 7.) Man kann sagen, daß sie in der Liebe ihre Quelle hat. Aber der Kreis oder Bereich ihrer Ausübung ist enger gezogen; es ist die Familie Gottes oder die Versammlung. Nichts könnte lieblicher sein als innige Bruderliebe; aber sie kann erkalten, kann an Herzlichkeit verlieren, nicht nur weil wir schwach sind, sondern auch weil es in unseren Geschwistern das eine und andere gibt, das unsere Liebe auf ermüdende Proben stellen kann. Darum: „In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander!" Petrus spricht von einer ungeheuchelten Bruderliebe. (1. Petr. 1. 22.)
Aber nicht nur das, geht in der Demut, die den anderen höher achtet als sich selbst, einander voran, gebt den übrigen ein gutes Vorbild, indem ihr allen Fleiß beweiset und, geleitet durch den Geist, dem Herrn dienet in Treue und Ausharren!
Das erinnert den Schreiber an die herrliche Zukunft, die vor dem Gläubigen liegt: „in 'Hoffnung freuet euch", sowie an die auf dem Wege dahin liegenden Beschwerden: „in Trübsal harret aus", und schließlich an das große, nie versagende Hilfsmittel: „im Gebet haltet an". Dabei werden wir niemals, wie der Apostel selbst es nicht tat, an anderer Not gefühllos vorübergehen, sondern mit offener Hand „an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen", auch etwa bei uns einkehrende Gäste nicht nur „ohne Murren" bewirten, sondern „nach Gastfreundschaft trachten" — Damit schließt dieser Teil der Ermahnungen, und unser Blick wird darauf gelenkt, wie Christus selbst hienieden gehandelt hat: „Segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden" (V. 14. 15). Ein welch vollkommenes Beispiel hat unser hochgelobter Herr uns in diesem allen gegeben! Er vergoß Tränen tiefsten Mitgefühls über die Stadt voller Mörder, betete für Seine Feinde, und Seine Liebe war groß genug, um Ihn an den Freuden und Leiden der Menschen um Ihn her innig Anteil nehmen zu lassen. Machen wir es auch so, entgegen unserer so leicht erregbaren und selbstsüchtigen Natur!
„Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst" (V. 16). Auch alle diese Dinge stehen in unmittelbarem Gegensatz zu unserer natürlichen, hochmütigen Gesinnung, die so leicht böse Unterschiede macht. Wie sehen wir sie wiederum in solch herrlicher Entfaltung auf dem Pfade des Hohen und Erhabenen, der sich herabließ zu den Ärmsten dieser Welt, ja, der selbst der Ärmste und Niedrigste unter ihnen wurde! Und wenn Sein Knecht Paulus später an die Philipper schreibt: „Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war", so dürfen wir gewiß sein, daß er selbst als Vorbild für alle in dieser Gesinnung wandelte. Nur so konnte er sagen: „Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich Christi" (1. Kor. 11, l; vergl. Phil. 3, 17). Gott schenke uns, ihm nachzueifern! Er bewahre uns auch in Gnaden vor allem Vertrauen auf Klugheit und Verstand! Wie manchem ist es ergangen wie einst der stolzen Stadt der Chaldäer, die da sprach: „Ich b i n's, und gar keine sonst", und deren „Weisheit und Wissen sie irregeführt hat!" (Jes. 47, 10).
Der Schluß unseres Kapitels zeigt uns noch einmal in ergreifenden Zügen das Bild des zweiten Menschen und die Gesinnung, die sich für uns, Seine Jünger, geziemt. Nie vergalt Er Böses mit Bösem, nie wurde Trug in Seinem Munde erfunden; gescholten, schalt Er nicht wieder, leidend, drohte Er nicht, sondern übergab sich Dem, der recht richtet, (1. Petr. 2, 22. 23.) Das ist auch der Weg Seiner Jünger, indem sie zugleich vorsorglich sind für alles, was ehrbar ist vor den Menschen, oder, wie Paulus an die Philipper schreibt, alles erwägen, was rein und lieblich ist, was wohllautet und irgendwie eine Tugend oder ein Lob genannt werden kann. So wandelnd werden sie, soviel an ihnen ist, mit allen Menschen in Frieden leben, indem sie nicht das Ihrige suchen, sondern das, was der anderen ist. (V. 17. 18.)
Vor allem geziemt es sich für die Geliebten Gottes, nie sich selbst zu rächen, denn Zorn und Rache gehören Gott. Zu Seiner Zeit wird Er vergelten. Unsere Sache ist es, wenn der Zorn der Menschen sich wider uns erhebt, ihm Raum zu geben, d. h. seinen Ausbrüchen nicht die Stirn zu bieten, sondern still den Sturm über uns ergehen zu lassen und alles Gott anheimzustellen. „Denn es steht geschrieben: „Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr" " (V.19). Was Gott von uns erwartet, ist, nicht nur allen Menschen unsere Gelindigkeit kundwerden zu lassen, sondern auch, von Christo lernend, unseren Feinden Liebe zu beweisen, den Hungrigen zu speisen, den Durstigen zu tränken. Vielleicht gelingt es uns auf diesem Wege, sein Herz und Gewissen zu erreichen: „denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln" (V. 20). Läßt er sich nicht beschämen, umso schlimmer für ihn! In jedem Falle soll der Christ, seiner neuen Natur folgend, sich nicht von dem Bösen überwinden lassen, sondern sich befleißigen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. (V. 21.) So erweist er sich als ein Nachahmer des Gottes, der in Christo all das Böse in uns mit tausendfachem Guten überwunden hat, und dessen Freude es ist, solang die Zeit der Gnade noch währt, unaufhörlich nach diesem Grundsatz zu handeln.
Wie groß die Freude ist, auf solchem Wege einen Feind zu überwinden und vielleicht eine Seele vom Tode zu erretten, das vermag nur der zu fühlen, dem es vergönnt ist, einen derartigen Sieg zu erringen. Freilich, es kostet etwas, sich geduldig übervorteilen, schmähen, niedertreten, als „Auskehricht" behandeln zu lassen, aber der Lohn ist umso süßer, je teurer er errungen wird.
Kapitel 13
Von der Ermahnung, nicht sich selbst zu rächen, sondern das Böse mit dem Guten zu überwinden, wendet sich der Apostel in dem vorliegenden Kapitel zu einer Verpflichtung allgemeinerer Art, die auf jedem Menschen, in besonderer Weise aber auf dem Christen ruht: „Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten; denn es ist keine Obrigkeit, außer von Gott, und diese, welche sind, sind von Gott verordnet" (V. l.).
„Jede Seele" — beachten wir den Ausdruck; er ist umfassender als „jeder von euch" oder „jeder Christ", und ist wohl mit Absicht so gewählt. (Vergl. Kap. 2, 9.) Der ganze Hausstand des Gläubigen, Kinder, Angehörige, Gesinde, alles ist miteingeschlossen. Der Christ ist zwar nicht von der Welt, aber noch i n der Welt, gleich seinen Mitmenschen, und so ist er verpflichtet, den obrigkeitlichen Gewalten zu gehorchen, und zwar aus Gründen, die für ihn von der höchsten Bedeutung sind. Zunächst ist die Obrigkeit „von Gott verordnet", dann ist sie „Gottes Dienerin", und schließlich sind die von ihr angestellten Personen „Gottes Beamte" (V. 4. 6). Es könnten kaum ernstere Gründe für unsere Verpflichtungen der Obrigkeit gegenüber aufgeführt werden. Ganz ähnlich ermahnt der Apostel Petrus in seinem ersten Briefe die Gläubigen aus der Beschneidung, sich um des Herrn willen aller menschlichen Einrichtung zu unterwerfen. (Kap. 2, 13. 14.)
Allerdings möchte hier die Vernunft, wie sie es so gern tut, ihre Stimme erheben und dem einfachen Gebot Gottes die Einwendung entgegenstellen: „Ja, aber wenn die Obrigkeit selbst ihre Abhängigkeit von Gott nicht anerkennt? wenn sie nach Willkür schaltet und waltet, harte, ungerechte Verfügungen trifft usw.? Was dann? Soll ich mich ihr dann auch noch bedingungslos unterwerfen?" Selbstverständlich bleibt das bekannte, dem Synedrium gegenüber ausgesprochene Wort der Apostel: „Man muß Gott mehr gehorchen als Menschen", allezeit zu Recht bestehen. Stellt eine obrigkeitliche Gewalt eine Forderung an uns, die dem klar ausgesprochenen Willen Gottes zuwiderläuft, deren Erfüllung also unser Gewissen belasten würde, dann muß dieser Wille von uns beachtet und der obrigkeitlichen Forderung übergeordnet werden. Aber auch nur in diesem Falle. In allen anderen habe ich mich einfach zu unterwerfen, ganz gleich, welchen politischen Charakter die Obrigkeit trägt, ob sie monarchisch, republikanisch oder was irgend sonst ist, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommt oder nicht. Denn es gibt keine Obrigkeit oder Gewalt außer von Gott. Wie einfach macht das den Weg für den Christen!
Zur Zeit der Abfassung unseres Briefes war es wahrlich nicht leicht, diesem Gebot nachzukommen, denn die obrigkeitlichen Gewalten waren durchweg heidnisch und götzendienerisch. Sie erblickten deshalb in den Gläubigen, die der Staatsreligion den Rücken gewandt hatten und sich standhaft weigerten, den Göttern zu räuchern, ihre natürlichen Feinde, bedrückten und verfolgten sie. Trotz allem aber blieb es wahr, daß die Regenten von Gott gesetzt sind, um dem Bösen zu steuern, das Gute zu fördern und zu belohnen. (V. 3.) Die Obrigkeit war und ist heute, wie bereits gesagt, „Gottes Dienerin". Zweimal hebt der Apostel das im 4. Verse ausdrucksvoll hervor: „Sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten . . . Sie trägt das Schwert nicht umsonst; denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut." Darum, wer sich ihr widersetzt, „widersteht der Anordnung Gottes i die aber widerstehen, werden ein Urteil (Gericht) über sich bringen" (V. 2). Mit anderen Worten: wo irgend eine Obrigkeit ist, da ist sie von Gott; der Gläubige sieht Gott in ihr und gehorcht ihr deshalb willig. Er würde ja Gott ungehorsam sein, wenn er es nicht täte.
Möglicherweise bringt dieser Gehorsam dem Christen Unannehmlichkeiten mancherlei Art, hat vielleicht gar empfindliche Verluste und Leiden für ihn im Gefolge. Aber das darf sein Verhalten nicht bestimmen. Hat er in dieser Welt der Ungerechtigkeit überhaupt etwas anderes zu erwarten? Er ist ein Fremdling und Pilgrim in ihr, sein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Durch den Glauben in die innigste Verbindung mit Gott gebracht, schaut er seinen Platz und sein Erbteil droben. Er ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Ortern. Auf seiner Reise zur himmlischen Heimat ist er nicht berufen, sein Recht in dieser Welt zu suchen, noch weniger auf ihre soziale oder politische Gestaltung tätig einzuwirken oder gar eine herrschende Stellung in ihr einzunehmen. Er wird einmal mit Christo herrschen, wenn die Zeit dafür gekommen ist; aber sein gegenwärtiges Teil ist, zu leiden und, soviel an ihm ist, mit allen Menschen in Frieden zu leben, ihr Wohl zu suchen und „durch Gutestun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen zu bringen" (1. Petr. 2, 15).
Haben wir das einmal verstanden, so wird unsere Stellung und unser Verhalten der Obrigkeit gegenüber sehr einfach. Indem wir Gott in ihr erblicken, verschwinden die Schwierigkeiten, und die meisten Fragen lösen sich von selbst. Wir erkennen dann auch die Notwendigkeit, ihr „ untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen — die uns im Falle eines Ungehorsams treffen würde —, sondern auch des Gewissens wegen" (V. 5). Aus dem gleichen Grunde können wir, wie bereits betont, etwaigen Befehlen nicht gehorchen, die mit dem bestimmten Willen Gottes und unserem Charakter als Christen in Widerspruch stehen. Es liegt uns aber niemals ob, die Frage zu entscheiden, wie die augenblicklich regierende Obrigkeit entstanden ist, wer die Gewalt ausübt und wie das geschieht. Wo ein Christ leben und in welcher irdischen Stellung er sich befinden mag, er hat der Obrigkeit zu gehorchen, der er unterstellt ist und die heute regiert; kommt morgen, vielleicht selbst infolge einer gewaltsamen Umwälzung, eine andere, so hat er sich d e r zu unterwerfen, ganz gleich, ob sie ihm gefällt oder nicht. Auch hat er nicht zu untersuchen, ob die Verordnungen, welche die jeweilige Obrigkeit trifft, die Gesetze, die sie gibt, richtig oder unrichtig sind, ob sie ihm und anderen Nutzen oder Schaden bringen; seine Sache ist, für die Obrigkeit zu beten, daß Gott sie richtig leiten und ihr Einsicht und Weisheit schenken möge, zum Wohle des Landes und Volkes zu regieren, und — ihr ohne Murren zu gehorchen, soweit das mit seinem Gewissen verträglich ist. Wenn er verwirklicht, daß seine Interessen nicht mit dieser Erde, sondern mit dem Himmel verbunden sind, wird ihm das auch nicht schwer werden.
Wir erinnern uns hier unwillkürlich an die eindringliche und, heute wie immer, zeitgemäße Ermahnung des Apostels in 1. Timotheus 2: „Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen zu tun, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst" (V. 1. 2). Anstatt über die Obrigkeit zu reden, uns über sie und ihre Maßnahmen zu ereifern, vielleicht gar lästernde Urteile über sie zu fällen (vergl. Tit. 3, 1. 2), wie es hier und da geschehen sein mag, ist es unser Vorrecht und unsere Pflicht, fürbittend für sie einzutreten, Fürbitten und Danksagungen für sie zu Gott emporzusenden. Paulus ermahnt vor allen Dingen, das zu tun. Wird eine treue Beachtung dieser Ermahnung seitens der Gläubigen nicht mehr Erfolg haben, als alle die vielleicht gutgemeinten Bemühungen, selbst helfend und gestaltend in den Lauf der Dinge einzugreifen?
Niemals gibt das fehlerhafte Verhalten einer höheren oder niedrigen Gewalt, eines der Beamten Gottes, dem Christen ein Recht, seinerseits nun auch seinen Verpflichtungen nicht treu nachzukommen. Fehlt die Obrigkeit in ihrem Auftrag als Gottes Dienerin, so hat sie es mit Gott zu tun; der Christ aber ist gehalten, unter allen Umständen „das Gute zu üben", auch allen zu geben, was ihnen gebührt, „die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt" (V. 7). Auch das ist ein Kapitel, ir welchem es manches zu lernen gibt; aber das Lernen würde uns bedeutend erleichtert und manchem Klagen und Seufzen der Boden entzogen werden, wenn wir wiederum stets im Auge behielten, daß wir nur Fremdlinge und Beisassen hienieden sind, und daß auch all unser irdischer Besitz, unser Verdienst usw. nicht eigentlich uns gehört, sondern daß wir nur als „Verwalter" darüber bestellt sind. Eins ist gewiß; wenn wir nicht nach hohen Dingen trachten, sondern uns zu den niedrigen halten (Kap. 12, 16), so werden wir gern und willig allen das ihnen Gebührende oder von ihnen Erwartete geben, umsomehr als wir Gott in allem sehen und Ihm auch in diesen äußeren Dingen zu dienen wünschen.
Im 8. Verse geht der Apostel dann noch einen Schritt weiter, indem er sagt: „Seid niemand irgend etwas schuldig, als nur einander zu lieben; denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt." Daß er bei dieser Ermahnung zunächst an die eben besprochenen Verpflichtungen denkt, ist kaum zu bezweifeln, aber wir dürfen gewiß auch eine Warnung vor leichtfertigem Schuldenmachen darin erkennen, wie solches leider immer wieder auch unter Christen vorkommt. Es ist und bleibt demütigend für einen Gläubigen, aus irgend einer Ursache in Schulden geraten zu sein, und es sollte den aufrichtigen Eifer in ihm wecken, sie so bald wie möglich und soweit es in seinen Kräften steht abzutragen. Von dieser allgemeinen Regel ist nur e i n Ding ausgeschlossen, und das ist die Liebe. Diese Schuld ist berechtigt und bringt auf niemand eine Unehre, weder vor Gott noch vor Menschen. Sie jemals abzutragen ist auch unmöglich. Gott selbst hat uns darin durch Seine Liebe zu bleibenden Schuldnern gemacht.
Zugleich ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Alle die Gebote, welche die Pflichten des Menschen seinen Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck bringen, finden sich in dem einen zusammengefaßt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (V. 9). Dieses Gebot war von alters her da, aber niemand war imstande, es zu halten. Die Gnade allein, die uns in Christo die ganze Vollkommenheit und Fülle der Liebe geoffenbart hat, vermag das Herz umzugestalten und uns zu befähigen, nicht mehr nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste zu wandeln; und wenn wir das tun, so wird „die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt". (Vergl. Kap. 8, 3. 4.) „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses." Sie würde ja ihrer Natur unmittelbar zuwider handeln müssen. „So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes", oder wie der Apostel den Galatern zuruft: „Das ganze Gesetz ist in einem Worte erfüllt, in dem: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" " (Gal. 5, 14).
Doch es gibt noch einen anderen Beweggrund für den Christen, treu und wachsam zu sein, und diesen nennt der Apostel jetzt. „Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, daß die Stunde schon da ist, daß wir aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben: Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe" (V. 11. 12). Solang „die Sonne der Gerechtigkeit" nicht aufgegangen ist, währt die Nacht dieser Welt. Die Menschen mögen in Geschäftigkeit und Vergnügungssucht ein Vergessen suchen und vielleicht für Augenblicke es finden, aber für jeden, der geistliches Verständnis hat und Christum kennt, ist es Nacht, finstere Nacht. Die Schatten werden umso tiefer, je weiter die Nacht vorrückt. Aber in dem Herzen des Gläubigen ist es hell, er ist aus dem Schlaf aufgewacht, in seinem Herzen ist der Morgenstern bereits aufgegangen. Die Nacht ist weit vorgerückt, und während die Welt trotz aller Warnungen fortfährt zu schlafen, schaut er frohlockend die Dämmerung des Tages. Sein Herr verzieht nicht zu kommen, mögen auch etliche es für einen Verzug achten. Jeder Tag bringt ihn dem Ziele näher, und so steht er da gleich einem Knechte, der mit gegürteten Lenden und brennender Lampe auf den Hausherrn wartet.
„Die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken", lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 7. Was kann man von solchen Leuten anders erwarten, als unfruchtbare „Werke der Finsternis", schändliche Dinge, deren Namen man nicht einmal in den Mund nehmen möchte? (V. 12. 13; vergl. Eph. 5, 11. 12.) Der Christ dagegen wandelt „anständig, wie am Tage". Werke der Finsternis sind unvereinbar mit einem Menschen, der aus der Gewalt des Fürsten der Finsternis errettet und berufen ist, nunmehr als ein „Kind des Lichts" zu wandeln. Es ist ihm „genug, die vergangene Zeit den Willen der Nationen vollbracht und den Lüsten der Menschen gelebt zu haben". Gern folgt er der Ermahnung, „die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichtes anzuziehen". Ohne Kampf geht das freilich nicht ab, denn wir befinden uns in dem Reiche Satans, des Fürsten der Finsternis, und Mächte der Bosheit stehen uns entgegen. Aber wenn das Licht, in welchem wir wandeln, unsere Waffenrüstung ausmacht, wenn die Macht des Lichts, der Wahrheit und Gottseligkeit, die jenem Tage angehört, in unseren Herzen wohnt, werden die Anläufe und Listen des Feindes von uns entdeckt werden, sie werden keinen Eingang in unsere Seele finden, keine Gewalt über uns gewinnen. Indem wir der Ermahnung folgen, „den Herrn Jesus Christus anzuziehen", d. h. in all unserem Denken, Reden und äußeren Tun den Charakter und Wandel unseres hochgelobten Herrn, des wahren Lichtes des Tages, zur Darstellung zu bringen, werden wir nicht nur „nicht Vorsorge treiben für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste" (V. 14), nicht Dingen nachgehen, in welchen diese Lüste ihre Nahrung finden, sondern „so wandeln, wie er gewandelt hat".
Noch einmal denn: Die Zeit unserer Errettung ist jetzt näher, als da wir geglaubt haben. Die Stunde ist schon da, daß wir aus dem Schlafe aufwachen sollten. „Deshalb sagt er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, undderChristuswirddirleuchten!" (Eph. 5.14).
Kapitel 14
Das Vorhandensein so vieler Gläubiger aus den Juden in der Versammlung zu Rom gab, wie wir schon früher sahen, Anlaß zu mancherlei Schwierigkeiten. Es ist ja verständlich, daß der Gegensatz zwischen den jüdischen und heidnischen Elementen leicht zu Reibungen führte. Die aus dem Judentum Gekommenen, von Jugend auf an die strenge, zeremonielle Beobachtung von Tagen, Enthaltung von Speisen und dergleichen gewöhnt, konnten nur schwer von diesen Dingen loskommen; für die Christen aus den Heiden bestand diese Schwierigkeit nicht. Es gab anscheinend viele in Rom, die sich in ihrem Gewissen noch gebunden fühlten, die eine oder andere mosaische Verordnung zu beobachten, während andere, die in Christo des Gesetzes Ende erkannt und in Seinem Tode Befreiung von aller gesetzlichen Knechtschaft gefunden hatten, in der Freiheit wandelten, für die Christus sie freigemacht hatte. Der Apostel nennt die einen „Schwache", die anderen „Starke".
Wir dürfen uns unter den „Schwachen" also keineswegs Gläubige vorstellen, die zu Nachlässigkeit oder gar Untreue im Wandel neigten; sie waren viel eher von einer übertriebenen Gewissenhaftigkeit und bemühten sich ängstlich, durch die Beobachtung der alten jüdischen Satzungen Gott wohlzugefallen und so Ruhe zu finden für ihre Seelen. In dem Bewußtsein, daß „das Alte" von Gott angeordnet war, waren sie schwach im Ergreifen der neuen Stellung des Gläubigen in Christo, dem Auferstandenen. Die dem Heidentum entronnenen Gläubigen hatten das ganze götzendienerische System, von dem sie befreit worden waren, als ein böses Werk des Feindes erkannt, und darum war die Gefahr, an einzelnen heidnischen Gebräuchen festzuhalten, für sie nicht groß.
Wie sollten nun solche „Schwache im Glauben" behandelt werden? Sollte man jene äußerlichen Dinge zu einem Gegenstand des Disputierens machen, oder gar die Schwachen geringschätzen und zurückweisen? Nein; die menschliche Natur ist zwar heute wie damals geneigt, das eine oder das andere zu tun, aber die Liebe handelt nicht so. Wir sagen „heute wie damals", denn die Gefahr, die dem christlichen Zeugnis in jenen ersten Tagen drohte, besteht zu allen Zeiten. Auch heute noch kann man dem: „Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht!" häufig genug in der einen oder anderen Form begegnen; viele Gläubige tun, als „lebten sie noch in der Welt" und wären noch allerlei Satzungen und Verordnungen unterworfen. Die wahre „Freiheit", die den Gläubigen in den Stand setzt, das zu suchen und auf das zu sinnen, „was droben ist", ist für viele eine unbekannte Sache.
Mit den Worten: „Den Schwachen im Glauben aber nehmet auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen", beginnt der Apostel seine Belehrung. Er benimmt dadurch der nicht leicht zu behandelnden Frage von vornherein den scharfen Stachel. „Nehmet auf", nicht: „Weiset zurecht, verurteilet". Die Liebe hat immer ihre besondere Art, die Dinge anzufassen. Indem sie in Gnade handelt und alles zu ertragen vermag, weist sie nicht kühl zurecht, sondern spricht; „Deshalb nehmet einander auf, gleichwie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit" (Kap. 15, 7). Christus ist ihr Vorbild, Sein Tun ihr Muster.
Freilich zur Entscheidung zweifelhafter Fragen, in Fällen, wo die Schrift keine bestimmte Anweisung gibt, sondern die Beantwortung dem geistlichen Verständnis des einzelnen überläßt, sollte der Schwache nicht herangezogen werden. Dazu war er nicht geschickt. „Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber ißt Gemüse" (V. 2). Der Schwache bewies die Schwachheit seines Glaubens darin, daß er sich ein Gewissen daraus machte, Fleisch zu essen. Indem er nicht in dem Licht und der Kraft der neuen Schöpfung lebte, fiel es ihm schwer, „die Elemente der Welt" als hinfällig und kraftlos zu erkennen.
Aus dieser Sachlage ergaben sich zwei Gefahren für die Gläubigen in Rom. Die einen, die Starken, die da glaubten, alles essen zu dürfen, konnten leicht dahin kommen, geringschätzend oder gar verächtlich auf ihre schwächeren Brüder herabzuschauen; die anderen waren in Gefahr, ihre Brüder zu richten, weil diese etwas taten, was ihr Gewissen ihnen verbot, wovon sie freilich ein stärkerer Glaube befreit haben würde. Nun, „wer ißt, verachte den nicht, der nicht ißt, und wer nicht ißt, richte den nicht, der ißt, denn Gott hat ihn aufgenommen" (V. 3). Damit stellt der Apostel die ganze Frage auf einen Boden, der für den einen wie für den anderen bindend und verpflichtend war. Ob ein Gläubiger aus Israel oder aus den Heiden, ob ein Schwacher oder ein Starker — Gott hatte ihn aufgenommen. Ohne Zweifel dachte der, welcher glaubte, alles essen zu dürfen, richtiger als sein Bruder, der aus Gewissensbedenken nur Gemüse aß. Aber so begehrenswert und gut Erkenntnis ist, Liebe, wahre Liebe ist besser. Sie bewahrt den Starken vor dem Verachten des schwächeren Bruders, und den Schwachen vor dem Richten des stärkeren.
In der weiteren Verfolgung des letzten Gedankens sagt der Apostel: „Wer bist du, der du den Hausknecht eines Anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten" (V. 4). Wer gibt dir das Recht, den Hausknecht eines anderen zu richten? Ist er dir, oder ist er seinem Herrn verantwortlich? Steht oder fällt er dir, oder ihm? Wird nicht sein Herr, dem er zu dienen begehrt, ihn aufrecht halten? Wahrlich, Er vermag es, wenngleich wir in unserer Torheit vielleicht anders denken möchten. Allerdings müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, daß in unserem Kapitel von Gewissensfragen die Rede ist, die der eine so, der andere so entscheidet, nicht etwa von bösen Handlungen. Sünde soll ich niemals auf meinem Bruder dulden, aber um Sünde handelt es sich hier nicht. Und wenn wir ermahnt werden, selbst dann einander in Liebe zu ertragen und einander zu vergeben, wenn einer Klage hat wider den anderen (Kol. 3, 13), wieviel mehr sollten wir dann bei solchen Gewissensfragen zur Duldsamkeit bereit sein! Der Apostel erklärt die Sache denn auch folgendermaßen:
Der eine, der einen Tag höher hält als den anderen, tut das um des Herrn willen — „er achtet ihn dem Herrn", und der andere hält aus dem gleichen Grunde jeden Tag gleich. Femer: Der Essende ißt dem Herrn, indem er Gott für die Speise, die er genießt, dankt, und der Nichtessende „ißt dem Herrn nicht", und auch er „danksagt Gott". Wer darf nun den einen oder anderen für das, was er tut oder nicht tut, verachten oder richten? Wünschen nicht beide dem Herrn zu dienen und zu gefallen, wenn auch, nach dem Maße ihres geistlichen Verständnisses, in verschiedener Weise? Und sind sie nicht Ihm allein verantwortlich? Weiter, woher hat der Starke, wenn er wirklich so genannt werden kann, seine Stärke? Muß die Gnade ihn nicht genau so gut aufrecht halten wie den Schwachen? Nur eines darf dabei nicht übersehen werden: „Ein jeder aber sei in seinem eigenen Sinne v ö l l i g ü b e r z e u g t !" (V. 5. 6). Nur so kann er mit glücklichem Herzen seinen Weg gehen. Aber wieviel Unverstand mag der Herr wohl auch heute noch in dieser Beziehung bei den Seinigen zu ertragen haben!
Es ist bei dieser Gelegenheit wohl kaum nötig zu bemerken, daß „der erste Tag der Woche" nicht zu den Tagen gehört, die man halten oder nicht halten kann. Er wird in Offenbarung 1. 10 ausdrücklich „des Herrn Tag" genannt, ein Tag, der in besonderer Weise Ihm gehört. Er ist geweiht durch die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes in der Frühe dieses Tages und durch Sein Erscheinen am Abend in der Mitte Seiner versammelten Jünger. (Joh. 20; vergl. auch Apstgsch. 20, 7; 1. Kor. 16, 2.) Für den Christen, der sich mit Christo gestorben und auferweckt weiß, gibt es keinen Tag, der mit dem Auferstehungstage seines Herrn verglichen werden könnte. Er liebt und ehrt ihn, nicht auf Grund eines gesetzlichen Gebots, sondern weil er das liebliche, charakteristische Kennzeichen des gegenwärtigen Zeitalters der Gnade ist, der Tag, an welchem er sich mit seinen Mitgläubigen dankbar versammelt, um seines abwesenden Herrn zu gedenken und Seinen Tod zu verkündigen.
Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung zu unserem Gegenstand zurück. Wir haben uns also davor zu hüten, zu verachten oder zu richten. „Denn keiner von uns lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst" (V. 7). Diese Tatsache, die in einem Sinne von allen Menschen wahr ist, wird hier vornehmlich auf die Gläubigen angewandt. „Denn sei es, daß wir leben, wir leben dem Herrn; sei es, daß wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, daß wir leben, sei es, daß wir sterben, wir sind des Herrn" (V. 8). Kostbare Tatsache! Wir gehören nicht uns selbst an, weder im Leben noch im Sterben, wir sind unseres Herrn. Keiner von uns lebt, keiner stirbt sich selbst. Der Apostel gründet diese Tatsache auf den Tod und die Auferstehung Christi. Dadurch hat Er als Mensch Seine Anrechte an uns, ja, Seinen Anspruch, über Lebendige und Tote zu herrschen, erworben. „Hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden" (V. 9). In Ihm, dem Todesüberwinder, sind wir für ewig geborgen. Er ist unser Herr, dem wir alles verdanken, der uns teuer erworben hat, und dem wir als Knechte und Mägde Rechenschaft über unser Tun und Lassen schuldig sind, in dessen Rechte wir uns aber auch nicht ungestraft einmischen dürfen.
Darum: „Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder?" Ihr beide, ob schwach oder stark, bekennt, diesem hohen, gewaltigen Herrn, der über Lebendige und Tote zu herrschen berufen ist, nach Leib und Seele anzugehören, und ihr wollt einander richten oder verachten? Wie töricht und ungeziemend ist euer Tun! Wißt ihr nicht, daß wir alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden? (V. 10.) „Denn es steht geschrieben:
„So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, und jede Zunge soll Gott bekennen." Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben" (V. 11. 12). Wenn aber jedes Knie (von Gläubigen und Ungläubigen) sich vor Gott beugen und ein jeder von uns fürsichselbst Gott Rechenschaft geben muß, was haben wir dann jetzt mit dem Richten anderer zu tun? Heißt das nicht tatsächlich in Gottes Rechte eingreifen? Darum: „Laßt uns nicht mehr einander richten!" (V. 13).
Ehe wir weitergehen, möchte ich noch einen Augenblick bei dem Richterstuhl verweilen. Wir finden das Wort hier und in 2. Korinther 5, 10, hier in Verbindung mit Gott, dort mit Christo. An keiner der beiden Stellen wird aber gesägt, daß der Gläubige vor diesem Richterstuhl gerichtet werden müsse. Es würde ja seine ewige Verdammnis bedeuten. Das gerechte Gericht Gottes ist in Christo am Kreuze an ihm vollzogen worden, Gericht kann ihn deshalb nie mehr treffen. Aber er muß offenbar werden, sein ganzes Leben, das Gute und das Böse, wird in dem untrüglichen Licht dieses Richterstuhls gesehen werden, und er wird jenachdem Anerkennung und Lohn empfangen, oder Schaden leiden. Wir alle sind ja Menschen, die dem Gott, vor dem einmal jedes Knie sich beugen wird, Rechenschaft schuldig sind, Knechte und Mägde, die im Blick auf ihren Dienst und die Verwaltung des ihnen Anvertrauten sich dereinst vor ihrem Herrn zu verantworten haben.
Wenn das Bewußtsein, daß ein jeder von uns einmal Rechenschaft ablegen muß, in unseren Herzen lebt, werden wir uns nicht nur vor allem „Richten" hüten, sondern der Wunsch, dem Herrn zu gefallen, der uns und unsere Brüder alle mit der gleichen Liebe liebt, wird uns auch antreiben, alles zu vermeiden, was dem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis geben könnte. Nach den Worten des Apostels ist vielmehr das Richten des eigenen Tuns am Platze. Er war für sich selbst ja völlig, „in dem Herrn Jesus", überzeugt, daß „nichts an sich selbst gemein ist, sondern nur dem, der es für gemein achtet" (V. 14). Er kannte die Gedanken des Herrn in dieser Beziehung und war über alle auf Speise und Trank usw. bezüglichen Fragen erhaben. Aber indem „sein Herz durch Gnade befestigt war" (Hebr. 13, 9), leitete ihn die Liebe Christi, die Freiheit, die er in Ihm besaß, in keiner Weise zu einem Anlaß für das Fleisch zu benutzen. Lieber wollte er für immer kein Fleisch mehr essen, als seinem Bruder ein Ärgernis geben, (1. Kor. 8, 13.)
„Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus gestorben ist" (V. 15). Wenn ich selbst auch „stark" bin und weiß, daß nichts an sich selbst gemein ist, soll ich doch das Gewissen meines Bruders achten und ihn nicht wegen einer Speise betrüben. Die Liebe soll, wie weiter oben schon gesagt, mein Verhalten bestimmen. Handle ich anders, so setze ich mich in Gegensatz zu der Gesinnung und Handlungsweise Christi und verderbe, soweit es an mir liegt, meinen Bruder, für welchen Christus gestorben ist. E r hat für den Schwachen Sein Leben gelassen, und ich kann mich nicht einmal um seinetwillen einer Speise enthalten, sondern veranlasse ihn vielleicht durch mein Verhalten, etwas zu tun, was sein Gewissen ihm verbietet, d. h. also ich verleite ihn, zu sündigen, und bringe ihn damit auf einen Weg, der im Verderben enden würde, wenn nicht Gottes Gnade ins Mittel träte. Ähnlich sagt Paulus in 1. Korinther 8, 11: „Durch deine Erkenntnis kommt der Schwache u m." Mein Verhalten führt dahin, das Werk Christi, soweit es auf mich ankommt, wirkungslos zu machen.
„Laßt nun euer Gut nicht verlästert werden!" (V. 16). Die Freiheit, in welcher wir als Christen stehen, ist ein kostbares Gut; aber laßt uns wohl zusehen, daß unser Tun nicht den üblen Leumund eines fleischlichen Ungebundensein auf uns bringe! Hüten wir uns auch davor, unseren Geschwistern etwas aufdrängen zu wollen, was wir als erlaubt betrachten, während es ihnen Bedenken macht. Statt zu der so nötigen Erbauung führt ein solches Verhalten zur Zerstörung, so geringfügig die in Rede stehenden Dinge, Essen und Trinken, uns an und für sich auch erscheinen mögen. „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste" (V. 17).
Der Leser wird verstehen, daß der Ausdruck „Reich Gottes" hier nicht die Bedeutung eines Abschnittes in den verschiedenen Haushaltungen oder Verwaltungen Gottes hat, sondern in sittlichem oder geistlichem Sinne zu verstehen ist. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, hat das Reich Gottes nichts zu tun mit den vergänglichen Dingen dieses Lebens, sondern umfaßt die geistlichen Güter, die dem Christen geschenkt sind: „Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste", das was er innerlich genießt, was ihn im Geiste wandeln läßt und ihn davor bewahrt, irgendwie dem Fleische zu folgen. „Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt" (V. 18). In diesem wie in allem anderen sind wir berufen, Christo zu dienen, und wer das in Treue und Einfalt tut, darf auf das Wohlgefallen Gottes rechnen und wird ein Zeugnis und ein Segen sein für seine Mitmenschen.
„Also laßt uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist, und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient" (V. 19). Gott ist „der Gott des Friedens", und der Herr wird „der Herr des Friedens" genannt, der uns den Frieden zu geben vermag immerdar auf alle Weise. (2. Thess. 3, 16.) Sollten wir nun nicht auch dem nachstreben, was des Friedens ist, und der Liebe, die nicht zerstört, sondern erbaut? Sollten wir nicht einander zu dienen und aufzuerbauen suchen? Erkenntnis ohne Liebe bläht auf und bringt in Gefahr, „einer Speise wegen das Werk Gottes zu zerstören". Wie ernst ist der Gedanke!
Es ist freilich wahr, alles ist rein für den, der ohne Anstoß ißt (V. 20.) Aber soll ich meinen schwachen Bruder durch meine Freiheit in Gefahr bringen, „mit Anstoß zu essen"? Nein, die Liebe sagt: „Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch e t w a s zu tun, worin dein Bruder sich stößt oder sich ärgert oder schwach ist" (V. 21). Es mag mancherlei, vielleicht selbst törichte Anlässe für den Schwachen geben, sich zu stoßen oder zu argem, aber die Liebe behandelt ihn deshalb nicht geringschätzig, sondern sucht in Treue und Selbstverleugnung sein Wohl.
Der 22. Vers enthält eine für alle Zeiten wichtige Richtschnur für den Starken. Wir sagten schon, ,,stark im Glauben" zu sein ist besser, als ,,schwach im Glauben", in wahrer christlicher Freiheit zu wandeln besser, als unter einem gesetzlichen Joch zu stehen. Aber, mein Leser, wenn dieses Bessere dein Teil sein sollte, habe dann deinen Glauben „für dich selbst vor Gott"! Sieh wohl zu, daß du dir nicht Dinge erlaubst, die Gott nicht gutheißen kann! „Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gutheißt!" Es würde dir sonst genau so gehen wie dem Schwachen, „der zweifelt, wenn er ißt". Abgesehen davon, daß du dem schwachen Bruder vielleicht einen Anstoß in den Weg legst, „bist du verurteilt", weil du, gleich ihm, nicht „im Glauben" handelst. „Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde" (V. 23).
Ein zweiter, überaus wichtiger Grundsatz! Unsere Freiheit in dieser oder jener Sache, selbst in den einfachsten Dingen des täglichen Lebens, kann sich nur auf den Glauben gründen, daß das, was wir tun, vor Gott bestehen kann. Erlaubt sich ein Gläubiger etwas, das nicht auf diesem Boden steht, so wird es ihm zur Sünde. Die Freiheit ist in einem solchen Falle grundsätzlich zur Ungebundenheit geworden.
Kapitel 15
Der Apostel setzt in den ersten 7 Versen dieses Kapitels, die eigentlich zu dem vorigen gehören, seine Belehrungen über das Verhalten der Starken den Schwachen gegenüber fort. Indem er sich unmittelbar mit jenen einsmacht, sagt er:
„Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen" (V. l). Darüber, wie er selbst zu der Frage stand, hatte er sich bereits geäußert; aber anstatt seine Überzeugung anderen aufzudrängen, was wohl nie zu einem guten Ende führt, wollte er die Schwachheiten seiner Brüder mit liebender Schonung behandeln und, eingedenk seiner Worte an die Korinther, „nicht das Seine suchen, sondern das des Anderen" (1. Kor. 10, 24).
Die Liebe wird uns davor bewahren, „uns selbst zu gefallen". Indem sie uns antreibt, „dem Nächsten zu gefallen zum Guten, zur Erbauung" (V. 2), werden wir nicht nur keine Last auf unseren Bruder legen, sondern vielmehr bereit sein, seine Last zu tragen und also das Gesetz des Christus zu erfüllen. (Gal. 6, 2.) „Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: „Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen" " (V. 3). Er, der vollkommene Diener, machte sich hie-nieden in allem eins mit Seinem Gott, ließ alles über sich ergehen, was die Erfüllung des Willens des Vaters mit sich brachte, nie Anerkennung für sich, nie Seine eigene Ehre suchend. Als das Bild des unsichtbaren Gottes ertrug Er willig die Schmähungen derer, die Gott schmähten.
Die Anführung der Stelle aus Psalm 69 gibt dem Apostel Gelegenheit, an die so wichtige Tatsache zu erinnern, daß alles, was zuvor geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Ja, das, was das Alte Testament von Christo sagt, wird heute auf uns, die Christen, angewandt. Welch einen Platz hat uns doch die Gnade gegeben! Als geliebte Kinder, eins mit Christo, Seines Lebens teilhaftig geworden, sind wir berufen, einerseits in Liebe zu wandeln, wie Er gewandelt hat, und andererseits, gleich Ihm, die Schmähungen der feindseligen Menschen über uns ergehen zu lassen. Indem wir an Seine Stelle getreten sind, ist Sein Teil unser Teil geworden. Mit dankbarer Freude dürfen wir jetzt dem nachstreben, was Er in Vollkommenheit getan hat, und so in unserem geringen Maße den Gott darstellen, der, wie es in einem Liede heißt, einst in Ihm „ohne Hülle" gesehen wurde.
„Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf daß wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben" (V. 4). Wie hat Gott doch so gnädig für uns gesorgt, damit wir auf dem Wege nicht ermatten oder den Mut verlieren! Quellen reichster Segnungen sind uns in den Schriften des Alten Testaments geöffnet. Das Erforschen der Wege Gottes mit den Seinigen in längst vergangenen Zeiten, das Sinnen über Sein Reden und Tun mit ihnen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber auch in Langmut und Gnade, dient zu unserer Ermunterung und weckt Geduld und Ausharren. Ach, daß so manche Kinder Gottes im Alten Testament so wenig zu Hause sind! Mit Ausnahme einiger Teile lesen sie es kaum; viel weniger suchen sie es zu erforschen, um die darin für uns und unsere Tage enthaltene „Belehrung" zu erfassen und zur Belebung der „Hoffnung" auf sich anzuwenden! 0, wenn sie wüßten, wieviel sie dadurch verlieren!
Wenn Paulus an Timotheus schreibt, daß „alle Schrift von Gott eingegeben und nütze ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit", so denkt er zunächst an die heiligen Schriften des Alten Testaments, die, wie er sagt, vermögend sind, den Menschen „weise zu machen zur Seligkeit" (2. Tim. 3, 15—17). Was würden wir, um nur eins zu nennen, ohne diese Schriften wissen von den wunderbaren Wegen Gottes mit dem gefallenen Menschen ohne Gesetz und unter Gesetz, denen die Ankunft Seines eingeborenen Sohnes, von dessen Person und Werk sie immer wieder prophetisch und im Vorbilde reden, die Krone aufsetzte? Freilich ist es nötig, das Alte Testament zu lesen unter der steten Beachtung des unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen Gesetz und Gnade. Israel stand unter Gesetz, wir sind unter Gnade, Israel war das irdische, wir sind das himmlische Volk Gottes. Behält man diesen grundsätzlichen Unterschied nicht im Auge, so wird das Erforschen der alttestamentlichen Schriften allerdings eher Verwirrung als Segen bringen.
Anknüpfend an das Wort, daß die Schriften zu unserer Belehrung geschrieben seien usw., nennt der Apostel im 5. Verse Gott den „Gott des Ausharrens und der Ermunterung". überaus verschieden sind die Namen, die unserem Gott und Vater im Neuen Testament beigelegt werden, und jeder einzelne ist von tiefer, kostbarer Bedeutung. Er ist, um nur einige Namen zu nennen, der Gott der Liebe und des Friedens, der Gott alles Trostes, der Vater der Erbarmungen, der Gott aller Gnade, der Gott der Hoffnung, der Gott der Herrlichkeit, ja, selbst der Gott des Maßes, der einem jeden Seiner Diener das Maß seines Wirkungskreises zuteilt. So gesegnet die Betrachtung dieser verschiedenen Namen in Verbindung mit den alttestamentlichen Namen Gottes auch sein möchte, können wir sie hier doch nur andeuten.
„Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, auf daß ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichet" (V. 5. 6). Aus diesem Gott fließt die Kraft, um eine gleichmäßige Gesinnung, Christo Jesu gemäß, in uns hervorzubringen. In Christo Jesu hat Gott uns das vollkommene Muster des Ausharrens und der Ermunterung in einer Welt voll Jammer und Elend vor Augen gestellt; auf Ihn lenkt Er unsere Blicke, und wenn Herz und Sinne auf Ihn gerichtet, von Ihm erfüllt sind, so wird sich die einmütige Gesinnung ganz von selbst ergeben, und „mit einem Munde" wird der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus von allen verherrlicht werden. Durch diesen Herrn haben wir ja alle, ob Juden oder Heiden, ob reich oder arm, die gleiche Berufung, den gleichen Zugang, die gleichen Segnungen. Ist Er der alles beherrschende Gegenstand der Herzen, der einzige .Beweggrund des Handelns, so werden wir „in demselben Sinne und derselben Meinung völlig zusammengefügt sein", und Gott wird verherrlicht werden.
„Deshalb nehmet einander auf, gleichwie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit" (V. 7.) Nicht unsere Würdigkeit, noch weniger ein übereinstimmendes Urteil in zweifelhaften Fragen bildet die Grundlage unserer Annahme durch Ihn. Als Er für uns starb, waren wir Gottlose und Feinde, und wenn Er als der Auferstandene und Verherrlichte uns jetzt aufgenommen hat, so ist es wahrlich nicht um deswillen geschehen, was wir waren oder was Er a n und i n u n s haben würde, sondern in bedingungsloser Gnade, „zu Gottes Herrlichkeit". Laßt uns diesem Beispiel folgen und einander aufnehmen, ob stark oder schwach, ob menschlich liebenswürdig oder nicht liebenswürdig, als Erlöste des Herrn, als Kinder Gottes, zu Gottesverherrlichung ! Behalten wir dieses Ziel: „Gottes Herrlichkeit" im Auge, so werden wir vor jeder kleinlichen Rechthaberei, vor Sektiererei und dergleichen bewahrt bleiben; es wird uns allerdings zugleich auch anleiten, die Tür vor solchen zu schließen, welche die Lehre Christi nicht bringen (2. Joh.), oder andere ernstlich zurechtzuweisen, die „nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandeln" (Gal. 2, 11 ff). Die Liebe ist tragsam, aber auch treu.
In den Versen 8—13 erinnert der Apostel noch einmal kurz an die Grundsätze, auf welchen der ganze Brief aufgebaut ist, vor allem an die Zulassung der Heiden zu den Vorrechten des Evangeliums. Schon in den Eingangsworten des 1. Kapitels hat er die Person des Herrn vor uns gestellt unter dem doppelten Gesichtspunkt als „Sohn Davids dem Fleische nach" und als „Sohn Gottes, in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach durch Toten-Auferstehung". Hier sagt er, daß Christus „ein Diener der Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen", zugleich aber auch, „auf daß die Nationen Gott verherrlichen möchten um der Begnadigung willen" (V. 8. 9). In diesen wenigen Worten treten die beiden großen Seiten der Sendung Christi klar vor unsere Blicke. Ursprünglich gekommen zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, um Seinem irdischen Volke zu beweisen, daß Gott wahrhaftig ist und treu zu Seinen den Vätern gemachten Verheißungen steht, war die Gnade Gottes, nachdem Israel sie von sich gestoßen und Jesum gekreuzigt hatte, zu den Nationen (Heiden) übergeströmt. Gerade das Kreuz Christi hatte ihnen die Tür zu den unermeßlichen Segnungen geöffnet, die Israel verschmäht hatte. Bei den Nationen handelte es sich also nicht um die Erfüllung von Verheißungen. Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, konnte bei ihnen von „der Wahrheit Gottes" keine Rede sein. Alles war „G n a d e".
So war Christus einerseits ein Diener der Beschneidung geworden, auf Grund der zwischen Gott und Israel bestehenden Bundesbeziehungen, und anderseits waren die Heiden, die völlig fern von Gott, ohne alle Ansprüche dastanden, durch Gnade mit Gott in Verbindung gekommen, damit sie ,,um der Begnadigung willen Ihn verherrlichen möchten". Wieder möchten wir ausrufen: „O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes!" Wie einfach und doch so wunderbar sind Seine Wege, wie klar und doch so hoch Seine Gedanken l Freilich für die Juden waren sie schwer verständlich.
Dennoch hatte Gott ihnen schon vor alters diese Gedanken und Wege kundgetan, und während die Nationen nie vergessen durften, woher sie gekommen waren, sollten die Gläubigen aus Israel sich ihrerseits immer wieder an diese Aussprüche Gottes bezüglich der Begnadigung der Nationen erinnern. Wieder führt der Apostel aus den drei großen Teilen des Alten Testaments, dem Gesetz, den Psalmen und den Propheten, Stellen an, welche die Absicht Gottes bezeugten, die Nationen mit Seinem irdischen Volke zu segnen. Unter ihnen sollte Sein Name bekannt und besungen werden, mit Seinem Volke sollten sie fröhlich sein, und auf „die Wurzel Isais und den, der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen", sollten sie ihre Hoffnung setzen. (V. 9—12.) Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, daß nicht eine der angeführten Stellen von der Versammlung, dem Leibe Christi, redet, in welchem alle Unterschiede zwischen Jude und Grieche aufgehoben sind. Das war ein Geheimnis, das erst nach der Verherrlichung des Menschensohnes zur Rechten Gottes geoffenbart werden konnte. Was der Apostel vorstellen will, ist die einfache, aber so bedeutungsvolle Tatsache, daß Gott von jeher durch den Mund Seiner Propheten die Begnadigung der Nationen angekündigt hat.
Hieran schließt sich der Wunsch oder das Gebet des treuen Dieners für die Heiligen in Rom: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!" (V. 13). Gott hat sidi in Christo nicht nur als ein Gott der Liebe, sondern auch als der Gott der Hoffnung geoffenbart, und der Apostel verbindet mit der Offenbarung dieses Namens die Bitte, daß dieser Gott sie im Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllen möge. So würden sie nicht nur imstande sein, im Frieden miteinander zu wandeln trotz mancherlei Meinungsverschiedenheiten, sondern „überreich in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes", vorausblickend auf die herrliche Zeit, wann alles und alle im Lichte droben vollendet dastehen werden, würden sie in friedevoller Gemeinschaft die ihnen geschenkten Segnungen genießen und „voll Gütigkeit, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig sein, einander zu ermahnen" (V. 14.)
Indem der Apostel mit offenbarer Freude seiner Überzeugung Ausdruck gibt, daß es so mit den geliebten Heiligen in Rom sein werde, (vergl. Kap. 1. 8) schließt er seine Belehrungen und begründet in einer Art Nachwort die Kühnheit, mit welcher er an sie geschrieben hatte. Er erinnert sie an den Auftrag, der ihm von seilen Gottes hinsichtlich der Nationen geworden war. Im Blick auf sie hatte er eine besondere Gnade von Gott empfangen. Deshalb konnte er auch ihnen gegenüber so freimütig auftreten, obwohl sie nicht unmittelbar eine Frucht seines Dienstes waren. Gehörten sie doch den Nationen an, für welche er ein von Christo Jesu angestellter Diener war, „priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, auf daß das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist" (V. 15. 16).
Die Ausdrücke, die der Apostel, durch den Geist geleitet, an dieser Stelle gewählt hat, um seinen Dienst zu beschreiben, sind von auffallender Kraft und Tragweite. Das für „Diener" gebrauchte Wort bedeutet eigentlich einen im öffentlichen Dienst angestellten Beamten; der Dienst an dem Evangelium Gottes wird als ein priesterlicher Dienst bezeichnet, und das Ergebnis desselben, die Gläubigen aus den Nationen mit den in ihnen gewirkten Früchten der Gnade, wird ein Gott wohlgefälliges, durch den Heiligen Geist von der Welt abgesondertes, geheiligtes Opfer genannt, das der Apostel Gott priesterlich darbringen durfte. Ähnlich wie einst Aaron die Leviten als ein Opfer seitens der Sohne Israels Jehova darbrachte, nur mit dem großen Unterschied, daß die Weihung damals durch äußere, zeremonielle Handlungen erfolgte, während jetzt der Heilige Geist der Heiligende war. Wir sind eine „gewisse Erstlingsfrucht" der Schöpfung Gottes, geweiht durch den Heiligen Geist.
Aber wenn der Apostel etwas zum Rühmen hatte in den Dingen, die Gott angehen, so war es doch nur „in Christo Jesu" (V. 17). Ach, daß doch niemand ihm etwas zuschreiben möchte! Hatte er auch in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, sondern mehr gearbeitet als sie alle (2. Kor. 11, 5; 1. Kor. 15, 10), sollte doch nicht ihm die Ehre zufallen, sondern Dem allein, dessen Gnade mit ihm gewesen war. Auch an dieser Stelle wagt der treue Mann nicht „von dem zu reden, was Christus nicht durch ihn gewirkt hatte zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk" (V. 18).
An dieses bescheidene Wort schließt sich dann in den nächsten Versen eine kurze, aber eindrucksvolle Beschreibung der gewaltigen Arbeit des Apostels an. Wie immer, wenn er von diesen Dingen redet, spricht er nicht von seiner hohen Begabung oder apostolischen Würde, sondern von dem Tun Gottes und der Kraft Seines Geistes. Er will auch nicht auf eines anderen Grund bauen, sondern beeifert sich, das Evangelium da zu verkündigen, wo „Christus noch nicht genannt war", nach dem Worte: „Denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen, und die nicht gehört haben, sollen verstehen" (V. 21). Aus diesem Grunde war er auch bis dahin nicht nach Rom gekommen, obwohl er seit vielen Jahren ein großes Verlangen gehabt hatte, sie zu sehen; aber er war verhindert worden. (V. 22; vergl. Kap. 1. 9—15.) Nun aber, da er in den bis dahin von ihm besuchten Gegenden keinen Raum mehr hatte — denn „von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrikum, (also wahrscheinlich bis an die Ostküste des Adriatischen Meeres) hatte er das Evangelium völlig verkündigt" — nun aber hoffte er, auf der Durchreise nach Spanien, die Gläubigen in Rom zu sehen und, nachdem er sie zuvor „etwas genossen habe", von ihnen „dorthin geleitet zu werden".
Der rastlos tätige Mann fühlte, daß die Zeit gekommen war, die Arbeit im Osten anderen zu überlassen, und es trieb ihn mit Macht nach dem Westen, um auch dort Christum zu verkündigen. Aber Gott hatte es anders beschlossen. Nach Spanien ist Paulus wohl nie gekommen, und Rom hat ihn nur als Gefangenen gesehen. „Gott wollte nicht", wie ein bekannter Schreiber (J. N. D.) sagt, „daß die römische Christenheit eine unmittelbare apostolische Grundlage haben sollte. Den Gedanken, daß Petrus in Rom gewesen sei oder damals dort war, schließt unser Brief völlig aus. Das Christentum hat sich selbst in Rom gegründet. Kein weiser Baumeister war dort. Es ist nicht die Gewohnheit Gottes, weltliche Hauptstädte zu einem Mittelpunkt Seines Werkes zu machen. Der apostolische Dienst Pauli im Osten war beendet; er stand im Begriff, eine Reise als Diakon nach Jerusalem zu machen, und hat nachher nie wieder, wenigstens soweit wir einen unmittelbaren geschichtlichen Bericht darüber haben, seine freie apostolische Tätigkeit aufgenommen." über die Frage: Warum? wird wohl die Ewigkeit erst völligen Aufschluß bringen. Der Glaube weiß, daß Gottes Weg, auch wenn er sich anders gestaltet, als wir meinen und erwarten, stets vollkommen ist. „Alle Seine Wege sind recht." Sie entsprechen Seinen ewigen Ratschlüssen, Seiner unergründlichen Gnade und nie irrenden Weisheit.
Inzwischen hatte der Apostel noch eine andere Aufgabe zu erfüllen. Er reiste nach Jerusalem im Dienst für die dortigen Heiligen. „Denn es hat Macedonien und Achaja Wohlgefallen, eine gewisse Beisteuer zu leisten für die Dürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind" (V. 25. 26). Es war wohl dieselbe Kundgebung werktätiger Liebe, von welcher er in seinem 2. Brief an die Korinther redet (Kap. 8 u. 9), der kurz vor dem Brief an die Römer geschrieben wurde. Es hatte den Versammlungen in Macedonien und Achaja, der römischen Provinz, in welcher Korinth lag, Wohlgefallen, diese „Hilfsleistung" den bedürftigen Gläubigen in Jerusalem zu senden, aber eigentlich war es nur die Abtragung einer Schuld. Denn wenn die Nationen der geistlichen Güter ihrer Brüder aus Israel teilhaftig geworden waren, war es dann etwas Großes, wenn sie ihnen in den leiblichen dienten? Waren sie nicht schuldig, das zu tun? (V. 27).
Nach der „Versiegelung" dieser kostbaren „Frucht" wollte er dann, wie schon bemerkt, über Rom nach Spanien reisen, und er wußte, daß, wenn er kam, er „in der Fülle des Segens Christi" kommen würde. (V. 28. 29.) Wenn auch der Weg nach Rom sich ganz anders gestaltete, als der Apostel es ahnen konnte, ist nichtsdestoweniger das letzte Wort buchstäblich in Erfüllung gegangen. Nicht nur durfte er zwei Jahre lang „in seinem gemieteten Hause" alle, die zu ihm kamen, aufnehmen, sondern er konnte ihnen auch „das Reich Gottes predigen und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehren" (Apstg. 28, 30. 31). Wir wissen ferner, daß während der Dauer dieser ersten Gefangenschaft die herrlichen Briefe an die Epheser, Philipper und Kolosser, neben dem an Philemon, von ihm geschrieben wurden.
„Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für midi zu Gott, auf daß ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde, und auf daß mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei" (V. 30. 31). Wie wird die dringende Bitte des großen Apostels um die Gebete der Heiligen deren Herzen bewegt haben! Heute noch können wir sie nicht ohne Rührung lesen. Die Kenntnis unseres gemeinsamen Herrn und die Liebe des Geistes verbinden zu allen Zeiten die Herzen der Gläubigen, wer sie auch sein und wo sie wohnen mögen, bewirken Teilnahme und rufen Fürbitte wach. Die Aufforderung, „mit ihm zu kämpfen in den Gebeten", bewies, wie das Herz des Apostels mit der bangen Frage beschäftigt war, ob seine Reise nach Jerusalem den von ihm gewünschten Erfolg haben werde. Als sie nicht lange danach wirklich zur Ausführung kam, „bezeugte ihm der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, daß Bande und Drangsale seiner warteten" (Apstgsdi. 20, 23). Aber die brennende Liebe zu seinem Volke ließ ihn alle Rücksichten auf sich und sein Leben vergessen und trieb ihn nach Jerusalem, dem Brennpunkt der Feindschaft wider Gott und Seinen Gesalbten.
Man hat gesagt, daß Paulus in diesem Falle nicht ganz auf der Höhe seiner Berufung als Apostel der Nationen gestanden habe. Vielleicht nicht; aber wollen wir ihn deshalb tadeln? Gott hat es nicht getan. Im Gegenteil durfte Paulus in dem Lager der römischen Besatzung Jerusalems die tröstlichen Worte des Herrn vernehmen: „Sei gutes Mutes! denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so mußt du auch in Rom zeugen."
Mit der Erwartung, daß er infolge der Fürbitte der Heiligen in Rom „durch den Willen Gottes mit Freuden zu ihnen kommen und sich mit ihnen erquicken" werde, verbindet der Apostel den kurzen, aber innigen Gebetswunsdi: „Der Gott des Friedens aber sei mit eudi allen! Amen" (V. 32. 33). Möchte dieser Wunsch sich auch an uns allen in reichem Maße erfüllen!
Kapitel 16
Das Ende der öffentlichen Tätigkeit des Apostels, soweit die Schrift uns Bericht darüber gibt, ist ergreifend. In mehr als einer Beziehung gleicht es dem Ende des Dienstes seines großen Herrn und Meisters. Wie Er, so wurde auch Paulus von den Juden der Gewalt der Heiden überliefert. Von allen verlassen, ging auch er einsam seinen Weg. Trotz rastloser Bemühungen bei Tag und Nacht gab das Werk mehr und mehr Ursache zur Sorge, und der Feind schien zu triumphieren. Wohl brachte Gott trotz allem Seine Gnadenratschlüsse zur Ausführung: Juden und Heiden war Paulus ein Zeuge gewesen; der hohe Rat in Jerusalem, Priester und Volk, Landpfleger und König, ja, selbst der Kaiser in Rom sollten die mächtige Stimme der Wahrheit vernehmen. Aber der Zeuge selbst stand im Begriff, von dem öffentlichen Schauplatz seiner Wirksamkeit abzutreten. Im Osten hatte er keinen Raum mehr, im Westen sollte er nur als Gefangener weilen. So sind die Wege unseres Gottes. Das scharfe Auge des Adlers erspäht sie nicht, aber die Weisheit ordnet und der Glaube bewundert sie.
Obwohl Paulus bis dahin Rom nicht gesehen hatte, gab es doch viele Gläubige dort, die ihm bekannt und seinem Herzen teuer waren. Grüße der Liebe an sie füllen die erste Hälfte des 16. Kapitels aus. Es ist bewunderungswürdig, wie der selbst so unermüdlich tätige Arbeiter sich jedes Liebesdienstes, der ihm persönlich erwiesen oder im Werk des Herrn geschehen war, erinnert und für jeden der Gegrüßten, Bruder oder Schwester, eine besondere Bezeichnung oder eine Anerkennung hat, die den Betreffenden wohltun und ihnen zur Ermunterung dienen mußte. Wie schön ist das Band der Liebe, das die Herzen aller umschließt, die Jesum lieben und in Seinem Dienste stehen! Die Liebe kennt keine Selbstsucht, keinen Neid; alle bilden ein Ganzes und streben, in liebender Anerkennung alles Guten und Lieblichen in den anderen, nach dem gleichen Ziele.
Unter den Gegrüßten waren gewiß solche, die von Gott dazu benutzt worden waren, das kostbare Evangelium der Gnade in die große Weltstadt zu tragen; vielleicht umherreisende Juden, die durch ihre Geschäfte oder andere Ursachen nach Rom geführt worden waren, oder auch solche, die dort ihren Wohnsitz hatten und auf ihren Reisen nach Griechenland und Palästina mit der Wahrheit bekannt geworden waren. Immer wieder werden wir so durch den Geist Gottes daran erinnert, daß in der Entstehung des Zeugnisses in Rom keine Spur von apostolischer Tätigkeit zu entdecken ist — gewiß, eine tief bedeutsame Sache im Blick auf die spätere Entwicklung der Dinge dort.
Die erste Person, welche Paulus nennt, ist eine Schwester, eine Dienerin oder Diakonisse der Versammlung in Kenchreä, einer der drei Hafenstädte Korinths, uns bekannt aus Apostelgeschichte 18, 18. Diese Schwester, Phoebe mit Namen, hatte offenbar einen besonderen Dienst unter den Heiligen in Kenchreä erfüllt. Worin er bestand, wird nicht näher gesagt; aber aus anderen Stellen wissen wir, daß Schwestern, besonders ältere, sich viel in Diensten der Liebe, in Krankenpflege und anderen Hilfsleistungen in den Umständen des täglichen Lebens, bemüht haben. Auch von Phoebe hören wir, daß sie vielen ein Beistand (oder eine Fürsorgerin) gewesen war, unter ihnen auch dem Apostel selbst. Es gibt ja überall und zu allen Zeiten Dienste und Hilfsleistungen, die von Schwestern passender und besser ausgeübt werden können, als von Brüdern. So war Phoebe offenbar eine in solcher Weise tätige und von der Versammlung zu Kenchreä anerkannte Schwester gewesen — im besten Sinne also das, was man heute gemeinhin eine „Gemeindeschwester" nennt. Was sie nach Rom geführt hatte, wissen wir nicht, aber der Apostel bittet, „sie in dem Herrn, der Heiligen würdig, aufzunehmen und ihr beizustehen, in welcher Sache irgend sie ihrer bedürfe" (V. 2).
Im nächsten Verse begegnen wir zwei bekannten Namen „Grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein i c h danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen." Paulus war diesem gottesfürch-tigen Ehepaar zuerst in Korinth begegnet, und weil sie gleichen Handwerks mit ihm waren (Zeltmacher), hatte er Wohnung in ihrem Hause genommen und mit ihnen gearbeitet. Später hören wir von ihnen, daß sie Apollos in ihr Haus aufnahmen und ihm den Weg Gottes genauer auslegten. (Apstgsch. 18, 2. u. 26.) In 1. Korinther 16, 19 finden wir sie in Ephesus. (Vergl. 2. Tim. 4, 19.) Sie arbeiteten also nicht nur in dem gleichen Handwerk wie Paulus, sondern waren auch des Apostels „Mitarbeiter in Christo Jesu", die für sein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben und sich so nicht nur seinen Dank, sondern auch, weil er der Apostel der Nationen war, den aller Versammlungen der Nationen erworben hatten. Beachten wir, daß der Name der Schwester hier, wie in Apo' stelgeschichte 18, 18 und 2. Tim. 4, 19, voransteht. Wir dürfen daraus wohl schließen, daß Priska oder Priscilla sich in hervorragender Weise um Paulus bemüht und sich besonderen Gefahren seinetwegen ausgesetzt hatte. In Apostelgeschichte 18, 2 und 26 und in 1. Korinther 16, 19 steht der Name des Mannes an erster Stelle, und wir verstehen leicht, warum. Wie wunderbar genau ist doch Gottes Wort!
Noch eine kurze Bemerkung über den Ausdruck: „und die Versammlung in ihrem Hause" hier und in 1. Korinther 16,19. (Vergl. auch Kol. 4, 15 und Philem. 2.) Bekanntlich versammelten sich die Christen in jenen ersten Tagen, in Ermanglung geräumiger Versammlungsstätten, „hin und her in den Häusern", und da Aquila zur Ausübung seines Handwerks wohl einen größeren Raum nötig hatte, ist es leicht erklärlich, daß man sich gern bei diesen treuen Leuten versammelte. An eine „Hausgemeinde", die nur aus den Familiengliedern bestanden hätte, ist wohl nicht zu denken; schon aus dem Grunde, weil nirgendwo gesagt wird, daß Aquila und Priscilla Kinder oder sonstige Angehörige besessen hätten.
Wenn der Apostel im 5. Verse Epänetus „seinen Geliebten" nennt, so weist das offenbar auf besondere Bande der Zuneigung hin, die zwischen ihm und diesem „Erstling Asiens für Christum" bestanden. Paulus umfaßte alle Heiligen mit derselben brüderlichen Liebe, aber Epänetus war die erste Frucht seiner gesegneten Arbeit in der römischen Provinz Asien gewesen, und da er sich ohne Frage seit langem als treu erprobt hatte, besaß er die besondere Zuneigung seines Vaters in Christo.
„Grüßet Maria, die sehr für euch gearbeitet hat" (V. 6). Beachten wir, daß in der Reihe der Gegrüßten manche Schwestern als solche bezeichnet werden, die im Herrn arbeiteten oder gearbeitet hatten. (Vergl. V. 12.) Von Maria nun wird gesagt, daß sie sehr für die Gläubigen in Rom gearbeitet hatte, diesen also vorteilhaft bekannt sein mußte.
„Grüßet Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, welche unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die auch vor mir in Christo waren" (V. 7). Es ist interessant, wie die Liebe allerlei Umstände und Beziehungen hervorzuheben weiß, welche geeignet waren, die genannten Personen zu ermuntern und sie zugleich vor ihren Mitgläubigen in ein günstiges Licht zu stellen und ihnen wertvoll zu machen.
In den nächsten Versen nennt Paulus auch Amplias und Stachys seine „Geliebten im Herrn", Urbanus seinen „Mitarbeiter in Christo", Apelles den „Bewährten in Christo", Herodion seinen „Verwandten"; an die, welche in den Häusern des Aristobulus und Narcissus „im Herrn" waren, sendet er nur einen Gruß. Die Liebe vergißt keinen, aber sie schärft den Blick und leitet im Urteil. Wie verschiedenartig wird dereinst erst das Urteil sein, wenn Der es fällt, der Liebe und Licht zugleich ist! Möchten wir alle eifriger nach Seiner Anerkennung streben!
„Grüßet Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßet Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn" (V. 12). Wir haben schon weiter oben auf solche Schwestern hingewiesen. Zwei von ihnen arbeiten noch im Herrn, eine, Persis, „die Geliebte", hatte in der Vergangenheit viel im Herrn gearbeitet. Warum jetzt nicht mehr? War Alter oder Krankheit die Ursache? Wir wissen es nicht. Der Titel „die Geliebte" läßt uns kaum daran denken, daß diese teure Schwester erlahmt oder gleichgültig geworden wäre.
„Grüßet Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter" (V. 13). Wenn Rufus derselbe Mann ist, von dem wir in Markus 15, 21 lesen, was von manchen Auslegern angenommen wird, so dürfen wir wohl sagen, daß der Herr den unfreiwilligen Dienst, den der Vater des Rufus Ihm einst am Tage Seines Leidens und Sterbens erweisen durfte, reich belohnt hat. Wir dürfen dann auch als sicher annehmen, daß das ganze Haus Simons von Kyrene dem Herrn treu angehangen hat, da Paulus die Mutter des Rufus (wohl in dankbarer Erinnerung an erfahrene Liebe und Fürsorge) auch seine Mutter nennt und ihn selbst als „den Auserwählten im Herrn" bezeichnet. Alle in Christo Geheiligten sind im Herrn auserwählt, aber Rufus hatte sich dieser Bezeichnung wohl besonders würdig erwiesen.
Nachdem der Apostel dann in den nächsten beiden Versen noch eine Reihe von Namen ohne besondere Beifügung genannt hat, schließt er den ganzen Abschnitt mit den Worten: „Grüßet einander mit heiligem Kuß. Es grüßen euch alle Versammlungen des Christus." Die gleiche Aufforderung finden wir in 1. Korinther 16, 20; 2. Korinther 13, 12 und 1. Thessa-lonicher 5, 26. (Vergl. 1. Petr. 5, 14.) Ohne an ein bestimmtes Gebot des Apostels denken zu wollen, dürfen wir doch annehmen, daß die Begrüßung mit einem Kuß unter den Christen gebräuchlich war; und wenn Gott dafür gesorgt hat, daß diese Aufforderung für uns aufbewahrt blieb, so würde es nicht gut sein, mit Gleichgültigkeit über sie hinwegzugehen. Es ist sicher so, daß in dieser Art der Begrüßung sich eine größere Wärme und Herzlichkeit kundgibt, als in dem bloßen Händeschütteln! und wenn es auch im Morgenlande und besonders unter den Juden, mehr als bei uns, gebräuchlich war, den Gruß mit einem Kuß zu verbinden, und der Nachdruck hier und an den drei anderen Stellen auf dem Wort „heilig" liegen mag, sollten wir doch nicht vergessen, daß der Heilige Geist dieser Begrüßungsart Seine Zustimmung gegeben hat. Nicht als ob Gläubige, so oft sie einander begegnen, sich mit einem Kuß begrüßen sollten, aber es sollte doch auch nicht so sein, daß die darin sich kundgebende Liebe nie oder doch nur ganz selten, bei besonderen Gelegenheiten, zum Ausdruck kommt.
In dem nächsten Abschnitt muß der Apostel sich um des Wohles der Gläubigen willen noch mit anderen, dem bisherigen ganz entgegengesetzten Dingen beschäftigen. Neben so vielem Guten und Anerkennungswerten gab es in Rom auch betrübende Erscheinungen. „Ich ermahne euch aber, Brüder, daß ihr achthabet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab" (V. 17). Aus diesen Worten geht hervor, daß damals schon Männer in der Versammlung zu Rom auftraten, die im Gefühl ihrer eigenen Wichtigkeit und unter dem auch heute so wohlbekannten Drang, immer
etwas Neues zu bringen, nicht bei der einfachen Lehre blieben, die ihnen gebracht worden war, sondern „verkehrte Dinge lehrten, um die Jünger abzuziehen hinter sich her".
Der Reiz der Neuheit ist groß, besonders für schwache, einfältige Seelen, und wenn die Verkündiger neuer Lehren, wie es meist der Fall ist, diese in schöne, verführerische Worte und süße Reden einzukleiden vermögen, so gelingt es ihnen leicht, „die Herzen der Arglosen zu verführen" (V. 18). Man folgt den Verführern, schart sich um sie, eifert für sie, und „Zwiespalt und Ärgernis" sind die unausbleiblichen Ergebnisse. Der Apostel ermahnt die Brüder, auf solche Leute achtzuhaben und sich von ihnen abzuwenden. Der Apostel Johannes fordert in späteren Tagen die Gläubigen auf, alle, die weitergingen und nicht blieben in der Lehre des Christus, nicht ins Haus aufzunehmen, ja, sie nicht einmal zu grüßen; denn wer ihnen Heil zu ihrem Wege wünschte, würde teilnehmen an ihren bösen Werken.
Solche Männer sind nicht Diener unseres Herrn Christus, denen das Wohl der Herde am Herzen liegt, sondern sie dienen „ihrem Bauche". Die Pflege ihrer eigenen Personen und Interessen geht allem anderen voran, überaus ernst ist das Urteil des Geistes über sie hier und an anderen Stellen. Ihnen gegenüber gibt es nur ein Bewahrungs- und Abwehrmittel, und das ist „die Lehre, die wir gelernt haben", das Wort der Wahrheit. (Vergl. auch Apstgsch. 20, 32.) So wie die „auserwählte Frau" und der „geliebte Gajus" (2. und 3. Joh.) angewiesen wurden, die Lehre zu prüfen, die ihnen gebracht wurde (nicht die Personen), so gibt auch hier das Abirren von der einmal überlieferten Wahrheit Anlaß zu der Ermahnung, sich mit Entschiedenheit abzuwenden. Einen anderen Weg gibt es nicht, und der Apostel rechnet auf den Gehorsam der römischen Gläubigen, der überall bekannt geworden war und sein Herz erfreute. Zugleich ermahnt er sie, „weise zu sein zum Guten, aber einfältig zum Bösen" (V. 19).
Die letzten Worte sind unserer besonderen Beachtung wert. Die Menschen dieser Welt suchen durch die Beschäftigung mit dem Bösen sich vor Betrug und Überlistung zu schützen. Nicht so der Gläubige, der die Weisheit von oben kennt, die „aufs erste rein ist, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte" (Jak. 3, 17). Ihm liegt nicht daran, die verschiedenen Arten oder Abstufungen des Bösen kennen zu lernen, er ist einfältig zum Bösen, „u n m ü n d i g an der Bosheit" (1. Kor. 14, 20), aber „weise zum Guten". Mit dem Guten beschäftigt, die Stimme des guten Hirten hörend und den Belehrungen des guten Geistes Gottes lauschend, geht er still den Weg, den sein Herr ihm vorangegangen ist, den Pfad heiliger Absonderung und göttlicher Güte und Weisheit. Diesen Pfad kennt er, und andere braucht er nicht zu kennen. Er weiß wohl, daß er sich noch auf dem Schauplatz der Sünde befindet, wo Satan herrscht und das Böse so oft triumphiert, aber er weiß auch, daß Satans Macht am Kreuze gebrochen worden ist, und hört mit Frohlocken, daß der Gott des Friedens, der Treue hält auf ewig, „in kurzem den Satan unter unsere Füße zertreten wird".
In kurzem — höre auch du es, meine Seele, und freue dich! Hat Gott auch in Gnaden bis heute noch gezögert, das Gericht kommen zu lassen, der Richter steht vor der Tür, dein Heiland kommt bald! Und bis dahin wird die Gnade deines Herrn Jesus Christus mit dir sein alle Tage. (V. 20.) Vergiß es nicht!
Der nächste Vers bringt Grüße von Timotheus, dem Mitarbeiter des Apostels, und von dreien seiner Verwandten, deren Namen kaum bekannt sind und vielleicht auch den Empfängern des Briefes unbekannt waren. Aber der Glaube an das Evangelium verbindet die Herzen und weckt die liebende Teilnahme des einen für den anderen, selbst wenn man einander nie gesehen hat.
Der Gruß in Vers 22 erinnert uns an die Tatsache, daß Paulus keinen seiner Briefe, mit Ausnahme desjenigen an die Galater, mit eigener Hand geschrieben hat. Er diktierte, und ein anderer schrieb. Hier ist ein Bruder, namens Tertius, der Schreiber. Zur Beglaubigung des wichtigen Inhalts unterzeichnete der Apostel aber alle seine Briefe mit eigener Hand. (Vergl. 1. Kor. 16, 21; Gal. 6, 11; 2. Thess. 3, 17.)
Es folgen dann noch kurze, aber trotz ihrer Kürze bedeutungsvolle Grüße von Gajus, dem Wirt der ganzen Versammlung in Korinth, sowie des Apostels selbst, von Erastus, dem Stadt-Rentmeister, und schließlich von dem „Bruder" Quartus, einem wohl einfachen, bescheidenen Manne, dessen Herz von Liebe zu seinen Brüdern in der Ferne erfüllt war, und der dieser Liebe Ausdruck zu geben wünschte. Dann schließt der Apostel seinen Brief mit dem uns so wohlbekannten Wunsch: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen."
Die drei letzten Verse bilden gewissermaßen einen Anhang, der aber von außergewöhnlicher Wichtigkeit ist. Der Apostel kann, wie ein anderer Schreiber sagt, „diesen Brief, in welchem er das Evangelium in seinen einfachsten Elementen entwickelt, in seinen praktischen Ergebnissen, seiner Verbindung mit den verschiedenen Haushalten oder Verwaltungen Gottes und den Pflichten, die aus der Annahme der guten Botschaft hervorgehen, nicht schließen, ohne das Geheimnis Gottes, dessen Offenbarung er in einigen seiner späteren Briefe bringt, mit den genannten Dingen in Verbindung zu bringen."
Die himmlische Seite der Wahrheit, wenn ich mich kurz so ausdrücken darf, d. h. alles das, was mit Christo, dem zur Rechten Gottes verherrlichten Menschensohne, dem Haupte Seines Leibes, der Versammlung, in welchem Gott einmal alles unter ein Haupt zusammenbringen will, in Verbindung steht, finden wir in unserem Briefe nicht. Derselbe hat einen anderen Zweck. Er behandelt die Frage, wie die einzelne Seele in glückseliger Freiheit vor Gott stehen kann. Die Tatsache, daß wir alle einen Leib bilden in Christo, sowie die Vorrechte dieses Leibes, der Versammlung, werden wohl kurz angedeutet, aber nicht näher besprochen. Wir dürfen auch im Blick hierauf sagen: „Alles hat seine Zeit." Die Stunde sollte kommen, in welcher der Verwalter der Geheimnisse Gottes auch dieses Geheimnis, in Verbindung mit der ganzen Fülle des Christus, den Gläubigen, vornehmlich den Ephesern und Kolossern, mitteilen würde. Der geistliche Zustand dieser beiden Versammlungen gestattete es, sie zu solchen Höhen hinaufzuführen. Die Versammlung in Rom bedurfte aber der Befestigung in den Grundlagen des Christentums, in dem, was der Tod und die Auferstehung des Sohnes Gottes dem sündigen, verlorenen Menschengeschlecht gebracht haben. Was uns heute bleibt, ist, alle diese Gaben Gottes dankbar entgegenzunehmen und die Weisheit und Gnade zu bewundern, die sich auch in der Art ihrer Darreichung bewiesen hat.
Das Herz des Apostels war so mit dem, was er „sein Evangelium" nennt, erfüllt — dieses Geheimnis stand allezeit so frisch und lebendig vor seiner Seele — daß er auch jetzt nicht umhin kam, noch einen Augenblick dabei zu verweilen. Dieses Geheimnis war, wie er sagt, in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen gewesen, „jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden" (V. 25, 26). Der Geist Gottes hatte in den früheren Zeitaltern über diese Dinge geschwiegen. Die Propheten des Alten Bundes hatten zwar „von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach" zuvor gezeugt, aber Gottes Gedanken über Christum und die Versammlung waren nie bekannt gewesen; sie waren erst durch prophetische Schriften des Neuen Testaments kundgetan worden. Welch einen bedeutsamen Charakter verleiht auch die letzte Bezeichnung den Briefen der Apostel! Diese Männer waren nicht nur Gesandte Gottes, sondern auch Propheten. Sie legten, ja, bildeten die Grundlage, auf welche wir aufgebaut sind. (Eph. 2, 20.)
Es konnte unmöglich in der Absicht Gottes liegen, das Geheimnis von Christo und der Versammlung während des Zeitalters des Gesetzes kundzutun, aber nachdem durch das am Kreuz vollendete Werk Christi und durch Seine Verherrlichung zur Rechten der Majestät droben alle Bedingungen dafür erfüllt waren, wurde es nach Befehl des ewigen Gottes geoffenbart und durch prophetische Schriften zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan. Die zeitlichen Wege Gottes standen in Verbindung mit Israel und der Erde; Seine ewigen, mit dem „Geheimnis" verbundenen Gedanken sind jetzt allen Nationen kundgetan worden, und unsere Sache, nein, unser seliges Vorrecht ist es, sie in einfältigem Glaubensgehorsam anzunehmen und bewundernd zu betrachten. 0 dieser allein weise Gott! Wie tief sind Seine Gedanken, wie anbetungswürdig Seine Wege, wie unausforschlich ist Sein Tun!
Wir sind am Schluß unserer Betrachtung angekommen. Wir haben ein wenig hineinschauen dürfen in die „Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes". Dieses Wenige hat unsere Herzen erwärmt und weit gemacht, hat uns gezeigt, wie gering unser Erkennen und Verstehen noch ist, und den Wunsch in uns geweckt, bald vom Stückwerk zum Vollkommenen, vom Glauben zum Schauen zu gelangen. Was bleibt uns am Ende anders übrig, als von Herzen einzustimmen in die Lobpreisung des großen Apostels der Nationen: „Dem aber, der uns (euch) zu befestigen vermag ..., dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, Ihm sei die Herriidikelt in Ewigkeit!" Amen.
Für den Thron bestimmt, Paul E. Billheimer
Leseprobe: 
Paul E. Billheimer Vom Segen des Kreuzes
Das Kreuz muß zum Mittelpunkt im Leben der Gläubigen Werden. Dies ist die zentrale Aussage des vorliegenden Buches von Paul E. Billheimer. Paulus schreibt im Römerbrief, unser alter Mensch sei mit Christus gekreuzigt~ Und nur so können wir tatsächlich der Sünde gestorben sein. Aber die Kreuzigung des alten Menschen.ist kein einmaliges Geschehen. Wir müssen am Kreuz bleiben, denn nur von dort aus haben wir Sieg und können den Satan in die Schranken weisen. Nur von dort aus können wir ein geheiligtes Leben führen. Der Autor will uns den Prozeß der Heiligung vor Augen führen. Dabei gibt er ganz konkrete Hinweise und Hilfen für das Leben der Christen.
Paul E. Billheimer stand mehr als sechzig Jahre im Dienst für Jesus Christus. Bevor sein Herr ihn 1983 zu sich rief, arbeiteten er und seine Frau eng mit einer christlichen Radiostation in Kalifornien zusammen. Ein weiteres Buch des Autors ist im Verlag Schulte + Gerth bereits erschienen: „Durchbruch zur Herrlichkeit".
Der Thron des Universums ist ein Kreuz Selbsthingabe ist das Gesetz des Universums, das Prinzip des gesamten Kosmos. Wäre Selbstverleugnung, Selbstaufopferung nicht das Fundament, das höchste Gesetz des Universums, würde dann Gott, der souveräne Herrscher der Welten, nach diesem Gesetz regieren? Seit Golgatha sagt uns der Herr: „Hier ist der Thron des Universums! Nicht nur für Christus, nein, für jedermann.
Hier ist der einzige Weg zu Vollmacht, Kraft und Autorität." Satan trotzte diesem Prinzip und unterlag. In allen Situationen unseres Lebens gibt Gott uns die Chance, entweder nach diesem Grundsatz zu handeln, um uns für die Herrschaft in der Ewigkeit vorzubereiten, oder uns für jene kreuzesfeindliche Haltung zu entscheiden, die das Eigenleben bewahren will und dadurch die Krone verliert. Wer aber Vollmacht über Satan begehrt, der muß am Kreuz bleiben. Hier finden wir Befreiung von aller Eigensucht, allem Sichselbst-dienen und aller Selbsterhöhung.
„Die aber vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst! Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuze herab! Gleicherweise spotteten auch die Hohenpriester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, so wollen wir ihm glauben!" „Und das Volk stand da und sah zu. Es spotteten aber auch die Obersten und sprachen: Andere hat er gerettet; er rette nun sich selbst, wenn er Christus ist, der Auserwählte Gottes!" Lukas 23,35
Satans Angebot an Christus: Sieg ohne Kreuz Mehrmals im Leben und Dienst unseres Herrn Jesus Christus bot Satan ihm einen leichten Weg zur Herrschaft, zur Macht ohne das Kreuz an. Doch das Angebot wurde abgewiesen. Jesus wählte das Kreuz. Versuchung und Möglichkeit, ihm zu entfliehen, bestanden zu jeder Zeit seines Dienstes. Doch er machte sein Angesicht fest wie einen Kieselstein und beschleunigte schließlich noch seinen Tod. Am Beginn seines Dienstes stand Jesus vor einer Alternative: „Alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest."
Es war das Angebot eines Sieges ohne Sterben, einer Krone ohne Kreuz! In der Tat: die ganze Wucht der Versuchung lag in der Aussicht auf Macht ohne Leiden, auf Erhöhung ohne Erniedrigung. Ähnlich war die Alternative, die sich beim Besuch der Griechen bot, als sie einen der Jünger Jesu ansprachen: „Wir möchten Jesus sehen!" Einige nehmen an, daß die Griechen ihn bitten wollten, mit in ihr Land zu kommen, um seinen Dienst dort sicher und ohne Todesgefahr zu tun. Dieser Einladung begegnet Jesus mit den Worten: „Es sei denn, das Weizenkorn fällt in die Erde und erstirbt, so bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht." Jesus wußte, daß sein Tod von überragender Bedeutung für eine verlorene Welt sein würde. Eine Verlängerung seines Lebens konnte niemals den Vorrang haben; was ihn davon abbringen wollte, wurde zurückgewiesen. Zum drittenmal begegnete Jesus dieser Versuchung.
Auf dem Weg nach Jerusalem, kurz vor dem Ende seines Dienstes, teilte er seinen Jüngern mit, daß er von den Hohepriestern und Schriftgelehrten verspottet, angespuckt, verworfen und gekreuzigt würde. Für den fleischlichen Sinn des Petrus eine Tragödie, wodurch der gesamte Dienst Jesu wertlos würde, ganz zu schweigen von der Hoffnung des Jüngers auf eine Machtstellung in einem irdischen Königreich. Deshalb widersprach er Jesus: „Das soll dir niemals geschehen!" Wiederum wies Jesus die Versuchung zurück: „Geh weg von mir, Satan!" Jesus hängt am Kreuz. Seine Prophezeiungen über seinen Tod nahen sich der Erfüllung. Die Stunde, um derentwillen er in diese Welt kam, hat geschlagen - doch noch nicht endgültig. In den Qualen der Kreuzigung, mitten im Todeskampf, den letzten Augenblikken furchtbarster Schmerzen, tritt die Versuchung noch einmal an ihn heran: „Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz!"
Es ist nicht nötig zu betonen, daß Christus die Macht dazu besaß, hätte er sich so entschieden. „Oder meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, und er würde mir noch jetzt mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Mehr als eine historische Wahrheit Christus herrscht heute, weil er ans Kreuz ging und dort blieb, bis die Kraft seines Lebens durch den Tod freigesetzt wurde. Doch ist es mehr als eine historische Wahrheit, es ist auch eine sittliche, denn Paulus sagt in Römer 6, wobei er sich auf Gläubige bezieht: ,,... wissen wir doch, daß unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so daß wir der Sünde nicht mehr dienen." -
„Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln." Und in Galater 2: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat." Mit großer Deutlichkeit betont diese -wie auch andere - Stelle der Schrift, daß alle Gläubigen an Christi Tod teilhaben.
Aber wie Dr. Huegel ausführt, ist unser Tod in Christus nur eine mögliche Beziehung. Er sagt: „Wenngleich vom göttlichen Gesichtspunkt aus längst vollkommen, historisch und objektiv vollendet, ist es dennoch etwas, das menschlicherseits nur wirksam wird, wenn es im Glauben ergriffen wird." Der Kampf beginnt Was bedeutet es, wenn wir uns vorbehaltlos hingeben, um geheiligt vom fleischlichen Sinn gereinigt und voll Geistes zu werden? Wir erklären uns damit einverstanden, daß unser alter Mensch, der- juristisch gesehen - mit Christus gekreuzigt ist, auch wirklich und praktisch ans Kreuz genagelt wurde. Gott akzeptiert unser Opfer, wenn es ernst gemeint und die Bereitschaft echt ist. Aber dann beginnt der Kampf. Was wir theoretisch vollzogen, muß nun in die Praxis übertragen, muß im Alltag, in unserer Erfahrung Wirk
Busch Wilhelm 1897-1966
365 mal ER. Tägliche Andachten
Das Geheimnis des Kreuzes
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Tägliche Andachten
Die belebte Straße. Entscheidende Begegnungen mit Jesus
Die Suchaktion Gottes. Kurzgeschichten der Bibel
Es geht am Kreuz um unsere Not. Predigten aus dem Jahre 1944
Freiheit aus dem Evangelium. Meine Erlebnisse mit der Geheimen Staatspolizei
Gegenstände der Passion. Anschauungs-Unterricht über das Leiden Jesu
Gottes Auserwählte. Aus den letzten Ansprachen Pfarrer Buschs 1966
In der Seelsorge Gottes. Angefochtene Gottesknechte
Jesus predigen
Jesus unser Schicksal
Jesus unsere Chance!
Jesus unsere einzige Hoffnung
Jesus unser Friede
Jesus unser König
Kleine Erzählungen
Pastor Wilhelm Busch erzählt – Auswahlband
Plaudereien in meinem Studierzimmer
Spuren zum Kreuz. Christus im Alten Testament
Unter Menschen. Kleine Erzählungen
Von Bethlehem bis Rom. Predigten zu den Festtagen im KirchenjahrDatei)
Was bremst denn da? Aufsätze für ein unverkrampftes Christsein
Wunderbar sind deine Werke. Vier Ansprachen über Texte aus den Psalmen
Bormuth Lotte 1934
Leben im Aufwind
... so sollt ihr meinen Bogen sehen
... wie die Sterne am Himmel
Am Ende zählt nur die Liebe
Aufregend - aber schön: so ist das Leben
Aus meinem Leben: Meines Lebens bunte Blätter
Beschenkt mit einem Königreich
Das Weihnachtstelegramm
Der Brötchentütenmissionar
Der verdächtige Nikolaus
Dichter, Denker, Christ: das Leben des Fjodor Dostojewski
Die Fülle meines Lebens
Die Geschichte einer Flucht
Die Gitarre auf dem Wunschzettel
Die Nacht leuchtet wie der helle Tag
Eine feste Burg ist unser Gott: aus dem Leben von Martin Luther
Freude und Trost ... aber werden bleiben
Fröhlich soll mein Herze springen: aus dem Leben von Paul Gerhardt
Für den Himmel geboren
Glück ist ein Geschenk des Himmels
Gott entdecken ist Leben
Gott kommt mir immer entgegen
Hätte ich nur einen Menschen
Heute muss ich Albert heißen: ... und andere wunderbare Geschichten
Hoffnung wird immer groß geschrieben
Ich habe immer an meine Rettung geglaubt: wahre Geschichten
Im warmen Schein der Kerzen
In meinem Herzen ist Weihnachten
Käthe Kollwitz: aus dem Leben einer engagierten Künstlerin
Keine Angst vor der Familie
Kleines Mädchen Nummer fünf
Lass mich das Ziel vor Augen haben
Liebe macht lebendig
Mein Lied für Gott: das Leben der Mahalia Jackson
Mosaiksteine meines Lebens
Mütter in der Krise - Mütter unter Gott
Schicksale, die das Herz bewegen
Schicksale: wahre Geschichten, die das Herz bewegen
Schlummern unterm Weihnachtsbaum
Segensströme im Alltagsgrau
Spurgeon: ... und er predigte in Vollmacht
Stark im Zerbruch: ein persönlicher Bericht
Staunen vor Freude: kleine Geschichten zum Durchatmen
Ungewöhnlich und doch wahr: Geschichten, die das Leben schrieb
Weil du so wertvoll bist
Wenn die Seele wieder singt
Wer baut die Gottesstadt?
Wie das Leben so spielt
Wie ein bunter Blumenstrauß: wahre Geschichten
Wie Perlen auf einer Schnur
Wunderbare Weihnachtspost
Büchle Elisabeth & Noa C. Walker
Im Herzen die Freiheit
Die Magd des Gutsherrn
Wohin der Wind uns trägt
Sehnsucht nach der fernen Heimat
Das Mädchen aus Herrnhut
Goldsommer
Der Klang des Pianos
Himmel über fremdem Land (Band 1 der Meindorff-Saga)
Sturmwolken am Horizont (Band 2 der Meindorff-Saga)
Hoffnung eines neuen Tages (Band 3 der Meindorff-Saga)
Skarabäus und Schmetterling
Unter dem Polarlicht
Sturm im Paradies
Unter dem Sternenhimmel
Der Korsar und das Mädchen
Unter dem Mitternachtsmond
Mehr als nur ein Traum
Unter dem Abendstern
Im Schatten der Vergangenheit
Das Lächeln des Drachen
Winterleuchten am Liliensee
LIV Neuanfang mit Hindernissen
Frühlingsfunkeln am Liliensee
Der Sommer danach
Das beste Geschenk von allen - WeihnachtsBüchle
Die Erbin des Bernsteinzimmers
Bellett, John Gifford (1795-1864)
John Gifford Bellett wurde am 19. Juli 1795 als ältester Sohn einer anglo-irischen Familie in Dublin geboren, verbrachte jedoch den größten Teil seiner Jugend in einem Landhaus außerhalb der Stadt. Er besuchte mit seinem jüngeren, von ihm sehr geliebten Bruder George, der später Pastor wurde, zunächst die Grundschule in Taunton und verlebte die Ferien bei seiner gottesfürchtigen Großmutter in Somerset.
Auf der höheren Schule zu Exeter und später im Trinity College in Dublin zeichnete er sich durch eine große Begabung aus. Während dieser Zeit kam er 1817 zur Bekehrung. Er studierte dann bis 1821 in London Rechtswissenschaft und kehrte nach Dublin zurück, um dort eine Anstellung anzutreten. Diese gab er jedoch wohl schon bald auf, um sich ganz dem Studium und der Verkündigung des Wortes Gottes hinzugeben.
In diesen Jahren heiratete er Mary Drury. Vier ihrer Kinder nahm der Herr ihnen im zarten Kindesalter.
Im Jahre 1826 oder 1827 Lernte John Gifford Bellett, der bekanntlich zu den ersten Brüdern gehört, die sich in Dublin nach dem Worte Gottes versammelten, Anthony Norris Groves aus Exeter kennen. Dieser war bei seinen späteren Besuchen in Dublin meistens Gast im Hause Belletts. Im Winter 1827/28 stieß auch John Nelson Darby (siehe Seite 40) zu dieser Gruppe von Brüdern. Anfang des Jahres 1827 äußerte Groves gegenüber Bellen, daß es schriftgemäß sei, jeden Sonntag das Brot zu brechen. Das wurde offensichtlich auch in die Tat umgesetzt. Bei seinem Abschiedsbesuch in Dublin (er wurde Missionar im Orient) äußerte Anthony Norris Groves Ende 1829 gegenüber John Gifford Bellett, daß es nach Gottes Gedanken sei, in aller Einfachheit als Brüder zusammenzukommen, und nicht auf ordinierte Geistliche zu blicken, sondern auf den Herrn zu vertrauen, der Brüder aus ihren eigenen Reihen zur Erbauung benutzen könne.
Später schrieb John Gifford Bellett, daß diese Worte ihn zutiefst beeindruckt hätten. In dieser Zeit besuchte John Gifford Bellett auch (gemeinsam mit John Nelson Darby) die sogenannten Powerscourt-Konferenzen, die im Schloß einer gläubigen Dame stattfanden.
Bis zum Ende des Jahres 1829 war der Versammlungsort der kleinen Schar von Brüdern die Wohnung von Francis Hutchinson in Dublin, Fitzwilliam Square 9, aber im folgenden Jahre mietete man einen öffentlichen Raum in der Aungier Street. Inzwischen war auch John V. Parnell (der spätere Lord Congleton) zu diesem Kreise derer gestoßen,
John Gifford Bellett in Irland. verbrachte seine Tage mit Besuchen bei den Christen zur Ermunterung und Beratung, besuchte die Zusammenkünfte der Gläubigen und hielt Bibelstunden in den Häusern seiner Freunde ab. In diesen Jahren entstanden die Betrachtungen über die Psalmen, über Lukas und Johannes. Später kamen Betrachtungen über das Buch Hiob (veranlaßt durch den Heimgang seines Sohnes), die Patriarchen, die kleinen Propheten, die vier Evangelien, die Briefe an die Epheser und Thessalonicher sowie manche andere Schriften hinzu. Seine bekanntesten und wohl schönsten Bücher, die unseren Herrn Jesus zum Gegenstand haben, sind „Der Sohn Gottes" und „Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus in Seiner Menschheit". Das letztgenannte Buch war auch das letzte, das er kurz vor seinem Heimgang schrieb.
In den Jahren 1846 bis 1848 wohnte er vorübergehend in Bath. Nach Dublin kehrte er erst 1854 zurück, um dort bis zu seinem Heimgang zu bleiben. Er entschlief am 10. Oktober 1864, ungefähr ein Jahr nach dem Tode seiner geliebten Gattin.
Es wird berichtet, daß er in seinen letzten Tagen von einem seiner Freunde besucht wurde, der ihn in körperlich schwacher Verfassung antraf. Seine mageren Hände waren gefaltet, Tränen rannen über seine Wangen, und er sagte: „Mein teurer Herr Jesus, du weißt, wie vollkommen ich mit Paulus sagen kann: abzuscheiden und bei Christo zu sein ... ist weit besser. 0, wieviel besser! Ich sehne mich danach! Sie kommen und sprechen von einer Krone der Herrlichkeit, - möchten sie aufhören; von den Herrlichkeiten, vom Himmel, - möchten sie still sein! Ich wünsche keine Krone! Ich habe IHN selbst, IHN selbst! Ich werde bei IHM selbst sein! Ach, bei dem Manne von Sichar zu sein, bei dem, der stillstand, um Zachäus zu rufen, bei dem Manne von Johannes 8, bei dem Manne, der am Kreuze hing, bei dem Manne, der starb! 0, bei IHM zu sein, ehe die Herrlichkeiten, die Kronen und das Reich in Erscheinung treten! Es ist wunderbar, wunderbar! Allein mit dem Manne von Sichar, dem Manne am Tore von Nain; und ich werde allezeit bei IHM sein! Nehmt diesen traurigen, traurigen Schauplatz, wo Er verworfen wurde, und gebt mir Seine Gegenwart! 0, der Mann von Sichar!"
J. G. Belletts ganzer Dienst war darauf ausgerichtet, Entfremdung zu vermeiden und die Ermahnung zu erfüllen: „Seid in Frieden untereinander".
Quelle: Gedenket eurer Führer
Bücher von Bellett auf dem Markplatz ChristundBuch.de
Betrachtung über das Evangelium nach Lukas, J.G. Bellett
Die geöffneten Himmel J.G. Bellett
Die Herrlichkeit Jesu Christi unseres Herrn als Mensch, J G Bellett
Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus in seiner Menschheit, J G Bellett
Die kleinen Propheten, Bellett, J. G
Die moralische Herrlichkeit Jesus Christus, G. Bellett
Die Welt vor der Flut und die Patriarchen, J.G. Bellett
Epheser Brief, J.G. Bellett
The Moral Glory of the Lord Jesus Christ, J G Bellett
Briem Christian
Bücher von Christian Briem
Antworten auf Fragen zu biblischen Themen, Christian Briem
Aus der Finsternis zum Licht, Christian Briem
Da bin ich in Ihrer Mitte, Christian Briem
Die christliche Taufe - Was bedeutet sie? Christian Briem
Die Entrückung der Gläubigen - Gehen Kinder Gottes durch die große Drangsal, Christian Briem
Ein Volk für seinen Namen Apostelgeschichte 1, Christian Briem
Ein Volk für seinen Namen Apostelgeschichte 2, Christian Briem
Ein Volk für seinen Namen Teil 3, Apg. 3-5, C. Briem
Fundamente des christlichen Glaubens, Christian Briem
Glücklich leben als Christ? Christian Briem
Ich sah den Himmel geöffnet, Christian Briem
Mit weitem Herzen auf schmalem Weg, Christian Bríem
