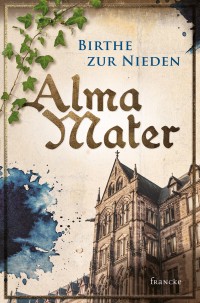Alma Mater, Birthe zur Nieden
Alma Mater
Marburg in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges:
Georg Kammann hätte sich nie träumen lassen, dass ausgerechnet er einmal Theologie studieren würde. Doch ein Überfall auf sein Heimatdorf, ein erhörtes Gebet und die Großzügigkeit seiner adeligen Patentante führen ihn in die Universitätsstadt Marburg. Hier eröffnen sich dem einfachen Lehrerssohn ungeahnte Möglichkeiten. Doch dann wird Marburg immer mehr zum Spielball der Mächtigen. Der Streit zwischen den Hessen-Kasselischen und den Hessen-Darmstädtischen entflammt neu und wird schonungslos auf dem Rücken der einfachen Bevölkerung ausgetragen. Während die Kanonen donnern, muss Georg plötzlich selbst kämpfen: um seine Zukunft, seine Berufung, seinen Glauben und um das Mädchen, das er liebt.
LESEPROBE
Deutschland, 1642
Der März war erst wenige Tage alt und schmeckte mehr nach Winter als nach Frühling. Fröstelnd setzte Georg sein Bündel ab, um den Mantel enger um sich zu wickeln. Es war noch so früh am Morgen, dass ein bläuliches Licht über der Landschaft lag und die Konturen der immer noch kahlen Bäume am Wegesrand ineinanderzufließen schienen. Kälte lag auf dem Land und das Gras unter Georgs Füßen knisterte vom Raureif, aber die Straßen waren nun endlich frei von Schnee und trocken genug, um nach dreimonatiger Wartezeit nach Marburg aufbrechen zu können. Ab Grünberg würde er nicht mehr allein wandern müssen, dort hatte er sich mit drei Handwerksgesellen verabredet, die ebenfalls nach Marburg reisen wollten.
Je mehr Reisende gemeinsam unterwegs waren, desto sicherer war jeder einzelne. Heute sollte der Aufbruch von Grünberg aus stattfinden.
Wieder einmal knurrte Georgs Magen laut auf, aber er hatte ihm nichts zu bieten. Seine Mutter hatte ihm zwar etwas von den spärlichen Vorratsresten mitgeben wollen, aber er hatte abgewehrt. Er wusste gut, dass ihm vorerst nichts anderes übrigbleiben würde als zu betteln, und ob er einen Tag früher oder später damit anfing, fiel nicht ins Gewicht. Das, was er mitnahm, würde seiner Familie in den nächsten Tagen fehlen. Dort, wo sie waren, gab es niemanden mehr, den sie noch um ein Stück Brot hätten bitten können – dort, wo Georg hinging, hoffentlich schon.
Er nahm das Bündel wieder auf, schob es auf der anderen Schulter zurecht und setzte sich in Bewegung. Es war zu kalt, um hier stehenzubleiben, außerdem hatte er eine weite Strecke vor sich. Zurück schaute er nicht. Womöglich wäre er dann umgekehrt. Er hatte sich rasch von seiner Familie verabschiedet und nur noch einmal gewinkt, bevor er Günsendorf den Rücken gewandt und so schnell wie möglich davonmarschiert war. Trotzdem verspürte er bei dem Gedanken an sein Zuhause einen schmerzenden Klumpen in seiner Brust.
Georg versuchte das Gefühl zu ignorieren und stattdessen kräftiger auszuschreiten. Bald wurde es heller, wenn auch nicht allzu sehr, denn die Sonne blieb hinter einer dichten Wolkenschicht verborgen. Zu Georgs Linken lagen Felder, die von Unkraut überwuchert waren. Zu viele Bauern waren im letzten Jahr nicht dazu gekommen, ihre Äcker zu bearbeiten. Zu viele Bauern waren gar nicht mehr da, nachdem Pest und Krieg ganze Dörfer ausgerottet hatten. Im Stillen sandte Georg ein kurzes Gebet gen Himmel, dass seiner eigenen Heimat ein solches Schicksal erspart bleiben möge, dabei setzte er weiterhin einen Fuß vor den anderen. Marburg war noch weit.
Schließlich erreichte er Grünberg. Die drei Gesellen warteten bereits vor der Schenke auf ihn, vor der sie sich verabredet hatten. Sie sprachen nicht viel, ja, grüßten Georg nicht einmal wirklich, bevor sie losgingen, aber das war in Ordnung. Sie waren nur aus Notwendigkeit miteinander unterwegs und würden nach diesen sieben oder acht Stunden gemeinsamen Weges vermutlich kaum noch einmal miteinander zu tun haben. Seine drei Reisebegleiter waren auf der von ihren jeweiligen Zünften vorgeschriebenen Wanderschaft und blieben nirgends lange.
Nachdem sie die Stadt verlassen hatten, begannen die Wandergesellen Lieder zu singen, die meisten davon nicht gerade fromm, und Georg trottete ihnen schweigend hinterher. Sein Geist war sowieso längst in Marburg. Ob er die Aufnahmeprüfung auch wirklich bestehen würde? Was, wenn nicht? Und wovon würde er sein tägliches Brot bezahlen? Vor allem der letzte Gedanke saß nicht nur in Georgs Kopf, sondern auch in seinem leeren Magen und wurde dort immer drängender.
Irgendwann gegen Mittag konnte er nicht mehr weitergehen. Seine Beine fühlten sich so wackelig an, als ginge er durch tiefen Sand, und jeder Schritt brachte ihn zum Keuchen.
»Was denn, macht Ihr schon schlapp?«, spottete Dörr, der Wortführer, als er seinen Zustand bemerkte.
Georg zögerte, aber dann sagte er es doch: »Ich habe heute noch nichts gegessen.« Es half nichts, es zu verschweigen, er musste endlich etwas in den Magen bekommen.
»Erwartet Ihr etwa, von uns verpflegt zu werden?«
»Nein. Da vorne ist ein Dorf, ich werde dort um ein Stück Brot bitten.«
»Aber nicht in unserem Beisein, wir sind kein Bettelvolk!« Dörr machte ein angewidertes Gesicht. »Wir warten am Ortsausgang auf Euch.«
Georg nickte, drehte sich um und hielt mit zusammengebissenen Zähnen auf das Dorf zu. Wenn doch nur Sommer wäre, dann könnte er im Wald ein paar Brennnesseln oder Beeren finden und bräuchte nicht fremde Leute anzubetteln, die vermutlich selbst wenig zu beißen hatten. Aber es half nichts.
Das Dorf sah nicht sehr mitgenommen aus und Georgs Skrupel schwanden weiter, als er die kleine Herde Gänse und die Hühner sah, die zwischen den Häusern nach Körnern und Würmern suchten. Gerade, als er das erste Haus passierte, trat eine Frau aus einem Schuppen daneben, im Arm einen kleinen Korb.
Georg holte tief Luft und trat auf sie zu. »Verzeiht meine Dreistigkeit, aber hättet Ihr vielleicht etwas zu essen für mich? Ich bin auf dem Weg nach Marburg, mein Dorf wurde im letzten Jahr niedergebrannt und meine Eltern konnten mir nichts mitgeben.«
Die Frau betrachtete ihn mit misstrauisch zusammengezogenen Brauen. »Na schön«, sagte sie schließlich. In ihrem Korb lagen sechs oder sieben Eier. Georg konnte den Blick kaum davon abwenden. »Einen Kanten Brot kannst du kriegen.« Sie verschwand im Haus und kam mit einem durchaus großzügigen Stück Brot zurück. Georg nahm es und bedankte sich überschwänglich, bevor er seinen Weg fortsetzte. Sobald er aus dem Dorf heraus war, kaute er an dem Brot. Es war altbacken und fast schon steinhart, aber nahrhaft und nicht einmal verschimmelt, mehr hatte er beim besten Willen nicht verlangen können. Zu seiner Überraschung bekam er keine dummen Bemerkungen, sondern nur ein »Wohl bekomm’s!« zu hören, als er seine Reisegefährten einholte.
Die Sonne stand schon recht tief, als sie wieder einmal ein Dorf durchquerten und auf Anfrage erfuhren, dass sie in Leidenhofen waren. Bis Marburg sei es nicht mehr weit. Eigentlich hatten sie vorgehabt, in einem der nächsten Dörfer endlich zu rasten und die Nacht zu verbringen, aber auf diese Neuigkeit hin entschlossen sich die drei Gesellen, doch weiterzugehen. Georg widersprach nicht. Als sie der Weg durch den Wald führte, bereute er jedoch fast, dass er geschwiegen hatte. Es war dunkel, unheimlich und kalt.
Doch schließlich öffnete sich der Wald und im Licht der Abendsonne, die Georg von halb links ins Gesicht schien, bot sich ihm ein atemberaubender Ausblick. Sogar seine drei Gefährten blieben für einen kurzen Augenblick stehen, bevor sie den Berg hinabgingen, mit dem lautstarken Wunsch nach einem guten Bier und einem Mädchen auf den Lippen. Georg ließ sie ziehen und betrachtete die Stadt, die seine Zukunft barg.
Auf einem steil aufragenden Berg lag das Marburger Schloss, trutzig hinter den starken Mauern und Befestigungen und gleichzeitig schön und zierlich mit seinen Türmchen und Fensterfronten. Zu seinen Füßen zogen sich Häuser den Berg hinab, wie Schwalbennester klebten sie am Hang und liefen bis zur Lahn hin aus. Links unterhalb des Schlosses stand eine Kirche zwischen den Häusern, deren Turm seltsam schief aussah, und rechts am Fuß des Abhanges erhoben sich die ehrwürdigen, vierhundert Jahre alten Türme der Elisabethkirche. Hier also hatte man früher, zu papistischen Zeiten, wie die Heiden die Knochen der heiligen Elisabeth von Thüringen angebetet, bevor Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen der Reformation in seinem Land zum Durchbruch verholfen und die Gebeine seiner Vorfahrin aus der Kirche genommen hatte.
Vor all den anderen Gebäuden lag ein eng bebautes Vorstädtchen. Die träge dahinfließende Lahn machte eine Schleife darum und glitzerte, wo die Sonne noch auf sie traf. Die Fachwerkhäuser und Steingebäude warfen tiefe Schatten auf die steinerne Brücke, die in das Dorf hineinführte. Weidenhausen hieß es, erinnerte Georg sich an die Erzählungen seines Vaters.
Er atmete tief ein. Die Stadt lag großartig wie ein ausgebreiteter Schatz vor ihm und er hatte das Gefühl, als hieße sie ihn willkommen: ‚Sei gegrüßt, Georg Nicolaus Kammann, willkommen in deinem neuen Leben. Sei fleißig und lerne, Wissen gibt es hier im Überfluss, und solange du dich bemühst, wirst du am Ende deiner Zeit hier alles haben, was du brauchst, um deiner Kirche zu dienen.‘
Er wusste immer noch nicht, wovon er leben würde, falls er im Pädagogium aufgenommen werden sollte – aber er war bereit, vieles zu erdulden, wenn er hier sein Versprechen erfüllen und seinen Traum leben konnte. Mit neuem Mut und ohne seine Müdigkeit noch zu bemerken, machte Georg sich auf den Weg den Berg hinunter und lief auf die Brücke zu.
* * *
Die Straße war belebt. Etliche von Bauern und ihren Frauen gezogene Karren kamen Georg über die Brücke entgegen. Ihre Ladeflächen waren so gut wie leer. Ein Markttag ging zu Ende und es schien, als sei der Krieg hier weit weg. Gespräche, Rufe und Gelächter waren zu hören und die Menschen wirkten aufgeräumt. Von den drei Gesellen, die Georg noch eine Weile vor sich her hatte gehen sehen, war im Gedränge keine Spur mehr zu entdecken.
»Achtung! Aus dem Weg da!«, ertönte es zusammen mit dem dumpfen Klopfen von Hufen auf der unbefestigten Straße hinter Georg und er trat hastig zur Seite. Ein junger Mann trabte mit wehendem Mantel auf einem kräftigen Braunen vorbei, den Degen an der Seite und einen Hut mit einer leuchtend roten Feder auf dem Kopf. Ob er einer der adligen Studenten war? Ein mulmiges Gefühl begann sich in Georg auszubreiten. Daran hatte er noch gar nicht gedacht: Selbst wenn er es schaffen würde, wenn er wirklich studieren könnte, würde er in die Gemeinschaft der Studenten vermutlich doch nie hineinpassen. Er, der Sohn eines kleinen Dorfschulmeisters, zusammen mit den adligen Herren? Wie viel hatte man wohl mit ihnen zu tun? Und wie sollte man ihnen begegnen?
Aber zuerst einmal müsste er in das Pädagogium aufgenommen werden, rief Georg sich zur Ordnung. Das Studieren lag noch in weiter Ferne. Der Gedanke beruhigte und störte ihn gleichermaßen. Zunächst würde es hauptsächlich heißen, sein Latein zu perfektionieren und Rhetorik zu üben, den Katechismus und das Gesangbuch durchzunehmen. Vieles davon hatte er längst gelernt – vielleicht, vielleicht würden sie ihn in eine höhere Klasse einstufen, wenn er in der Prüfung sehr gut abschnitt? Das würde die Zeit verkürzen und damit das Problem seines Lebensunterhaltes. Er hatte zwar die Zusage seiner Patin, sein Schul- bzw. Studiengeld zu zahlen, aber wie lange sie ihn unterstützen wollte, hatte sie nicht geschrieben. Er musste einfach gut abschneiden, das war er ihr und auch seinem Vater schuldig. Aber jetzt sollte er lieber nicht weiter darüber nachdenken, sonst würde er noch so nervös, dass er nichts mehr wissen würde, wenn es so weit war.
Beginnen konnte all das sowieso erst morgen. Heute Abend war er lediglich ein Besucher. Zögerlich überquerte er die Brücke ganz am Rand, um nur ja niemandem im Weg zu sein, und betrat schließlich das eigentliche Marburg durch das hohe Stadttor. Die Straße stieg gleich danach an und führte rechts an einem beeindruckend großen Gebäude vorbei. Georg schaute an den trutzigen Mauern mit den kleinen Fenstern hinauf und fühlte eine leichte Gänsehaut über seinen Rücken laufen. Das konnte nur das ehemalige Dominikanerkloster sein, in dem das Pädagogium untergebracht war – hier würde er mit Gottes Hilfe bald lernen. Die südliche Außenseite des Klosters bildete gleichzeitig ein Stück der Stadtmauer, daran angeschlossen befand sich eine Kirche, die mit ihren hohen Spitzbogenfenstern auch ohne Turm für Georgs Begriffe schon prächtig genug war. Irgendwo in diesem riesigen Gebäudekomplex würde es hoffentlich wenigstens für diese Nacht ein Plätzchen für ihn geben?
Mit heftig pochendem Herzen ließ er den schweren eisernen Türklopfer an das Eingangstor niederfallen und wartete. Nach einer Weile näherten sich Schritte und die Tür wurde geöffnet. Ein junger Mann schaute ihn mit gerunzelter Stirn an. Georg machte eine Verbeugung, die ihm sehr linkisch vorkam. »Verzeiht die Störung. Mein Name ist Georg Nicolaus Kammann und ich möchte mich zur Aufnahme ins Pädagogium bewerben.«
»So.« Sein Gegenüber strich sich über den modischen dunklen Spitzbart und betrachtete Georg von Kopf bis Fuß. »Wo kommt Ihr her, Kammann?”
»Aus Günsendorf bei Grünberg. Mein Vater ist dort der Lehrer.”
Die Augenbrauen seines Gegenübers hoben sich verächtlich. »Ein Dorflehrer. Aha. Hast du eine Empfehlung, einen Fürsprecher in der Stadt?«
Beklommen schüttelte Georg den Kopf. Er hatte nicht gewusst, dass das nötig war. Würden sie ihn ohne womöglich gar nicht erst prüfen?
»Hm. Hast du denn überhaupt das Schulgeld, wenn du hier wie ein Landstreicher anklopfst?«
»Ich habe einen Brief von meiner Patin in der Tasche, der edlen Frau Sophia Elisabeth von Sassen. Sie wird das Schulgeld zahlen.«
»Na schön. Dann kannst du morgen früh kommen. Ich werde dem Pädagogiarchen Bescheid geben. Wenn du Glück hast, wird er dich dann prüfen. Sei mit dem Glockenschlag sieben hier.« Damit trat er einen Schritt zurück und bevor Georg auch nur Luft holen konnte, um nach einem Platz zum Schlafen zu fragen, fiel die Tür vor seiner Nase ins Schloss.
Einen Augenblick stand er wie betäubt da und starrte auf das alte Holz und die eisernen Beschläge. Prüfung morgen um sieben, vielleicht auch noch beim Rektor des Pädagogiums, und er wusste nicht, ob er überhaupt ein Auge würde zutun können in dieser Nacht. Wenn er draußen übernachten musste, würde er sein Bündel bewachen müssen wie ein Hofhund das Haus seines Herrn.
Nur – wo konnte er sich überhaupt hinlegen? Wo schlief man hier, wenn man kein Geld und keinen Fürsprecher hatte? Für einen kurzen Augenblick wünschte sich Georg, er wäre nie auf diese Reise gegangen.
Aber es half ihm nicht, wenn er hier in Heimweh und Traurigkeit versank, im Gegenteil. Energisch schluckte er den Knoten hinunter, der sich in seiner Kehle gebildet hatte, und machte sich auf die Suche nach einem Schlafplatz.
Der war nicht einmal so schwer zu finden, wie er gedacht hatte. Direkt unter dem stadtseitigen Ende der steinernen Weidenhäuser Brücke war es trocken, und ein Gestrüpp schützte vor direkten Blicken. Seinen vor Hunger schmerzenden Magen ignorierte Georg und sein Bündel legte er sich kurzerhand unter den Kopf.
Langsam wurde es Nacht. Gut, dass er wenigstens seinen Mantel hatte, auch wenn der im letzten Jahr noch kürzer geworden war, denn es wurde immer kälter. Nach einer Weile holte Georg alle Kleider, die er besaß, aus dem Bündel und zog sie übereinander. Dann rollte er sich wie ein Igel zusammen, hielt das deutlich geleerte Bündel zwischen Knien und Armen und schloss die Augen. Wenige Schritte von ihm entfernt gluckerte das Wasser der Lahn an ihm vorbei und sang ihn schließlich sanft in den Schlaf.
555 Seiten, Buch, Paperback
Format: 13,5 x 20,5 cm
Bestellnummer: 332157
ISBN: 978-3-96362-157-4
2. Auflage, erstmals erschienen im August 2020