P Schriftsteller
Evangelisation ein Lebensstil, Jim Petersen
Inhalt
Einleitung
Einige Beobachtungen zu den herkömmlichen
Evangelisationsmethoden 7
I. Teil: Einige Schwierigkeiten
1. Sich der Wirklichkeit einer unerreichten Welt stellen 11
2. Schlimmes Erwachen 22
3. Unser missionarischer Übereifer 27
4. Wirkliche Verständigung 37
II. Teil: Evangelisation durch Verkündigung
5. Verkündigung des Evangeliums 43
6. Das religiöse Erbe 48
7. Reichweite der Verkündigung 51
III. Teil: Evangelisieren durch ein gelebtes Zeugnis
8. Die rätselhaften Briefe der Apostel 55
9. Israel – ein lebendiges Zeugnis an die Welt 60
10. Das Zeugnis der Gemeinde Jesu 65
IV. Teil: Evangelistischer Lebensstil – praktisch
11. Ein gutes Zeugnis 69
12. Eine attraktive Alternative anbieten 78
13. Einheit von Glaube und Leben 82
14. Die Gefahr der Abkapselung 92
15. Angst voreinander 98
16. Wer passt sich wem an? 104
17. Das Prinzip des Leibes Christi 108
18. Drei Bereiche, die zusammenwirken 117
19. Die biblische Grundlage für den Glauben 124
20. Einflussreiche Kräfte bei der Bekehrung 134
21. Das Beispiel von Abrahao 144
22. Einige Tipps für die Praxis 150
7
Einleitung
Einige Beobachtungen zu den herkömmlichen Evangelisationsmethoden Unser Evangelisationsstil ist in Traditionen stecken geblieben 1963 reisten wir als Familie mit dem Schiff von den USA nach Brasilien. Wie erwartet stellte diese Reise für uns einen Neuanfang dar.
Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir schon während der 16 Tage auf dem Schiff entscheidende neue Erkenntnisse sammeln würden. Dieser Lernprozess dauert bis heute an. Das vorliegende Buch ist der Versuch, das weiterzugeben, was ich seit dieser Reise darüber gelernt habe, wie man das Evangelium weitergeben kann.
Wir waren 120 Passagiere an Bord, eine Hälfte Touristen, die andere Hälfte Missionare – 60 Touristen und 60 Missionare! Ein ideales Verhältnis! An Bord kann man nicht viel mehr unternehmen als spazieren gehen, lesen oder Gespräche führen. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Tourist an das Ziel der Reise gelangen konnte, ohne nicht gründlich mit der christlichen Botschaft konfrontiert worden zu sein. Idealere Bedingungen, um das
Evangelium weiterzugeben, konnte es nicht geben.
Während der ersten drei Tage versuchten meine Frau und ich, die anderen Passagiere kennenzulernen. Unsere Gespräche standen nicht unter Zeitdruck, und schon bald diskutierten wir ernsthaft mit unseren Bekannten über Christus. Am dritten Tag wurde mir klar, dass wir die Passagiere bald total überfordern würden, wenn alle anderen 58 Missionare dasselbe tun würden wie wir. Ich entschloss mich, mit den anderen darüber zu reden, wie wir unsere
evangelistischen Bemühungen aufeinander abstimmen könnten. Die erste Gelegenheit zu einem solchen Gespräch ergab sich, als
ich sechs Missionare traf, die auf dem Oberdeck zusammensaßen. Ich setzte mich zu ihnen und erzählte ihnen von meinen Überlegungen. Mein Vorschlag war, dass wir uns absprechen sollten, wie wir die Passagiere am besten erreichen könnten, ohne sie dabei zu überrennen.
Ich hatte die Lage völlig falsch eingeschätzt. Als ich ihnen erklärte, was mir auf dem Herzen lag, haben sich die sechs be fremdet angeschaut. Anscheinend war es ihnen noch nicht in den Sinn
gekommen, mit den anderen 60 Passagieren über Christus zu sprechen.
Schließlich sagte einer von ihnen: »Wir haben gerade erst unser Theologiestudium hinter uns gebracht. Wir haben dort nicht gelernt, wie man so etwas macht.« Ein anderer sagte: »Ich weiß
nicht so recht. In mir sträubt sich alles gegen die Vorstellung, dass man sich bekehren soll.« Ein Dritter sagte: »Ich bin jetzt seit drei Jahren Gemeindeleiter, aber ich habe noch nie jemanden persönlich auf den Glauben hin angesprochen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie man das macht.«
Ich sagte ihnen daraufhin, dass wir die [damals] 95 Millionen Brasilianer vergessen könnten, wenn es uns nicht gelingen würde, diesen 60 Leuten innerhalb von 16 Tagen und mit so vielen Missionaren das Evangelium nahezubringen. Dann sollten wir doch lieber gleich das nächste Schiff zurück nach Hause nehmen.
Nach einigen Stunden klopfte es an unserer Kabinentür. Da
waren drei der sechs, mit denen ich gerade gesprochen hatte. Sie
wollten mir mitteilen, dass sie vom Kapitän die Erlaubnis bekommen
hätten, am Sonntag einen Gottesdienst für die Schiffsmannschaft
durchzuführen. Sie baten mich, die Predigt zu halten.
Als sie mir ihr Vorhaben erklärten, kam mir ein Gespräch in den
Sinn, das ich vor drei Wochen mit einem befreundeten Gemeindeleiter
geführt hatte. Dieser Gemeindeleiter erzählte mir, dass seine
Gemeinde glieder kürzlich angefangen hätten, Zeugnis von ihrem
Glauben abzulegen. Die jungen Leute gingen jetzt jeden Sonntag
in ein Altersheim, um dort einen Gottesdienst zu halten. Einige der
Gemeindeglieder hielten jede Woche Gefängnisgottesdienste; am
9
Ende dieser Gottesdienste boten sie den Gefangenen persönliche
Seelsorge an.
Natürlich ist nichts Falsches daran, Gottesdienste in Gefängnissen
und Altersheimen zu halten. Aber wenn das allein den evangelistischen
Einsatz einer Gemeinde ausmacht, dann entsteht ein
Problem. Ich fragte den Gemeindeleiter: »Laufen Sie nicht Gefahr,
Ihrer Gemeinde beizubringen, dass das Evangelium nur für Menschen
in schwierigen Umständen bestimmt ist, für diejenigen, bei
denen uns das Zeugnisgeben leichter fällt? Sollten Christen nicht
lernen, die Botschaft gerade auch denjenigen Menschen zu bringen
und sich um diejenigen zu kümmern, mit denen sie es täglich
zu tun haben?«
Diese Gedanken gab ich an die drei Missionare in meiner
Kabine weiter. Hier an Bord standen wir in der Gefahr, in das gleiche
Denken zu verfallen. Ich sagte: »Durch unser Gespräch haben
Sie Gewissensbisse bekommen. Da haben Sie sich jetzt diese armen
Seeleute ausgesucht, die nie zu einer christlichen Gemeinde gehen,
und haben einen Gottesdienst für sie geplant. Das ist gut. Aber ich
denke, wir können uns vor der Verantwortung für die anderen Passagiere
nicht drücken.« Sie verstanden, was ich sagen wollte. Aber
sie hatten jetzt schon zugesagt, diesen Gottesdienst für die Mannschaft
zu halten. Der Kapitän machte einen Anschlag in den Mannschaftsunterkünften,
und der Speisesaal wurde für den Anlass hergerichtet.
Ich sagte zu, zu kommen, aber nicht, um zu predigen.
Wir vier Missionare waren rechtzeitig im Speisesaal. Es war niemand
gekommen. Hin und wieder liefen Seeleute ganz geschäftig
durch den Raum. Sie waren jedoch sehr darauf bedacht, nicht
von uns »abgefangen« zu werden. Schließlich kam ein Seemann
herein und setzte sich. Er war Baptist. Das war also unser Gottesdienst.
Vier Missionare und ein baptistischer Seemann. Nach diesem
Abend fingen meine drei Freunde an, ernsthaft darüber nachzudenken,
wie sie auf die Touristen zugehen könnten.
Unter den Passagieren befand sich auch ein älteres gläubiges
Ehepaar. Der Mann hatte Geburtstag, und aus diesem Anlass ver
10
anstalteten die drei Missionare einen traditionellen Liederabend.
Ich wusste, was einen da erwartete, und hielt es für besser, wegzubleiben,
um nicht die Beziehungen zu den Leuten, mit denen ich
im Gespräch über den Glauben war, aufs Spiel zu setzen. Als sie mit
ihrem Abendprogramm anfingen, war ich auf dem Oberdeck. Ein
anderer Passagier wollte wie ich die Abendluft genießen. Wir fingen
an, uns über das Neue Testament zu unterhalten, das ich zum
Lesen bei mir hatte.
Wir hörten deutlich, was unten vor sich ging. Es wurden zu -
nächst Volkslieder gesungen, dann kamen geistliche Lieder, und
schließlich wurden Glaubenszeugnisse gegeben und eine An -
sprache gehalten. Meine drei Freunde waren hinterher ganz be -
geistert. Es war ihnen gelungen, zu fast allen Passagieren zu »predigen«.
Natürlich organisierten sie am übernächsten Abend wieder
einen Liederabend. Wieder ging ich auf das Oberdeck, aber dieses
Mal leisteten mir noch 60 andere Passagiere Gesellschaft. Sie wollten
nicht ein zweites Mal in dieselbe Falle gehen!
Als ich später noch einmal über diese 16 Tage nachdachte, ging
mir auf, dass unsere Situation auf dem Schiff die Situation der
christlichen Gemeinde im Kleinen widerspiegelte. Durch diese
Erkenntnis und die Erlebnisse der darauffolgenden Jahre, in denen
mein missionarischer Dienst die Eingewöhnung in eine neue Kultur
mit einer neuen Sprache notwendig machte, ergaben sich Hunderte
von Fragen. Seitdem bin ich auf der Suche nach Antworten.
Ich möchte herausfinden, wie man das Evangelium wirklich in die
Welt hineintragen kann. Das ist der Gegenstand dieses Buches.
11
I. Teil: Einige Schwierigkeiten
1. Sich der Wirklichkeit
einer unerreichten Welt stellen
Bewegen wir uns in die richtige Richtung?
»Geht hin in die ganze Welt« (Markus 16,15). Wenn Sie diese Worte
Jesu lesen, wie stellen Sie sich diese Welt vor?
Sie könnten sich zum Beispiel darunter ein riesiges Gebiet vorstellen,
das von mehr als 7 Milliarden Menschen bewohnt wird,
die sich einzig und allein dadurch voneinander unterscheiden, ob
sie eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus haben oder nicht.
Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns, die sich allerdings auf
eine leichte Formel bringen lässt: die Botschaft des Evangeliums
all denen zu bringen, die Christus nicht kennen. Oder aber Sie
haben eine geografische Vorstellung von der Welt. Es gibt heute
über 190 unabhängige Länder auf der Welt. Wir müssen na tionale
Grenzen überschreiten, unsere Arbeit in so vielen dieser Länder
wie nur möglich aufnehmen und dort als Zeugen Christi leben.
Wie oft messen wir den Erfolg unserer missionarischen Arbeit an
der Zahl der Länder, in denen wir arbeiten! Die Aufgabe der Weltmission
wird dann dahingehend vereinfacht, dass lediglich schon
be stehende Formen und Ausprägungen von missionarischer Arbeit
in andere Länder der Welt getragen und überall dieselben evangelistischen
Methoden angewandt werden.
Stattdessen sollten wir unser Augenmerk mehr auf die einzelnen
Menschen richten. In einem Bericht der Organisation World Vision
heißt es unter anderem:
12
»Gott hat in Christus jeden Menschen zur Mission verpflichtet,
nicht zur Mission der Länder der Welt, sondern der ta
ethne, der Volksgruppen der Welt.
Die Sünde, die tief in unseren Herzen wohnt, hat uns für
die wunderbare Tatsache blind gemacht, dass Gott nicht nur
alle Völker der Welt liebt, sondern dass er sie gerade in ihrer
Verschiedenheit voneinander liebt – so, wie sich ein Gärtner
über die verschiedenen Farben und Arten der Blumen, die
Gott für seinen Garten geschaffen hat, freut.
Das missionarische Konzept des Apostels Paulus hatte vor
allem die Volksgruppen im Blick. […] Er arbeitete als Jude
mit dem gebührenden Respekt vor der jüdischen kulturellen
Tradition. […] Er respektierte den Lebensstil der Griechen,
solange wie dieser Jesus Christus als Herrn in einem tiefen
biblischen und geistlichen Sinne unterworfen war.
Mission sollte die Farben und Schattierungen, die Grundzüge
und Wesensarten der verschiedenartigen Völker ernst
nehmen. Viele Missionare haben die Tatsache, dass Gott
alle Völker ohne Unterschied liebt, missverstanden und setzen
sich stattdessen für ein falsches Ideal der Ausräumung
aller Unterschiede ein. […] Glücklicherweise wächst die
Wertschätzung der vielen verschiedenen und erstaunlich
reichen Sprachen und Kulturen auf der ganzen Welt. Es ist
von un geheurer Wichtigkeit, dass wir in der Mission das
rechte Feingefühl für die Verschiedenartigkeit der Völker
entwickeln.«1
Dr. Charles R. Taber, Herausgeber der Zeitschrift »Practical
Anthropology« und Übersetzungsberater für die »United Bible
Societies«, kommt auch in diesem Bericht zu Wort:
1 »Unreached Peoples Directory«, Monrovia, California, MARC, 1974, S. 12 – vor -
gelegt auf dem Weltevangelisationskongress in Lausanne (Schweiz).
13
»Da Gesellschaften, Kulturen und Menschen derart große
Unterschiede aufweisen, geht man am besten an die Mission
heran, indem man sich möglichst genau auf die jeweilige
Situation des Zuhörers einstellt. Der Evangelist muss herausfinden,
von welchen Voraussetzungen der Zuhörer in Bezug
auf Begriffe wie Realität und Wahrheit ausgeht und welche
Wertvorstellungen er hat.«
Es ist sehr ermutigend, dass in der heutigen Mission eine evangelistische
Strategie betont wird, die an die jeweilige Situation angepasst
ist. Wir brauchen solche biblisch fundierten Missionsstrategien,
die die ethnischen und kulturellen Unterschiede sowie die Denkvoraussetzungen
in Bezug auf Begriffe wie Realität, Wahrheit und
Wertmaßstäbe mit einbeziehen. Ein Mitarbeiter von World Vision
hat es so formuliert:
»MARC hat richtig erkannt, dass man nur mit einer klar
umrissenen Strategie zur Erreichung der unerreichten Völker
missionarische Durchschlagskraft haben kann. MARC fordert,
dass im Mittelpunkt einer solchen Missionsstrategie das
einzelne Volk und nicht der Evangelist oder Missionar stehen
sollte.«
Bei all diesen Betrachtungen geht es darum, wie das Evangelium weitergesagt
werden kann. Dr. Taber drückt das folgendermaßen aus:
»Wir sollten uns darum bemühen, dass wir bei der Darstellung
des Evangeliums möglichst genau auf die Be -
dürfnisse des Zuhörers eingehen.«
In diesen zitierten Untersuchungen geht es hauptsächlich darum,
dass die »Völker« und ihre Kultur verstanden werden, damit wir
fähig werden, die verbale Verkündigung des Evangeliums der
je weiligen Ausgangssituation genau anzupassen.
14
Mit diesem Buch möchte ich eine biblisch fundierte Strategie
für Evangelisation darstellen. Ich bin jedoch der Meinung, dass
wir noch einen Schritt über das bloße Verkündigen hinausgehen
müssen, um eine wirkungsvolle Strategie zu finden, die sich auf die
Schrift stützt. Wir müssen erkennen, dass die Verkündigung des
Evangeliums nur der erste Schritt in der Missionsstrategie des Paulus
war. Wir brauchen für diese unerreichten Völker etwas, was über
die bloße Verkündigung hinausgeht und mehr Durchschlagskraft
besitzt.
Heute leben 800 Millionen Menschen in Ländern mit Namenschristentum –
dieser Begriff »Namenschrist« ist zum Synonym für
die westliche Zivilisation geworden. MARC ordnet die Menschen
in den anderen Ländern in sieben Kategorien ein: Animisten, Buddhisten,
christlich-heidnische Synkretisten, Hinduisten, Muslime,
Menschen mit traditionellem Stammesglauben und die säkularisierten
Menschen.
Die Verwendung des Begriffes »säkularisiert« finde ich besonders
interessant. In meinem Buch behandele ich die Frage, wie
die unerreichten Menschen mit dem Evangelium erreicht werden
können. Hierzu habe ich in den USA und in den entwickelten
Ge bieten Brasiliens reichliche Erfahrungen gesammelt. Die größte
un erreichte Gruppe ist in beiden Ländern der säkularisierte Teil
der Bevölkerung. In diesem Buch geht es darum, wie die säkularisierten
Menschen mit dem Evangelium angesprochen werden können.
Wir verwenden dieses Wort »säkularisiert« an einigen Stellen
in einer neuen Bedeutung. Deshalb sollten wir es erst einmal genau
definieren. »Säkular« wird definiert als »zur Welt ge hörend – oder
zu Dingen, die nicht als religiös, geistlich oder heilig an gesehen werden
können«. »Säkularisiert« bedeutet »profan geworden, losgelöst
von jeglicher Religion oder geistlichen Zusammenhängen oder Einflüssen,
weltlich oder ungeistlich geworden«. Die erste Definition
beschreibt ein Leben ohne einen Glauben. Die zweite De finition
beinhaltet, dass sich ein Gesinnungswandel von einem gottesfürchtigen
Leben zu einem ungeistlichen Leben vollzogen hat.
15
Wir können diese Definitionen miteinander verknüpfen und
damit einen großen Teil der Weltbevölkerung wie folgt beschreiben:
»Menschen, die außerhalb eines christlichen Rahmens leben«.
Der christliche Glaube ist kein wichtiger Bestandteil ihres Lebens
mehr. Ihre persönliche Lebensphilosophie gründet sich nicht auf
christliche Vorstellungen.
Mit dieser Definition hätten wir die rein »weltlichen« Menschen
– jene, die nach einer nichtchristlichen Philosophie leben –
umfasst. Sie würde aber auch die Atheisten, die Agnostiker und
diejenigen mit einschließen, für die der Materialismus zur Pseudo-
Religion geworden ist – so, wie auch der Marxismus eigentlich eine
Pseudo-Religion ist.
Sie würde auch die umschließen, die erst später weltlich »ge -
worden« sind, bei denen sich ein Gesinnungswandel von einer
christlichen Philosophie zu einer nichtchristlichen Lebens -
auffassung vollzogen hat. Einige Menschen haben diesen Wandel
selber erlebt. Aber meistens erstreckt er sich über mehrere Generationen,
die vom Christentum enttäuscht wurden. Bei vielen ist es
schon mehr als 25 Jahre her, dass sie ein Leben innerhalb christlicher
Strukturen kennengelernt haben. Sie sind der Meinung, dass
der christliche Glaube als gültiges Fundament für eine persönliche
Lebens philosophie ausgedient hat. Sie leben in einem nachchristlichen
Zeitalter.
Sie wissen vielleicht traditionsgemäß einiges über den Glauben,
aber das hat keine Auswirkungen auf ihr persönliches Leben.
Einige dieser Leute verfügen vielleicht sogar über ein breites Wissen
in Bezug auf Glaubensinhalte. Sie haben zum Beispiel den Katechismus
gelernt. Wenn man sie auf den christlichen Glauben hin
anspricht, werden sie die »richtigen« Antworten geben. Aber diese
Glaubensinhalte haben für sie persönlich keine Bedeutung mehr.
Andere wissen überhaupt nichts von Glaubensinhalten oder
davon, dass es den christlichen Glauben gibt. Viele von uns können
sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, dass das sogar noch auf
ganze Bevölkerungsschichten Nordamerikas zutrifft.
16
Es gibt natürlich verschiedene Grade der Säkularisierung. Die
Extreme lassen sich immer leicht aufzeigen – aber oft sind die
Unterschiede nicht so deutlich erkennbar. Zwischen Schwarz und
Weiß gibt es unendlich viele Grauzonen. Viele Menschen sind teilweise
säkularisiert und teilweise christlich.
Wie viele Nordamerikaner könnten als säkularisiert bezeichnet
werden? Bei einer Meinungsumfrage der Zeitschrift Christianity
Today unter Nordamerikanern über 18 Jahren im Jahre 1979 wurde
festgestellt, dass 94 % der Amerikaner an Gott oder an ein höchstes
Wesen, das sie als Gott ansehen, glauben. Die Hälfte von diesen
94 % sagte, dass dieser Glaube ihnen großen Trost spendet. Ungefähr
ein Viertel glaubte, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch
ist. 45 % sagten, dass ein persönlicher Glaube an Christus die einzige
Hoffnung der Erlösung ist.
In den USA gehören heute 67 % der Bevölkerung einer christlichen
Gemeinde an. Die Hälfte dieser Leute geht zumindest einmal
im Monat zum Gottesdienst. Diese Zahl beinhaltet Pro testanten,
Katholiken und andere christliche Gemeinschaften. Jeder fünfte
US-amerikanische Erwachsene bezeichnet sich selber als evangelikal.
2
Wie können wir die Ergebnisse dieser Umfrage auswerten? Sie
zeigen ganz deutlich, dass die christliche Botschaft guten Anklang
gefunden hat. Aber was ist mit der Hälfte dieser 94 %, die wenig
oder keinen Trost in dem Gott finden, an den sie glauben? Scheinbar
sind sie Anhänger eines einfachen Deismus, eines Glaubens an
einen Gott, der vielleicht einmal die Welt erschaffen hat, sich dann
aber zurückgezogen hat – für sie ist Gott nicht jemand, der aktiv in
das Leben der Menschen eingreift.
In dem angeführten Bericht stellt Dr. Taber die Frage:
»Wie sehen diese unerreichten Volksgruppen aus?«
2 »The Christianity Today-Gallup Poll: An Overview«, Christianity Today, Jahr -
gang 23, 21. Dezember 1979, S. 12.
17
Er führt weiter aus:
»Damit sind nicht winzige und einheitliche Volks gruppen
gemeint, ähnlich den entlegenen Dschungelstämmen, sondern
hier handelt es sich vielmehr um klar abgrenzbare
Untergruppen innerhalb schon gründlich missionierter
Gesellschaftsgruppen oder um Gruppen, die in einer früheren
Generation oder in einem anderen Jahrhundert missioniert
wurden. Unter ihnen befinden sich z. B. viele Gottesdienstbesucher
aus den reichen westlichen Ländern, die
trotz all ihrer Kirchlichkeit nie das Evangelium klar und
deutlich gehört haben … In der Praxis sind diese Menschen
eigentlich genauso wenig erreicht wie die Dschungelstämme
oder die in den Ghettos unserer Städte lebenden
Menschenmassen.«
Der Theologe Reinhold Niebuhr hat uns davor gewarnt, »uns nicht
mit der allgemein vorherrschenden Religiosität unseres Volkes
zufriedenzugeben. Sehr vieles davon ist einfach eine Verfälschung
der christlichen Botschaft.«3
Ich möchte gerne aus meiner Erfahrung heraus die Lage wie
folgt beurteilen: Angesichts solcher Statistiken, meiner eigenen
Erfahrung und unserer Definition des Wortes »säkular«: Müssen
wir da nicht konsequenterweise die Hälfte der US-amerikanischen
Bevölkerung als »säkularisiert« ansehen – als Menschen, die dem
Christentum fernstehen?
Ich habe meine Erfahrungen als Missionar unter säkularisierten
Menschen gemacht. Ich stehe im Dienst einer christlichen Organisation,
die weltweit arbeitet. Meine Freunde, die unter anderen
unerreichten Völkern arbeiten, machen ähnliche Erfahrungen wie
ich. Ich glaube, dass die gleichen Prinzipien angewendet werden
3 Reinhold Niebuhr, »Religiosity and the Christian Faith«, Christianity & Crisis,
28. Mai 1951.
18
können, wann und wo immer wir unsere Gesellschafts- und Kulturschicht
verlassen und versuchen, den Menschen die gute Nachricht
zu bringen – und zwar zu den Menschen, die nicht die gleichen
Denkvoraussetzungen wie wir haben und bei denen noch
keine Vorarbeit geleistet wurde, die eine Tür für das Evangelium
geöffnet hätte.
Wir tun uns schwer damit, diese kulturellen Grenzen zu überschreiten.
Es findet keine echte Kommunikation statt – wir reden
eigentlich nur zu uns selber!
Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung, für heute
und für morgen. Nur das Evangelium bietet grundlegende Antworten
auf persönliche und gesellschaftliche Probleme. Das Evangelium
ist die gute Nachricht, dass Gott durch seine Gnade die
Versöhnung all derer, die durch den Sündenfall verdorben waren,
möglich gemacht hat (vgl. Römer 8,19-32).
Wenn das so ist, dann sollten wir uns genau überlegen, wie
wir diese Sache anderen vermitteln können. Es gibt kein schwierigeres
Problem. Eine wirkungsvollere Verkündigung des Evangeliums
wird vor allem dadurch beeinträchtigt, dass wir glauben,
wir hätten im Grunde die Patentlösung gefunden, wie wir die Verlorenen
gewinnen können. Das ist aber nicht der Fall. Wir scheinen
genau zu wissen, was es bedeutet, jemandem das Evangelium
weiter zusagen. Wir denken, dass es jetzt nur noch eine Frage der
Zeit, der Mitarbeiter und des Geldes ist, bis diese Aufgabe der
Welt mission erledigt ist. Wir haben es aufgegeben, nach wirkungsvolleren
Ansätzen zu suchen.
Bei meinen Bemühungen, das Evangelium über kulturelle und
sprachliche Grenzen hinweg zu den Menschen zu bringen, habe
ich etwas Gutes gelernt – nämlich, dass bei diesem Versuch meine
unantastbarsten Lieblingsideen über den Haufen geworfen wurden.
Nur wenige meiner bewährten Methoden überlebten diese
Grenzüberschreitung. Und diese wären auch besser auf der Strecke
geblieben. Als mir dann kaum mehr etwas blieb, entdeckte ich
meine Unkenntnis, die unterschwellig schon lange da gewesen war.
19
Das war eine außerordentlich wertvolle Erfahrung. Denn, wenn
man endlich aufwacht und merkt, dass man nichts weiß, kann man
erst anfangen, etwas Neues zu lernen.
Während der letzten Jahre habe ich mich mit der Frage befasst,
wie beweglich wir bei der Verkündigung des Evangeliums eigentlich
sind. Viele meiner Fragen blieben unbeantwortet (unter an -
derem einige von denen, die ich hier aufführe). Aber ich habe
genug gelernt, um zu erkennen, dass ich manchmal einige wichtige
biblische Wahrheiten außer Acht gelassen habe. Deswegen waren
diese Jahre von dem Forschen nach Antworten geprägt. Ich möchte
Sie gerne in diese Suche mit hineinnehmen, damit wir gemeinsam
dazu beitragen können, dass mehr Menschen mit dem Evangelium
erreicht werden.
Hierzu einige Fragen, denen ich mich gestellt habe:
Wie sieht die Welt, in der wir leben, eigentlich aus? Sind wir
wirklich vertraut mit ihr? Verstehen wir, was in den Köpfen der
Leute um uns her vor sich geht? Sind wir uns dessen bewusst, wohin
die moderne Philosophie den Menschen von heute gebracht hat?
Wissen wir, wo er gefühlsmäßig steht? Wie steht es mit der Säkularisierung?
Kennen wir das Ausmaß der Säkularisierung in unserer
näheren Umgebung? Wie verständigen wir uns mit den säkularisierten
Menschen? Ist eine Verständigung überhaupt möglich? Was
macht eine echte Kommunikation aus? In welcher Weise müssen
wir die unterschiedlichen Denk- und Lebensweisen berücksichtigen,
wenn wir Christus bezeugen? Wann können wir wissen, dass
wir das Evangelium wirklich vermittelt haben? Wer trägt die Verantwortung,
wenn wir in der Kommunikation versagen? Wie gehen
wir eigentlich auf unsere Zuhörer ein?
Was meinte Jesus, als er sagte, dass das Evangelium »der ganzen
Schöpfung« und »in der ganzen Welt« gepredigt werden soll?
Bis zu welchem Grad haben wir diesen Auftrag erfüllt? Haben wir
ihn schon erfüllt, wenn wir jemandem lediglich die Bedingungen
des »Vertrags« erklärt haben, oder geht es hier nicht um viel mehr?
Sind »evangelisieren« und »ernten« synonyme Begriffe?
20
Was meinte Jesus, als er uns sagte, dass wir »in der Welt« leben
sollen (vgl. Johannes 17,11; Philipper 2,15)? Wie können wir an dererseits
befolgen: »Geht aus ihrer Mitte hinaus« (2. Ko rinther 6,17)?
Wie könnte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem
Engagement in der Welt und der Absonderung von ihr aussehen?
Leben wir in der Welt, so, wie Jesus das von uns wollte, oder haben
wir uns in ein Ghetto zurückgezogen? Was ist mit den großartigen
Dingen, die heute in der christlichen Gemeinde geschehen: Großevangelisationen,
Konferenzen, riesige Gemeinden der Superlative?
Können wir es nicht doch mit genügend Zeit und Leuten schaffen,
die Befehle Christi auszuführen? Werden unsere Programme und
Institutionen den Mangel ausfüllen können? Wenn nicht, was fehlt
uns dann?
Wer sorgt für das Fortschreiten der christlichen Botschaft in der
Welt? Ist es eine realistische Erwartung, dass sich hier jeder Christ
einbringen soll? Oder laden wir den Gläubigen falsche Schuldgefühle
auf? Ist die persönliche Evangelisation die Lösung? Was
ist die Aufgabe der christlichen Gemeinde dabei? Ist persönliche
Evangelisation nur etwas für ein paar Begabte?
Als ich nach Antworten auf diese Fragen suchte, erkannte ich,
dass die christliche Mission viel komplizierter und vielschichtiger
ist, als wir zugeben wollen. Unser geringer Erfolg darin, uns
über die Grenzen verschiedener Denkweisen und Kulturen hinweg
verständlich zu machen, zeigte mir, dass wir gewisse, wichtige
biblische Wahrheiten bei der Verkündigung des Evangeliums in der
Welt übersehen haben müssen. Wir haben ein so begrenztes Verständnis
von Evangelisation, dass wir heute von einer säkularisierten
Welt umgeben sind. Wir haben uns dermaßen an sie gewöhnt,
dass wir manchmal gar nicht merken, dass es sie gibt. Wir schaffen
es nicht, uns gegenüber säkularisierten Menschen verständlich
zu machen.
Das mag heute so sein, aber es muss nicht so bleiben. Es ist
möglich, den verschiedensten Leuten das Evangelium mit Erfolg
weiterzusagen. Aber um das tun zu können, müssen wir zunächst
21
besser verstehen lernen, was uns die Bibel über das Evangelisieren
lehrt. Es ist das Ziel dieses Buches, Christen wachzurütteln, damit
sie anfangen, die vielen Menschen in ihrer Umgebung zu sehen,
und damit sie auf einige biblische Wahrheiten, die bis jetzt vernachlässigt
wurden, aufmerksam werden. Wir werden noch näher
darauf eingehen, dass es von der Bibel her hauptsächlich zwei Möglichkeiten
gibt, wie das Evangelium weitergesagt werden kann:
1. das Verkündigen oder Bekanntmachen des Evangeliums:
eine Tätigkeit, durch die der Nichtchrist ganz klar mit den
wesent lichen Inhalten der Botschaft konfrontiert wird;
2. die Bekräftigung oder Darstellung des Evangeliums: ein langwieriger
Prozess – wir erklären und gestalten die christliche
Botschaft mit unserem ganzen Leben, durch unser gelebtes
Zeugnis.
Wir werden noch sehen, dass beide Methoden gleich wichtig sind,
wenn wir alle Bevölkerungsschichten erreichen wollen. Aber beide
Evangelisationsmethoden haben auch ihre Grenzen. Wir sind vertrauter
mit der ersten Art der Evangelisation und haben sie als
die umfassende verstanden, obwohl sie doch eigentlich nur als
Anfangsphase zu werten ist. In der Vergangenheit haben wir den
Schwerpunkt auf die Verkündigung gelegt und haben die Botschaft
zu wenig durch ein gelebtes Zeugnis bekräftigt und erklärt.
In unserer Gesellschaft lassen sich viel mehr Menschen mit dem
Evangelium erreichen als wir denken – obwohl diese Menschen
vielleicht nicht gleich Christen werden. Es ist höchste Zeit, dass wir
Gott vertrauen, dass er mehr Menschen als bisher aus dem Reich
der Finsternis herausrettet. Das ist möglich, wenn wir bereit sind,
umzudenken.
22
2. Schlimmes Erwachen
Sind wir geduldig genug?
Osvaldo war einer der ersten Brasilianer, mit denen ich über Christus
sprach. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Als ich Osvaldo
kennenlernte, arbeitete er als Chemiker in der Industrie. Wir kannten
uns durch seinen Bruder, mit dem ich intensives Bibel studium
machte. Osvaldo wollte wissen, was wir eigentlich da machten,
denn er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Bruder sich mit
irgendwelchen religiösen Dingen beschäftigen könnte. Sein Bruder
sei kein religiöser Typ. Als ich Osvaldo zu mir zum Essen einlud,
nahm er deshalb die Einladung gerne an.
Unser Gespräch begann damit, dass Osvaldo fragte, warum wir
in Brasilien lebten. Und er wollte auch wissen, was sich eigentlich
zwischen seinem Bruder und mir abspielte. Am besten konnte ich
seine Fragen beantworten, indem ich ihm das Evangelium erklärte.
Ich nahm ein Stück Kreide und eine Bibel und benutzte den Holzfußboden
als Tafel. Während der nächsten zwei Stunden zeichnete
ich ihm etwas auf, was ich oft und gerne benutzte, um je mandem
die Botschaft des Evangeliums zu erklären. Ich war ziemlich zu -
frieden mit meiner Leistung. Als ich fertig war, lehnte ich mich
zurück, um zu beobachten, wie Osvaldo reagieren würde. Ich war
mir sicher, dass er kurz davor stand, Buße zu tun und Christ zu
werden.
Stattdessen schaute er zuerst meine Zeichnung und dann mich
an. Er war ziemlich verblüfft. »Wollen Sie mir weismachen, dass Sie
deswegen den langen Weg nach Brasilien zurückgelegt haben, um
das hier den Leuten zu erzählen?«, fragte er mich.
In seinen Augen schien das, was ich ihm erzählt hatte, völlig
belanglos und unwichtig zu sein. Ich erkannte in diesem Augenblick,
dass es sich hier um Verständigungsschwierigkeiten handelte,
die ich vorher nie bedacht hatte. In meiner Vorstellung hatte ich
23
»evangelisieren« immer mit »ernten« gleichgesetzt. Aber hier lag
jetzt ein Brachfeld vor mir. Hier musste erst gepflanzt, bewässert
und bebaut werden, bevor ich darauf hoffen konnte, ernten zu können.
Ich lud Osvaldo ein, mit mir zusammen in der Bibel zu
lesen. In den nächsten drei Monaten trafen wir uns mehrmals
in der Woche, um das Johannesevangelium zu lesen. Es war
ganz deutlich zu sehen, wie er von einem freien humanistisch-
philosophischen Denken dazu kam, Christus Glauben zu schenken
und sich ihm schließlich zu unterwerfen.
Dieser Weg, jemanden anhaltend mit der Schrift zu konfrontieren,
wurde für mich zum Verhaltensmuster. Ich fand bald heraus,
dass hier in Brasilien Leute zum Glauben fanden, die ich in den
USA als gleichgültig und als unerreichbar abgeschrieben hätte. Ich
merkte auch, dass diese neuen Christen, die sich nach einer längeren
Zeit eingehender Beschäftigung mit der Bibel bekehrt haben,
anschließend weniger geistliche Schwierigkeiten hatten. »Geistliche
Todesfälle« waren selten. »Und anderes fiel in die gute Erde und
gab Frucht, indem es aufschoss und wuchs; und eins trug dreißig-
und eins sechzig- und eins hundertfach« (Markus 4,8).
Mein Verständnis vom Evangelisieren hatte sich erweitert und
schloss nun auch das Pflanzen, Bewässern und Bearbeiten sowie
auch das Ernten ein. Ich begriff, dass das Evangelisieren ein langwieriger
Prozess ist. Wenn wir jemanden innerhalb eines oder
zweier Gespräche zu einer Entscheidung für den Glauben an Christus
bringen, dann können wir sicher sein, dass in diesem Leben
schon Vorbereitung durch andere stattgefunden hat, bevor wir
überhaupt auf den Plan traten. Das meint Jesus, glaube ich, wenn er
zu den Jüngern in Johannes 4,36-38 sagt:
»Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen
Leben, damit beide, der sät und der erntet, zugleich sich
freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Einer ist es, der sät,
und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten,
24
woran ihr nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und
ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.«
Gott benutzt viele Dinge, um die notwendigen Vorbereitungen zu
treffen: Menschen, Umstände und Ereignisse.
Einige der entscheidenden Schritte auf diesem Weg kann nur
Gott tun. Dazu gehört unter anderem die Gotteserkenntnis, die ins
Herz jedes Menschen gepflanzt wird (vgl. Römer 1,20). Gott hat
außerdem sein Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben
und gleichzeitig ihr Gewissen geschärft und ihnen ein Gefühl für
Schuld gegeben (vgl. Römer 2,14-15).
Manchmal benutzt er politische Ereignisse. Unter der Herrschaft
des Königs Josia wurde das Buch des Gesetzes im Tempel
wiedergefunden, und Josia führte sein Volk zu einer Er weckung
(2. Könige 22,8ff.). Wirtschaftliche Ungewissheit, politische Um -
wälzungen, Revolutionen, die die Gewohnheiten und Wert -
vorstellungen eines normalen Lebens umwerfen – alle diese Er -
eignisse können dazu dienen, dass Menschen aus dem Reich der
Finsternis in das Reich des Lichtes herausgerettet werden. Sogar
zufällige Bemerkungen können hier eine entscheidende Rolle spielen.
Ein Freund, der früher Buddhist war, beschreibt seine Be -
kehrung zu Christus und weist zurück auf eine Bemerkung seiner
Mutter während eines buddhistischen Gottesdienstes, die dann
zum auslösenden Moment wurde. Diese Bemerkung hatte bewirkt,
dass er eine Suche begonnen hat, die ihn schließlich zu Christus
führte. Seine Mutter hatte sich laut gefragt, warum der »wahre
Gott« als letzter und nicht in vorderster Reihe auf dem Regal der
verschiedenen Götter im Tempel stand. Diese Frage seiner Mutter
hatte er nie vergessen. Ihre Bemerkung bereitete ihn vor, die christliche
Botschaft mit offenem Herzen anzunehmen. Gott bedient sich
einer unendlichen Vielfalt von Wegen und Mitteln, um den Samen
des Evangeliums bei uns auszusäen und uns von Unwissenheit und
Rebellion zum Glauben zu führen. Das augenfälligste und bei Weitem
das wirksamste Vorbereitungsmittel ist eine gefestigte christ
25
lich geprägte Familie – dort aufzuwachsen, wo die Grundlagen des
christlichen Glaubens zu Hause und in der Gemeinde praktiziert
und gelehrt werden. Wenn jemand eine solche Erziehung genossen
hat, ist der Boden reif zur Ernte. Christlich geprägte Menschen gibt
es noch in großer Zahl an vielen Orten der Welt. Bei solchen Menschen
kann man beim Ernten sehr ermutigende Erfolge erzielen.
Aber das kann dazu führen, dass wir uns in der falschen Sicherheit
wiegen, dass die ganze Welt auf der gleichen Stufe steht und in der
gleichen Weise vorbereitet ist. Dabei können wir leicht vergessen,
dass das Evangelisieren in Wirklichkeit ein Prozess ist.
Das war jedenfalls meine Erfahrung. Meine ersten Versuche,
Menschen für Christus zu beeinflussen, beruhten auf solch einem
falschen Konzept für Evangelisation. Als junger Christ hatte ich
es mir zur Gewohnheit gemacht, ziemlich viel Zeit dafür zu verwenden,
die Schrift zu studieren und über das Gelesene nachzudenken.
Das hat sich offensichtlich auf mein Leben sehr po sitiv
ausgewirkt. Ich war ganz begeistert über das, was an mir geschah.
Aber im Laufe der Zeit wurde ich immer unruhiger, denn ich
wusste, dass von jedem Christen, der Jesus ernsthaft nachfolgen
will, erwartet wird, dass er seinen Glauben bezeugt. Der bloße
Gedanke, ein Zeugnis sagen zu müssen, lähmte mich mit Furcht,
und ich konnte mich nicht überwinden, meinen Mund aufzutun.
In meiner Vorstellung hatte sich eine Karikatur dessen festgesetzt,
was einen »guten Zeugen« ausmacht. Zum Teil wurde dieses
Bild davon beeinflusst, wie ich mir den Apostel Paulus vorstellte:
Er predigte auf dem Areopag, auf dem Marktplatz oder redete mit
einer römischen Wache. In unsere heutige Zeit übertragen, stellte
ich mir unter einem guten Zeugen so eine Art guten Geschäftsmann
vor, der unerschrocken ist, auf andere zugeht, furchtlos
gegenüber Fremden ist. Aber meine Welt war voller fremder Menschen,
und ich hatte Angst vor ihnen. Ich kam zu dem Schluss, dass
mir »diese Gabe nicht gegeben ist«, und versuchte, nicht mehr an
das Evangelisieren zu denken. Aber das gelang mir auch nicht. Eine
innere Spannung war immer noch da. Ich wollte das Evangelium
26
weitersagen. Mehrere Male ließ ich einfach alles stehen und liegen,
was ich gerade tat, setzte mich in mein Auto und fuhr an die Universität
von Minnesota, an der ich studierte, und wollte dort un -
bedingt jemandem von Christus erzählen. Ich machte mehrere solcher
heimlichen Fahrten, sprach aber nie mit irgendjemandem.
Schließlich habe ich meine Schwierigkeiten einem reiferen
Christen eröffnet, von dem ich wusste, dass er ein fruchtbarer
Zeuge war. Daraufhin nahm mich dieser Freund mit auf das Universitätsgelände,
wo ich ihm zusah, wie er einen ganzen Nachmittag
Gespräche anknüpfte, die in Gelegenheiten zur Darlegung
des christlichen Glaubens mündeten. Aus meiner Angst wurde
Begeisterung, als ich entdeckte, dass persönliches Zeugnisgeben
doch möglich ist. Diese Erfahrung war ein entscheidender Durchbruch.
In den darauffolgenden Monaten habe ich allen meinen Freunden
meinen Glauben bezeugt. Einige wurden Christen, andere
nicht. Während ich in die Leute drang und sie beschwor, sich für
Christus zu entscheiden, wurden meine Beziehungen zu denen, die
diesen Schritt nicht tun wollten, sehr gespannt. Bald hatte ich alle
meine Freunde in zwei Lager aufgeteilt. Aber das machte mir nichts
aus, denn ich hatte meine Frustrationen überwunden. Ich dachte
sogar, dass ich damit meine geistliche Rechtschaffenheit bewies!
Als ich nun keine Freunde mehr hatte, denen ich Christus
bezeugen konnte, fing ich an, Studentenwohnheime zu besuchen,
und ging dort von Tür zu Tür. Ich ging zu Veranstaltungen von Studentenverbindungen
und besuchte Militärkasernen. Daraufhin
haben sich einige Leute bekehrt, aber die »Geburtsrate« war beinahe
so hoch wie die »Sterberate«. Das Gleichnis vom Sämann bot
mir eine willkommene Erklärung für diese schlechten Ergebnisse:
ein schlechter Boden – es war ihre Schuld, nicht meine. In dieser
falschen Gesinnung sprach ich in Brasilien mit Osvaldo.
27
3. Unser missionarischer Übereifer
Sind wir zu sehr erfolgsorientiert?
Vor einigen Jahren besuchte uns ein guter Freund in Curitiba, Brasilien.
Er war seit 10 Jahren Missionar und hatte reichlich Er fahrung
bei der Vorbereitung und Durchführung von evangelistischen Veranstaltungen
in Großstädten gesammelt. Er und sein Team gingen
zum Beispiel in eine Stadt, ließen alle Leiter der christlichen
Gemeinden dieser Stadt zusammenkommen und schulten innerhalb
von 3 bis 6 Monaten Seelsorger, bereiteten die Nacharbeit
vor und machten andere wichtige Vorbereitungen für diese Großevangelisationen.
Wir saßen in seinem VW-Bus, als er mir Folgendes erzählte:
»Ich werde es noch ein einziges Mal versuchen. Ich mache diese
Arbeit jetzt schon 10 Jahre lang und habe bis jetzt noch keinen bleibenden
Erfolg bei meinen Bemühungen gesehen. Wir organisieren
eine Evangelisation, und es entscheiden sich viele für Christus.
Leiter der Ortsgemeinden geben bewegende Zeugnisse davon, dass
ihre Gemeinden verwandelt wurden. Aber dann ist alles wieder
vorbei. Wenn wir drei Monate später noch einmal an diesen Ort
kommen, dann ist keine Spur davon mehr zu sehen, dass wir überhaupt
einmal dort waren. Wenn es nach meinem nächsten Versuch
nicht anders wird, werde ich aufgeben, in die USA zurückkehren
und ins Geschäftsleben einsteigen.«
Das tat er dann auch! Solch frustrierende und ernüchternde
Resultate kommen daher, dass wir versuchen, dort zu ernten, wo
die Menschen nicht oder kaum vorher »bearbeitet« wurden. Lassen
Sie mich ein paar Beispiele für die Grenzen geben, die ein solches
Ernten-wollen unserem evangelistischen Zeugnis steckt.
Vor ein paar Jahren kam die Idee der »Totalen Evangelisation«
auf. C. Peter Wagner schreibt in seinem Buch »Frontiers in Missionary
Strategy« (auf Deutsch so viel wie »Grenzen der Missions
28
strategie«), dass diese Form der Evangelisation erreichen möchte,
»dass jedem Volk aus jedem Land, jeder Gesellschaftsschicht, jeder
Familie und jedem Einzelnen das Evangelium in mündlicher und
schriftlicher Form angeboten wird … Diese Durchdringung der
Welt mit dem Evangelium hat das Ziel, jeden Gläubigen zu motivieren
und ihn zu schulen, ein aktiver und wirksamer Zeuge für
Christus zu werden.«4
Das sind mitreißende Ziele. Ich könnte leicht mein Leben dafür
einsetzen, wenn sie nur realistisch wären!
Viele evangelistische Großeinsätze mit diesem Ziel solcher
»totaler Durchdringung« wurden an verschiedenen Orten Lateinamerikas
und überall in der Welt durchgeführt. Aber Untersuchungen
von verschiedenen Missionswissenschaftlern über
die Effek tivität solcher Einsätze haben gezeigt, dass solche Evan -
gelisationen nur wenig oder kaum dauerhaftes Wachstum bringen.
Wagner zitiert Dr. George Peters vom Dallas Theological Se minary,
der zu dem Schluss kam, »dass es aufgrund der Berichte und Statis
tiken in den Jahren nach solchen Großevangelisationen in den
meisten Ortsgemeinden zu keinem nennenswerten, mess baren
Gemeindewachstum gekommen ist«.
In der Tat zeigt Wagner auf, dass die Gemeinden vor diesen
»gründlichen« Bemühungen mehr Gemeindewachstum verzeichneten.
Er bringt ein Beispiel aus Bolivien: »Der Pro zentsatz
des jährlichen Wachstums von sieben zu sammenarbeitenden
Gemeinden … war größer in dem Jahr vor dieser Großevangelisation
als in den zwei darauffolgenden Jahren.«5
In jedem Land waren für diese Großevangelisationen alle Kräfte
erfolgreich mobilisiert worden, aber am Ende fiel doch alles in sich
zusammen. Warum? Wagner erklärt: »Zum einen, weil die meisten
Leute, die mitgemacht haben, am Ende total erschöpft waren. Dieses
Mammutprogramm raubte den Mitarbeitern die letzten Kraft-
4 C. Peter Wagner, Frontiers in Missionary Strategy, Chicago, Moody Press, 1971,
S. 135.
5 Wagner, ebenda, S. 143.
29
reserven. Einige konnten ihren normalen Beschäftigungen nicht
mehr nachgehen … und mussten anschließend einen riesigen Berg
von Arbeit nachträglich bewältigen. Einige haben ihre Ferien verschoben
und haben dann gemerkt, dass sie doppelt so viel Ferien
benötigten … Einige Leiter litten am Ende an einer ›evangelistischen
Verstopfung‹, und es dauerte ein ganzes Jahr, bis sie sich
wieder erholten.«6
Dr. Win Arn, Präsident des »Institute for American Church
Growth« (auf Deutsch so viel wie »Institut für amerikanisches
Gemeindewachstum«), untersuchte die Ergebnisse kürzlich stattgefundener,
evangelistischer Großeinsätze. Diese Untersuchung
wurde in der Zeitschrift Church Growth: America veröffentlicht.
Typische Ergebnisse sahen wie folgt aus: 140 Leiter geschult,
7200 getätigte Telefonanrufe, Material an 1987 Personen verteilt,
525 Entscheidungen für Christus, 72 sind interessiert daran,
ein Bibelstudium anzufangen (20 davon werden neue Gemeindemitglieder,
von diesen 20 hatten 16 schon vorher irgendeinen Kontakt
zur Gemeinde).7
Diese Ergebnisse wurden in einer US-amerikanischen Stadt
des Mittleren Westens erzielt, einer Stadt in einer »christlichen«
Gegend. In Gegenden mit weniger vorbereiteten Leuten würde ich
noch schlechtere Ergebnisse erwarten. Natürlich kann man den
Erfolg nicht ausschließlich an der Gemeindezugehörigkeit messen,
und ich stelle auch den Wert dieser evangelistischen Arbeit nicht
infrage – es wurden ja Erfolge erzielt.
Diese Form des evangelistischen Großeinsatzes erfordert jedoch
einen riesigen Arbeitsaufwand und Verwaltungsapparat, um die
Arbeit bewältigen zu können – und trotzdem bringt sie nur enttäuschende
Ergebnisse! Das wird immer so sein, wo immer wir uns
beim Evangelisieren unter nicht vorbereiteten Menschen aus missionarischem
Übereifer nur auf das Ernten versteifen.
6 Wagner, ebenda, S. 159-160.
7 Win Arn, »A Church Growth Look at ›Here’s Life America‹«, Church Growth:
America, Januar/Februar 1977, S. 7.
30
Da, wo Ortsgemeinden mit riesigen evangelistischen Einsätzen
säkularisierte Menschen erreichen wollen, kommt es nur
zu geringen Erfolgen. Eine sehr erfolgreiche Gemeinde in Minneapolis
hat unlängst ein Marktforschungsinstitut beauftragt, eine
Umfrage unter den 200 000 Menschen im direkten Umkreis dieser
Gemeinde zu machen. 86 % wussten überhaupt nicht, dass es diese
Gemeinde gab, obwohl sie an einer Hauptverkehrsstraße liegt und
schon von Weitem zu sehen ist. Nur 7 % dachten an die Möglichkeit,
irgendwann einmal in diese Gemeinde zu gehen.
Ein anderer Gemeindeleiter aus Minneapolis fasste die Ergebnisse
seines sechsjährigen Dienstes in einer evangelikalen Ge -
meinde von 350 Mitgliedern zusammen: Während dieser 6 Jahre
kamen von 159 neuen Mitgliedern 117 aus anderen Gemeinden.
36 davon waren Kinder von Gemeindegliedern, und es blieben nur
sechs übrig, die neu bekehrt waren.
Das gleiche Problem zeigt sich auch bei der Evangelisation in
kleinerem Stil und sogar bei der persönlichen Evangelisation von
Mann zu Mann. Ich könnte dieses Buch mit Berichten von meinen
eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet füllen und von denen
anderer Leute, die ich beobachtet habe: Sie haben sich voll und
ganz auf die Verkündigung verlassen, was aber nur zu dürftigen
und kurzlebigen Erfolgen geführt hat.
Ich will hier nicht bloß kritisieren. Wir sollten dafür dankbar
sein, wann immer das Evangelium in irgendeiner Form weitergesagt
wird. Ich meine nur, dass wir anders vorgehen müssen,
wenn wir die unerreichten Gruppen unserer Bevölkerung wirklich
mit dem Evangelium erreichen wollen.
31
Grenzen der Verständigung
Dr. Ralph Winter, Direktor des amerikanischen Zentrums für Weltmission,
sagte einmal:
»In der zweiten Generation tauchen automatisch Namenschristen
auf, und sie scheinen sich überall wie ein ›Hefekranz‹
um die Gemeinde zu legen, wodurch die engagierten
Christen davon abgehalten werden, die nichtchristliche Welt
jenseits dieses Hefekranzes zu erreichen.«8
Mit anderen Worten: Er stellt die Behauptung auf, dass wir unsere
evangelistischen Kräfte auf unseren engen Kreis verschwenden –
auf die Namenschristen um uns her. Könnte das der Fall sein?
Vor einigen Jahren wurde ich misstrauisch, was die Wirksamkeit
unserer Verständigung mit den säkularisierten Menschen
angeht. Ich versuchte die Frage zu beantworten: Wen erreichen
wir eigentlich mit unseren evangelistischen Bemühungen? Ich entdeckte
bald, dass dies sehr schwer zu beantworten ist. Einerseits
sind wir nicht daran gewöhnt, in diesen Kategorien zu denken.
Andererseits ist es schwierig, genaues Zahlenmaterial zum Stand
des Christentums zu bekommen. Deswegen habe ich mir einen
einfachen Test aus gedacht, der wenigstens offenbaren würde, welche
Ergebnisse meine Mitarbeiter auf diesem Gebiet erzielt haben.
Nach meiner Schätzung sieht etwa die Hälfte der US-amerikanischen
Be völkerung das Christentum nicht als die Grundlage ihrer
persönlichen Lebensphilosophie an. Wenn sie sagen sollen, welche
Religion ihnen am meisten liegt, würden sie sich wahrscheinlich
für das Christentum entscheiden, aber in ihrem alltäglichen
Leben ist das ohne Bedeutung. Wenn wir diese unerreichte Hälfte
der Be völkerung wirkungsvoll erreichen würden, sollten, wie mir
8 Ralph Winter, »Who are the three Billion?«, Part II, Church Growth Bulletin,
Juli 1977, S. 139-144.
32
scheint, diese Neubekehrten doch irgendwo in der Gemeinde
Christi auftauchen. Deshalb habe ich eine Frage formuliert, die
ich über Jahre hinweg meinen christlichen Zuhörern bei jeder
Gelegenheit gestellt habe.
Ich habe diese Frage in Gemeinden, Bibelschulen, Kon ferenzen
und christlichen Studentengruppen gestellt. Mich interessierten
besonders die Studentengruppen, weil hier sowohl religiös vorgeprägte
als auch säkularisierte Menschen zusammenkommen.
Meine eigene Organisation, die Navigatoren, betont das »Heranbilden
von eigenen Jüngern«, indem sie die Verlorenen zu ge winnen
sucht und die Neubekehrten in der Jüngerschaft schult. Deswegen
beginnt jede Navigatoren-Arbeit vor Ort mit Evan gelisation. Aus
verständlichen Gründen war ich sehr daran in teressiert, an ihren
Veranstaltungen teilzunehmen, da hier neubekehrte Christen, die
durch persönliche Evangelisation gewonnen wurden, zu finden
sind. Ich wollte herausfinden, woher diese neuen Christen kamen.
Hatten sie einen christlichen Hintergrund oder kamen sie aus der
»Welt«? Sind einige von ihnen in einer säkularisierten Welt groß
geworden? Die Frage, die ich stelle, lautet: »Wie viele von euch sind
von einer christlichen Tradition geprägt? Oder wie viele von euch
sind von einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Jugend an nicht regelmäßig
zu einer christlichen Gemeinde gegangen?«
Ich ging davon aus, dass ihre Antworten ziemlich schnell die
Zuhörerschaft in zwei Lager teilen würde, die religiös vor geprägten
und die säkularisierten. Wenn ich diese Antwort mit meiner Einschätzung
des nationalen Querschnitts (die eine Hälfte säkularisiert,
die andere hat einen frommen Hintergrund) vergleiche,
würde ich mir einen Begriff davon machen können, wie wirkungsvoll
unsere Arbeit unter den säkularisierten Menschen ist. Bis auf
einige wenige Ausnahmen kam ich zu dem Ergebnis, dass un gefähr
90 % der Menschen in unseren christlichen Kreisen schon vorher
religiös geprägt waren. Ganz selten habe ich eine Gruppe gefunden,
in der mehr als einer von zehn aus einem säkularisierten Milieu
kam. Mit anderen Worten: Ungefähr 90 % der aktiven Christen an
33
unseren Universitäten sind aus dieser einen Hälfte der Be völkerung
hervorgegangen, die schon länger mit der Religion kon frontiert
gewesen war, während nur etwa 10 % aus der säku larisierten
Gruppe kommen.
Evangelistische Großeinsätze
Vor ein paar Jahren hatte ich Gelegenheit, diese Dinge mit Charlie
Riggs aus dem Team von Billy Graham zu besprechen. Riggs war
schon mehr als 20 Jahre Mitarbeiter des Missionsteams von Billy
Graham und in dieser Zeit hauptsächlich für die Nacharbeit verantwortlich.
Ich fragte ihn, was für eine Art von Leuten vor 10 Jahren bei den
Evangelisationen von Billy Graham zum Glauben kamen. Woher
kamen sie? Dann fragte ich ihn, was für Leute denn heute zum
Glauben kommen. Er erklärte mir, dass zu Beginn ihrer Arbeit
die Leute, die sich entschieden haben, aus »den liberalen Kirchen
kamen, wo sie das Evangelium nicht hören konnten«. Aber heute
seien mehr als 90 % der Neubekehrten aus »unseren evangelikalen
Gemeinden«.
Ich fragte ihn, wann sich denn das Blatt gewendet habe und wie
er diese Veränderung interpretieren würde. Er antwortete, dass
diese merkliche Verschiebung in der Mitte der 1960er-Jahre stattgefunden
habe. Er sei der Meinung, »der Baum ist abgeerntet«. Mit
anderen Worten: Die Masse der Fernstehenden, die bereit waren,
auf die Verkündigung des Evangeliums zu hören, wäre inzwischen
erreicht!
Das positive Ergebnis, dass Leute mit dem Evangelium erreicht
wurden, soll nicht geschmälert werden. Aber wir können es uns
nicht erlauben, zu denken, dass – selbst in Nordamerika – jedem
Menschen das Evangelium schon vollständig weitergesagt worden
ist. Kommunikation erfordert immer zweierlei: einen Redner
und einen Hörer. Die Leute hören zwar zu, aber sie verstehen bei
34
Weitem nicht alles, was wir ihnen sagen. Daher müssen diejenigen
unter uns, die das Evangelium weitersagen, dies auf ansprechendere
Weise tun.
Schlussfolgerungen
Ich gebe offen zu, dass ich hier nicht sehr wissenschaftlich vorgehe
und dass meine Ergebnisse viele Ausnahmen zulassen. Aber
ich muss es jemand anderem überlassen, der qualifizierter dafür ist,
diesem Thema genauer nachzugehen.
Da meine Zahlen eher ungenau sind, dafür aber wachrütteln
wollen, wollen Sie jetzt vielleicht selber prüfen, wie Sie diese Zahlen
auf Ihre Situation übertragen können. Das sollte nicht allzu
schwierig sein.
Vergleichen Sie einfach das religiöse Profil Ihrer Stadt und Ihrer
Umgebung mit der Situation Ihrer Ortsgemeinde. Wie verhält sich
Ihre Gemeinde bei der Erreichung von säkularisierten Menschen?
Was kann uns all dies lehren? Wenn 90 % unserer Frucht nur aus
der einen Hälfte der Bevölkerung kommt, die sowieso schon bis zu
einem gewissen Grad zu uns gehörte, dann stehen wir vor einem
echten Kommunikationsproblem in Bezug auf die andere Hälfte.
Das bedeutet, dass wir die Grenzen der verschiedenen Denk- und
Lebensweisen überschreiten müssen, um diejenigen mit dem Evangelium
zu erreichen, die aus einer nichtchristlichen, säkularen Welt
kommen.
Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass wir unseren
Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, schon effektiv erfüllt hätten.
Und wir sollten auch nicht meinen, dass wir, wenn wir nur
so weitermachen wie bisher – und uns sogar noch mehr anstrengen –,
unsere Welt erreichen werden. Das erfordert sehr viel mehr.
Unsere Evangelisationsmodelle und -methoden müssen sich radikal
ändern. Als das Billy-Graham-Team zu Beginn der 1970er-
Jahre einen Evangelisationskongress vorbereitete, veröffentlichte es
35
eine Erklärung, die die Ziele des Kongresses zusammenfasste. Das
Magazin Church Growth Bulletin veröffentlichte diese Er klärung
unter dem Titel »Billy Grahams neue Sicht für die Zukunft«.9
Der
Artikel spricht Projekte an, die vorsehen,
»… dass zuerst einmal ein früher übersehenes, schwieriges
Problem in Angriff genommen werden soll: Die meisten
der unerreichten Völker der Welt (mindestens eine Milliarde
Menschen) leben nicht in dem normalen evangelistischen
Umfeld irgendeiner Ortsgemeinde. Diese Tatsache
ist überraschend, da wir wissen, dass es heute in jedem Land
der Welt christliche Gemeinden gibt. Das Problem liegt
darin, dass herkömmliche evangelistische Einsätze einfach
nicht wirksam genug sind angesichts der unüberbrückbaren
Schranken, die durch ethnische, kulturelle und so ziale
Unterschiede bedingt sind. Es ist eine schlimme Tatsache,
dass die christlichen Gemeinden der USA und der ganzen
Welt, die geografisch diesen noch nicht mit dem Evangelium
er reichten Menschen oder ethnischen Gruppen am nächsten
stehen, oft kulturell oder emotional am weitesten von ihnen
entfernt sind … Diese erstaunliche, neue Sicht hat die Illusion
vieler Christen zerstört, dass die Welt gewonnen werden
kann, wenn sich die weltweite Gemeinde nur darum bemüht,
den Menschen, mit denen sie normalerweise in Berührung
kommt, das Evangelium weiterzusagen.«
Was mich am meisten in Verbindung mit dieser Erklärung be -
unruhigte, war die Tatsache, dass dem Verfasser des Artikels das
alles ganz neu erschien!
9 »Billy Graham’s New Vision«, Church Growth Bulletin, November 1972, S. 278.
36
Schlussbemerkung
Unsere Unfähigkeit, das Evangelium weiterzusagen, wirkt sich auch
direkt auf die Durchschlagskraft unserer Weltmission aus. In einem
kürzlich veröffentlichten weltweiten Bericht einer christlichen Missionsgesellschaft,
die in mehr als 30 Ländern arbeitet, wurde festgestellt,
dass 87 % der durch sie erreichten Leute aus einem protestantischen
Milieu stammten!
Wahrscheinlich müssen wir es einfach zuerst einmal lernen, uns
mit den säkularisierten Menschen unserer Kultur wirklich zu verständigen,
bevor wir außerhalb unserer Kultur eine echte Durchschlagskraft
haben können. Schicken wir Menschen auf das Missionsfeld,
die nur unter denjenigen arbeiten können, die die
ei genen evangelikalen Voraussetzungen mitbringen?
Wo sind die Apostel für die Heiden unserer Generation?
37
4. Wirkliche Verständigung
Verstehen die Menschen unsere Sprache?
Mitte der 1970er-Jahre gingen drei nordamerikanische Ehepaare
zusammen als Missionsteam nach Caracas, Venezuela. Die drei
Ehepaare hatten schon viel Erfahrung im Missionsdienst. Sie hatten
jahrelang an der Basis Evangelisation betrieben und in Universitäten
und Gemeinden Jünger herangebildet.
Ihre erste Zielgruppe in Caracas waren die Studenten. Sie verbrachten
die meiste Zeit auf dem Universitätsgelände, um dort
jedem, der es hören wolle, das Evangelium zu erklären. Sie knüpften
Beziehungen, leiteten Bibelgruppen und versuchten mit allen
nur denkbaren Mitteln eine kleine Gruppe von Christen zu gründen,
die später mit ihnen zusammenarbeiten sollte.
Caracas ist aus verschiedenen Gründen einzigartig. Es ist reich
an Ölvorkommen, und es gibt dort viele öffentliche Einrichtungen
zum Wohl der Bürger. Venezuela hat eine harte Währung, und
es sind genügend Arbeitsplätze vorhanden. Arbeitssuchende aus
Europa, Nord- und Südamerika strömen hier zusammen. Jeder
kann zu Geld kommen, nur die Armen nicht. Caracas ist zu einer
übervölkerten Weltstadt geworden. Es kann sich räumlich nicht
weiter ausdehnen, da es von den Anden eingeschlossen wird. In der
Geschichte hat sich Caracas immer wieder den Christianisierungsversuchen
vonseiten der protestantischen und der römisch-katholischen
Kirche widersetzt. Aus alldem ist eine zutiefst heidnische
Gesellschaft entstanden, die fast ausschließlich nur für materielle
Dinge lebt.
Nach einem langen Jahr harter Arbeit, die nur sehr wenig
Frucht gebracht hatte, schrieb mir einer der Missionare: »Wir sind
alle übereinstimmend der Meinung, dass wir hier ganz neu lernen,
was evangelisieren bedeutet. Oder vielleicht lernen wir es zum ersten
Mal richtig. In den USA war es keine Seltenheit, dass jemand
38
ablehnend reagierte, wenn man ihm Gott verkündigte, ohne gleichzeitig
eine Beziehung aufzubauen. Aber hier sieht das ganz anders
aus! Hier sagen die Leute meist: ›Wie schade um dich!‹ Mit anderen
Worten: Die Studenten in Caracas bedauern es sehr, dass sich sonst
ganz vernünftige Leute für solch eine verrückte Sache engagieren.«
In seinem Brief hieß es weiter: »Nur wenige Menschen hier sind
davon überzeugt, dass es so etwas wie Sünde gibt. Sie haben keine
geistlichen Bedürfnisse, kein Interesse an der Bibel und an dem,
was sie zu sagen hat.«
Was ist die Ursache? Warum fanden diese Ehepaare nicht dieselbe
Reaktion auf das Evangelium, wie sie sie von einer typischen
US-amerikanischen Stadt gewohnt waren? Die Hörer und die Redner
trennten Welten. Bedenken Sie: Dieses Problem geht nicht nur
Missionare an! Jeder Mensch, der irgendwo das Evangelium weitersagen
will, hat damit zu kämpfen.
1. Die Hörer
Das geistliche Erbe eines durchschnittlichen Nichtchristen aus
Caracas und eines durchschnittlichen Nichtchristen aus Nordamerika
oder Europa ist grundverschieden. Nicht jedes Volk der
Welt ist in der gleichen Weise vorbereitet, das Evangelium zu hören
und anzunehmen.
Zu diesem Thema hat Paulus in seiner Rede auf dem Aeropag
einige bemerkenswerte Sätze gesagt. Er behauptete, dass es Gottes
Idee war, die Welt in verschiedene Rassen, Sprachen, Kulturen und
Nationen zu unterteilen.
Paulus sagte: »Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht
hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht
in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden
bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst
allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut
jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erd
39
boden wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer
Wohnung bestimmt, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl er -
tasten und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem
jeden von uns« (Apostelgeschichte 17,24-27).
Da ich lange Zeit meines Lebens mit kulturellen und sprachlichen
Schranken zu kämpfen hatte, sah ich diese eher als etwas
an, worauf wir hier auch gut verzichten könnten. Daher war es
für mich eine erstaunliche Entdeckung, dass Gott diese Sprachbarrieren
bewusst eingerichtet hatte und dass er dabei die Versöhnung
der Welt im Sinn hatte! Anscheinend sollen diese Schranken
als Schutz dienen. Sie sollen den schädlichen Einfluss, den der
sittliche Verfall und Niedergang einer Kultur auf die andere Kultur
ausübt, verhindern (vgl. 1. Mose 11,1-9).
An diesem Punkt ist es wichtig zu sehen, dass nicht jede
Nation oder jedes Volk in gleicher Weise vorbereitet ist. Das wird
sicherlich auch die Art unserer Kommunikation beeinflussen:
Wir müssen damit rechnen, dass die Leute in Caracas, einer uns
fremden und säkularisierten Stadt, anders reagieren werden als
in einer uns vertrauten Stadt. Wir bemerken diesen Unterschied
sehr deutlich, wenn wir ein traditionelles Erweckungsgebiet mit
einer un erreichten Stadt wie Caracas vergleichen. Es gibt eine
ähn liche Kluft zwischen Christen und Nichtchristen aber auch in
US-amerikanischen Städten – allerdings ist sie nicht so offenkundig.
2. Die Redner
Lassen Sie uns Folgendes bedenken: Was geschieht, wenn jemand
mit allen Mitteln versucht, ein missionarisches Gespräch weiterzuführen,
obwohl sein Gegenüber völlig andere Denkweisen und
emotionale Prägungen hat als er?
Kürzlich war ich Zeuge eines Gesprächs zwischen einem jungen
Missionar und einem nichtchristlichen südamerikanischen
40
Studenten. Jedes Mal, wenn dieser Missionar versuchte, mit seinen
nichtchristlichen Freunden über das Evangelium zu sprechen, hatte
er die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass sie befremdet und
ablehnend reagierten.
Dieses Mal hatte er sich mit einem Freund verabredet, mit
dem er schon seit einigen Monaten regelmäßig Fußball spielte. Er
bat mich, Zuhörer des Gesprächs zu sein, weil er hoffte, dass ein
Außenstehender ihm helfen könnte, zu verstehen, was er falsch
macht.
Sein Einstieg war gut. Er erklärte, warum er nach Brasilien
gekommen war, nämlich, um in einer christlichen Studentenbewegung
mitzuarbeiten. Seine Absicht war es, Menschen zu finden,
die Interesse daran hätten, gründlich die Bibel zu studieren
und darin nach Antworten auf die Fragen des Lebens zu suchen.
Dann fuhr er fort: Um effektiv vorgehen zu können, müsse er zuerst
einmal die Denk- und Lebensweisen der Leute, die er be einflussen
wollte, verstehen. So weit, so gut.
Dann stellte er seinem Freund einige Fragen. Diese wurden
zuerst gut aufgenommen, aber dann landete das Gespräch bald in
einer Sackgasse.
Bei den Fragen ging es darum, woran ein Christ im Wesentlichen
glaubt: Welche Vorstellung hat er von Gott? Wer war Jesus
Christus? Was versteht er unter Errettung? Alle diese Fragen be -
antwortete sein Freund ziemlich schnell – mit vorgefertigten Antworten
aus dem Katechismus!
Da mein Freund diese Antworten für bare Münze nahm, war
er auch der Meinung, dass er es mit jemandem zu tun habe, der
genauso denkt und glaubt wie er. Das war sein erster Fehler. Der
zweite ließ nicht lange auf sich warten.
Der Student fragte meinen Freund, wie er denn dieselben Fragen
beantwortet hätte. Mein Freund hätte jetzt besser geschwiegen,
aber er missverstand die Frage als eine Gelegenheit zum Zeugnis
und ergriff sie. Seine Antwort brachte seiner Meinung nach ganz
klar die wesentlichen Aussagen der christlichen Botschaft. Jesus
41
war Gottes Sohn, er starb für unsere Sünden, aus Gnade können
wir durch den Glauben mit Gott versöhnt werden usw.
Während mein Freund sprach, beobachtete ich den Studenten.
Auf seinem Gesicht zeichnete sich Enttäuschung ab. Er hatte die
Inhalte des Katechismus, den er gerade vorgebetet hatte, nie wirklich
akzeptiert. In der Tat hatte er die Religion seit Langem an den
Nagel gehängt. Seine Antworten waren wie Versuchs ballons. Er
mochte diesen US-Amerikaner und hoffte, dass dieser ihm irgendetwas
Neues anzubieten hätte. Aber die feinen Unterschiede zwischen
seinem Katechismus und der Lehre dieses US-Amerikaners
waren für ihn nicht erkennbar. Beide, der Sprecher und der
Hörer, redeten – ohne es zu wollen – in verschiedenen Sprachen
miteinander. Sie benutzten die gleichen Fachausdrücke, aber sie
erkannten nicht, dass diese Begriffe für jeden von ihnen eine unterschiedliche
Bedeutung hatten. Durch das Gehörte wurde der Student
nur noch mehr in seiner negativen Haltung zur Religion
bestärkt. Dieser Missionar hatte unbewusst und un widerruflich
dafür gesorgt, dass er in eine bestimmte, religiöse Schublade
gesteckt wurde. Anstatt diese Glaubenssätze un mittelbar auszusprechen,
hätte er noch mehr Fragen stellen sollen, um sicherzugehen,
dass er wirklich versteht, was sein Freund denkt und
glaubt. Er hätte erst in dem Augenblick reden sollen, als er genau
wusste, dass sein Freund wirklich bereit war, ihm zuzuhören. Wenn
Menschen wie diese beiden von so unterschied lichen An sätzen
herkommen, dann ist das Ergebnis oft ebenso. Und weitere Verständigungsversuche
ergeben oft, dass sich beide noch weiter voneinander
entfernen.10
Beide Parteien erkennen oftmals die Unterschiede
gar nicht und geben sich der Illusion hin, sich zu verstehen.
Wir denken, wir haben die Wahrheit vermittelt. In Wirklichkeit
aber werden unsere Worte anhand des Wertsystems un seres Zuhörers
umgedeutet.
10 Eugene Nida, Message and Mission, New York, Harper and Brothers, 1960, S. 89-90.
42
Das hat zur Folge, dass unser Zeugnis, anstatt einen Einfluss zu
haben und Veränderung zu bewirken, einfach nur von unserem
Zuhörer in seine persönliche Philosophie eingebaut wird. In Wirklichkeit
ist nichts zu ihm durchgedrungen.
Man könnte also sagen, dass die Hauptaufgabe dieses Mis -
sionsteams ist, sich erst einmal richtig zu verständigen, damit die
Kluft zwischen Rednern und Zuhörern überwunden werden kann.
Das erfordert zweierlei: Verstehen der Denkmuster der Zu hörer
und Übersetzen der Botschaft des Evangeliums in die Alltagssprache.
Die Botschaft dieser Missionare muss übersetzt werden
– aus der landesüblichen protestantischen Fachsprache und
Verständigungsform – in Formen, die von südamerikanischen
Studen ten verstanden werden können.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht: »Wie sieht das alles im Vergleich
zum Neuen Testament aus? Wie können wir das verbinden
mit dem einzigartigen Erfolg, den die Urgemeinde der Apostelgeschichte
verzeichnete?«
Genau das werden wir im folgenden Kapitel untersuchen.
43
II. Teil: Evangelisation durch Verkündigung
5. Verkündigung des Evangeliums
Biblisch, am Wesentlichen orientiert
Wie erwähnt, kennt das Neue Testament hauptsächlich zwei Formen
der Evangelisation. Die erste ist die Verkündigung des Evangeliums.
Das ist etwas, was man mit Worten tut; den Menschen,
die dem Glauben fernstehen, werden die Hauptaussagen der
christlichen Botschaft deutlich dargelegt. Dies geschieht meist zu
einem bestimmten Zeitpunkt – zum Beispiel während einer Großevangelisation
oder in einer Rundfunk- oder Fernsehsendung oder
wenn wir jemandem die Botschaft persönlich weitersagen. Wir
sprechen von Verkündigung immer dann, wenn wir jemanden
mit den Bedingungen für die Versöhnung des Menschen mit Gott
bekannt gemacht haben.
Die Bibel gibt uns den klaren Auftrag, der ganzen Welt das
Evangelium zu verkündigen. Wir brauchen nicht mehr darüber
zu reden, ob dieser Auftrag uns gilt oder nicht. Die Verkündigung
muss jedoch weise eingesetzt werden, wenn wir wollen, dass
die Botschaft alle Arten von Menschen erreicht. Verkündigung ist
nur bei ganz bestimmten Menschen erfolgreich: bei denen, die vorbereitet
sind.
Wenn wir eine größere Anzahl von Menschen, die nicht christlich
vorgeprägt sind, erreichen wollen, brauchen wir eine andere
Art der Evangelisation. Ich nenne diese Art der Evangelisation das
Zeugnis durch unser Leben oder das gelebte Zeugnis.
Was sind die Merkmale dieser Form des Evangelisierens? Es
handelt sich hier um einen Prozess, der dadurch in Gang gebracht
wird, dass ein Christ die christliche Botschaft mit seinem gan
44
zen Leben ausdrückt. Diese Methode ist besonders bei Menschen
wirksam, die unvorbereitet sind, bei Menschen ohne einen christlichen
Hintergrund oder bei solchen, für die das Christentum als
Hilfe zur Lebensbewältigung unglaubwürdig geworden ist. Bei
den Letzteren besteht meist eine Abhängigkeit von irgendwelchen
Ideo logien (Humanismus, Existenzialismus, Sozialismus oder
Kapitalismus), die ihnen Sinnerfüllung versprechen. Ab gesehen
von wenigen Ausnahmen brauchen solche unvorbereiteten Menschen,
um in das Reich Gottes finden zu können, weit mehr als
eine kurze Dar stellung des Evangeliums. Beide Arten des Evangelisierens
– die Verkündigung und das Vorleben des Evangeliums –
sind von entscheidender Bedeutung, wenn wir sowohl
Menschen aus einem nichtchristlichen Milieu als auch christlich
vorgeprägte Menschen ansprechen wollen. Die eine Form ist
nicht besser und erfolg reicher als die andere. Im Neuen Testament
wirken beide Formen in einander. Für uns ist nur wichtig
zu wissen, wann wir welche Form des Evangelisierens an wenden
sollen. Wenn wir da, wo Verkündigung genügen würde, auf das
gelebte Zeugnis Wert legen, verschwenden wir nur Kraft und
Zeit. Aber wenn wir da nur verkündigen, wo ein Mensch mehr
braucht, um zu Gott finden zu können, werden wir keinen Erfolg
haben.
Die Verkündigung des Evangeliums
Das griechische Wort für Verkündigung ist kerysso, was so viel
bedeutet wie »bekannt machen«, »verkündigen«, »öffentlich ausrufen«.
Unsere Tageszeitung und die Fernsehnachrichten erfüllen
jeden Tag diese Aufgabe. Sie machen die Nachrichten bekannt. Bei
den Römern beschrieb dieses Wort die Tätigkeit des Ansagers bei
öffentlichen Wettspielen.
Aber es wäre falsch, die Bedeutung des Wortes »verkündigen«
nur auf das »öffentliche Predigen« einzugrenzen. Die Verkün
45
digung kann viele Formen haben und schließt auch das persönliche,
missionarische Gespräch von Person zu Person mit ein.
In den vier Evangelien bekommen wir den klaren Auftrag, das
Evangelium zu verkündigen. In Matthäus 24,14 sagt Jesus: »Und
dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis
gepredigt (kerysso) werden, allen Nationen zum Zeugnis …« Es
ist nicht nur an einigen bestimmten Orten der Welt möglich, zu
verkündigen. Wir sollen es in der ganzen Welt tun. Markus 13,10
geht in dieselbe Richtung. Das Evangelium muss allen Nationen ge -
predigt (kerysso) werden.
Markus 16,15 sagt es noch spezifischer: »Geht hin in die ganze
Welt und predigt (kerysso) der ganzen Schöpfung das Evangelium.«
In Lukas 24,47 wird dasselbe Wort gebraucht: Lukas sagt uns, was
der Inhalt unserer Verkündigung sein sollte: Jesus möchte, dass wir
»allen Nationen« »Buße und Vergebung der Sünden« predigen.
Denken Sie einmal einen Augenblick darüber nach, was wir im
Allgemeinen von der Verkündigung erwarten. Nehmen wir einmal
an, Sie wollten einem jungen Mann das Evangelium verkün digen.
Dieser Mann hat jahrzehntelang so gelebt, wie es ihm passte, er hat
bestimmte Gewohnheiten entwickelt und sich sein eigenes Wertsystem
»zusammengebastelt«. Fast alles, womit er sich bis zu dem
Zeitpunkt des Gesprächs beschäftigt hat, ist dem Wort Gottes total
entgegengesetzt. Wir würden uns jetzt eine Stunde lang mit ihm
unterhalten und ihm den christlichen Glauben deutlich er klären.
Was erwarten wir jetzt? Wir erwarten, dass er einsieht, dass er in
seinem Leben bisher eine falsche Richtung eingeschlagen hatte. Wir
erwarten, dass er sagt: »Ich habe mich jahrelang geirrt. Innerhalb
dieser Stunde haben Sie mir klar gezeigt, wie ich in Bezug auf mein
bisheriges Leben eine radikale Kehrtwendung vollziehen kann.«
Erwarten wir hier nicht Unmögliches? Ja, das tun wir, und doch
passiert es sehr oft überall auf der Welt, dass wir solche übersteigerten
Erwartungen haben. Trotzdem kommen oft Menschen gerade
auf diese Art zum Glauben. Wie ist das möglich? Ich möchte dafür
verschiedene Gründe anführen.
46
In Apostelgeschichte 11,21 berichtet Lukas von einer erfolgreichen
Verkündigung, denn »die Hand des Herrn war mit ihnen«.
Das ist das Entscheidende. Erst dadurch wird eine fruchtbare Verkündigung
möglich. Wenn die Hand des Herrn nicht mit uns ist,
verschwenden wir eigentlich unsere Zeit. Aber die Bibel gibt noch
andere Gründe, warum wir mit Erfolgen bei der Verkündigung
rechnen dürfen.
In Apostelgeschichte 11,24-25 wird ein weiterer Grund genannt:
»… und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan.
Denn er [Barnabas, der Verkündiger] war ein guter Mann und voll
Heiligen Geistes und Glaubens …« Das ist ein mächtiges Dreigespann:
ein gutes Leben, der Heilige Geist und der Glaube. Es fanden
Menschen zu Gott, weil der Verkündiger der Botschaft ein so
vortreffliches Leben führte.
In Apostelgeschichte 13,48, wo von einer weiteren Verkündigung
der Botschaft berichtet wird, sagt uns Lukas, warum es zu
einem so positiven Echo kam: »… und es glaubten, so viele zum
ewigen Leben bestimmt waren.«
Ich verstehe das so, dass Gott bestimmte Menschen vorbereitet
hat, die dann zum Zeitpunkt unseres missionarischen Gesprächs
bereit sind, positiv auf die Botschaft zu reagieren. Wir können
damit rechnen, überall auf der Welt – wo auch immer wir hingehen –
wenigstens einige solch vorbereiteter Menschen zu finden.
Aber es gibt noch andere Gründe für eine berechtigte Hoffnung
auf eine fruchtbringende Verkündigung. In Apostelgeschichte 14,1
heißt es, dass »sie … so redeten, dass eine große Menge glaubte,
sowohl Juden als auch Griechen«. Apostelgeschichte 16,14 nennt
noch einen anderen Grund: Lukas schreibt von Lydia, »deren Herz
der Herr auftat, dass sie achtgab auf das, was von Paulus geredet
wurde«.
Wir haben also eine Reihe von Gründen im Neuen Testament
gefunden, die uns Anlass geben, mit einer positiven Reaktion auf
unsere Verkündigung zu rechnen. Wenn wir Menschen sind, die
sich durch Glauben und Reinheit auszeichnen, können wir er -
47
warten, dass die Hand des Herrn mit uns sein wird. Wir können
erwarten, dass wir – wo immer wir auch hingehen – einigen vor -
bereiteten Menschen begegnen werden. Wir können es lernen,
anderen das Evangelium wirkungsvoll mitzuteilen. Und wir dürfen
vom Herrn erwarten, dass er Menschenherzen öffnen wird und
sich Menschen aufgrund unserer Verkündigung bekehren werden.
48
6. Das religiöse Erbe
Bestandsaufnahme: Voraussetzung
für wirksame Verkündigung
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Menschen so und nicht
anders auf die Verkündigung reagieren. Vielleicht ist das der wichtigste
Grund. Nach dem Bericht der Apostelgeschichte gab es zwei
Gruppen von Menschen, die für die Verkündigung des Evangeliums
offen waren. Die erste Gruppe waren die Juden. Im Neuen
Testament ist ein Jude ein Mensch mit einer religiösen Tradition
von 16 Jahrhunderten. Gott hatte ihm die Schriften – das Gesetz
und die Propheten – gegeben. Religion und Staat waren für die
frommen Juden ein untrennbares Ganzes. Der Jude war für das
Evangelium sehr gut vorbereitet. Der Pfingstfesttag brachte »Juden,
gottesfürchtige Männer, aus jeder Nation unter dem Himmel« nach
Jerusalem (Apostelgeschichte 2,5).
Die zweite Gruppe waren die Heiden, die sich dem jüdischen
Glauben angeschlossen hatten. Sie waren unter dem Namen »Proselyten«
bekannt. Als Gott anfing, das Evangelium unter den Heiden
auszubreiten, wählte er Kornelius aus, einen römischen Hauptmann,
den Lukas als »fromm und gottesfürchtig« be zeichnet
(Apostelgeschichte 10,2). Das war der Anfang der Mission. In
Antiochien diente Paulus der Gemeinde als einer von fünf Leitern.
Barnabas war auch einer dieser Leiter. Der Heilige Geist
wusste, dass die Gemeinde in Antiochien zwei von diesen fünf
ent behren konnte – so wurden Paulus und Barnabas als Missionare
aus gesandt. Wo sie auch hinkamen, verfolgten sie eine ganz
bestimmte Taktik. Zuerst gingen sie in die Synagogen. Es war anzunehmen,
dass jeder, der sich in einer Synagoge befand, ein gewisses
Maß an geistlichem Interesse mitbrachte. Obwohl diese Menschen
nicht von Christus gehört hatten, suchten sie Gott auf ihre traditionsgemäße
Art. Sie hatten das Vorrecht, eine religiös geprägte
49
Tra dition zu besitzen. So war es nur natürlich, dass viele von ihnen
zum Glauben kamen, als Paulus und Barnabas ihnen das Evangelium
predigten. Sowohl Juden als auch zum Judentum übergetretene
Heiden wurden Christen.
Etwas Ungewöhnliches geschah, als sie nach Philippi kamen. Es
gab in dieser Stadt keine Synagoge. Anscheinend hatten Paulus und
Barnabas gehört, dass sich die Leute irgendwo am Fluss regelmäßig
zum Gebet trafen. Sie gingen also auch dorthin und lernten Lydia
kennen. Aber auch Lydia war schon eine Frau, »die Gott anbetete«
(Apostelgeschichte 16,14). Wieder brachten sie das Evangelium nur
denjenigen, die schon auf irgendeine Weise vorbereitet waren. In
Athen verlief die Sache ganz anders (vgl. Apostelgeschichte 17,16-
34). »Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein
Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er
unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den
An betern, und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade
herzukamen« (Apostelgeschichte 17,16.17). Er fing sogar Streitgespräche
mit Philosophen – Epikuräern und Stoikern – an. Die
Philosophen waren durch die neue Lehre, die Paulus ihnen vorstellte,
hellhörig geworden – sie führten ihn zum Areopag, damit
er auch dort eine Rede halten sollte. Das ist die einzige schriftlich
überlieferte Predigt, die Paulus vor einer heidnischen Menge
(vor Menschen, die nicht religiös vorgeprägt waren) gehalten hat.
Beachten Sie den inhaltlichen Unterschied in dieser Botschaft. Er
berief sich nicht auf das Alte Testament, er argumentierte von der
Philosophie her. Er zitierte sogar griechische Dichter. Sein Zeugnis
knüpfte an einer anderen Stelle an – er setzte bei der Person Gottes
an. Dann redete er von Jesus und der Auferstehung. Er hatte nur
geringen Erfolg mit seiner Predigt: »Einige Männer aber schlossen
sich ihm an und glaubten« (Apostelgeschichte 17,34).
Vergleichen Sie einmal die Reaktion auf die Predigt des Paulus
mit dem Erfolg, den Petrus mit seiner Pfingstpredigt erzielte
(Apostel geschichte 2,37-41). Was war anders in Athen? War Petrus
mehr vom Heiligen Geist erfüllt? Konnte Petrus besser predigen?
50
Nein, der Unterschied lag einzig und allein in dem religiösen Erbe
des Judentums, das die Menschen vorbereitet hatte, das Evangelium
so bereitwillig aufzunehmen.
Damit die Verkündigung wirklich etwas bewirkt, muss der
Hörer unbedingt in irgendeiner Form vorbereitet worden sein, d. h.
jemand muss vorher gepflanzt und bewässert haben. Und doch ist
es unser Auftrag, das Evangelium der ganzen Welt zu predigen.
Warum wohl? Ich denke, weil Gott am Werk ist und überall auf
der Welt einige Menschen vorbereitet. Aber Gott wollte nie von uns,
dass unser missionarisches Zeugnis sich allein auf die Verkündigung
beschränkt.
51
7. Reichweite der Verkündigung
Grenzen der Wirksamkeit
Wir haben den Auftrag, zu verkündigen. Die Verkündigung kann
auch wirklich auf der ganzen Welt Menschen zum Glauben bringen.
Allerdings gibt es für sie auch Grenzen der Wirksamkeit.
Diese Grenzen gelten sowohl für die Zuhörerschaft, die mit der
Ver kündigung erreicht werden kann, als auch für das Ziel, das man
mit der Verkündigung verfolgt.
Der Apostel Paulus wusste um diese Grenzen der Wirksamkeit;
er hat sich deshalb in seiner Missionsarbeit an ganz
be stimmten Richtlinien orientiert und sein Betätigungsfeld auf
bestimmte Städte begrenzt. Diese Haltung war entscheidend für
seinen Erfolg. Paulus versuchte nicht, alles zu machen. Er war in
der Hauptsache Verkündiger. Er reiste durch seine Welt und verkündigte
ihr das Evangelium, bis er in seinem Brief an die Römer
die erstaunliche Feststellung machen konnte: »… sodass ich von
Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium
des Christus völlig verkündigt habe […] Jetzt aber, da ich keinen
Raum mehr habe in diesen Gegenden, seit vielen Jahren aber
großes Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien
reise …« (Römer 15,19.23.24).
Was meinte Paulus mit der Aussage, dass er seine Arbeit vollendet
habe? Wollte er etwa behaupten, er habe jedem Menschen
in dem Gebiet von Jerusalem bis nach Illyrien das Evangelium verkündigt?
Das konnte doch gar nicht sein. Seine missionarische
Strategie sah vielmehr so aus, dass er in eine Stadt ging, diejenigen
»erntete«, die vorbereitet waren, die Neubekehrten im Glauben festigte
und dann zur nächsten Stadt weiterzog.
Wie viele Menschen einer Stadt wie Korinth, der sündigen
Hafenstadt des Römischen Reiches, hatten je eine jüdische Synagoge
von innen gesehen? Wahrscheinlich nur ein geringer Prozent
52
satz der Bevölkerung. Trotzdem beschränkte sich die missionarische
Arbeit des Paulus auf die Synagogen. Wie konnte Paulus dann
behaupten, dass er an allen diesen Orten seine Aufgabe vollständig
ausgeführt habe? An anderer Stelle sagt Paulus: »Wir aber wollen
uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises,
den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat, um auch
bis zu euch zu gelangen. […] wobei wir uns nicht ins Maßlose rühmen
in fremden Arbeiten, aber Hoffnung haben, wenn euer Glaube
wächst, unter euch vergrößert zu werden nach eurem Wirkungskreis«
(2. Korinther 10,13-15).
Paulus wollte damit sagen, dass er sich in seinem Dienst auf
einen bestimmten Wirkungskreis beschränkte. Er wollte in strategisch
wichtigen Städten Menschen zum Glauben führen, damit
sie für die weitere missionarische Arbeit sozusagen als Brückenköpfe
dienen können. Paulus machte nicht die ganze Arbeit – er er -
richtete nur Brückenköpfe.
Paulus vertraute darauf, dass die, die er zum Glauben geführt
hatte, im Glauben wachsen und da weitermachen würden, wo er
aufgehört hatte.
Sein Erfolg beruhte auf dem beständigen geistlichen Wachstum
und der weiteren Verbreitung des Evangeliums durch seine »geistlichen
Kinder«.
Oft wurde Paulus durch Verfolgung gezwungen, weiter -
zuziehen; aber selbst wenn er nicht verfolgt wurde, blieb er nicht
lange in einer Stadt. Er zog dann weiter, wenn sich diejenigen, die
vor bereitet waren, bekehrt hatten und er sie in den Grundlagen des
Glaubens unterrichtet hatte (Ephesus, wo er drei Jahre blieb, war
die Ausnahme dieser Regel).
Wir wollen heute bei unseren evangelistischen Einsätzen dem
Vorbild des Paulus folgen. Wir schaffen es aber nicht, uns ein
umfassendes Bild davon zu machen, wie Paulus seine Missionsarbeit
betrieb. Wir verhalten uns so, als ob das Evangelium, wenn
es erst einmal der Welt verkündigt worden ist, schon genügend
bewirkt hat. Wir denken, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben,
53
wenn wir jedem Menschen unserer Generation das Evangelium
einmal verkündigt haben. Aber selbst, wenn wir dieses Ziel er -
reichen würden, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir
mit der Missionierung der Welt dann erst angefangen hätten. Wir
hätten dann nur Brückenköpfe errichtet, aber vor uns läge noch
die größere Herausforderung. Wir müssten dann einsehen, dass
wir erst, nachdem wir verkündigt haben, den Punkt erreicht hätten,
von dem aus wir anfangen könnten, diese Welt wirklich mit
dem Evangelium zu durchdringen. Denken Sie nur einmal an Ihre
unmittelbare Umgebung: Wie viele Ihrer Freunde und Bekannten
stehen dem Evangelium wirklich nahe? Wenn jemand ihnen das
Evangelium erklären würde, wie viele würden ihr Leben Christus
übergeben? Was ist mit den anderen? Sind sie hoffnungslose Fälle?
Wenn nicht, wie könnten sie angesprochen werden? Wer würde
sich um sie bemühen?
Nicht jeder ist mit dem Evangelium erreichbar, und nicht
jeder wird sich sofort bekehren. Wenn wir jedoch erst einmal verstehen
lernen, dass das Evangelisieren weit mehr beinhaltet als
bloße Verkündigung, dann haben wir die Notwendigkeit erkannt,
beim Evangelisieren verschiedenste Methoden anzuwenden. Das
erst ermöglicht es jedem Menschen, die Botschaft in einer Form
zu hören, die für ihn verständlich ist. Wir leben in einer säkularisierten
Welt, in der der Einfluss des Evangeliums kaum sichtbar
ist. Zum Teil liegt das daran, dass wir eine zu begrenzte Sicht von
Evangelisation haben. Wir verstehen darunter nur das gesprochene
Zeugnis, das Weitersagen des Evangeliums.
Diese Sicht schränkt jedoch die Möglichkeiten des Evangeliums
in zwei Weisen ein: Es gibt nur einen begrenzten Kreis von Menschen,
der auf diese Art erreicht werden kann (nur die vorbereiteten
Menschen), und es gibt nur wenige, die verkündigen können.
Geschäftsleute in mittleren Jahren oder Hausfrauen werden wohl
kaum die Verkündigung als Evangelisationsmethode in ihrer normalen,
alltäglichen Umgebung benutzen können. Wenn jemand
verkündigen will, braucht er ständig neue Zuhörer.
54
Jesus sandte seine zwölf Jünger zu zweit aus, aber weder sie
selbst noch ihre Nachfolger haben diese Methode angewandt.
Kann unser Verständnis von Evangelisation wirklich umfassend
sein, wenn es dem Durchschnittschristen nicht erlaubt, sich mit
seinem Leben persönlich einzubringen und Frucht zu bringen?
55
III. Teil: Evangelisieren
durch ein gelebtes Zeugnis
8. Die rätselhaften Briefe der Apostel
Wo werden wir in den Briefen aufgefordert, zu verkündigen?
Bevor Sie dieses Kapitel lesen, lesen Sie einmal die neutestamentlichen
Briefe daraufhin durch, wo sich Ermahnungen in Bezug auf
das Zeugnisgeben finden.
Wir haben gerade festgestellt, dass Paulus sich in seiner Mis sionsarbeit
auf das Errichten von Brückenköpfen mithilfe von Neubekehrten
beschränkte – und dies meist in strategisch wich tigen
Städten oder Gebieten. Sein Wirkungskreis war begrenzt, aber
nicht seine Perspektive für die zukünftige Arbeit. Er war ab hängig
von dem beständigen Wachstum dieser kleinen christlichen
Gemeinden, damit seine Arbeit bleibende Früchte tragen und das
Evangelium in die Welt hineingetragen werden konnte. Paulus
sagte: Wenn diese Arbeit nicht von anderen weitergeführt würde,
wäre seine Arbeit letztlich umsonst gewesen (vgl. Philipper 2,16).
Wenn doch Paulus so viel Wert auf die Arbeit dieser kleinen
Gemeinden legt, könnte man dann nicht erwarten, dass er in seinen
Briefen häufig dazu auffordert, Zeugnis zu geben? Dass er
uns heftig ermahnt, hinauszugehen und das weiterzuführen, was
er angefangen hatte, nämlich jedem Menschen das Evangelium
weiterzusagen? Aber solche Ermahnungen finden sich in seinen
Briefen nicht. Wie kommt das? Wohl daher, weil Paulus erkannt
hat, dass noch mehr Verkündigung genau das Gegenteil bewirken
würde!
56
Er war in diese Gegend gekommen und hatte geerntet. Um die
anderen Menschen dieser heidnischen Städte gewinnen zu können,
brauchte man mehr als nur Worte. Es musste gepflanzt und
be wässert werden.
Das wird in anderen Aussagen von Paulus in seinen Briefen in
Bezug auf das Gewinnen der Verlorenen bestätigt. Zum Beispiel
gab er Titus den Auftrag: »… die alten Frauen ebenso in ihrem
Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt […]; damit sie die jungen
Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,
besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig,
sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes
nicht verlästert werde« (Titus 2,3-5; Hervorhebung hinzugefügt).
Paulus forderte Titus auf: »Die jüngeren Männer ermahne
ebenso, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein
Vorbild guter Werke darstellst; in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen
Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von
der Gegenpartei beschämt wird, da er nichts Schlechtes über uns zu
sagen hat« (Titus 2,6-8; Hervorhebung hinzugefügt).
Paulus rief Titus auf: »Die Knechte ermahne, sich ihren ei genen
Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend,
nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue er -
weisend, damit sie die Lehre, die unseres HeilandGottes ist, zieren in
allem« (Titus 2,9-10; Hervorhebung hinzugefügt).
Hier macht Paulus Aussagen über Ursache und Wirkung im
Leben eines Christen und zeigt damit, dass er ein klares Verständnis
der wichtigen Aufgabe hat, die Gottes Volk haben soll – Gottes
Wesen soll beispielhaft vorgelebt werden, bevor anderen das Evangelium
gepredigt wird. Immer wenn Paulus das Problem der verlorenen
Welt anspricht, dann legt er das Hauptgewicht auf unser
Leben, als der einzig richtigen Art und Weise, Mission zu betreiben.
»Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei
es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch
höre, dass ihr feststeht in einem Geist, indem ihr mit einer Seele
mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums« (Philipper 1,27).
57
Das Beispiel von Sergio
Sergio gehörte zu den ersten Christen, der aufgrund unserer Studentenarbeit
in Brasilien zum Glauben gekommen war. Er kam aus
einer Industriellenfamilie, die bekannt dafür war, es mit Ehrlichkeit
und Rechtschaffenheit nicht so genau zu nehmen. Sergio studierte
Jura und Volkswirtschaft. Sein Studium sollte ihn darauf vorbereiten,
die Verantwortung für die Rechtsbelange der verschiedensten
Spekulationsgeschäfte seiner Familie zu übernehmen. Als
Sergio 4 Jahre alt war, hatte er Kinderlähmung. Er konnte nur mithilfe
einer Körperstütze und auf Krücken laufen. Er besaß einen
unglaublich starken Willen, der sich in den Jahren des Ankämpfens
gegen die Grenzen, die ihm sein gelähmter Körper steckte, ge bildet
hatte.
Als wir uns das erste Mal sahen, war er eine harte und kalte Persönlichkeit.
Wir fuhren einmal oder zweimal die Woche zu einem
Aussichtsplatz, von dem aus man die ganze Stadt überblicken
konnte, und machten dort ein intensives Bibelstudium. In dem
Maße, wie Sergio Jesus Christus kennenlernte, zeigten sich langsam
Veränderungen bei ihm. Bis zum Abschluss seines Studiums war
aus ihm ein reifer Christ geworden. Die Veränderungen in seiner
Persönlichkeit waren für alle, die ihn kannten, klar erkennbar.
Aber es gab für ihn noch ein großes Problem. Wie sollte seine
Zukunft aussehen? Seine Familie hatte ihn mit der Absicht studieren
lassen, dass er später für sie arbeiten würde. Musste er dann
nicht seinem Ideal der Ehrlichkeit untreu werden? Und war es
nicht eigentlich die Aufgabe des Rechtsanwalts, dem Geschäftsmann
zu helfen, mit möglichst viel unrechtmäßigem Verhalten
ungeschoren davonzukommen? Ich sah, dass Sergio sich Sorgen
machte wegen dieser Sache. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich
ihm helfen konnte.
In dem Jahr, als Sergio sein Examen an der Universität machen
wollte, erlebte Brasilien eine schwere Wirtschaftskrise. Das hatte
zur Folge, dass viele Firmen bankrottgingen, unter anderem auch
58
die von Sergios Familie. Auf einmal war er frei von allen Verpflichtungen
seiner Familie gegenüber. Er stand nun auf eigenen Füßen.
In der Examenswoche kam er zu mir. Er erzählte mir, dass er
zwei Entschlüsse gefasst habe. Er wolle jetzt Gott an die erste Stelle
in seinem Leben setzen und immer ehrlich sein. Mit diesen Vorsätzen
ging er zurück in seine Heimatstadt. Er mietete dort ein
Büro und eröffnete eine eigene Anwaltspraxis.
Ein paar Monate später war einer der Bauern dieser Gegend
gerade im Begriff, wegen überzogener Steuern Haus und Hof zu
verlieren. Sein Bauernhof wurde öffentlich versteigert. Sergio kaufte
ihn. Das hatte zur Folge, dass in der Stadt Gerüchte umgingen: Dieser
Kauf sei doch wieder einmal typisch für diese auf ihre Vorteile
bedachte Familie. Aber was Sergio dann tat, setzte die ganze Stadt
in Erstaunen. Er ging zu dem Bauern und gab ihm seine Grundstücksurkunde
zurück – er solle seine Schulden so zurückzahlen,
wie es ihm möglich sei.
Sergio war nicht verpflichtet, sich so zu verhalten. Es war sein
verbürgtes Recht, den Hof zu behalten. Aber er ließ Gnade vor
Recht ergehen – so verhält sich Gott auch uns gegenüber.
Sergio hat wahrscheinlich noch 35 Jahre zu arbeiten. Wenn er
aber auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht, dann wird schon
allein sein Leben einen großen Einfluss auf die Menschen ausüben.
Es wird den Boden in seiner Gegend nachhaltig für das Evangelium
vorbereiten.
Ich habe viel dadurch gelernt, wie Sergio sein Christsein im
Beruf auslebt. Seine Grundsätze »Gott an die erste Stelle setzen«
und »ehrlich sein« waren entscheidend für seine weitere evangelistische
Arbeit. Ohne diese Vorentscheidungen hätte er weder den
Freiraum zum Zeugnisgeben noch eine Botschaft gehabt, die durch
seinen christlichen Lebensstil abgedeckt war. Ohne diese Ziele
hätte er wenig Hoffnung haben können, dass Gott sein Leben für
andere Menschen wirklich einsetzen kann.
Jesus hat gesagt: »… ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
Heilige Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeu
59
gen sein …« (Apostelgeschichte 1,8). Ich denke, dass dieser Satz
das zusammenfasst, was wir in diesem Kapitel festgestellt haben.
Unser Auftrag ist nicht das Tun des Zeugnisses, sondern das Leben
als Zeugen Christi. Evangelisieren ist nicht etwas, was wir tun, sondern
etwas, was unser ganzes Sein umfasst. Wenn wir das aus den
Augen verlieren und das Hauptgewicht nur auf das Ver kündigen
legen, dann sind die Leute, die wir für Christus ge winnen, un fähig,
andere zu Christus zu führen. Wir müssen Christi Befehl ge horchen
und Jünger heranbilden, indem wir sie lehren, »alles zu bewahren,
was ich euch geboten habe« (Matthäus 28,20). Anderenfalls werden
diese Neubekehrten kein geistliches Wachstum er leben und selber
keine Frucht bringen können. Es würde dann keine zweite Ernte
geben. Die Ernte würde sich auf den ersten Ertrag be schränken.
Aber wo wir uns auf das Sein mehr als auf das Reden kon zentrieren,
werden wir oft ernten können.
Ich hoffe, dass Sie sich nun Zeit nehmen werden, noch einmal die
neutestamentlichen Briefe daraufhin durchzulesen und sich alles aufzuschreiben,
was diese über unser Zeugnis in der Welt sagen.
60
9. Israel – ein lebendiges Zeugnis an die Welt
Das auserwählte Volk Gottes
Gott verfolgt mit allem, was er mit dem Menschen tut, ein bestimmtes
Ziel. Dieses Ziel lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Versöhnung.
»Nämlich dass Gott in Christus war, die Welt mit sich
selbst versöhnend, […] und er hat in uns das Wort der Versöhnung
niedergelegt« (2. Korinther 5,19).
Er gab den Menschen den Auftrag, die »Botschaft der Versöhnung«
zu predigen. Wie wir festgestellt haben, hat Gott sogar
die Welt in verschiedene Völker und Kulturen unterteilt und be -
absichtigte damit ihre Versöhnung.
Das Volk Gottes hat immer eine entscheidende Rolle gespielt,
damit die Ziele Gottes verwirklicht werden konnten. Solange wir
das nicht begriffen haben, werden wir nie ein angemessenes Verständnis
von Evangelisation oder einem christlichen Leben haben.
Israel: das am wenigsten geeignete Volk
Die unwahrscheinlichste Sache der Welt war, dass aus Israel einmal
eine Nation werden würde, und es hatte die allergeringsten
Über lebenschancen. Alles begann mit einem Mann und einer Verheißung.
Abraham war 75 und Sara 65 Jahre alt, als sie Haran verließen,
um die Erfüllung von Gottes Verheißung zu emp fangen.
Nach 11 Jahren in der Wüste – Abraham war mittlerweile 86 und
Sara 76 Jahre alt – verloren sie die Geduld. Das Ergebnis war Ismael.
Aber er war nicht die Erfüllung der Verheißung.
Sie müssten noch weitere 14 Jahre warten, bis Isaak, der verheißene
Sohn, geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham
100 und Sara 90 Jahre alt. 40 Jahre später heiratete Isaak Rebekka.
Zu dieser Zeit war seine Mutter schon tot. Isaak und Rebekka
61
mussten 20 Jahre warten, bis ihre Zwillingssöhne, Jakob und Esau,
zur Welt kamen. Aber nur einer der Zwillinge, Jakob, sollte an der
Verheißung teilhaben. So bestand das Volk Israel also nach 85 Jahren,
angefangen bei der Berufung Abrahams durch Gott bis hin zur
Geburt Jakobs, nur aus 3 Personen: Jakob und seinen Eltern.
Weder Jakob noch seine Mutter führten ein besonders vor -
bildliches und tugendhaftes Leben. Jakob betrog seinen Vater, log
seinen Bruder an und kämpfte mit seinem Onkel. Seine Frauen
dienten anderen Göttern. Und doch wuchs Jakobs Familie auf
70 Leute an – sie wurden ein Nomadenstamm mit zweifelhaften
mo ralischen Maßstäben.
Dieses Volk bestand also nach 215 Jahren (in dieser Zeit zogen
sie von Haran nach Ägypten) aus einer einzigen Familie mit
70 Leuten. Dann kamen 215 Jahre Sklaverei in Ägypten. Das waren
Jahre, in denen sich Gott in Schweigen hüllte: keine Wunder, keine
Zeichen, keine bestätigten Verheißungen. Gott schwieg. In diesen
Jahren musste sich Israel mit dem begnügen, was Gott früher einmal
getan hatte – es musste sich an den uralten Ge schichten festklammern,
die vom Vater an den Sohn überliefert wurden. Es entstand
der Eindruck, dass Gott scheinbar sehr fern war – er hatte
sich nur früher einmal ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob
gezeigt. Aber jetzt musste Israel in der Sklaverei leben – nicht
gerade eine Umgebung, die einer kulturellen Entfaltung förderlich
war.
Schließlich floh Israel unter Moses Führung aus Ägypten – sie
waren jetzt ein Volk von ca. 1 Million Menschen. Auf ihrer Wanderschaft
durch die Wüste entwickelten sie eine Kultur, mit der
sie ihrer Zeit weit voraus waren und die – verglichen mit ihren
Nachbarn – äußerst fortschrittlich und vielschichtig war. Gott gab
Israel Richtlinien für alle praktischen Bereiche des Lebens: Medizin,
Hygiene, Wirtschaft, Landwirtschaft, Ethik, Politik, Recht und
Religion. Zwischen dem Aufbruch aus Haran und dem Auszug aus
Ägypten lagen 430 Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit! Wenn wir
das auf unsere Zeitrechnung übertragen, hätte Abraham Ende des
62
16. Jahrhunderts gelebt und der Auszug aus Ägypten würde heute
stattfinden. Warum hat Gott das so gemacht? Das 5. Buch Mose
gibt uns Aufschluss darüber. Gott dachte dabei nicht nur an Israel,
sondern an die ganze Welt. Mose forderte das Volk Israel heraus,
an diesen umfassenderen Plan Gottes zu denken, und sagte ihnen:
»Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt […], damit
ihr so tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt […] Und so
haltet sie und tut sie! Denn das wird eure Weisheit und euer
Verstand sein vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen
hören und sagen werden: Diese große Nation ist ein
wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große
Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der
HERR, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und welche
große Nation gibt es, die gerechte Satzungen und Rechte
hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?«
(5. Mose 4,5-8).
Gott erwählte Israel nicht, weil sie die Besten und Größten waren,
sondern weil sie so schwach und ungeeignet waren. Es war ganz
klar, dass, wenn sie irgendetwas leisten würden, Gott dabei seine
Hände im Spiel haben musste: »So erkenne denn, dass der HERR,
dein Gott, nicht um deiner Gerechtigkeit willen dir dieses gute
Land gibt, es zu besitzen; denn ein hartnäckiges Volk bist du.
Er innere dich daran – vergiss es nicht –, wie du den HERRN,
deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast! Von dem Tag an, als du
aus dem Land Ägypten herausgezogen bist, bis ihr an diesen
Ort kamt, seid ihr widerspenstig gegen den HERRN gewesen«
(5. Mose 9,6-7).
Israel war Gottes Sprachrohr für die Welt. Angesichts der
Geschichte Israels musste die Welt einfach erkennen, dass Gott dieses
Volk wirklich unter seine Fittiche genommen hatte. Das war der
springende Punkt. Der König Salomo zum Beispiel war »größer an
Reichtum und an Weisheit als alle Könige der Erde. Und die ganze
63
Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören,
die Gott in sein Herz gegeben hatte« (1. Könige 10,23-24). Gott
schloss mit Israel einen Bund. Er identifizierte sich selber so sehr
mit diesem Volk, dass er in der Welt als der »Gott Israels« bekannt
wurde. Und wie sehr gedieh Israel aufgrund dieser Beziehung zu
Gott! Israel wurde ein angesehenes Volk, denn es spiegelte das
Wesen des lebendigen Gottes wider. Israel wirkte wie ein Ma gnet
auf die anderen Völker: Alle suchten hier Rat und Heil.
Alles ging so lange gut, wie Israel Gottes Geboten gehorchte.
Aber Gott machte sich selber durch diesen Bund verwundbar.
Israel hatte die Macht, die ganze Welt auf einen falschen Weg zu
führen! Es brauchte nur Gott ungehorsam zu sein oder die Götter
seiner Nachbarn anzubeten – und schon hatte die Welt ein falsches
Bild von Gott. Die Welt zog dann auch tatsächlich falsche Schlüsse
über Gottes Wesen aufgrund von Israels Verhalten.
Aus dieser hervorgehobenen Stellung Israels wird deutlich,
warum Gott bei ihnen keinen Götzendienst dulden konnte und
warum er seinen Namen und seine Gegenwart Israel auf dieselbe
dramatische Weise entzog, wie er sie ihnen gegeben hatte. Mose
hatte die Israeliten gewarnt, dass Gottes Gericht über sie kommen
würde, wenn sie sich gegen Gott auflehnen würden: »… und
alle Nationen werden sagen: Warum hat der HERR diesem Land
so getan? Weshalb diese große Zornglut? Und man wird sagen:
Weil sie den Bund des HERRN, des Gottes ihrer Väter, verlassen
haben …« (5. Mose 29,23-24).
Gott hatte der Welt etwas zu sagen: Er wollte sich nicht mit
Israels Ungerechtigkeit und Perversion identifizieren. Durch den
Propheten Hesekiel sagte Gott: »Und sie werden wissen, dass ich
der HERR bin, wenn ich sie unter die Nationen versprenge und
sie in die Länder zerstreue. Und ich werde von ihnen einige Leute
übrig lassen vom Schwert, vom Hunger und von der Pest, damit sie
alle ihre Gräuel erzählen unter den Nationen, wohin sie kommen
werden. Und sie werden wissen, dass ich der HERR bin« (Hesekiel
12,15-16).
64
Wenn Israel Gott gehorsam war, verherrlichte es Gott. Das
heißt, es machte der Welt Gottes Wesen bekannt. Die Israeliten verkörperten
Gottes Eigenschaften – sie waren Vorbilder aus Fleisch
und Blut, für alle sichtbar. Weil es Israel gab, konnte sich die Welt
nicht länger damit entschuldigen, Gott und seine Wege nicht zu
kennen.
65
10. Das Zeugnis der Gemeinde Jesu
Ein einzigartiges Volk
Folgende Verse aus dem Römerbrief beziehen sich auf die christliche
Gemeinde: »Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen
worden sind, du aber, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie
ein gepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig
geworden bist …« (Römer 11,17). Hier ist die christliche
Gemeinde, das neue Volk Gottes, gemeint. Es geht auf dieselben
Verheißungen zurück und soll denselben Zweck erfüllen wie einst
das Volk Israel.
Das Volk Israel hatte versagt und konnte nicht länger Sprachrohr
Gottes in der Welt sein. Als Israel sich von Gott abwandte, haben
die meisten Israeliten eine bestimmte Richtung ein geschlagen. Sie
haben den Reichtum und alles Schöne, was Gott ihnen als Volk
geschenkt hatte, an sich gerissen und haben damit »in Saus und
Braus« gelebt, sodass die vorherrschenden Merkmale Israels Sittenverfall,
Ungerechtigkeit und Korruption wurden (vgl. Hesekiel 16).
Eine andere Gruppe, die frommen Juden, waren entsetzt über
dieses Abwenden von den alten Werten. Sie, das »wahre Israel«,
wollten als »kleiner Rest« den Glauben bewahren und verteidigen.
Sie erweiterten die fünf Bücher Mose um einen 70 Bände
um fassenden Kommentar und behielten die Verwaltungsstruktur,
die Mose eingeführt hatte, bei (vgl. 2. Mose 18).
Fest entschlossen, die alten Wertmaßstäbe zu erhalten, verfielen
sie in eine tote Werkgerechtigkeit. Auf diese Weise entstand die
Sekte der Pharisäer.
Es ist erstaunlich zu sehen, wie aus einem so angesehenen Volk
wie Israel ein so abgefallenes Volk werden konnte. Es ist schwer zu
sagen, welche extreme Haltung schlimmer ist: die Missachtung des
Gesetzes oder die Gesetzlichkeit. Beide Haltungen hatten jedenfalls
einen negativen Einfluss auf die Welt (vgl. Römer 2,24).
66
Aber Gott änderte seinen Plan nicht. Gott rief durch seinen
Sohn ein neues Volk ins Leben, das in dieselbe Wurzel eingepflanzt
wurde, aus der auch das Volk Israel gewachsen war. Bei
den Anfängen gab es Parallelen: 12 Söhne Jakobs, 12 Apostel. Aber
die Geschwindigkeit war unterschiedlich. Was bei Israel 215 Jahre
gedauert hatte, schaffte Jesus Christus in etwas mehr als drei Jahren.
Jakob hinterließ eine 70-köpfige Sippe in Ägypten, während
Jesus in einem Saal in Jerusalem eine Gruppe von 120 Menschen
zurückließ. Gott hat Israel vor allen anderen Völkern mit einer
einzigartigen Kultur ausgezeichnet – ebenso tat es Jesus mit der
Gemeinde. Jedoch lässt sich hier ein großer Unterschied feststellen:
Während Israels Kultur von ihrem Wesen her gesellschaftspolitisch
geprägt war, hatte die »Kultur« des neuen Gottesvolkes einen eher
geistlichen Charakter.
Die Gemeinde: die Vorhut des Reiches Gottes
Jesus kam in die Welt, um über das Reich Gottes zu predigen (Markus
1,15). Das »Reich Gottes« ist der zentrale Begriff seiner Verkündigung.
Obwohl dieses Thema bei ihm höchste Priorität hatte,
gab es nur wenige, die verstanden, was er damit meinte. Wir können
es den Menschen von damals nicht verdenken, denn auch für
uns heute sind seine Worte vom Reich Gottes noch dunkel und
geheimnisvoll.
Jesus beschrieb das Reich Gottes als etwas Gegenwärtiges
(Matthäus 12,28) und doch zugleich Zukünftiges (Lukas 21,31);
es ist unter uns (Lukas 17,21) und nicht von dieser Welt (Jo -
hannes 18,36); klein wie ein Samenkorn (Markus 4,31) und dennoch
alles durchdringend (Lukas 13,18-21). In den Gleichnissen
vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Netz voller
Fische (Matthäus 13,47), 10 Jungfrauen (Matthäus 25,1-13),
einem im Feld verborgenen Schatz und einer kostbaren Perle
(Matthäus 13,44-46).
67
Bei ihrem letzten Gespräch mit Jesus, kurz vor seiner Himmelfahrt,
bewiesen die Jünger, dass sie eigentlich nur wenig vom Reich
Gottes verstanden hatten. Sie fragten Jesus, ob er jetzt ihre Er -
wartungen erfüllen würde und ein sichtbares Reich Israel wieder -
herstellen würde (Apostelgeschichte 1,6). Sie hatten die wirk liche
Bedeutung und Tragweite des Reiches Gottes nicht verstanden. Sie
hatten nicht begriffen, dass Jesus mit seiner Lehre eine total andere
Gesellschaftsordnung einsetzte, einen völlig neuen Lebensstil, der
neue Wertmaßstäbe, neue Einstellungen, neue Beziehungen, kurz:
eine neue Kultur beinhaltet – die Lebensweise des Reiches Gottes.
Sobald wir verstanden haben, was Jesus uns als Bürger des Reiches
Gottes lehrt, können wir die Radikalität und Einzigartigkeit
des christlichen Lebens, wie Jesus es meint, erahnen. Die Worte
Jesu sind für uns das, was das Buch Mose für die Juden war. Jesus
möchte, dass seine Gemeinde diesen Lebensstil beispielhaft vorlebt.
E. Stanley Jones hat festgestellt, dass das Reich Gottes eigentlich ein
totalitäres Reich darstellt. Es ist ganz anders als eine menschliche
Gesellschaftsordnung, die sich mit einer rein äußer lichen Übereinstimmung
begnügen muss. Dagegen geht der Einfluss des Reiches
Gottes bis in unsere geheimsten Gedanken. Wir können keinen
Gedanken denken, ohne dass er an den Maß stäben des Reiches
Gottes gemessen würde. Auch bei jeder un serer Be ziehungen zu
anderen Menschen hat Gott mitzureden.11
Das klingt nach Sklaverei!
Aber die Wirkung ist gerade umgekehrt als in autoritären Staaten.
Wenn jemand die Kultur und den Lebensstil des Reiches Gottes
annimmt, dann bedeutet das für ihn Befreiung anstatt Sklaverei.
Vielleicht scheinen die Worte Jesu so unverständlich, weil sie im
Gegensatz zu den Wertsystemen der Welt stehen. Wir lesen, was
Jesus gelehrt hat, und verstehen seine Sätze, aber wir kommen oft
fälschlicherweise zu dem Schluss, dass er alles wohl nicht so radikal
gemeint hat.
11 E. Stanley Jones, A Song of Ascents, Nashville/Tennessee: Abingdon Press, 1968,
Festival Edition, 1979, S. 151-152.
68
Für uns ist es jedoch im Augenblick wichtig zu erkennen, dass
Gott uns denselben Auftrag gibt wie einst dem Volk Israel, nämlich
dass wir sein Sprachrohr in und für die Welt sein sollen. Petrus
wiederholt für die christliche Gemeinde die Verheißung, die Gott
auch seinem Volk Israel schon vor Jahrhunderten gemacht hatte:
»Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit
ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; […] und dass ihr euren
Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie […] Gott verherrlichen
am Tag der Heimsuchung« (1. Petrus 2,9.12).
Zusammenfassung
Wir finden in der Schrift viele Beispiele dafür, dass Paulus das
»Sein« des Christen besonders betont. Was für Gottes Ver -
söhnungsprogramm mit der Welt grundlegend ist, ist die Existenz
eines einzigartigen Volkes, dessen Leben von Gott selbst geprägt
ist. Sein Volk verkörpert seinen Charakter – der Lebensstil seines
Volkes soll plastisch darstellen, wie das Wesen seiner ewigen Herrschaft
aussieht.
Wie sich das praktisch verwirklichen lässt, war und ist heute
noch eines der schwierigsten Probleme, mit denen die Gemeinde
zu kämpfen hat. Die Gemeinde schwankt seit den fast 2000 Jahren
ihres Bestehens zwischen zwei Extremen: der Isolation und dem
Kompromiss.
69
IV. Teil: Evangelistischer Lebensstil – praktisch
11. Ein gutes Zeugnis
Oft nur eine Karikatur
Als mein Sohn Todd 13 Jahre alt war, fragte er mich eines Tages:
»Papa, wie kann ich ein guter Zeuge sein? Ich bin nicht so ein guter
Christ wie Michelle (seine ältere Schwester). Michelle erzählt ihren
Freunden von Christus.«
Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich so alt war wie er. Ich hatte
mit zwei völlig entgegengesetzten Wünschen zu kämpfen. Auf der
einen Seite wollte ich meinen Freunden gegenüber meinen christlichen
Glauben bezeugen, denn das schien der Wunsch und die
Erwartung meiner Eltern an mich zu sein. Auf der anderen Seite
suchte ich die Anerkennung meiner Altersgenossen. Ich erinnere
mich noch an die Schuld gefühle und die innere Spannung, die dieser
Konflikt bei mir auslöste. Wie konnte ich meinem Sohn helfen
und ihn vor ähnlichen Schwierigkeiten bewahren? Schließlich sagte
ich ihm: »Todd, du musst nicht viele Worte machen. Lass dir eine
Sache besonders wichtig sein: Sei ein Friedensstifter!« Ich erklärte
ihm, dass es Gottes Willen entspricht, wenn wir dem an deren wirklich
Beachtung schenken und von uns aus die Initiative bei der
Lösung von Konflikten ergreifen. Das war ein Vorschlag, den mein
13-jähriger Sohn in die Tat umsetzen konnte.
Einige Wochen später hatte Todd einen heftigen Streit mit
E duardo, dem Sohn unserer Nachbarn. Das war ein harter Schlag
für ihre Freundschaft. Als Todd mir von diesem Streit erzählte,
haben wir noch einmal darüber gesprochen, wie man sich als Friedensstifter
verhält, und haben dazu Römer 12,17-18 gelesen:
70
»Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was
ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, soviel an euch ist,
lebt mit allen Menschen in Frieden.«
Todd machte bewusst den ersten Schritt, besuchte Eduardo und
versöhnte sich wieder mit ihm. Kurze Zeit später lud E duardos
Mutter meine Frau zu einem Gespräch zu sich ein. Sie erzählte, dass
ihre Familie Todds Freundschaft mit Eduardo aufmerksam verfolgt
hatte. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass in unserem Leben
etwas vorhanden sei, was sie dringend brauchten. Das Leben eines
13-jährigen Jungen hatte die Tür zu einer ganzen Familie geöffnet!
Es ist Gottes Absicht, den Menschen etwas durch unser Leben
zu zeigen. Solch ein gelebtes Zeugnis findet sich schon in Gottes
Absichten mit Israel und auch in der Lehre der Apostel. »Denn
unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern
auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie
ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen« (1. Thessalonicher
1,5). Diese große Wahrheit wurde verfälscht und auf eine
Formel reduziert: »Ein gutes Zeugnis haben.« Das kann so weit
gehen, dass unser christliches Zeugnis in der Praxis zu einer Karikatur
wird und dass sowohl Christen als auch Nicht christen sich
daran aufhalten, wie denn nun ein »guter Christ« aus zusehen
habe. Diese Karikatur besteht oft aus unbiblischen For derungen,
die sich immer wieder in christliche Gruppen ein schleichen. Wenn
wir diesem erwarteten christlichen Image nicht ent sprechen,
befürchten wir, dass wir Christen und auch Nichtchristen vor den
Kopf stoßen. Die Angst, die Erwartungen an derer zu enttäuschen,
trägt zum Fortleben dieser Karikatur bei. Der Nichtchrist, der die
Christen sehr scharf beobachtet, wird sie beim Wort nehmen und
fordern, dass die Christen nach ihren eigenen »frommen« Maßstäben
leben sollen. Das hat zur Folge, dass diese Karikatur, wie
sich ein Christ zu benehmen habe, als »geheiligter Lebensstil«
an gesehen wird. Und die traurige Konsequenz davon ist, dass wir
vielen eigentlich in teressierten Menschen den Zugang zum Evangelium
versperren.
71
Was ein gutes Zeugnis nicht ist
»Was muss ich aufgeben?«, fragte ein junger Mann. »Zuerst einmal
bunte Kleidung. Alles, was nicht weiß ist, muss aus deinem Kleiderschrank
verschwinden. Du darfst nicht länger auf einem weichen
Kissen schlafen. Du musst deine Musikinstrumente ver kaufen
und darfst kein Weißbrot mehr essen. Wenn du Christus ernsthaft
gehorchen willst, darfst du keine warmen Bäder mehr nehmen und
deinen Bart nicht mehr rasieren. Wenn man sich rasiert, handelt
man gegen den, der uns erschaffen hat; man versucht dann, sein
Werk noch zu verbessern.«12
Das klingt seltsam, nicht wahr? Aber hier werden nicht biblische
moralische Bedenken deutlich – vielleicht amüsieren wir uns
darüber. Und doch ist diese Liste von Verhaltensregeln (die vor
1800 Jahren entstand) immer wieder neu und anders geschrieben
worden.
Diese Liste ändert sich je nachdem, wer du bist und wo du lebst.
Trotz des relativen Charakters solcher christlichen Wertmaßstäbe
sind wir doch geneigt, sie sehr ernst zu nehmen. Es scheint fast
unvermeidlich, dass innerhalb des Leibes Christi Leute auftauchen,
die überspitzte Moralvorstellungen zur Norm erheben – und dass
dadurch die Lebendigkeit des Zeugnisses bedroht wird. Sie versuchen,
alle Natürlichkeit durch starre Normen zu unterbinden. Es
ließen sich viele Gründe dafür finden, warum das so ist, aber wir
wollen sie hier nicht behandeln.
Was uns jedoch hier wichtig ist, ist die Tatsache, dass überspitzte
Moralvorstellungen die Verbreitung des Evangeliums hindern.
Jesus sagte, dass die Pharisäer durch ihre Lehre »den Menschen
das Reich der Himmel verschließen« (Matthäus 23,13). Jedes Mal
da, wo Christen besonders betonen, was sie tun müssen – anstatt
wie sie sein müssen –, wird es zu ähnlichen negativen Ergebnissen
kommen.
12 E. Elliot, The Liberty of Obedience, Waco/Texas: Word Books, 1968, S. 45-46.
72
Jesus behandelte dieses Thema auch in seiner Bergpredigt, wo
er sagt: »Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit
sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln
ist, verherrlichen« (Matthäus 5,16). Später scheint er sich zu widersprechen:
»Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor
den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen …« (Matthäus
6,1). Warum sagt Jesus zwei solch widersprüchliche Dinge?
Der Kontext kann uns den Unterschied der beiden Aussagen deutlich
machen. In der ersten Aussage wird der Gedanke ausgedrückt,
dass wir so leben sollen, dass Menschen Gott in uns erkennen können.
Die Betonung liegt darauf, dass wir einzigartige, von Jesus
geprägte Beziehungen zu Menschen haben und uns in bestimmten
Situationen anders verhalten.
Der Kontext der zweiten Aussage Jesu hat zu tun mit un seren
»frommen« Aktivitäten: spenden, beten und fasten. Jesus hat
nicht gesagt, dass wir diese Dinge nicht tun sollen. Er befiehlt
sie uns vielmehr. Was er sagen wollte, war, dass wir sie nicht an
die große Glocke hängen sollen. Warum denn nicht? Es kommt
entscheidend auf die Motive unseres Herzens an. Wenn meine
christlichen Aktivitäten das sichtbarste Element meines christlichen
Glaubens darstellen, dann bin ich wahrscheinlich dabei,
mich selbst dadurch zu verherrlichen. Und ich verbreite damit
ein falsches Gottesbild. Dieses falsche Gottesbild bewirkt, dass
Außenstehende niemals Lust bekommen werden, auch Christen
zu werden: Wer verzichtet schon gerne auf Nahrung, gibt gerne
sein Geld an andere oder verbringt gerne seine Zeit auf den Knien
im Gebet, und das alles, um in einen Himmel zu kommen, der
einem vielleicht noch nicht einmal gefallen wird? Wir tun dem
Evangelium großes Unrecht, wenn wir versuchen, unseren Glauben
dadurch zu bezeugen, dass wir unsere moralischen Forderungen
öffentlich verkündigen, unsere gemeindlichen Aktivitäten
jedermann vorzeigen oder unser geistliches Leben ge -
nauestens beschreiben. Wenn sich jetzt noch jemand finden
sollte, der von dieser Idee begeistert wäre, würde er wahrschein
73
lich denken: Vielleicht sollte ich auch Christ werden, aber woher
würde ich die Zeit dafür nehmen?
Von Gnade und Wahrheit erfüllt
Was ist denn nun wirklich ein gutes Zeugnis? Ein Mensch mit
einem guten Zeugnis ist jemand, der den Charakter Gottes verkörpert.
»… wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, […] voller
Gnade und Wahrheit« (Johannes 1,14). Welch eine anziehende und
überzeugende Person war Jesus! Keine gesetzliche Karikatur, sondern
das Abbild der Person Gottes! Ich glaube, wirklich Gott verherrlichen
heißt, Gottes Person mit dem ganzen Leben zu offenbaren.
Gnade und Wahrheit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit,
das sind untrennbare Eigenschaften Gottes. In Epheser 4,15 wird
uns gesagt, dass auch Wahrheit und Liebe untrennbar zusammengehören:
»… sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe …« Wahrheit
ohne Liebe zerstört, Liebe ohne Wahrheit betrügt.
Sich als Söhne der Wahrheit verhalten
Selbst Jesu Feinde erkannten an, dass Jesus sich der Wahrheit verschrieben
hatte. Eines Tages, bevor sie ihm eine Fangfrage stellten,
sagten sie zu ihm: »Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und
den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst,
denn du siehst nicht auf die Person der Menschen …« (Matthäus
22,16). Als Glieder am Leib Christi sind wir berufen, Christus
nachzuahmen und wie er wahrhaftig zu sein. Petrus schreibt
über Jesus, dass kein Trug in seinem Mund gefunden wurde
(1. Petrus 2,22). Warum sollte ein guter Zeuge in der Wahrheit
leben? Zum einen, weil alle unsere gesellschaftlichen und so zialen
Probleme, wie zerrüttete Ehen, Armut etc., von unserem E goismus
und unserer Habgier herrühren. Die Probleme beginnen in den
74
Herzen der Menschen; deshalb muss die Lösung der Probleme
auch dort ansetzen. Das Gegenteil von Egoismus bewirkt, dass man
das Richtige und Gute tut, selbst wenn das Nachteile und Leiden
nach sich zieht (vgl. Psalm 15). Das heißt »in der Wahrheit leben«.
Unsere Welt braucht solche wahrhaftigen, integren Männer und
Frauen unbedingt. Und wenn diese Wahrhaftigkeit und Rechtschaffenheit
im Volk Gottes nicht zu finden ist, wo sonst sollte man
sie denn finden? Wenn der Christ diese Wahrhaftigkeit vorlebt,
zeigt er damit der Welt, dass es eine andere, bessere Art gibt, das
Leben zu gestalten.
Die Gnade
Wir können Gottes Gnade nur in unseren Beziehungen zu an deren
Menschen weitergeben. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie
viel Bedeutung Jesus unseren Beziehungen mit anderen Menschen
beigemessen hat? Als man Jesus bat, das größte Gebot zu nennen,
sagte er, dass sich das ganze Gesetz in zwei Sätzen zusammen fassen
lässt (bei beiden geht es um eine Beziehung): »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. […] Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst« (Matthäus 22,37-39).
Sehr vieles, was Jesus in der Bergpredigt sagte, beinhaltet im
Wesentlichen den Aufruf, »heilsame« Beziehungen zu anderen
Menschen einzugehen, Beziehungen, in denen man das Wohl und
das Heil des anderen im Auge hat. Hier einige Sätze aus der Bergpredigt:
»Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht
töten; wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen
sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder ohne Grund
zürnt, wird dem Gericht verfallen sein; wer aber irgend zu seinem
Bruder sagt: Raka!, wird dem Synedrium verfallen sein;
75
wer aber irgend sagt: Du Narr!, wird der Hölle des Feuers verfallen
sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und
dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so
lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne
dich mit deinem Bruder; und dann komm und bring
deine Gabe dar. Einige dich schnell mit deinem Widersacher,
während du mit ihm auf dem Weg bist; damit nicht etwa der
Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich
dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst.
[…] Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon
Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. […] Ihr habt
gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich
aber sage euch: Widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich
auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin;
[…] Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von
dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage
euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist;
[…] Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater
vollkommen ist« (Matthäus 5,21-25.28.38-39.42-45.48).
Das sind schwer verständliche Aussagen Jesu. Man kann sie
anscheinend unmöglich in die Praxis umsetzen. Aber so erscheint
Gottes Gnade immer – als absolut unmöglich, genau entgegengesetzt
dem, was wir instinktiv als richtig »erkannt« haben, egal ob
es sich um die Erlösung aus Glauben oder aufgrund von Werken
handelt, um unfaires oder faires Verhalten im Alltagsleben.
Die Gnade ist von Natur aus das, was der Mensch am wenigsten
verdient hat. Auf dieser Basis fängt Gott seine Beziehung mit uns
an, und er will, dass wir auch mit unseren Mitmenschen auf diese
gnädige Weise umgehen. Einsicht in diese Wahrheit der Gnade
Gottes – so, wie wir sie empfangen und weitergeben – könnte der
Anfang eines geistlichen Wachstumsprozesses werden. So wie Pau
76
lus es formulierte: »… wie es [= das Evangelium] auch in der ganzen
Welt Frucht bringend und wachsend ist, wie auch unter euch,
von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit
erkannt habt« (Kolosser 1,6).
Alle unsere natürlichen Neigungen widersetzen sich dieser großen
Wahrheit. Paul Tournier, der Schweizer Psychiater und Autor,
hat festgestellt, dass wir uns selbst gegenüber gerne Gnade walten
lassen und dass wir für unsere eigenen Schwächen sehr viel Verständnis
haben (zum Beispiel: »Ich habe Übergewicht, weil das
bei uns in der Familie liegt.«), während wir andere auf gerade solche
Dinge aufmerksam machen und sie zur Rechenschaft ziehen
(»Warum kann er beim Essen keine Disziplin üben?«).13
Wir
müssen das genau umdrehen. Vielleicht beinhaltet der Begriff
»Be kehrung« zum Teil eine solche radikale Kehrtwendung. Damit
so etwas passieren kann, müssen wir versuchen zu verstehen,
warum ein anderer Mensch so und nicht anders ist, und dann entsprechend
nachsichtig und gnädig sein (während wir uns selber für
unser Verhalten zur Verantwortung ziehen sollten). Das ist die Botschaft
des 18. Kapitels des Matthäusevangeliums, des Ka pitels über
die Vergebung: »… hättest nicht auch du dich deines Mit knechtes
erbarmen sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe?«
(Matthäus 18,33). Die letzten Verse dieses Kapitels enthalten eine
Warnung an uns:
»Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern,
bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. So wird auch mein
himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder
von Herzen vergebt« (Matthäus 18,34-35).
Unbarmherzige Worte zum Thema »Vergebung«! Wie ist das
möglich? Ich frage mich, ob Jesus nicht damit sagen will: »Wenn
ihr nicht vergebt, wenn ihr in euren Beziehungen mit euren Mitmenschen
nicht Gnade walten lässt, ist das ein sicheres Indiz, dass
ihr die Bedeutung des Kreuzes niemals verstanden habt!«
13 P. Tournier, The Person Reborn, New York, Harper and Row, 1966, S. 128-129.
77
Wenn wir freundlich und wohlwollend behandelt werden, können
wir am eigenen Leib erfahren, was Erlösung und Befreiung von
Schuld bedeuten. Sind Sie jemals akzeptiert und verstanden worden,
als Sie das genaue Gegenteil erwartet und verdient hatten? Das
ist eine überwältigende Erfahrung. Umso besser, wenn Sie selber
mit einem anderen so gnädig umgehen.
Wir können also abschließend sagen, dass ein »guter Zeuge«
ein Mensch ist, dessen Lebensqualität ihn als Kind seines himm -
lischen Vaters, voller Gnade und Wahrheit ausweist. Wie sein
himm lischer Vater übt dieser Mensch einen positiven, heil samen
Einfluss auf seine Um gebung aus, angefangen bei dem en geren
Kreis seiner Familie bis hin zu dem Menschen am Rande, zu
seinen Feinden.
78
12. Eine attraktive Alternative anbieten
Das Christsein praktisch vorleben
Wie wir festgestellt haben, übt der gute Zeuge Christi einen heilsamen
Einfluss auf seine Umgebung aus. Wo immer er auch hingeht,
sät er Leben und Hoffnung statt Verzweiflung, Konflikte oder
Tod. Als solch ein Zeuge Christi ist er die wichtigste Person in
unserer Gesellschaft. Jesus nennt ihn »Salz der Erde«, »Licht der
Welt« und »guter Same« (siehe Matthäuis 5,13-14; 13,38). Er ist eine
einzigartige Ausnahme in einer Welt, die jegliche Orientierung verloren
hat.
Eines Tages (zu dieser Zeit wurde gerade der Watergate-Skandal
aufgedeckt) musste ich nach Washington fliegen. Ich war so vertieft
in ein Buch über Politik, dass ich den neben mir sitzenden Mann
gar nicht bemerkte. Meine Lektüre schien ihn sichtlich zu interessieren,
denn er fing ein Gespräch mit mir darüber an. Ich erfuhr,
dass er von Beruf Anwalt für Arbeitsrecht war.
Wir kamen dann auch auf die Watergate-Affäre zu sprechen. Ich
fragte ihn, was seiner Meinung nach die grundlegenden Ursachen
dafür wären. Er nannte zwei Gründe: die Unfähigkeit der Politiker
zu regieren und den Verlust des Kontakts zum Mann auf der
Straße.
Ich erwiderte ihm, dass es in meinen Augen mindestens noch
einen weiteren Grund gäbe, und das wäre das Fehlen von absoluten
moralischen Wertmaßstäben. Da er nicht verstand, was ich sagen
wollte, erläuterte ich mein Argument anhand eines Beispiels.
Zu Beginn der 1960er-Jahre haben mehrere Restaurant-In haber
in Kalifornien angefangen, Oben-ohne-Kellnerinnen ein zustellen.
Die Bewohner dieser Gegend strebten einen Prozess wegen un -
moralischen Verhaltens an. Sie gewannen vor dem Gericht des US-
Bundesstaates Kalifornien. Die Restaurantbesitzer legten beim
Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten Berufung ein. Das
79
erste Gerichtsurteil wurde widerrufen, und damit bekamen die
Restaurant-Inhaber die Genehmigung, weiter diese Oben-ohne-
Kellnerinnen zu beschäftigen.
Ich wies meinen Gesprächspartner darauf hin, dass das Be -
unruhigende an der ganzen Sache das Argument sei, aufgrund
dessen die Restaurantbesitzer den Prozess gewonnen hatten. Das
Gerichtsurteil des Obersten Gerichtshofs (zusammen mit ähnlich
gelagerten Fällen) schuf im US-Recht einen Präzedenzfall, der das
gesamte Gesellschaftssystem untergräbt. Die Besitzer gewannen
den Prozess mit dem Argument: »Einige der führenden Persönlichkeiten
der Stadt besuchten die Restaurants. Da man davon aus -
gehen kann, dass diese Personen die moralischen Wertmaßstäbe
der ganzen Stadt widerspiegeln, und da es die Bürger einer Stadt
sind, die die Wertmaßstäbe festlegen, ist es also rechtmäßig, was
in den Restaurants geschieht, weil es von den Bürgern akzeptiert
wurde.«
Wenn wir diesem Argument erst einmal zugestimmt haben,
dass es Sache der Bürger ist, zu entscheiden, was recht oder unrecht
ist, dann haben wir dem totalen Relativismus Tür und Tor geöffnet.
Um das Ganze auf die Spitze zu treiben: Mit demselben Argument
könnten die führenden Bürger einer Stadt auch entscheiden, dass
sie keine Spanisch sprechenden Leute oder andere Volksgruppen
mögen, und hätten damit sogar eine Rechtfertigung, sie zu töten!
Zurück zu »Watergate«: Die Angeklagten haben immer wieder
gesagt, dass sie nur getan haben, was dem Ziel dienen sollte, Präsident
Nixon im Amt zu halten. Wenn es einmal dahin gekommen
ist, dass »Recht« genannt wird, was immer zur Erreichung eines
Ziels zweckdienlich ist, dann führt das zur Auflösung von Recht
und Ordnung. Mein Nachbar und ich dachten eine Weile über die
verheerenden Folgen einer Gesellschaft ohne absolute Werte nach.
Die nun folgende Frage musste so gestellt werden: »Welche absoluten
Werte würden Sie denn vorschlagen?« Ich sagte ihm, dass ich
Christ sei. Da er nicht verstand, was das mit unserem Thema zu
tun hatte, holte ich weiter aus: »Nehmen wir für einen Augenblick
80
an, dass Sie und ich Christen seien. Das würde bedeuten, dass wir
beide an einen Gott glauben würden, der dann für uns ein Absolutum
wäre?« Er stimmte zu. »Aber selbst wenn es Gott gäbe, würde
uns das nicht viel bringen, wenn er uns nicht gesagt hätte, warum
wir überhaupt leben. Genau das sagt uns aber die Bibel: Sie ist
Gottes Wort, und sie kann uns den Sinn unseres Lebens deutlich
machen. So hätten wir – Sie und ich – also als Christen einen absoluten
Maßstab: Gott und sein Wort. Das wäre doch eine echte Basis
für unser Handeln, oder?«
Diese Gedanken führten uns in ein interessantes und angeregtes
Gespräch über Jesus Christus.
Es ist eine Tatsache, dass sich der Mensch in einer Gruppe nicht
ohne moralische Wertmaßstäbe entfalten kann. Das trifft auch auf
das Leben des Einzelnen zu, auch wenn es dort weniger augen fällig
wird. Während eines kurzen Aufenthalts in den USA vor einigen
Jahren zogen wir als Familie in eine neue Stadt. Zu unseren ersten
Freunden gehörte ein junges Ehepaar, das ein paar Häuser weiter
in derselben Straße wohnte. Bei einem gemeinsamen Abend essen
erzählten meine Frau und ich ihnen, dass wir vorhatten, einige
unserer Nachbarn einzuladen. Wir wollten mit ihnen im Licht der
Bibel über ähnlich gelagerte Probleme wie Ehe, Familie oder andere
Beziehungen sprechen. Sie waren begeistert. Der Mann sagte: »Ich
glaube, dass jeder in diesem Wohnbezirk bereit wäre zu kommen.
Der Grund: Keines dieser Ehepaare ist wirklich ›glücklich‹.«
Wir leben tatsächlich in einer neurotischen Gesellschaft. Es gibt
überall Probleme und Spannungen, der Einzelne stellt sich »Überlebensfragen«:
»Wie gehe ich mit Gefühlen von Sinnlosigkeit und
Unsicherheit um?« »Wie kann ich diese Ehefrau ertragen?« »Was
soll ich mit meinen Kindern machen?«
Weder unsere Soziologen noch unsere Philosophen haben Antworten
auf solche existenziellen Fragen. Die existenzialistische
Philo sophie, die sich eingehend mit unserer Zeit beschäftigt hat,
sagt uns, dass alle Ideologien gefährliche Illusionen sind. Sie und
andere mit ihnen kamen zu dem Schluss, dass es auf die grund
81
legenden, entscheidenden Fragen des Menschen keine wirk lichen
Ant worten gibt. Mit dieser These kommen sie der Wahrheit so
nahe, wie ein Nichtchrist der Wahrheit nahekommen kann. In
Jesaja 50,11 sagt Gott: »Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet,
mit Brand pfeilen euch rüstet: Hinweg in die Glut eures Feuers und
in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt! Das geschieht euch von
meiner Hand; in Herzeleid sollt ihr daliegen.«
Als Jesus sagte: »Ich bin die Wahrheit« (vgl. Johannes 14,6), war
das wirklich eine gute Nachricht. Er ist die Mitte unseres Lebens.
Von ihm her ist es dem Christen möglich, mit Zuversicht durch die
Kartenhäuser menschlicher Philosophien einen geraden Weg zu
gehen. Wenn der Christ in dem Licht und in der Wahrheit lebt, die
Jesus Christus selber ist, dann ist er eine Nachricht Gottes an die
Welt, die zeigt, dass es eine echte Alternative gibt.
82
13. Einheit von Glaube und Leben
Das Wertsystem der Christen
In Epheser 5,8 lesen wir: »Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber
seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als Kinder des Lichts …«
»Licht sein« erfordert eine Übereinstimmung, eine Harmonie
zwischen Gottes Wegen und unseren eigenen Wegen. Diese Harmonie
wird jedoch ständig von den unterschwelligen, oft kaum zu
erfassenden Einflüssen bedroht, die unsere Gesellschaft auf uns
ausübt. Jesus nahm in seinen Ausführungen über den Sauerteig auf
diese Bedrohung Bezug. Er warnt seine Jünger: »… hütet euch vor
dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer« (Matthäus 16,6), und:
»Gebt acht, hütet euch vor dem Sauerteig […] des Herodes« (Markus
8,15). Der Sauerteig ist ein Bild für die menschliche Unvollkommenheit
(vgl. 2. Mose 12,15-20; 13,3-8; 3. Mose 2,11; 1. Korinther
5,6-8). Jesus warnt uns davor, unvollkommene menschliche
Ideen und Vorstellungen mit Gottes Wahrheit zu vermischen und
zu verwechseln. Die Pharisäer konnten nicht mehr unter scheiden
zwischen ihrer eigenen religiösen Tradition und dem, was die
Schriften wirklich sagten. Die Sadduzäer waren die Philosophen
der jüdischen Gesellschaft, und Herodes stand für das weltliche
System. Es scheint fast unvermeidlich, dass sich diese drei Einflussbereiche
– Tradition, Philosophie und Gesellschaft – einen Weg
in das Wertsystem jeder christlichen Gemeinschaft bahnen. Diese
Einflüsse sind so subtil, dass ein Christ es nicht einmal bemerken
muss, wenn er fast ganz nach heidnischen Wertmaßstäben lebt.
Ich kam zu dieser Erkenntnis, als wir nach Brasilien in eine
völlig andere Kultur übersiedelten. Wir merken nichts von kulturellen
Unterschieden, solange wir nicht der einzigen Kultur, die
wir wirklich kennen, den Rücken kehren. Ein Fisch bemerkt das
Wasser nicht, in dem er schwimmt. Und so wissen auch wir nichts
von unserer Kultur und von dem Einfluss, die sie auf unsere Ge -
83
danken und unser Verhalten ausübt. Oft müssen wir erst einmal
aus un serem eigenen Kulturkreis heraustreten, um ihn und uns
selbst zu verstehen.
Ich habe mittlerweile erkannt, dass jeder, der kulturelle Grenzen
überschreitet, ähnliche Erfahrungen macht. Einer meiner Freunde,
Bob Malcolm, der viele Jahre auf den Philippinen als Missionar
tätig war, sagte mir einmal: »Die meiste Zeit auf den Philippinen
habe ich damit verbracht, herauszufinden, was an meinem Glauben
von Amerika oder von den Philippinen geprägt war und was wirklich
christlich war. Ich kam zu dem Schluss, dass das meiste zu den
beiden ersten Kategorien gehörte.«
Je mehr wir in die brasilianische Kultur hineinwuchsen, desto
klarer wurde uns, woher unser Wertsystem stammte. Ich war entsetzt,
als ich entdeckte, dass mein sogenanntes »biblisches Christentum«
gar nicht biblisch, sondern kulturell geprägt war. Meine Einstellung
zur Arbeit und zu materiellen Dingen entstammte einem
kulturellen Zerrbild der puritanischen Arbeitsmoral. Meine Denkweise
und meine Art, Probleme zu lösen, waren geprägt von der
Computerrevolution. Die moderne Marktwirtschaft und das Konsumdenken
hatten einen Einfluss darauf, was für mich Fortschritt
war und woran ich ihn maß. Die Werbung und das Fernsehen hatten
dazu beigetragen, welchen Lebensstandard ich haben wollte.
Ich entdeckte, dass ich als Erbe der US-amerikanischen Geschichte
einen größeren Hang zur Gewalt hatte als die Leute, denen ich das
Evangelium weitersagen wollte. Meine Vorstellungen von Kindererziehung
waren vom Humanismus beeinflusst. Selbst die Frauenbewegung
und die Beatles hatten Auswirkungen auf mein Leben.
Was für ein Schock, als ich bemerkte, wie zusammengewürfelt
mein sogenanntes biblisches Christentum war! Mein Christsein
war nichts anderes als eine Subkultur.
Als mir dies klar wurde, fragte ich mich: Will ich meinen brasilianischen
Freunden eine Botschaft der Subkultur bringen? Ich war
der Meinung gewesen, ich müsste mein Christentum »brasilianisieren«.
Aber dann bemerkte ich, dass das nur wieder eine andere
84
christliche Subkultur hervorbringen würde, denn alle menschlichen
Systeme sind unvollkommen.
Zu dieser Zeit fiel mir beim Bibelstudium immer wieder der
Begriff »Reich Gottes« ins Auge. Für mich gehörte dieses »Reich«
zu den Themen in der Bibel, die ich am liebsten übersprang. Es
schien so weit entfernt und gehörte zu den abstraktesten biblischen
Wahrheiten. Aber dann fing ich eines Tages aus irgend einem
Grund an, dieses Wort »Reich«, sooft es mir in der Bibel be gegnete,
zu unterstreichen. Das machte ich zwei Jahre lang, ohne zu wissen
warum. Wenn ich versuchte, jemandem zu erklären, was ich
an diesem Punkt lernte, war ich jedes Mal sprachlos – ein si cheres
Zeichen dafür, dass ich die einzelnen Puzzleteile noch nicht zu -
sammengebastelt hatte. Ich bat Gott, mir an diesem Punkt Klarheit
zu schenken, denn ich hatte jetzt auf fast jeder Seite der Bibel diesen
Begriff »Reich« gefunden. Ein derart vorherrschendes Thema
musste doch von großer Bedeutung sein!
Dann endlich erkannte ich, dass es eine dritte Alternative gibt:
weder ein US-amerikanisches noch ein brasilianisches Christentum,
sondern ein Christentum, das sich aus der Lebensweise des
Reiches ergibt, der Kultur des Reiches Gottes! Nicht eine menschliche,
unvollkommene, soziale oder politische Ordnung, sondern
das weltweite und vollkommene Reich Gottes, ein total
neuer Lebensstil! Und diesen Lebensstil hatte Gott auf wunderbare
Weise für sein Volk vorbereitet! Wenn wir uns diese einzigartige
Reich-Gottes-Kultur zum Ziel setzen, dann kommen alle
unsere Un gereimtheiten, alle Bereiche, die bis dahin vom heilsamen
Umwandlungsprozess ausgeschlossen waren, zum Vorschein.
Keine andere biblische Wahrheit unterstreicht so sehr die
radikale Besonderheit des christlichen Lebensstils wie die Lehre
vom Reich Gottes.
Als Jesus von diesem Reich sprach, nahm er auch Bezug auf die
Gefahren des Sauerteigs. Wie kommt dieser Sauerteig zustande? In
Markus 7,6-13 beschreibt Jesus die einzelnen Etappen, wie er entsteht.
Er zeigt uns, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der
85
oft mit einer guten Idee beginnt. Diese gute Idee ist sogar so gut,
dass wir übereinkommen, sie zur Norm, zur Regel zu erheben.
Daraus folgt, dass eine menschliche Idee genauso viel Gewicht wie
das Wort Gottes bekommt.
Auf der nächsten Stufe wird das Wort Gottes vernachlässigt,
während die gute Idee beibehalten wird. Mittlerweile hat sich
aus der guten Idee eine Tradition entwickelt. Bald gefällt uns die
Tradition besser als das Wort Gottes, so wird sein Wort beiseitegeschoben.
Schließlich hat sich der Kreis geschlossen: Die Tradition
tritt an die Stelle des Wortes Gottes. Jesus sagt: »… indem ihr
das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr
überliefert habt …« (Markus 7,13). Das tritt immer dann ein, wenn
sich unsere religiösen Traditionen gegen den Willen Gottes richten.
Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wollen wir
eine der segensreichsten und beliebtesten Einrichtungen der US-
amerikanischen Gemeinden betrachten: die Sonntagsschule. Ur -
sprünglich war die Sonntagsschule eine glänzende Idee. Sie war
eingerichtet worden, um Kindern nichtchristlicher Eltern, die zu
Hause das Evangelium nicht hören konnten, biblischen Unterricht
zu erteilen. In der ersten Zeit haben christliche Eltern, die etwas
auf sich hielten, ihre Kinder nicht zur Sonntagsschule geschickt.
Das wäre ja einem Eingeständnis ihres Versagens gleich gekommen.
Sie wären als Eltern angesehen worden, die ihrer Verantwortung,
ihre Kinder im Sinn von 5. Mose 6,6-7 zu unterrichten, nicht nachgekommen
wären: »Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen
auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen
und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn
du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du
aufstehst.« Aber der Segen der Sonntagsschule zeigte sich bald so
deutlich, dass die christlichen Eltern ihre Meinung änderten. Bald
ließ es sich ein christliches Ehepaar, das etwas auf sich hielt, nicht
nehmen, ihre Kinder zur Sonntagsschule zu schicken.
Der nächste Schritt ist voraussagbar: Der Vater versäumt seine
von der Bibel geforderte Verantwortung, seine Kinder in Gottes
86
Wort zu unterweisen, und verlässt sich an diesem Punkt ganz auf
die Gemeinde. Das ist aber eine Pflicht, die eine Gemeinde schlicht
nicht erfüllen kann – sie ist Aufgabe der Eltern. Die Sonntagsschule
kann einen Beitrag leisten, aber sie kann nicht die Aufgabe übernehmen,
die allein dem Vater zukommt.
Wir finden hier die einzelnen Stufen wieder, die Jesus in Markus
7 anspricht. Wenn der Vater seiner Verantwortung nicht
nachkommt, rennt er in sein eigenes Unglück. Der Wunsch, ein
glaubwürdiges Leben als Christ zu führen und eine tiefere Bibelerkenntnis
zu bekommen, verschwindet langsam, aber sicher. Und
damit auch die Fähigkeit, seine Kinder zu lehren. Wenn der Vater
die Verantwortung für seine Familie abgibt, kann er leicht vom
Weg des Glaubens abkommen.
Wenn es etwas gibt, was mich anspornt, mein geistiges und
geistliches Leben zu kultivieren, dann ist das die Erkenntnis, dass
meine Kinder und Kindeskinder alles übernehmen, was ich denke
und tue. Unsere Heiligung erscheint von dieser Warte aus als etwas
Sinnvolles (vgl. 5. Mose 4,39-40).
Also wie kommt es, dass sich Ungereimtheiten wie ein Sauerteig
immer wieder in unser Christsein einschleichen? Um es
noch einmal zusammenzufassen: Die gute Nachricht wird in Ver -
halten umgesetzt, und dieses Verhalten wird zur Gewohnheit. Die
Gewohnheit wird zur bloßen Sitte und dadurch zur Form ohne
Inhalt. Genauso kann der Glaube zum bloßen Glaubensbekenntnis
werden und im bloßen Lippenbekenntnis enden.
Was hat das Ganze nun mit dem Erreichen Fernstehender zu
tun? Sehr viel sogar. Ein Leben, in dem Leben und Glaube übereinstimmen,
eine Einheit bilden, ist der Schlüssel zu einem natürlichen
Weitergeben der Botschaft. Und Natürlichkeit ist das Ge -
heimnis, wie aus einem abstoßenden ein anziehendes Zeugnis wird.
Aber da, wo unser Leben nicht mit unserem Glauben über -
einstimmt, müssen wir uns verstellen, um unsere Botschaft an den
Mann zu bringen. Wir müssen uns der Frage stellen: Woher beziehe
ich meine Ansichten über Geld, Erfolg, Ehe, Kinder erziehung,
87
Berufsleben, Zeiteinteilung, Sexualität, Menschen, Vergnügen,
Bildung, Fortschritt, Gesellschaft, Sport, Politik, Verbände, Religion?
Habe ich überhaupt irgendwelche biblisch fundierten Überzeugungen?
Es ist nicht zu vertreten, dass ein Christ seine Wertmaßstäbe
von der Welt entleiht. Paulus fordert uns in Römer 12,2
deutlich auf:
»Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt
durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen
mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille
Gottes ist.«
Wenn wir wirklich sagen können, dass alle unsere Wertmaßstäbe
auf Gottes Wort beruhen, dann wird es in allen Bereichen un seres
Lebens unendlich einfacher, unseren Glauben anderen weiterzugeben.
Wenn wir irgendein Thema tief genug besprechen, wird
es uns schließlich zum Evangelium führen. Wir müssen jederzeit
bereit sein, anderen zu erklären, warum wir so sind, wie wir sind
(vgl. 1. Petrus 3,15). Als ich gerade Christ geworden war, versuchte
ich meinen Freunden meinen Glauben zu bezeugen – wusste
aber nie, wie ich den Einstieg in das Gespräch bekommen sollte.
Ich wusste fast nie, was ich sagen sollte. Ich fing an, mir mögliche
»Einstiegsfragen« in einem Buch zu notieren. Diese Fragen wollte
ich stellen, um zum Thema zu kommen. Unter an derem waren
es Fragen wie: »Gab es einen Zeitpunkt in Ihrem Leben, an dem
Sie ernsthaft daran gedacht haben, Christ zu werden?« »Wie hat
Ihnen die Predigt gefallen?« »Interessieren Sie sich für geistliche
Dinge?« – Solche Fragen können eine Hilfe sein. Aber meistens
schlagen sie auf mich zurück. In einem ganz normalen Gespräch
versuchte ich, diese Fragen wie »zufällig« einzuflechten. Und von
diesem Punkt an wurde alles unnatürlich. Mein »Opfer« verkrampfte
sich und fühlte sich ebenso unwohl und nervös wie ich.
Dann fing ich in dieser »spannungsgeladenen« Atmosphäre an,
das Evangelium darzustellen. Das ganze Gespräch war ebenso un -
88
natürlich wie die Einstiegsfrage. Ich bedrängte meinen Gesprächspartner
hart mit dem Angebot des ewigen Lebens und erzählte
ihm ganz vage von einer Freude schon hier auf Erden. Da, wo der
Glaube nicht mit unserem Leben übereinstimmt, können wir nur
solche vagen Angaben über das Christsein machen. Wir haben ihm
kein besseres Leben anzubieten als das, was er schon hat. Selbst das
Angebot des ewigen Lebens besitzt keine besondere Anziehungskraft
für ihn. Er hat schon jetzt seinem irdischen Leben gegenüber
gemischte Gefühle: Er liebt und hasst es gleichzeitig, aber er findet
es nicht attraktiv genug, um es ewig fortzusetzen.
Vor einigen Jahren war ich für mehrere Wochen von zu Hause
fort. Da ich ständig mit Menschen zu tun hatte, war es mein sehnlichster
Wunsch, eine Weile allein zu sein. Als ich dann ins Flugzeug
kam, wählte ich einen Platz am Gang. Der mittlere Sitz war
nicht belegt, und am Fenster saß eine junge Frau. Schon vor dem
Abflug vertiefte ich mich absichtlich in ein Buch. Ich wollte mir
damit Leute vom Hals halten. Aber meine Reisegefährtin wollte
unbedingt mit mir reden. Sie fragte: »Was lesen Sie denn da?« –
»Ein Buch«, antwortete ich.
»Wie heißt es?« – »›Psychokybernetik‹ von Maxwell Maltz.« –
»Studieren Sie Psychologie?« – »Nein.« Die Unterhaltung war einsilbig.
Jetzt heulten die Flugzeugmotoren los, und wir fuhren auf
die Piste. Meine Nachbarin ließ sich nicht entmutigen. Ich hatte
eine Erkältung und konnte fast nichts verstehen. Schließlich legte
ich mein Buch beiseite und setzte mich auf den freien Platz neben
sie, und wir fingen an, uns zu unterhalten. Ich merkte sehr bald,
dass sie eigentlich nur auf Partnersuche war. Ohne Umschweife
sagte ich: »Ich bin viel auf Reisen und fühle mich oft einsam. Ich
bin vielen Versuchungen ausgesetzt, meiner Frau untreu zu werden.
Aber ich habe mich entschieden, dass es sich nicht lohnt. Ich weiß,
dass ich sie betrügen könnte, aber die Basis unserer Be ziehung ist
Liebe und Vertrauen. Sie vertraut mir, und ich vertraue ihr. Mir ist
im Laufe meines Lebens klar geworden, dass der Sinn des Lebens
weder in Dingen liegt, die man heimlich tut, noch in größeren Leis
89
tungen, noch in einer beruflichen Position, noch in der Freizeitgestaltung.
Ich habe entdeckt, dass eigentlich erst die Be ziehungen
zu anderen Menschen Sinnerfüllung geben. Aus diesem Grund
möchte ich auch nicht die beste Beziehung, die ich zu einem Menschen
habe, zerstören. Selbst wenn meine Frau es nicht bemerken
würde, dass ich ihr untreu gewesen bin, und es mir gelingen würde,
es vor ihr zu verbergen, dann würde ich es doch immer noch wissen.
Sie würde mir mit blindem Vertrauen begegnen, und ich wäre
gezwungen, mich auf die eine oder andere Weise von ihr zu distanzieren.
Wir würden auseinandergetrieben, und sie würde niemals
wissen, warum. Bald würden wir dann wie Fremde unter
einem Dach leben. Diejenigen, die es das meiste kosten würde,
wären meine Frau und meine Kinder. Das wäre wirklich der Gipfel
an Egoismus.«
Meine Gesprächspartnerin war wie vom Donner gerührt. Dann
erzählte sie aus ihrem eigenen Leben: »Ich bin 24. Ich sollte ans
Heiraten denken, aber alle meine verheirateten Freunde haben
noch außereheliche Beziehungen. Wenn so die Ehe aussieht, habe
ich kein Interesse. Wenn meine Freundinnen am Wochenende verreisen,
dann kommen ihre Ehemänner zu mir. Sie sind wie kleine
Jungs. Ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, wenn mein Mann
auch so wäre.« Und dann sagte sie: »Ich habe noch nie solche
Gedanken wie Ihre gehört. Woher haben Sie die?« – »Sie würden
lachen, wenn ich es Ihnen sagen würde.« – »Das werde ich nicht
tun.« – »Sie kommen aus der Bibel«, antwortete ich.
Ich versuchte, ihr die christliche Botschaft zu erklären: wie
dadurch Menschen verändert werden und sie ihr Leben in Ordnung
bringen können. In diesem Augenblick setzte das Flugzeug
zur Landung an. Wie schade! Wir waren noch mitten in der Er -
klärung. Sie war brennend an allem interessiert, was ich sagte, aber
wir mussten uns trennen.
Einige Zeit später, als ich aus dem Flughafengebäude heraustrat,
sah ich sie umringt von zehn ihrer Freunde, die sie abgeholt hatten.
Das waren dieselben Freunde, von denen sie mir im Flugzeug
90
erzählt hatte. Sie winkte mir zu und stellte mich ihren Freunden
vor. Ich stand 10 Minuten bei ihnen, während sie den anderen von
unserem Gespräch erzählte. Ich fühlte mich total frustriert: Wenn
ich doch nur einige Tage mit diesen Leuten verbringen könnte!
Ich hätte vielleicht dazu beitragen können, dass ihre Dunkelheit
in Licht verwandelt würde. Ich fühlte mich unersetzbar, aber ich
musste meine Reise fortsetzen.
Gott bereitete mich auf eine noch größere Lektion vor. Gott ist
derjenige, der die Versöhnung zwischen ihm und dem Menschen
bewirkt, nicht wir. Nur ein Jahr nach dieser Begebenheit kam ich
noch einmal in dieselbe Stadt. Am Sonntagmorgen ging ich dort
in den Gottesdienst. Die Frau, mit der ich im Flugzeug gesprochen
hatte, kam auch in diese Gemeinde und setzte sich genau vor mich.
Nach dem Gottesdienst begrüßte ich sie und wollte mich vorstellen.
Das war nicht nötig. Sie rief gleich aus: »Natürlich erinnere
ich mich an Sie! Ich werde unser Gespräch nie vergessen. Dadurch
wurde mein Leben total verändert!«
Diese Geschichte zeigt, wie wir mit biblisch fundierten Wertmaßstäben
jede Unterhaltung in ein Gespräch über das Evangelium
verwandeln können.
Aber ich muss bekennen, dass ich auch heute noch mit Ängsten
zu kämpfen habe, wenn wir neue Nachbarn bekommen, wenn wir
umziehen oder wenn ich Menschen begegne, die ich nicht kenne.
Ich reagiere oft zuerst ängstlich und vorsichtig. Wie werde ich diesen
Menschen ansprechen können? Er sieht nicht aus, als würde er
Interesse haben. Ich muss mich selbst daran erinnern, dass die Barrieren
zwischen uns verschwinden, wenn wir uns näher kennengelernt
haben. Jedes Gespräch bei einem Essen oder einem ge -
meinsamen Ausflug wird uns früher oder später dahin führen, über
geistliche Dinge zu reden. Über irgendetwas würden wir sowieso
sprechen, und alle Gespräche werden schließlich bei Jesus Christus
enden.
Melker, ein Priester aus dem 1. Jahrhundert, beschreibt das folgendermaßen:
»Das Reich Gottes muss in uns beginnen, in un -
91
serem Herzen, und dort regieren; dann werden aus den Tiefen
un seres Seins die äußeren Aktivitäten in Übereinstimmung mit
den offenbarten und niedergeschriebenen Lehren und Geboten
Gottes fließen …‚ bis das Äußere dem Inneren gleich ist, und so
geht es vom Einzelnen zu den Völkern.«14
14 Brief von Melker, einem Priester aus dem 1. Jahrhundert der Synagoge von
Bethlehem, an den Hohen Sanhedrin der Juden in Jerusalem, übersetzt von
Dr. McIntosh und Dr. Twyman, The Archko Volume, New Canaan/Connecticut:
Keats Publishing Inc., 1975, S. 71-72.
92
14. Die Gefahr der Abkapselung
Wenn Absonderung zur Abkapselung wird
Martin Marty, ein Theologieprofessor von der Universität Chicago,
schreibt in einem Artikel des »Wall Street Journal« vom 11. 7. 1980:
»Wenn Sie zu einer christlichen Subkultur gehören, dann spielt sich
Ihr ganzes Leben darin ab. Sie gehen zur Gemeinde, Sie kaufen
christliche Bücher, schauen sich christliche Fernsehprogramme an.
Aber wenn Sie nicht zu dieser Subkultur gehören, dann wissen Sie
noch nicht einmal, dass es sie gibt.«
In diesem Artikel kommt zum Ausdruck, in welchem Ausmaß
sich evangelikale Christen von der Welt, in der sie leben, distanziert
haben. Die Untertitel spiegeln die Schlussfolgerung des Schreibers
wider:
• Eine Erweckung ergreift das Land, jedoch ohne nennenswerte
Auswirkung auf die Welt
• Die Christen meiden diese sündige Welt
• Angst vor dem Engagement
In einem anderen Zeitungsartikel ist zu lesen: »Die gegenwärtige
evangelikale Erweckung hat bis heute wenig mehr als Neugierde
bei den Nichtchristen hervorgerufen … Diese Bewegung hat
die US-amerikanische Gesellschaft weit weniger beeinflusst als die
große Erweckung des 18. Jahrhunderts.«
Er merkt außerdem an, dass es bei den Evangelikalen eine
Tendenz gibt, die sich historisch nachweisen lässt, sich nämlich
von jeglichem Engagement in der säkularisierten, sündigen Welt
zurückzuziehen.
Die Kluft zwischen Gemeinde und Welt wurde mir zu Beginn
meines Aufenthalts in Brasilien sehr bewusst. Kurze Zeit nachdem
Osvaldo (der Student, den meine zwei stündige Dar stellung
des Evangeliums unbewegt gelassen hatte) Christ ge worden war,
luden wir ihn ein, bei uns zu wohnen. Er lebte drei Jahre bei uns im
93
Haus. Wir profitierten voneinander: Wir lehrten ihn alles, was wir
konnten, über Nachfolge und Gehorsam gegenüber Gottes Wort.
Er lehrte uns, was er konnte, über Brasiliens Sprache und Kultur.
In dem Maße, wie Osvaldos Liebe zu Gott wuchs, wurde auch
die Beziehung zwischen ihm und mir tiefer. Er wurde mir bald zu
einem treuen Freund. Und ich fand, es wäre nun allmählich an der
Zeit, ihn mit in den Gottesdienst zu nehmen. Das war Osvaldos
erste Konfrontation mit dem Protestantismus. Alles schien gut zu
laufen. Er kam immer mit, äußerte sich aber nie darüber, wie es
ihm gefiel. Ich beobachtete, dass ihm irgendetwas Schwierig keiten
bereitete. Eines Sonntags, als wir nach Hause gingen, sagte ich zu
ihm: »Dir scheinen die Gottesdienste nicht so ganz zu gefallen,
oder?« Endlich öffnete er sich und stellte seine Fragen: »Warum
singen sie auf diese Art und Weise? Warum verändern sie ihre
Stimme beim Beten?« Und so weiter. Seine Fragen waren ernsthaft –
er suchte wirklich nach Antworten. Aber sie brachten mich
aus der Fassung. Ich versuchte ihm zu antworten, aber ich merkte,
dass es mir nur sehr schlecht gelang. Und das brachte mich ebenfalls
aus der Fassung.
Die Zeit verging, aber Osvaldos Fragen blieben bei mir hängen.
Seine Fragen bewirkten, dass ich die Gottesdienste jetzt mit den
Augen eines »Außenstehenden« sah. Ich musste zugeben, dass es auf
beiden Seiten scheinbar unüberwindliche Verständigungs probleme
gab. Ein Neuer würde sich niemals in unseren Gemeinden wohlfühlen,
es sei denn, dass er sich in seinem Lebensstil an uns anpassen
würde. Und die Gemeinden wären nicht bereit, ihn in ihre
Gemeinschaft aufzunehmen, ehe er diese Änderung nicht vollzogen
hat. Manchmal akzeptieren junge Christen diese Be dingungen
und unterwerfen sich ihnen. Das ist sogar sehr häufig der Fall.
Aber solche Veränderungen sind zweifelhafte Siege, denn sie gehen
oft auf Kosten der Verständigung mit dem früheren Bekanntenkreis
der Neubekehrten.
Wir geben es zwar nicht gerne zu, aber für Neubekehrte, die aus
einer säkularisierten Welt kommen, gibt es oft keine Gemeinde, der
94
sie sich anschließen könnten. Kulturell gesehen, trennen sie und
unsere Gemeinden Welten. Dieser Tatbestand gilt noch mehr für
die unerreichten Volksgruppen, die eine ganz andersartige Kultur
haben. Ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der so denkt.
In dem Buch »Let the Earth Hear His Voice« stellt Ralph Winter
die Frage: »Sind wir darauf vorbereitet, dass die meisten Nichtchristen,
die noch zum Glauben finden werden – selbst in un serem
Land – nicht richtig in den Stil, den wir in unseren Gemeinden
haben, hineinpassen?«15
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die Gemeinde und
die Welt so weit voneinander entfernt sind. Wir können hier an dieser
Stelle nicht ausführlich auf alle Punkte eingehen. Einige Gründe
dafür sind positiv und andere negativ. Was uns hier wichtig ist, ist
die Tatsache, dass Jesus Christus die Gemeinde in die Welt gesandt
hat und dass wir aus diesem Grund auf keinen Fall den Kontakt mit
denen in der Welt verlieren dürfen.
Kurz vor seinem Tod nennt Jesus seinem Vater seine Pläne für
die Gemeinde: »Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind
in der Welt […] sie [sind] nicht von der Welt […], wie ich nicht von
der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest,
sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. […] Wie du mich in
die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt …«
(Johannes 17,11.14-15.18). Der Grund, warum Gott uns noch in der
Welt lässt, ist, dass wir vorrangig für sie leben sollen und nicht so
sehr für uns selbst. Aber der Herr erkannte schon, als er uns diesen
Auftrag gab, vor welchem Dilemma wir stehen würden: in der Welt
leben und doch nicht von der Welt sein. Wie kann ein Christ dem
Befehl gehorchen: »Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert
euch ab« (2. Korinther 6,17), und gleichzeitig »in die Welt gesandt«
(Johannes 17,18) sein? Im Laufe der Kirchengeschichte war immer
wieder die falsche Haltung der Christen zur Welt der Konfliktherd.
15 Ralph Winter, »The Highest Priority: Cross Cultural Evangelism«, in: Let the Earth
Hear His Voice, Minneapolis: World Wide Publications, 1975, S. 221.
95
Durch die Jahrhunderte haben die Christen versucht, die Balance
zwischen diesen scheinbar widersprüchlichen Be fehlen zu halten –
das Pendel schlug mal zur einen und mal zur anderen Seite
aus, entweder waren wir so isoliert wie E remiten, oder wir haben
uns total der Welt gleichgestellt.
Keines dieser Extreme entspricht dem Plan Gottes. Totale
Gleich stellung mit der Welt verdunkelt Gottes Herrlichkeit. Ab -
kapselung macht das christliche Zeugnis unwirksam. Der Welt entgeht
etwas Entscheidendes, wenn wir uns von ihr isolieren. Wenn
wir in einem Ghetto leben, erfahren sie nie, wie eine Einheit von
Glaube und Leben aussieht.
»Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den
Scheffel« (Matthäus 5,15).
Diese Versuchung, sich abzukapseln, ist verständlich. Die Welt
birgt Gefahren in sich! »Seid nüchtern, wacht; euer Widersacher,
der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlinge« (1. Petrus 5,8).
Wir stimmen in vielen Punkten mit den Nichtchristen nicht
überein. »Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und
Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?
[…] Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Un gläubigen?
[…] Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes […] Darum
geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab …« (2. Ko rinther
6,14-17).
Bei einigen Dingen kann der Christ einfach nicht mehr mitmachen –
sie passen nicht mehr zu ihm. »Denn die vergangene Zeit
ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, […] wobei
es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben
der Ausschweifung, und sie lästern euch …« (1. Petrus 4,3-4).
Wenn man das alles in Betracht zieht, scheint es das einzig
Vernünftige zu sein, sich auf einen »Sicherheitsabstand« zurückzuziehen.
Vor einigen Jahren nahm ich an einer Tagung teil,
auf der der Referent erklärte: »Wenn der Christ klare Stellung
bezieht, zwingt er seine nichtchristlichen Freunde und Be kannten
96
zwangsläufig, sich zu entscheiden. Entweder hat das Christsein
An ziehungskraft für sie, oder es wirkt abstoßend, und das be deutet:
Sie ziehen sich zurück. Die Folge davon ist, dass der reife Christ
eines Tages ohne wirkliche nichtchristliche Freunde dasteht.« Ein
anderer Redner sagte: »In dem Maße, wie wir im Glauben wachsen,
hat unser Leben immer weniger Auswirkung auf die Welt.« Verstehen
wir eine solche Haltung unter »Sicherheitsabstand« – denken
wir, es sei eine christliche Tugend, keine nichtchristlichen
Freunde mehr zu haben? Wenn ja, ist es tragisch, denn diese Ab -
kapselung hat eine zerstörende Wirkung auf die Ortsgemeinde und
macht außerdem unsere Verständigung mit den Fern stehenden
unmöglich. Christen, die in ihrem geschlossenen Zirkel leben und
nicht einen ständigen Zuwachs von Menschen erleben, die von der
Dunkelheit zum Licht finden, fahren sich in ihren eigenen Traditionen
fest. Weil sie nicht mehr infrage gestellt werden durch
Menschen, die »frisch« aus der Welt kommen. Sie vergessen, wie es
»draußen« aussieht. Sie entwickeln eine eigene Sprache, eigene Verhaltensmuster;
und Verständigungsmechanismen tauchen auf, die
nur noch von den »Eingeweihten« verstanden werden. Auf diese
Weise wächst die Gemeinde nur noch nach innen. Dadurch entfremdet
sie sich der Welt immer mehr, und sie erscheint Außenstehenden
immer seltsamer, bis schließlich die Verständigung mit
dem Mann auf der Straße unmöglich geworden ist.
Was ist nun also ein »Sicherheitsabstand« – worin könnte ein
guter, sinnvoller Abstand zur Welt bestehen? Jesus beantwortet
diese Frage mit einer erstaunlichen Aussage in Johannes 17,17: Er
bittet seinen Vater (nachdem er seine Jünger in die Welt gesandt
hat), »sie durch die Wahrheit zu heiligen« (= für einen heiligen
Auftrag abzusondern). »Dein Wort ist Wahrheit.« In Wirklichkeit
ist die Heiligung nicht daran gebunden, wo wir uns auf der Welt
befinden, sondern sie hat etwas mit der Herzenshaltung zu tun
(wem gehört unser Herz?). Wir haben den richtigen »Sicherheitsabstand«
von der Welt, wenn wir uns ständig verändern lassen,
und zwar durch eine Erneuerung unseres Geistes durch die Wahr
97
heit von Gottes Wort. Das erfordert Zeit, die wir mit Gott allein
verbringen, wo wir unser Denken aktiv dem Wort unterwerfen.
Wenn diese Praxis nicht ein Teil unseres Lebens ist, oder wenn sie
nicht wirklich Frucht bringt, dann sind wir sehr schlecht auf Be -
gegnungen mit Nichtchristen in der Welt vorbereitet. In diesem
Fall wäre tatsächlich die Abkapselung noch die beste Lösung!
98
15. Angst voreinander
Ein Hindernis für ehrliche Beziehungen
Der Christ fürchtet sich vor dem Einfluss der Nichtchristen. Auf
der einen Seite hat er guten Grund dazu: »Schlechter Umgang verdirbt
gute Sitten!« (1. Korinther 15,33; Schlachter 2000). Auf der
anderen Seite sind diese Befürchtungen ohne Grund. Diese Art
Furcht ist gegenseitig: Der Nichtchrist hat genauso viel Angst vor
dem Christen wie dieser vor dem Nichtchristen. »Denn wir sind
für Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden,
und in denen, die verlorengehen; den einen ein Geruch vom Tod
zum Tod, den an deren aber ein Geruch vom Leben zum Leben«
(2. Korinther 2,15-16). Die Gegenwart eines Christen erinnert den
Nichtchristen an Gottes unmittelbar bevorstehendes Gericht.
Einige der Befürchtungen vonseiten der Nichtchristen sind be -
gründet, andere nicht. Aber ob nun berechtigte oder un berechtigte
Furcht, sie be hindert jede Art von Weitergabe des Evangeliums.
Denken Sie einmal darüber nach: Wenn Sie völlig frei von jeglicher
Furcht wären, was für ein Zeuge wären Sie? Selbst der
un erschrockene Apostel Paulus hatte mit Furcht zu kämpfen. Er
schrieb an die Christen in Korinth, dass er bei ihnen »in Schwachheit
und in Furcht und in vielem Zittern« (1. Korinther 2,3) war.
Er bat die Epheser, für ihn zu beten: »[Betet] für mich, damit mir
Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit
kundzutun das Geheimnis des Evangeliums« (Epheser
6,19). Die Furcht des Paulus rührte aus seinen Erfahrungen her,
er hatte im Gefängnis gesessen, war ausgepeitscht und gesteinigt
worden. Unsere Furcht ist abstrakter, aber nicht grundlos.
Die Furcht des Nichtchristen kommt zum Teil daher, dass wir
ihn an Tatsachen erinnern, an die er lieber nicht denken möchte:
Sünde, Tod und das Gericht. Andere Ängste ergeben sich da raus,
dass wir ihm das Gefühl geben, dass wir mit seinem Verhalten
99
nicht einverstanden sind. Dazu haben wir kein Recht, denn wir
sind nicht sein Richter.
Die Ängste des Nichtchristen abbauen
Christen neigen dazu, Nichtchristen anhand einer eigens dafür aufgestellten
Liste akzeptablen oder inakzeptablen Verhaltens zu be -
werten. Diese Liste von Vorschriften enthält viele ganz klare Gebote
aus dem Wort Gottes wie zum Beispiel »Du sollst nicht ehe brechen«
(2. Mose 20,14) bis hin zu traditionsgebundenen Vorschriften wie
»totale Enthaltung von Alkohol«. Der Nichtchrist weiß genau, was
der Christ über ihn denkt, und fühlt sich ver urteilt. Manchmal entschuldigt
er sich sogar für seine schlechten Gewohnheiten. Er zeigt
damit, dass er das Gefühl hat, in die Hände von jemanden ge fallen
zu sein, der ihn unbedingt um krempeln will. Solche Ver urteilungen
machen jede Ver ständigung hoffnungslos. Wie können wir dieses
Hindernis überwinden? Wie können wir eine Beziehung zu je -
manden aufbauen, dessen Sünden ihn und seine Umgebung zerstören?
Sollen wir einfach die Augen ver schließen, wenn wir es mit
jemandem zu tun haben, der seine Familie mit seinem untreuen
Verhalten kaputtmacht? Können wir vor ihm unsere negative Be -
urteilung verbergen? Was können wir tun? Schauen wir auf Jesus!
Es gelang ihm, selbst die Schlimmsten unter uns an zunehmen.
Wie? Er schaffte das, weil er ein Realist war. Er kannte den Menschen
und seinen Hang zum Bösen – er erwartete nicht das Gute
von ihm. Er wusste auch, dass die schlimmsten Taten des Menschen
nur Symptome einer tie feren und hässlicheren Sünde sind: der
Rebellion gegen Gott. Die Rebellion ist es und nicht die Unkenntnis,
die den Menschen von Gott trennt. Und diese Rebellion ist der
Ursprung aller Probleme der Menschen. Jesus hielt sich nicht lange
mit der Behandlung der Symptome auf: Er wollte die Menschen heil
machen. Wir dürfen nicht bei den äußeren Symptomen stehen bleiben,
sondern müssen auf die tiefere Not sehen. Erst dieser Blick in
100
die Tiefe be fähigt uns zu ehrlichen Be ziehungen mit Nichtchristen.
Um sie als Person akzeptieren und lieben zu können, müssen wir
ihr Handeln nicht gutheißen. Einer meiner Freunde kam aus der
alternativen Szene. Er arbeitete fast nie und nahm Drogen. Er lebte
mit einer Frau zu sammen. Wir begannen, die Bibel miteinander
zu studieren. Doch da ich nur sehr wenig Zeit hatte, lud ich ihn zu
einer Bibelgruppe ein. Die Leute in der Gruppe wollten auch Christus
kennen lernen, waren aber »bürgerlicher« und in tellektueller als
mein Freund. Unsere Gespräche gingen über seinen Kopf hinweg.
Endlich, eines Abends, ex plodierte er: »Ihr wisst ja gar nicht, wo ich
herkomme! Was ihr hier macht, sagt mir nichts!« Ich musste ihm
recht geben: Auch ich verstand ihn nicht. Er versuchte, mich zu provozieren,
und lud mich ein, seine Welt kennenzulernen. Wir trafen
uns kurze Zeit später bei seinen Freunden. Es gab viel für mich zu
lernen! Wir waren die Ersten, doch langsam, aber sicher füllte sich
der Raum. Jeder Einzelne war eine Lektion für mich. Schließlich
kam der »Anführer« der Gruppe he rein. Er sah total ungepflegt und
schlampig aus, hatte lange Haare und einen Bart, und vorne fehlten
seine Zähne. Er setzte sich hin und ver kündete: »Ich habe meinen
Job an den Nagel gehängt.« Aus der Reaktion der an deren entnahm
ich, dass er das für ihre Gesellschaft Höchste getan hatte: den
Job an den Nagel zu hängen. Das be deutete, seine Freiheit zurückgewinnen,
unangenehme Verpflichtungen zu um gehen, andere für
sich arbeiten zu lassen. Ich entdeckte langsam, wie dieser Mann der
uneingeschränkte Führer dieser Gruppe werden konnte. Er hatte
sowohl ein ab geschlossenes Studium als auch eine militä rische
Laufbahn hinter sich. Eines Tages verließ er aus einer Laune he raus
seine Frau und seinen Posten im Pentagon. Er handelte mit Drogen,
um sich ein Leben ohne Ver pflichtungen leisten zu können.
Sein ganzer Besitz bestand nur aus einem schwarzen Lieferwagen,
einem Paar Skier und zwei großen Hunden. Er hatte einen Lebensstil,
der es ihm erlaubte, sich keine tiefschürfenden Gedanken
mehr zu machen und gerade das zu tun, was ihm im Moment Spaß
machte.
101
Nachdem ich meinen Freund in seiner Welt erlebt hatte, nahm
ich ihn aus der Bibelgruppe mit den anderen heraus. Wir studierten
die Bibel bei ihm zu Hause. Da seine Freunde das wussten,
kamen sie ab und zu vorbei. Manchmal nahmen sie seine Bibel und
lasen selber darin. Seine Freundin bekam auch Interesse, setzte sich
zu uns, und ihr entging kein Wort! Aber was sollte ich mit seiner
Sünde machen? Nachdem er Christ geworden war, fingen wir an,
die Symptome für Sünde herauszuarbeiten. Das erste Problem, mit
dem wir uns beschäftigten, war seine mangelnde Ver bindlichkeit
gegenüber seiner Freundin. Glücklicherweise sind Gottes Gebote
vernünftig; sie sind nicht unsinnig oder willkürlich. Stellen wir
uns einen Menschen vor, der alle Weisheit der Welt besitzt. Wenn
wir ihn fragen würden, welche Richtlinien zum Überleben einer
Gesellschaft und welche Wertmaßstäbe zu ihrem Gedeihen er vorschlagen
würde, bin ich überzeugt, dass er auf die Zehn Gebote
käme.
Was die Bibel über Ehebruch und Ehe sagt, entspricht dem
gesunden Menschenverstand. Eines Tages, als mein Freund und
ich wieder einmal zusammen waren, beschrieb ich ihm, wie ich
die Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin sah: Sie liebten
einander sehr, sie wollten den anderen nicht verlieren, und doch
wussten sie, dass sich keiner von beiden fest binden wollte. Konsequenterweise
gaben sie vor, in einer Harmonie zu leben, die sie
nicht wirklich fühlten. Dann versuchte ich, mir die Zukunft ihrer
Be ziehung auszumalen. Wahrscheinlich würde sie damit enden,
dass sie sich nur noch etwas vorspielen, dass sie weiter so tun, als
ob sie sich lieben. Deswegen würde ihre Beziehung in der ersten
wirk lichen Krise auseinanderbrechen. Wenn es zum Bruch käme,
würden beide ihrer Wege gehen und beide sehr verletzt sein. Ich
fuhr dann fort und erklärte, wie Gott Mann und Frau in eine un -
trennbare Einheit zusammenfügen will (Matthäus 19,6). Deshalb
muss die Grundlage jeder zwischenmenschlichen Beziehung,
wenn sie von Dauer sein soll, Verbindlichkeit sein. Mein Freund
sagte nichts, aber zwei Wochen später wurden wir zu seiner Hoch
102
zeit eingeladen. Heute leben sie beide mit Christus. Wir müssen
den Nichtchristen so annehmen, wie er ist, und ihm helfen, Heilung
zu finden. Dann erst können wir ihn lehren, wie er mit Dingen,
die ihn zerstören, umgehen kann. Wenn wir diese Reihenfolge
um drehen, versuchen wir, ihn zu verändern, anstatt Gottes Heilung
anzubieten.
Umgang mit unseren eigenen Ängsten
Wir müssen handeln, wenn wir aus der Sackgasse der Abkapselung
herauskommen wollen. Jesus gab uns einfache Vorschläge, wie wir
sie meiden können und stattdessen unser Licht da leuchten zu lassen,
wo es am nötigsten ist: in der Dunkelheit der Welt.
In Matthäus 5,43-48 sagt Jesus, dass wir wie unser Vater sein sollen,
der »seine Sonne aufgehen [lässt] über Böse und über Gute«.
Jesus sagt uns, dass wir nicht nur diejenigen lieben sollen, die uns
lieben. Selbst Zöllner tun das! Wir sollen nicht nur unsere Brüder
grüßen, das tut jeder. Wir sollen von uns aus zu allen Menschen
freundlich sein und aufmerksam auf das sein, was um uns her vorgeht.
Das ist doch nicht schwer, oder?
In Lukas 14,12-13 schlägt Jesus vor, dass wir nicht nur Freunde
und Verwandte zum Essen einladen sollen. Ihr wisst ja, wie das
unter Freunden geht: Dieses Mal sind wir dran – und das nächste
Mal ihr. Am Ende sind wir quitt. Es hat niemanden etwas gekostet.
Aber Jesus sagt uns, dass wir die Armen, die Krüppel, die Lahmen
und die Blinden einladen sollen, die es uns nicht vergelten können –
bis zum Tag der Auferstehung, an dem sie unsere Treue rühmen
werden.
Mit anderen Worten: »Seid gastfrei« (vgl. 1. Petrus 4,9).
Brecht freiwillig mit eurer täglichen Routine; bleibt um des
Evangeliums willen nicht immer am selben Ort, immer mit denselben
Leuten zusammen. Ich kenne keinen besseren Rahmen für
103
ein evangelistisches Gespräch als ein Abendessen zu Hause oder in
einem ruhigen Restaurant.
Wir müssen in die Welt gehen, um die nötigen Kontakte zu
knüpfen und Leute in unser Leben mit einzubeziehen.
104
16. Wer passt sich wem an?
Eine offene Atmosphäre für den anderen schaffen
Wenn wir über unsere eigenen Kreise hinaus Menschen er reichen
wollen, dann sollte es unser Hauptanliegen sein, die Ver stän digungs
barrieren zwischen Christen und Säkularisierten zu überwinden.
Da das eine so grundlegende Notwendigkeit ist, habe ich
mich in den vorhergehenden fünf Kapiteln mit diesem Problem
befasst. Ein Abschnitt von Paulus im 9. Kapitel des Korintherbriefs
fasst das in einem einzigen Grundsatz zusammen:
»Denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum
Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich
bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne;
denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz (obwohl ich selbst
nicht unter Gesetz bin), damit ich die, die unter Gesetz sind,
gewinne; denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz […], damit
ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich
geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne.
Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette.
Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm
teilhaben möge« (1. Korinther 9,19-23).
Paulus sagt damit, dass ein Zeuge sich an diejenigen an passen
muss, die das Evangelium noch nicht kennen. Es ist Sache des Zeugen,
sich auf diejenigen einzustellen, denen er das Evangelium weitersagt,
und nicht umgekehrt. Paulus verteidigt seine Freiheit, allen
Menschen alles zu sein, denn er wusste, dass das die ausgewogene
Haltung war zwischen dem »in der Welt sein« und dem »von ihr
abgesondert sein«. Um in der Welt zu sein, muss man die Freiheit
haben, an dem Leben der Menschen, mit denen wir es zu tun
haben, teilzunehmen. Abgesondert sein heißt, dass wir in der Welt
sind, ohne uns Gottes souveräner Herrschaft über unser Herz zu
entziehen – mit anderen Worten: ohne zu sündigen.
105
Wie könnte dieses »allen alles sein« praktisch aussehen? Was
bedeutet es für Paulus, wie ein Jude unter den Juden zu leben und
dann, als er bei den Heiden war, sein Leben total umzukrempeln
und wie einer ohne Gesetz zu leben? Das hieß für ihn, dass er die
moralischen Bedenken und Traditionen derer, mit denen er gerade
zusammen war, respektierte und flexibel genug war, um seine
eigene Kultur hintenanzustellen.
Für viele war dieser Gedanke ein Skandal, aber Paulus war
bereit, den Preis für seine Überzeugung zu bezahlen. Und so wurde
er bis zu seinem Tod von Christen wie Nichtchristen kritisiert. Man
braucht Reife und Mut, um »zu den Heiden zu gehen«!
Ich diskutierte einmal mit einem Südamerikaner darüber, warum
unser Missionsteam in Lateinamerika so große Schwierigkeiten hat,
die Arbeit im Land zu verwurzeln. Er sagte mir: »Eure Heiligung ist
nordamerikanisch. Ich habe den Eindruck, dass ihr Angst habt, sich
der Kultur anzupassen, weil ihr dann befürchtet, euch mit der Welt
zu beschmutzen. Ihr habt Angst, Heiden zu werden.«
Es ist schwer, sich zu ändern, besonders wenn es um verschiedene
Verhaltensmuster geht. Trotzdem erfordert das In-die-Welt-Gehen
Veränderung. Es bedeutet, am Leben anderer teilzunehmen. Das
heißt, dass wir so denken und fühlen wie die, die wir ge winnen wollen –
dass wir sie verstehen und ihre Wertmaßstäbe ernst nehmen.
Die Menschwerdung Jesu liefert uns das Vorbild für einen solchen
Kontakt mit der Welt. Jesus verließ die Herrlichkeit Gottes.
»… der […] sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt
annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und
[…] sich selbst erniedrigte …« (Philipper 2,6-8). Deswegen haben
wir »einen Hohenpriester, […] der in allem versucht worden ist in
gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde« (Hebräer 4,15). Er
kam in die Welt, lebte unser Leben und durchlitt alles, was wir leiden.
Er machte nur bei der Sünde nicht mit. Inwieweit könnten wir
uns mit Gott identifizieren, wenn Jesus nie Mensch geworden wäre?
Der Apostel Paulus lebte nach dem gleichen Grundsatz: Er ging
zu den Nichtchristen, um sie zu Gott zu führen. Aber er wusste,
106
dass ihr Weg zu Gott nur über sein Leben ging. Er erinnert die
Thessalonicher: »Ihr seid Zeugen […], wie heilig und gerecht
und untadelig wir gegenüber euch, den Glaubenden, waren …«
(1. Thessalonicher 2,10).
Ob wir wollen oder nicht: Unser Lebensstil gibt einen Einblick,
wie das Leben eines Nichtchristen nach seiner Bekehrung aussehen
wird. Je nachdem, was er im Leben des Christen sieht, wird er sich
für oder gegen das Christsein entscheiden. Die Entdeckung dieser
Wahrheit überraschte mich selbst.
Mit einem brasilianischen Freund, Mario, studierte ich vier Jahre
zusammen die Bibel, ehe er Christ wurde. Mario, ein In tellektueller,
hatte fast alle führenden westlichen Denker von Rousseau bis Kafka
gelesen und sich daraus eine eigene Weltanschauung »zurechtgezimmert«,
die im Grunde marxistisch war und als Schutzpatron
Bertrand Russell hatte. Er war als führende Persönlichkeit
in marxis tischen Kreisen politisch aktiv. Wir können uns beide bis
heute nicht erklären, wieso er es vier Jahre durchhielt, mit mir die
Bibel zu studieren und warum ich so lange Geduld mit ihm hatte.
Da die Philosophie einen so großen Platz in seinem Leben einnahm,
kamen wir bei unserem Bibelstudium immer wieder darauf
zu sprechen. Eines Tages (einige Jahre nach Marios Bekehrung) er -
innerten wir uns an diese erste Zeit. Er fragte mich: »Weißt du, was
mich eigentlich bewogen hat, mich für Christus zu entscheiden?«
Natürlich dachte ich sofort an die vielen Stunden Bibelarbeit, aber
ich antwortete: »Nein, was denn?«
Seine Antwort kam total überraschend: »Erinnerst du dich
daran, als ich das erste Mal bei dir zu Hause war? Wir waren vorher
irgendwo gewesen, und ich aß mit deiner Familie zusammen zu
Abend. Während ich dich, deine Frau und deine Kinder be obachtete
und sah, wie ihr miteinander umgingt, fragte ich mich: Wann werde
ich solch eine Beziehung mit meiner Verlobten haben? Als ich diese
Frage mit ›Niemals‹ beantworten musste, stand für mich fest, dass
ich Christ werden musste, um überhaupt zu überleben.«
Ich erinnerte mich noch gut an diesen Tag: Meiner Meinung
107
nach hatten sich die Kinder an diesem Abend nicht besonders gut
benommen. Mir fiel sogar ein, dass ich mich besonders niedergeschlagen
gefühlt hatte, weil ich sie in Marios Gegenwart zurechtgewiesen
hatte. Aber Mario sah, dass das Christsein eine Fa milie
zusammenschweißt, der letzte Vers im Alten Testament nimmt
darauf Bezug: »Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und
das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden …« (Maleachi 3,24).
Meine Familie hatte gar nichts von ihrem Einfluss auf Mario
bemerkt. Gott hatte diese Arbeit durch uns getan, ohne dass
wir etwas davon merkten. Die meisten Christen sind sich nicht
bewusst, welche Veränderungen Gott im Verlauf der Heiligung an
ihnen bewirkt.
Wir tendieren mehr dahin, die Schwächen und Un vollkommen
heiten in unserem Leben zu sehen. Wir schrecken schon vor
dem Gedanken zurück, einen Außenstehenden nah an uns herankommen
zu lassen, damit er uns sieht, wie wir wirklich sind. Selbst
wenn diese Ängste berechtigt sind, habe ich doch beobachtet, dass
jeder Christ, der aufrichtig seinen Weg mit Gott zu gehen versucht,
trotz aller seiner Fehler doch immer etwas von Christus widerspiegelt.
Es scheint so, dass wir, je mehr wir mit unserem Verhalten
zufrieden sind, desto schlechter bei den Leuten ankommen.
Zusammenfassung
Es ist also nicht genug, wenn wir nur gelegentlich einmal in der
Welt eines anderen Menschen auftauchen, ihn anpredigen und
dann wieder unserer Wege gehen. Wir müssen ihm irgendwie
unser Leben öffnen. Wenn wir ihm keinen Einblick in unser
Leben geben, sieht er nur einen Teil der Wirklichkeit des christlichen
Lebens. Er könnte dann nicht sehen, wie sich Gottes Gnade
in unserem alltäglichen Leben auswirkt. Aber es wird kein wirklicher
Austausch stattfinden, wenn wir es als Christen nicht lernen,
»allen alles« zu sein.
108
17. Das Prinzip des Leibes Christi
Ergänzung durch verschiedene Gaben
Wir haben gesehen, dass sich Gott von Anfang an der Welt in erster
Linie durch ein Volk geoffenbart hat. Das erste Volk war Israel,
die Nation, die sich innerhalb weniger Generationen von der Sklaverei
zu unbeschreiblicher Attraktivität entwickelte. Dann rief Gott
die Gemeinde ins Leben, indem er eine völlig kopflose Gruppe von
120 Jüngern, die sich in einem Saal in Jerusalem verbarrikadiert
hatten, in ein einzigartiges Volk umwandelte. Seine bloße Existenz
gab der Welt zu denken.
Gott hat immer ein Volk dazu benutzt, um seine Stimme in der
Welt hörbar zu machen, und er wird es auch weiter auf die gleiche
Weise tun. Diese Tatsache ist von entscheidender Bedeutung
für Theorie und Praxis unseres christlichen Zeugnisses.
Was kann das konkret bedeuten? Zweierlei:
1. Das Zeugnis der Gemeinde
2. Das Prinzip des Leibes Christi.
Das Zeugnis der Gemeinde
In seinem Buch »Die Gemeinde am Ende des 20. Jahrhunderts«
schreibt Francis Schaeffer:
»Die Gemeinde sollte sich in einer sterbenden Kultur vor
allem durch Liebe auszeichnen. Nach welchen Kriterien wird
uns also die sterbende Kultur beurteilen? Jesus sagte: ›Daran
werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt‹ (Johannes 13,35). Mitten in einer
sterbenden Kultur gibt Jesus ihr ein Recht: Aufgrund seiner
Autorität gibt Jesus der Welt das Recht, zu beurteilen, ob du
109
und ich wiedergeborene Christen sind, und zwar je nachdem,
ob unsere Liebe zu allen Christen erkennbar ist oder nicht.«16
Jesus betete für uns: »… damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in
mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast« (Johannes 17,21). Als Kommentar
zu diesem Vers schreibt Schaeffer: »Hier sagt Jesus […], dass wir
von der Welt nicht erwarten können, dass sie glaubt, dass der Vater
den Sohn gesandt hat – dass sie glaubt, dass Jesu Be hauptungen
stimmen und dass das Christentum auf Wahrheit beruht, wenn die
Welt nicht etwas von der Einheit der wahren Christen in der Praxis
sehen kann.«17
Dem Christen, der im Alleingang versucht, Verlorene zu ge -
winnen, entgeht etwas Entscheidendes. Selbst wenn in seinem
Leben ganz deutlich die Frucht des Geistes erkennbar wird, werden
die, die er zu gewinnen versucht, nicht die ganze Kraft seines Zeugnisses
erleben, weil er eben allein ist. Es ist sehr einfach, eine einzelne
Person abzutun und sie mit der Bemerkung ent schuldigend
beiseitezuschieben: »Er hat eine ungewöhnliche Vergangenheit«,
oder: »Er ist ein komischer Kauz.« Aber wenn der Nichtchrist
einer Gruppe von Christen begegnet, dann wird der gemeinsame
Nenner – der Heilige Geist – bald für jedermann sichtbar sein.
Das Zeugnis einer Gemeinschaft ist un widerlegbar. Manchmal
kommt man gar nicht umhin, allein oder in einem kleinen Team zu
ar beiten – beispielsweise ein Pionierevangelist, der in Orte und zu
Menschen geht, wo es noch keine christliche Gemeinde gibt. Paulus
sagte, dass er sich »so beeifere, das Evangelium zu predigen,
nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf fremden
Grund baue« (Römer 15,20).
Es gehört immer noch zur wesentlichsten Aufgabe der Ge -
meinde, in evangelistisch noch unerreichte Gebiete vor zustoßen;
16 Zitat: Francis Schaeffer, The Church at the End of the Twentieth Century, Downers
Grove/Illinois, InterVarsity Press, 1970, S. 136-137.
17 Schaeffer, ebenda, S. 138-139.
110
denn die Welt ist voller Völker und Subkulturen, die keine christliche
Basis haben. In diesem Augenblick, in dem ich dieses Buch
schreibe, lebe ich in einer solchen Subkultur.
Es ist schwierig, ganz bei null anzufangen. Die ersten Kontakte
sind in der Regel sehr schwer zu knüpfen. Langsam, aber
sicher findet man dann aber Menschen hier und da in der Stadt.
Aber diese kennen sich noch nicht untereinander und haben keinen
Sinn für Gemeinschaft. Sie werden sich aber nach einiger
Zeit wünschen, dass ihre Freunde und Verwandten auch Christus
kennen lernen. Oft empfinden sie diesen Wunsch schon, wenn sie
gerade erst Christen geworden sind. Wenn das so ist, dann glaube
ich, dass Gott dem jungen Christen diesen Wunsch ins Herz gibt,
damit er sich seiner Abhängigkeit von anderen Christen bewusst
wird. Wenn ein junger Christ anfängt, das Evangelium anderen
zu verkündigen, wird er merken, dass er es lernen muss, wirksamer
zu evangelisieren. Junge Christen werden durch diesen stark
emp fundenen Drang zu evangelisieren zu anderen Christen hingetrieben
und haben das Bedürfnis, Beziehungen zu reiferen Christen
aufzubauen.
Das war eine der Entdeckungen, die mich meine langjährige
Erfahrung lehrte – ich habe erst später ihren biblischen Ursprung
erkannt. Vor einigen Jahren war ich mit einem Mitarbeiter in einer
kleinen Gruppe von Neubekehrten, die gerne lernen wollten, wie
man Freunden das Evangelium weitersagt. Aber sie hatten selber
dazu nicht das geistliche Rüstzeug. Bevor wir sie kennenlernten,
hatten die meisten von ihnen nie eine Bibel zur Hand genommen.
Wie konnten wir ihnen helfen, ihre Freunde in fruchtbarer Weise
zu beeinflussen?
In einer solchen Situation nimmt der Erfahrenere meist die
Sache selbst in die Hand und spricht selber mit den Freunden des
Neubekehrten. Aber auf diese Weise geht im Allgemeinen eine
wichtige Gelegenheit zum Lernen verloren – der junge Christ zieht
dann rasch falsche Schlüsse, dass das Evangelisieren nur etwas
für vollzeitliche Mitarbeiter ist. Wenn der Missionar selber den
111
Besuchsdienst übernimmt, wird sich der junge Christ hinter die
Kulissen zurückziehen und wird sich für den Rest seines Lebens
damit begnügen, ein Zuschauer zu sein. Wir sollten das auf jeden
Fall vermeiden. Aber wie sollen wir eine Gruppe junger Christen
anleiten, die so wenig vom wirksamen Evangelisieren wissen?
Als Antwort darauf bekamen wir die Idee, eine (wie wir es
nannten) »offene Bibelstudiengruppe« anzufangen. Es handelt
sich dabei um eine Reihe von sechs wöchentlichen oder 14-täglichen
Bibel abenden, die auf Nichtchristen ausgerichtet sind. Diese
Bibelabende finden in einem neutralen und persönlichen Rahmen
statt, meistens bei jemandem zu Hause. Es herrscht eine entspannte
Atmosphäre – dezente Musik und Kaffee. Es wird eine
kurze, provokative Ansprache über einen Teilaspekt der christlichen
Botschaft ge halten, wie zum Beispiel »Wer ist Jesus Christus?«
oder »Was ist der Mensch?«. Dann folgt eine Diskussion, an
der sich jeder beteiligen darf und wo jede Frage erlaubt ist. Damit
das Gespräch lebendig bleibt, geben wir acht, dass die Gruppe
zur Hälfte aus Nichtchristen und zur Hälfte aus Christen besteht.
Damit ein junger Christ bei diesen Hauskreisen etwas lernt, nimmt
ein erfahrener Christ ihn unter seine Fittiche und hilft ihm bei der
Leitung des Gesprächs. Den anderen reiferen Christen, die auch
mitmachen, raten wir, möglichst diese tödlichen Patentantworten
zu vermeiden, die den Christen so leicht über die Lippen gehen.
Das offene Bibelgespräch war ein voller Erfolg – so über -
wältigend, dass Osvaldo eines Tages zu mir kam und sagte: »Ich
habe mich entschlossen, keinen meiner Freunde mehr zu diesen
Hauskreisen mitzubringen. Jeder, der dorthin kommt, bekehrt sich
am Ende. Ich habe das Gefühl, dass diese Hauskreise für mich zur
›Krücke‹ werden. Ich lerne nicht mehr, wie ich selber jemandem
das Evangelium weitersagen kann.«
Ich wusste nicht, wie ich Osvaldo antworten sollte. Ich be -
obachtete aber daraufhin intensiver, was an den Abenden vor sich
ging. Was war das Geheimrezept für ihren Erfolg? Es konnte nicht
am Inhalt liegen, denn oft waren die Kurzansprachen ziemlich
112
schwach. Und es lag auch nicht an den Gesprächen anschließend.
Mein Mitarbeiter und ich hatten beschlossen, uns die meiste Zeit
zurückzuhalten und die Leitung der Abende den jungen Christen
zu überlassen. Oft mussten wir mit ansehen, wie die Nicht christen
unsere Zöglinge »auseinandernahmen«. Aber trotzdem hörte ich,
wie die Gäste öfters zueinander sagten: »Ich habe noch nie solche
Leute gesehen. Sie sind ganz anders als die, mit denen wir bis jetzt
zusammen waren.« Nach mehreren Abenden dämmerte mir das
»Erfolgsrezept«. Die Nichtchristen reagierten nicht in erster Linie
auf das, was sie gehört hatten, sondern vielmehr auf das, was sie
gesehen hatten. Sie hatten nie zuvor Christen in einer Gruppe erlebt.
Dann fiel mir einiges auf. Woher hatte Osvaldo die Idee, dass er
in der Lage sein musste, im Alleingang seinen Freunden das Evangelium
weiterzusagen? Er hatte diese Idee offensichtlich von mir.
Und woher hatte ich sie?
Es war nie Gottes Absicht, dass ein Einzelner evangelisieren soll.
Die Bibel sieht vor, dass das Zeugnis des Einzelnen in den Rahmen
des Zeugnisses einer Gruppe eingebettet sein soll. Das Zeugnis
einer Gruppe von Christen sagt den Menschen: »Schaut auf uns
alle. Genauso könnt ihr eines Tages werden. Es gibt Hoffnung.«
Man kann immer gute Gründe finden, das Zeugnis eines Einzelnen
abzuwerten, aber es ist unmöglich, das Zeugnis einer ganzen
Gruppe zu widerlegen. Der Apostel Johannes unterstreicht diese
Tatsache mit den Worten: »Niemand hat Gott jemals gesehen.
Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist
in uns vollendet« (1. Johannes 4,12).
Das Prinzip des Leibes Christi
Evangelisieren kann man auf zwei verschiedene Arten: entweder
bei einer Großveranstaltung oder indem man persönlich einem
Einzelnen das Evangelium weitersagt. Beides ist gut, aber un -
zureichend, denn es passiert dabei nur ein Bruchteil dessen, was
113
eigentlich geschehen sollte. Bei beiden Evangelisationsmethoden
können die meisten Christen nicht mitmachen. Verkündigung im
großen Stil kann leicht dazu führen, dass der einzelne Christ seine
Verantwortung, ein wirksamer Zeuge zu werden, nicht mehr wahrnimmt.
Und in der persönlichen Evangelisation von Person zu Person
ist der Christ in der Regel sich selbst überlassen. Viele Christen
fühlen sich nicht dazu in der Lage, ihren Glauben persönlich
zu bezeugen.
Wenn wir versuchen, die Verlorenen zu erreichen, sieht das
oft folgendermaßen aus: Wir lehren das nötige geistliche Handwerkzeug;
wir starten eine kurzfristige, evangelistische Aktion, er -
mahnen zum Zeugnisgeben und hinterlassen Christen mit großen
Schuldgefühlen.
Gibt es denn keinen anderen Weg, damit auch der normale
Christ beim Evangelisieren mitmachen kann, und zwar in einer
realistischeren Art und Weise und auf lange Sicht?
Die eine vorherrschende Wahrheit im Neuen Testament in
Bezug auf die christliche Gemeinde ist die Tatsache, dass sie als
Leib beschrieben wird – als ein lebendiger Organismus, dessen
Glieder in ständiger Abhängigkeit voneinander leben müssen (vgl.
1. Korinther 12; Epheser 4 und Römer 12). Wenn es einen Bereich
gibt, wo dieses Prinzip des Leibes angewendet werden muss, dann
ist das beim Evangelisieren der Fall.
Es ist viel darüber geschrieben und geredet worden, wie man
seine geistlichen Gaben entdeckt und ausübt. Die Frage »Welche
Gabe habe ich?« ist nicht leicht zu beantworten.
Auf welcher Grundlage basiert meine Antwort auf diese Frage?
Es wäre wohl besser zu fragen: »Was kann ich tun?« Jeder kann
diese Frage beantworten. Wenn wir das tun, was wir können, werden
wir auch die Frage nach unseren Gaben beantworten können.
Wenn wir anfangen zu handeln, werden wir auch unsere Gaben
entdecken!
Wie oft hat Ihnen schon jemand gesagt: »Evangelisieren ist nicht
meine Gabe«? Von der Methode her gesehen, besitzt niemand die
114
Gabe des Evangelisierens. Es gibt jedoch einige Menschen, die
bestimmte Gaben haben, die es ihnen leichter machen, wirksam zu
evangelisieren. 1. Korinther 12,4-10 beschreibt verschiedene Gaben
und Dienste.
Wenn wir das Evangelisieren als Dienst einer Gruppe oder
Gemeinschaft ansehen, werden wir bald feststellen, dass jede
geistliche Gabe, die den Leib auferbaut, auch bei der Evangelisation
der Verlorenen genutzt werden kann. Aus diesem Grund können
wir nicht trennen zwischen Evangelisieren und Auferbauen.
Das eine existiert nicht ohne das andere. Wir sprechen von Evangelisation
als Dienst des Leibes Christi, wenn sich einige Christen
zusammenschließen und ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten in
einen Topf werfen, um die Botschaft in die Welt hineinzutragen.
Hier kann jede vorhandene Gabe gut eingesetzt werden. Alles, was
ganz natürlich zu Ihnen gehört, Ihre Gastfreundschaft, Ihr Organisationstalent,
Ihre Geselligkeit, Ihr Gebet, Kochen, Bibelkenntnis,
Lehrfähigkeit – alles, was Sie tun können, kann beim Evangelisieren
gebraucht werden. Ihre Gaben – Ihre Fähigkeiten, Stärken und
Interessen – können den Leib Christi auferbauen und auch Brücken
der Verständigung zu Nichtchristen aufbauen. Fangen Sie
mit dem an, was Sie haben. Wenn Sie voranschreiten, werden Sie
Fähigkeiten entwickeln, die Sie vorher nicht besaßen.
Vor ein paar Jahren haben fünf Ingenieure zur gleichen Zeit
ihr Examen an der Universität Curitiba in Brasilien abgelegt. Alles
junge Christen, die unterschiedlich weit in ihrer geistlichen Reife
waren. Gemeinsam entschlossen sie sich, nach São Paulo zu gehen,
um dort für das Reich Gottes zu leben und zu arbeiten.
São Paulo ist eine Stadt mit 14 Millionen Einwohnern. Es gibt
kaum Christen dort. São Paulo gehört zu den Städten der Welt,
die am meisten Evangelisation brauchen. Zu dem Zeitpunkt, als
sie sich dort eine gemeinsame Wohnung suchten, hatte keiner der
fünf Arbeit gefunden. Sie legten ihr Geld zusammen. Es ging ihnen
bald aus. Schließlich, als sie buchstäblich hungerten, bekam einer
von ihnen eine Stelle. Er war der jüngste Christ unter ihnen. Sechs
115
Wochen vergingen. Die fünf mussten von einem Gehalt leben. Elf
Monate später bekam der letzte der fünf, Evilasio, eine Stelle. Er
war der reifste Christ von ihnen, auf dessen Glauben das gewagte
Unternehmen ruhte.
Keiner dieser Männer hatte viel Ahnung vom Evangelisieren.
Keiner war ein erfahrener Leiter oder biblischer Lehrer, aber sie
hatten gelernt, dass das Wenige – wenn sie es in einen Topf warfen
– genug war. Sie säten unter ihren Bekannten und Arbeitskollegen
den guten Samen des Evangeliums, und eine neue Gruppe
von Gläubigen entstand.
Epheser 4,11-12 zeigt ganz klar, dass die Aufgabe der Leiter
(A postel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer) darin be steht,
Gottes Volk zum Dienst zuzurüsten. Es ist wichtig zu verstehen,
dass jeder Christ die Verantwortung hat zu dienen. Es darf keine
bloßen Zuschauer geben, denn jede Gabe, wenn sie mit den an deren
Gaben gemeinsam genutzt wird, ist wichtig. Dann pas sieren auf einmal
Dinge, die sonst unmöglich wären. Evan gelisieren sollen nicht
nur diejenigen, die sich auf die Verkün digung des Evan geliums spezialisiert
haben. Gemeinsam können wir Dinge vollbringen, auf die
wir niemals hoffen könnten, wenn wir allein ar beiten würden.
Die einfachste und am besten zu praktizierende Anwendung
dieser Überlegungen ist der Hauskreis mit den Nachbarn.
Was braucht man dazu? Man sollte ein aufmerksamer und mitdenkender
Nachbar sein. Wir müssen unsere Häuser öffnen, Leute
einladen, ihre Interessen und Nöte kennen. Wir müssen bereit
sein, ein Bibelgespräch zu leiten. Jemand muss sich für die Gruppe
ver antwortlich fühlen, um sie zusammen und in Gang zu halten.
Wenn die Gruppe zu unübersichtlich wird, muss jemand da sein,
der erkennt, dass es Zeit für eine Teilung und den Beginn eines
neuen Hauskreises ist. Mehr ist nicht nötig. Stellen Sie sich einmal
vor, was passieren würde, wenn wir alle uns in einer solchen Hauskreisarbeit
engagieren würden!
Was ich gerade beschrieben habe, kommt der Form nahe, die die
Gemeinde während der ersten drei Jahrhunderte ihrer Geschichte
116
zur Verfügung hatte. Die verfolgten Christen konnten nicht in der
Öffentlichkeit tätig sein. Es gab keine christlichen Gemeinden und
keine Gemeindegebäude. Sie waren auf Häuser von Einzelnen und
Ähnliches angewiesen (vgl. Römer 15 und 16). Ich frage mich, ob
die Gemeinde nicht etwas Entscheidendes von ihrem Wesen verloren
hat, als wir sie aus den Wohnzimmern und Geschäften vertrieben
und anfingen, sie in eigens dafür gebauten Häusern unterzubringen.
Es war nun vorbei mit der ständigen Nachfrage nach
verantwortlichen, neuen Mitarbeitern, die solch ein Netzwerk
von Glaubenszellen hervorbrachte. Nachdem man feste »Ämter«
in christlichen Gemeinden eingerichtet hatte, wurde der »Durchschnittschrist«
vom Druck der Verantwortung enthoben. Aber
wir brauchen solchen Druck. Gottes Plan für die Gemeinde ist es,
dass sie einer »Guerillabewegung« vergleichbar ist und nicht einer
un erschütterlichen Festung.
Schlussfolgerung
Jeder von uns ist vor Gott dafür verantwortlich, wie er seine Fähigkeiten
und Gaben nutzt, um Verlorene zu erreichen. Aber das
bedeutet nicht, dass Evangelisation Sache des Einzelnen ist. Sie ist
auch Sache der christlichen Gruppe oder Gemeinde. Die wenigsten
von uns können diese Aufgabe erfüllen, wenn sie sich nicht
mit anderen zusammentun, um ihre Möglichkeiten und Mittel
mit Gleichgesinnten zu teilen. Auf diese Weise können wir das ge -
meinsame Ziel verwirklichen: als eine Gemeinschaft von Gläubigen
Zeugnis für Christus abzulegen, indem wir aktiv am Leben
einiger nichtchristlicher Freunde teilnehmen.
117
18. Drei Bereiche, die zusammenwirken
Leben, Gemeinschaft und gesprochenes Zeugnis
Wir können erwarten, dass Gott uns in seinem Versöhnungsplan
auf drei Arten gebraucht:
• durch das Zeugnis unseres Lebens,
• durch das Zeugnis der Gemeinschaft,
• durch unser gesprochenes Zeugnis.
Das Zeugnis des Lebens
Wir haben schon gesehen, dass, wenn wir durch unser Leben
Zeugnis ablegen, wir mit unserem Lebensstil das Evangelium verkörpern.
In unseren Beziehungen zu anderen sollte das Wesen
Christi – voller Gnade und Wahrheit – zum Ausdruck kommen.
Das bedeutet, dass wir anderen Lasten von ihrer Seele nehmen.
Seit 20 Jahren lässt mich eine eher zufällige Bemerkung eines
gottesfürchtigen, von mir sehr verehrten Professors nicht mehr
los. Er war gerade von einer zweijährigen Lehrtätigkeit im Nahen
Osten zurückgekehrt, und seine Gedanken waren noch voll von
den Erfahrungen, die er dort in Begegnungen mit Muslimen
gesammelt hatte. Er beschrieb, wie die Leute sich an jedes kleinste
Anzeichen von persönlichem Interesse und Freundlichkeit klammern.
Er sagte: »Weißt du, 90 % des Evangelisierens ist Liebe.« Ich
wusste das noch nicht! Zu jener Zeit, als junger Christ, der sich
nach Er folgen sehnte, sah ich das Evangelisieren als eine Aktivität
an, an die ich mich mit Leib und Seele hingab. Die Menschen, um
die es dabei ging, waren eher Missionsobjekte, die gerettet werden
mussten, als wirkliche Personen. Ich wollte Ergebnisse erzielen und
keine Zeit damit verlieren, irgendjemanden zu lieben.
118
Aber dieser befreundete Professor hatte recht: Es kommt entscheidend
auf die Liebe an. Der Apostel Paulus sagt uns: »Denn
die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben,
dass einer für alle gestorben ist …« (2. Korinther 5,14). Be achten
Sie, woher diese Liebe kam, die Paulus zum Handeln bewegte.
Es war die Liebe Christi. Und Christi Liebe spiegelt die Liebe
des Vaters wider. Gott hatte angefangen zu lieben: »Wir lieben,
weil er uns zuerst geliebt hat« (1. Johannes 4,19). Das ist gelebtes
Zeugnis.
Ich muss zugeben, dass ich beim Evangelisieren erst bleibende
Frucht sah, als ich anfing, die Bedeutsamkeit dieser Tatsache zu
verstehen, und sie in die Tat umsetzte.
Das Zeugnis der Gemeinde
Wir haben bereits darüber gesprochen, welche Auswirkung das
gemeinsame Zeugnis einer Gruppe von Christen bei der Evangelisation
hat. Die einfache Tatsache, dass es eine Gruppe mit ihrer
einzigartigen Liebe zueinander gibt, ist schon in sich eine mächtige
Verkündigung an die Welt. Sie bezeugt die Echtheit unserer Botschaft:
dass wir tatsächlich veränderte Menschen sind, dass Jesus
wirklich vom Vater in die Welt gesandt wurde und dass es für jeden
Menschen Hoffnung gibt.
Wenn wir wollen, dass unser Zeugnis gehört und beachtet wird,
müssen wir als Glieder des Leibes Christi in der Welt und zum
Segen der Welt leben. Das ist das Zeugnis der Gemeinde.
Das gesprochene Zeugnis
Wenn sich unser christliches Zeugnis nur auf die beiden ersten
Arten beschränkt, ist es allerdings unvollständig.
119
»Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört
haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? […]
Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten
verkündigen!« (Römer 10,14-15).
Was Menschen sehen, muss mit Worten erklärt werden, sonst gibt
es keine Verständigung. »Wie könnte ich denn [verstehen], wenn
mich nicht jemand anleitet?«, fragte der Kämmerer aus Äthiopien
den Philippus (Apostelgeschichte 8,31). Wir müssen von unserem
Glauben auch sprechen.
Auf drei Ebenen gleichzeitig
Man könnte jetzt leicht den Eindruck bekommen, dass ich meine,
diese Dinge sollten der Reihe nach getan werden – dass es notwendig
sei, eine gewisse Zeit dafür einzusetzen, um eine persönliche
Freundschaft aufzubauen, dann später diese Person mit un seren
christlichen Freunden zusammenzubringen und dann schließlich
mit ihm über den Glauben zu sprechen. Wenn dieser Eindruck
bei Ihnen haften bliebe, würde er Sie auf die falsche Fährte führen
– nämlich in die Unwirksamkeit. Weil wir er warten können,
dass Gott uns auf alle drei Arten gleichzeitig gebrauchen wird, sollten
wir alle drei Einflussbereiche – unser Leben, die Gruppe, zu der
wir gehören, und unser gesprochenes Zeugnis – so lange ein setzen,
bis der Angesprochene Christus be gegnet und anfängt, als Jünger
Jesu zu leben. Jeder dieser drei Bereiche ist für sich ge nommen
unvollständig. Die Schwächen eines stummen Zeugen liegen auf
der Hand. Jedoch hat ein nur gesprochenes Zeugnis auch ernstliche
Mängel. Es ist unpersönlich, selbst wenn wir mit Einzelnen persönlich
sprechen. In 1. Thessalonicher 2,8 schreibt Paulus: »So, da wir
ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch
nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes
Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart.«
120
Die drei Einflussbereiche wirken zusammen. Es hängt von
der jeweiligen Situation ab, womit wir anfangen. Ich weiß aus Er -
fahrung, dass ich schon ganz am Anfang einer Beziehung von meinem
Glauben sprechen muss. Je länger ich warte, desto schwieriger
wird es. Es entwickeln sich in einer Freundschaft Verhaltens muster
und Gewohnheiten, die man später nur noch schwer durch brechen
kann. Wir müssen am Anfang nicht besonders viel sagen. Es genügt
oft, »einfach Farbe zu bekennen«.
Wenn das gesprochene Zeugnis zuerst kommt, müssen die
anderen beiden Bereiche so schnell wie möglich folgen.
Einer meiner Freunde war ein säkularisierter Exis tenzialist, der
am Rande der Gesellschaft lebte. Wir waren gerade in eine andere
Stadt gezogen, und ich machte seine Bekanntschaft auf einer Feier,
kurze Zeit nach unserer Ankunft. Wir kamen ins Gespräch. Ich
erklärte ihm, dass ich neu in der Stadt war und kaum jemanden
kannte. Ich erzählte ihm von meiner Gewohnheit, mit Freunden
zusammen die Bibel zu studieren; dass ich noch keine In teressenten
gefunden hätte und das vermisste. Ich sagte, er würde mir einen
Gefallen tun, wenn er mitmachen würde, Er antwortete, dass er
nicht an Gott glaube und nichts von der Bibel wüsste, aber wenn
er mir damit helfen könne, würde er gerne einmal kommen. Er
lag mir als Persönlichkeit, und ich zeigte ihm das auch. Wir vereinbarten
ein Treffen.
Als wir mit dem Bibelstudium anfingen, waren wir uns noch
fremd. Doch schon bald entwickelten wir eine enge, ungezwungene
Freundschaft, spielten Tennis miteinander, liefen Ski und
aßen zusammen. In der Zwischenzeit hatte ich einige Freunde und
Bekannte zu diesen Treffen dazu eingeladen.
Mein neuer Freund hatte Schwierigkeiten mit dem Inhalt und
den Ansprüchen des Evangeliums. Er hatte viele ehrliche Probleme
vom Verstand her, aber auch die üblichen Kämpfe mit dem Willen.
Wenn diese inneren Kämpfe beginnen, ist die Liebe in einer
Be ziehung zu einem Nichtchristen von entscheidender Bedeutung.
Die natürliche Reaktion des Nichtchristen zu diesem Zeitpunkt ist
121
die Flucht vor der Botschaft – irgendwo hingehen, nur nicht mehr
in die Nähe der Bibel. Aber Liebe füreinander und Freund schaften
in einem kleinen Kreis sorgen dafür, dass der Nichtchrist sein
In teresse am Glauben nicht verliert. Der Heilige Geist gebraucht
diese Einflüsse, um den Nichtchristen anhaltend mit der Schrift zu
konfrontieren.
Das war auch bei meinem Freund der Fall. Diese drei Einflussbereiche
– das Zeugnis des Lebens, die Gemeinschaft und das
gesprochene Zeugnis – haben zusammen bewirkt, dass er schließlich
Christ wurde. In seinem Fall erfolgte der erste Kontakt durch
ein gesprochenes Zeugnis.
Unser Zeugnis aussprechen
In 1. Petrus 3,15 heißt es: »… heiligt Christus, den Herrn, in euren
Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der
Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch
ist …« Und in Kolosser 4,5-6 lesen wir: »Wandelt in Weisheit gegenüber
denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer
Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr
jedem Einzelnen antworten sollt« (Hervorhebung hinzugefügt).
Wenn unser Leben Jesus Christus widerspiegelt, dann wird das
nicht unbeachtet bleiben. Unsere Freunde und Bekannten werden
uns Fragen stellen, um zu verstehen, was sie in unserem Leben
sehen. Aber meistens sind diese Fragen indirekt und versteckt. Selten
fragt uns jemand offen heraus: »Warum bist du so, wie du bist?«
Stattdessen versteckt sich diese Frage vielleicht in einer Anklage
gegen seine Ehefrau, oder jemand macht sich Sorgen über seine
schwer erziehbaren Kinder. Oder seine Fragen drücken Enttäuschung,
Zynismus oder Gefühle der Sinnlosigkeit aus. Wenn sie
sich über unseren Glauben lustig machen, dann ist das eigentlich
nur der ungeschickte Versuch, aus uns herauszubekommen, woran
wir eigentlich glauben!
122
Deswegen müssen wir nicht nur lernen, wie wir antworten, sondern
erst einmal, wie wir richtig zuhören können, um diese versteckten
Fragen zu entdecken. Anfangs überhören wir diese verkappten
Fragen oder es »dämmert« uns eine Stunde oder einen Tag
später, wenn es zu spät ist. Dann könnten wir uns selbst ohrfeigen,
weil wir so wenig sensibel waren. Dawson Trotman, der Gründer
der Navigatoren, sagte, dass es unmöglich ist, auf jede uns gestellte
Frage immer die richtige Antwort parat zu haben. Er sagte, dass
das ganz verständlich ist. Aber wir sollten nicht ein zweites Mal
auf die gleiche Frage keine Antwort wissen. Mit anderen Worten:
Wenn wir eine Gelegenheit verpassen oder sehr ungeschickt waren,
sollten wir darüber nachdenken, was passiert ist, und uns genau
einprägen, was wir hätten sagen sollen und was in einer solchen
Si tuation angebracht gewesen wäre. Wenn wir nicht wissen, wie wir
richtig antworten sollen, sollten wir uns um die richtige Antwort
bemühen.
Wenn Sie auf diese Weise die Gebote in 1. Petrus 3,15 und
Ko losser 4,5-6 verwirklichen, werden Sie über den Erfolg erstaunt
sein.
Sagen Sie nicht zu viel
Wir fallen leicht in Extreme. Entweder wir sagen gar nichts und
lassen die Gelegenheit vorbeigehen – oder wir sagen zu viel und
schrecken damit ab.
Es ist nicht immer richtig und passend, sich die Zeit zu nehmen,
die ganze Botschaft zu erklären. Besser, man sagt gerade genug, um
den Weg zu einer besseren Gelegenheit (z. B. bei einem späteren
Besuch) vorzubereiten.
Und was sollen junge Christen tun oder diejenigen, die sich
nicht so gut ausdrücken können? Wie sollen sie die Botschaft vermitteln?
Es braucht nicht viel dazu. Alles, was die Samariterin sagen
konnte, war: »Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt
123
hat, was ich getan habe! Dieser ist doch nicht etwa der Christus?«
(Johannes 4,29).
Andreas ging zu seinem Bruder Simon Petrus und sagte: »Wir
haben den Messias gefunden« (Johannes 1,41) und bringt Petrus zu
Jesus. Philippus ging zu seinem Freund Nathanael und sprach: »Wir
haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz ge schrieben hat
und die Propheten, Jesus, den Sohn des Joseph, den von Nazareth«
(Johannes 1,45). Nathanael verkompliziert die Sache, indem er
fragt: »Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?« Aber Phi lippus
antwortete ganz schlicht: »Komm und sieh!« (Johannes 1,46).
Wir haben Jesus gefunden, kommt und seht. Gewinnende, einfache
Worte, sodass jeder sie nachsprechen kann. Mehr als das zu
sagen, verkompliziert nur unnötig.
124
19. Die biblische Grundlage für den Glauben
Bewusster Gehorsam gegenüber Gott durch sein Wort
Unser christliches Zeugnis hat zum Ziel, dass wir Menschen zum
Glauben an Jesus Christus führen. Mark Twain definierte Glauben
als »an etwas glauben, von dem man weiß, dass es eigentlich gar
nicht wahr ist«. Aber echter Glaube ist das genaue Gegenteil – er
muss auf Wahrheit gegründet sein.
Eine der hilfreichsten biblischen Definitionen von Glauben finden
wir in Römer 4,21: »… und war der vollen Gewissheit, dass
er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag.« Glauben ist die
Gewissheit und das feste Vertrauen, dass Gott das tun wird, was er
verheißen hat. »Zum Glauben kommen« bedeutet also: wissen, was
Gott gesagt und getan hat – und dann sein Leben auf diese Wirklichkeit
aufbauen.
Der Glaube ist nicht ein Sprung ins Ungewisse. Er ist vielmehr
eine bewusste, mit dem Willen vollzogene Unterwerfung unter
Gottes Willen mit unserem ganzen Leben. Beim Evan gelisieren versorgen
wir den Nichtchristen mit dem, was er braucht, um glauben
zu können. Zu diesem Zweck müssen wir aber biblische Grundlagen
legen. Was gibt uns Sicherheit zu wissen, dass das tatsächlich
geschieht? Es ist nicht immer leicht, das zu erkennen.
In einem unveröffentlichten Artikel »Die Lehre der Sünde
beim Gemeindebau in anderen Kulturen« beschreibt der Autor
die Bemühungen eines Teams von Missionaren, die unter Berg -
stämmen in Neuguinea arbeiteten. Als sie diese primitiven Völker
näher kennenlernten, waren sie von zwei Dingen sehr betroffen:
von der Polygamie und dem Betelnuss-Kauen. Ihre Besorgnis ging
so weit, dass sie den Neubekehrten diese Praktiken kategorisch
untersagten. Für die Dorfbewohner waren jedoch andere Dinge
wichtiger. Ihr Ideal eines langen und guten Lebens war die Vermeidung
jeglichen Unfriedens. Der Autor berichtet von folgendem
125
Fall: Als Reaktion auf die Bemühungen der Missionare hatten sich
einige Dorfbewohner scheinbar bekehrt. Sie wurden getauft, gaben
mehrere Jahre lang den Zehnten, gingen regelmäßig zur Gemeinde
und befolgten die wichtigsten Regeln christlichen Verhaltens. Eines
Tages kamen die Dorfältesten zu den Missionaren und sagten: »Wir
haben wohl jetzt genug getan, um abzuzahlen, was Jesus für uns
getan hat.« Dann gingen sie zurück in ihr Heidentum.
Was war geschehen? Sie hatten überhaupt nicht wirklich an -
gefangen zu glauben. Es war etwas entstanden, was wie christlicher
Glaube aussah, aber von heidnischen Voraussetzungen ausging.
Deswegen waren die Dorfbewohner ein Stück des Weges mit den
Missionaren gegangen, bis sie es leid waren, und dann gingen sie
wieder ihre eigenen Wege.
In einem solchen Fall, wo die Gegensätze zwischen Christentum
und Heidentum so krass sind, bedarf es keiner besonderen Scharfsicht,
um festzustellen, wo der Fehler lag. Aber die gleiche Gefahr
droht überall da, wo wir das Evangelium weitersagen wollen, und
oft ist sie schwer zu erkennen.
Im Juni 1964 machte ich in einer Kunstgalerie in Curitiba die
Bekanntschaft von Henrique. Ich knüpfte ein Gespräch mit ihm an.
Henrique ist einer der brillantesten Männer, die ich je gekannt habe.
Er liest enorm viel und hat ein unwahrscheinlich gutes Gedächtnis.
Er kann über jedes Thema reden, angefangen von byzantinischer
Kunst bis zur Genetik, als wenn er gerade erst ein Buch darüber
gelesen hätte. Neben Portugiesisch spricht er fließend Englisch und
Spanisch, ebenso Deutsch und Französisch. Als wir uns trafen, war
er 21 Jahre alt, frisch verheiratet und hatte gerade eine Sprachschule
aufgemacht.
Ich lud ihn zu einem Tee in ein Restaurant ein. Seine erste Frage
war: »Was machen Sie, ein Amerikaner, hier in Curitiba?« Als ich
es ihm erzählt hatte, antwortete er: »Gut, dann bekehren Sie zuerst
einmal mich, dann haben Sie eine ganze Schule als Missionsfeld.«
Er meinte es ernst. Er wollte, dass ich an seiner Schule das
Evangelium erkläre. Er hatte sich entschieden, Christ zu werden,
126
noch bevor er gehört hatte, was ich zu sagen hatte. Ich ließ ihn bis
zum nächsten Tag warten. Und dann studierten wir die Bibel miteinander.
Henrique entschied sich sofort für Jesus Christus. Einige
Wochen später folgte seine Frau seinem Beispiel. Wir haben uns
einige Jahre lang jeden Tag getroffen. Eine tiefe Freundschaft entwickelte
sich. Wir wurden wie Brüder.
Schon in der ersten Woche entdeckte ich bei Henrique eine
gefährliche Charakterschwäche. Ich bemerkte sie das erste Mal, als
wir zusammen aßen. Er konnte sich beim Essen nicht be herrschen.
Nachdem ich darauf aufmerksam geworden war, fing ich an, nach
mehr Anzeichen für mangelnde Selbstkontrolle Ausschau zu halten.
Sie zeigte sich zum Beispiel darin, wie er mit seinem Geld
umging, in der Art, wie er seinen Beruf ausübte, und in seiner starken
Abhängigkeit vom Rauchen. Ich bekam es mit der Angst zu
tun. »Die Frucht des Geistes […] ist Selbstbeherrschung« (Galater
5,22; Schlachter 2000). Aber er hatte keine Selbstbeherrschung.
Die Bibel war noch etwas Neues für Henrique, deswegen machte
es ihm Spaß, sich eingehend mit ihr zu beschäftigen. Er wurde auch
bald ein mutiger Zeuge, aber nur, weil alles noch so neu war. Ich
wusste, dass, wenn der Reiz des Neuen vorbei ist, er eine tiefere
Motivation brauchte, um im Glauben beständig zu wachsen. Wir
würden Schwierigkeiten bekommen. Und so war es auch.
Bald las er nicht mehr selbstständig in der Bibel. Wir trafen
uns, um gemeinsam darin zu lesen und diesen Mangel an Selbstdisziplin
auszugleichen. Wir trafen uns jeden Tag zwei Jahre lang
zum gemeinsamen Bibelstudium. Dadurch hatte Henriques Leben
immer noch einen christlichen Anstrich. Aber ich sah nie, dass der
Heilige Geist an den Wurzeln seiner Probleme arbeitete. Ich wurde
mit Gott ungeduldig und fragte ihn, warum ich seine Arbeit jetzt
auch noch machen sollte. Diese Einstellung half auch nicht weiter.
Ich konnte diese täglichen »Transfusionen« nicht auf Dauer aufrechterhalten.
Nach einigen Jahren entschloss ich mich daher, ihn
jetzt zu »entwöhnen«. Henrique musste jetzt endlich anfangen,
seine geistliche Nahrung von Gott selber zu beziehen.
127
Als wir nach einem dreimonatigen Heimaturlaub nach Curitiba
zurückkamen, erfuhren wir, dass Henriques Sprachschule pleitegegangen
war, dass er von seiner Frau geschieden war und die Stadt
verlassen hatte.
Das letzte Mal war ich mit Henrique 1971 in einem Restaurant in
Porto Alegre zusammen. Seine neue berufliche Karriere und seine
zweite Ehe waren auch gescheitert. Im Verlauf unseres Gesprächs
sagte er: »Du weißt gar nicht, wie nah du dran warst, in Curitiba
aus mir einen Christen zu machen!«
Henrique hatte versucht, ein christliches Leben zu führen, ohne
Christ zu sein, und ich hatte ihn noch darin bestätigt. Welche Zeitverschwendung!
Henrique hatte eine Entscheidung ge troffen, aber
ich hatte ihm nicht dabei geholfen, die richtige Grundlage für seinen
Glauben zu legen. Wir hatten uns also zwei Jahre lang einer
Illusion hingegeben. Wir müssen dafür sorgen, dass der Glaube
sich auf die einzige sichere Grundlage, den Felsen des leben digen
Wortes Gottes, gründet (vgl. Epheser 2,20). Der Glaube darf nur
auf diesem Fundament ruhen; sonst wird er mit an deren Glaubensvorstellungen
oder mit heidnischen oder humanistischen Philosophien
vermischt. Wir müssen uns schon nach Gottes Be -
dingungen richten, wenn wir zu ihm kommen wollen. Wie einfach
ist es doch, die Fragen und Probleme eines anderen mit ein
paar oberflächlichen Sätzen vom Tisch zu fegen, je mandem ein
Über gabegebet zu entlocken oder ihn etwas anderes tun zu lassen,
was wir als »eine Entscheidung für Christus« werten! Dann
gehen wir fort und freuen uns über unseren Erfolg! Eine der
Heraus forderungen an einen Missionar ist, klar zu erkennen, ob
die jenigen, mit denen er spricht, wirklich ihren Glauben in Jesus
Christus gesetzt haben, oder ob sie nur an den Missionar glauben.
Manchmal kann es eine ganze Generation dauern, bis dieser falsche
Glaube aufgedeckt wird.
Wie immer also das Evangelium weitergesagt wird, sollte der
Zeuge sich um eine echte Reaktion vonseiten des An gesprochenen
bemühen. Oberflächliche, unechte, gut gemeinte Be kehrungen
128
untergraben eine echte Bekehrung. Henrique hatte zum Beispiel
alles getan, was in meinen Augen für eine Bekehrung nötig war. Er
und ich gingen davon aus, dass eine geistliche Wieder geburt stattgefunden
hatte. Aber das war gar nicht der Fall. Wenn so etwas
passiert, ist die Folge entweder Verwirrung – wie in un serem
Fall – oder Enttäuschung. Ein Mensch nimmt vielleicht unser
Angebot an und erwartet dann den versprochenen Segen, der ausbleibt –
die Folge ist Enttäuschung. Als ich einem unserer Nachbarn
in den USA das Evangelium nahebringen wollte, wehrte er
mit den Worten ab: »Mann, ich bin schon 3-mal bekehrt worden!«
Er hatte es mit dem Glauben versucht, aber es hatte nicht »funktioniert«.
Also hatte er etwas anderes ausprobiert.
Wie können wir so etwas vermeiden?
Wie trifft man eine echte Entscheidung für Christus?
Bei der Entscheidung, Christ zu werden, oder auch bei jeder an -
deren wichtigen Entscheidung im Leben spielen drei Bereiche
unserer Persönlichkeit eine große Rolle: das Gefühl, der Verstand
und der Wille. Zum Beispiel: Ein junger Mann begegnet einer jungen
Frau. Sie fühlen sich gleich zueinander hingezogen. Sie sagen
sich beide: Das wäre jemand, den ich gerne heiraten möchte! Wenn
sie zu diesem Zeitpunkt ihrem Gefühl nachgeben würden, gäbe
es bald eine Hochzeit. Aber der Verstand schaltet sich ein und
stellt die gefühlsmäßige Reaktion infrage. Würden wir wirklich zu
sammenpassen? Wie ist sie eigentlich wirklich? Kann ich für ihren
Unterhalt sorgen? Beide kommen zu dem Schluss, dass es besser
wäre, sich noch etwas mehr Zeit zu nehmen und noch einige Fragen
zu klären, bevor sie eine feste Bindung eingehen. Also werden
die zwei jetzt mehr Zeit miteinander verbringen. Er wird schließlich
erkennen, dass ihr inneres Wesen genauso schön ist wie ihr
Äußeres. Jetzt rät auch sein Verstand ihm, abgesehen von seinen
Gefühlen, dass er sie heiraten soll.
129
Aber die letzte und schwierigste Entscheidung muss noch ge -
troffen werden – die Ent scheidung mit dem Willen. Vor dem Gang
zum Traualtar werden ihn noch folgende Fragen begleiten: Bin
ich bereit, meinen Lebensstil für sie zu ändern? Was ist mit meiner
Freiheit – lohnt sich der Tausch? Welche zusätzliche Ver antwortung
kommt auf mich zu – will ich sie über nehmen? Es wird erst zu einer
Hochzeit kommen, wenn schlussendlich der Wille mit den Ge -
fühlen und dem Verstand an einem Strang zieht. Und diese drei
Bereiche müssen auch über einstimmen, wenn jemand zu Christus
kommen will. Das Gleichnis vom Sämann sagt uns ähnliche Dinge:
»Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht,
kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war; dieser
ist es, der an den Weg gesät ist. Der aber auf das Steinige
gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit
Freuden aufnimmt; er hat aber keine Wurzel in sich, sondern
ist nur für eine Zeit; wenn nun Drangsal entsteht oder Verfolgung
um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Der
aber in die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört;
und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken
das Wort, und er bringt keine Frucht. Der aber auf die gute
Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der
wirklich Frucht trägt; und der eine bringt hervor hundert, der
andere sechzig, der andere dreißigfach« (Matthäus 13,19-23).
Die unterschiedliche Reaktion auf das Wort liegt nicht am Samen,
sondern an der Beschaffenheit des Bodens: 4 verschiedene Böden
bewirken 4 verschiedene Reaktionen.
1. Der Same, der an den Weg gesät wird. Der Boden war hart. Es
gab da nicht genug lockeren Boden, damit auch nur eine gefühlsmäßige
Reaktion zustande kommen konnte. Wir alle kennen solche
Menschen, die gleichgültig sind und sich für geistliche Dinge
überhaupt nicht interessieren. Diese Menschen sind am schwierigsten
mit dem Evangelium zu erreichen. Sie haben vielleicht viel Bil
130
dung und sind lieb und nett, aber ganz unempfänglich für das Wort
Gottes – es prallt an ihnen ab! Es gibt für sie nur Hoffnung, wenn
Gott selbst diesen harten Boden aufbricht, die Beschaffenheit des
Bodens verändert und ihn bearbeitet, damit er den guten Samen
aufnehmen kann. Wir sollten damit anfangen, ernsthaft für diese
Menschen zu beten. Nur so kommen wir an sie heran. Gott wird
unser Gebet erhören und ihre Widerstände brechen. Das habe ich
schon oft erlebt, und es ist immer wieder beeindruckend.
2. Dann gibt es den steinigen Boden. Diese Menschen hören
das Wort und nehmen es anfangs mit Freuden auf. Sie re agieren
gefühlsmäßig. Ihnen fehlt die entsprechende Grundlage für den
Glauben. Deswegen ist ihre Reaktion kurzlebig. Was geht in ihnen
vor? Sie fangen erst nach der Entscheidung an zu denken. Sie stellen
dann hinterher das, was sie getan haben, wieder infrage. Sie
schämen sich wegen ihrer Gutgläubigkeit und Impulsivität. Es
kann leicht dazu kommen, dass sie sich ganz zurückziehen.
In diesem Fall fehlte – wie wir aus dem Gleichnis erkennen – das
rechte Verständnis. Der Verstand kam nicht zu seinem Recht: Die
Entscheidung konnte einer genaueren, verstandesmäßigen Prüfung
nicht standhalten. Aus irgendeinem Grund sind diese Menschen
vom Verstand her noch nicht zu einer verbindlichen Beziehung mit
Jesus Christus bereit.
3. Einige Samenkörner fallen in die Dornen. Hier geht der Same
auf, eine Schlacht scheint gewonnen, neues Leben hat be gonnen.
Aber andere Samenkörner liegen noch unbeobachtet auf dem gleichen
Weg. Sie sind »die Sorge der Welt« und »der Betrug des Reichtums«.
Es sind Sorgen und ehrgeizige Pläne. Der Wille hält an
zusätzlichen Bindungen und Neigungen fest. Dadurch wird die
positive Reaktion auf das Evangelium wieder zunichtegemacht.
Warum entschließt sich ein solcher Mensch überhaupt, Christ
zu werden? Er trifft diese Entscheidung vielleicht deswegen, weil
ihm die Gegenargumente ausgegangen sind. Vom Verstand her
kann er keine guten Gründe mehr dagegen finden, Christ zu werden,
selbst wenn er es eigentlich gar nicht will.
131
Normalerweise ist es nicht allzu schwer, die Argumente eines
Menschen gegen das Evangelium zu zerstreuen. Es ist möglich,
dass unser Gesprächspartner dann einfach aufgibt und sagt: »Sie
haben gewonnen!« Er beugt sich dann vor der Wahrheit, aber er
unterstellt sein Leben damit noch lange nicht Jesus Christus. Sein
Wille ist ungebrochen.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie einfach es für Gott
wäre, jedem Menschen seine Existenz zu beweisen? Oder denken
Sie an Jesus – warum ging er nicht wenigstens einmal nach seiner
Auferstehung in den Tempel nach Jerusalem, hielt da eine Rede vor
den Leuten, die ihn noch vor drei Tagen getötet hatten?
Stattdessen beschränkte sich Jesus darauf, diejenigen zu be -
suchen, die sowieso schon an ihn glaubten. Wäre er in den Tempel
gegangen, hätte die ganze Welt anerkannt, dass er der Messias
ist. Warum tat er das nicht? Ich glaube, weil er nicht an dieser Art
Reaktion in teressiert war: Die Menschen hätten gegen ihren Willen
vor seiner Sou veränität kapitulieren müssen. Er hätte keinen
Glauben und keine Liebe hervorgerufen, nur zähneknirschendes
Akzeptieren der Wahrheit seiner Botschaft.
Es wird einen Tag geben, an dem das geschehen wird, was ich
gerade beschrieben habe. Aber es wird der Tag des Gerichts sein.
Außerdem kann sich jemand für Christus entscheiden, weil er
denkt, er könnte dann immer noch seinen eigenen Willen durchsetzen
und Kompromisse eingehen. Aber das ist eine Illusion, denn
wir können zu Gott nur zu seinen Bedingungen finden oder überhaupt
nicht. Jesus war während seines dreieinhalbjährigen Dienstes
zeitweilig beim Volk sehr beliebt. Die Massen folgten ihm überallhin.
Seine Reden gefielen ihnen, und sie waren von seinen Wundern
fasziniert. Sie wollten ihn zum König machen. Von außen
betrachtet, war Jesus sehr erfolgreich. Jesus ließ sich aber nicht
von dem Jubel der Menge beeindrucken. Im Gegenteil: Er stieß die
Leute bewusst vor den Kopf mit einer Reihe von sehr harten Aussagen
und Ansprüchen. Sie waren verletzt und beleidigt und gingen
zurück nach Hause (vgl. Johannes 6,25-66).
132
Was war das Problem? Die Leute folgten Jesus aus falschen
Beweggründen. Jesus sagte ihnen: Wenn sie nicht bereit wären,
ihn als die einzige Quelle des ewigen Lebens anzunehmen, dann
wollte er sie nicht als seine Jünger haben. Obwohl sie Jesus gernhatten,
waren sie nicht bereit, ihn zum Mittelpunkt ihres Lebens zu
machen. Schockiert durch seine hohen Anforderungen gingen sie
weg. Der Eigenwille war schon immer das größte Hindernis zum
persönlichen Glauben an Gott. Und deshalb ist auch das Grundproblem
des Menschen seit dem Sündenfall seine willentliche Auflehnung
gegen Gott. Satan sagte zu Eva: »Ihr werdet sein wie Gott«
(vgl. 1. Mose 3,5). Das war ein verlockendes Angebot! Sich gegen
Gott auflehnen, bedeutet, dass man sein eigener Gott sein will (vgl.
Jesaja 53,6).
Gott kann nur begrenzt in einem Menschen wirken, der aufbegehrt.
Er schuf uns mit einem freien Willen – er kann und will
unsere Freiheit nicht einschränken. Wir sehen das zum Beispiel an
der Art und Weise, wie Gott sein Volk Israel inständig bittet: »Denn
warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen
am Tod des Sterbenden, spricht der Herr, HERR. So kehrt um
und lebt!« (Hesekiel 18,31-32). Oft tun wir bei unserem Evangelisieren
so, als ob Unkenntnis das größte Hindernis zum Glauben wäre.
Es ist ein Hindernis, jedoch nur ein zweitrangiges. Stellen Sie sich
vor, wie leicht es sonst wäre, Ihre ganze Stadt mit dem Evangelium
zu erreichen, wenn die Aufgabe nur darin bestünde, diejenigen zu
informieren, die vom Evangelium noch nichts wissen. Aber Errettung
bedeutet, dass sich jemand mit seinem ganzen Wesen Christus
unterwirft. Es kann keinen anderen Weg geben.
4. Der vierte Boden ist die gute Erde. »… der das Wort hört und
versteht …« Wir wissen, dass jemand gutes Erdreich hat, wenn er
Frucht bringt. Wir wissen auch, dass da, wo Frucht ist, Leben ist.
Woher bekommen wir Gewissheit darüber, dass ein neues, geistliches
Leben begonnen hat? Woher wissen wir, dass ein Baby geboren
wurde? Das Leben spricht für sich selbst. Wenn jemand Christ
wird, empfängt er gleichzeitig den Heiligen Geist (vgl. Römer 8,9).
133
Ist es möglich, dass der Schöpfer all dessen, was lebt, dass der, der
alle Macht und Weisheit besitzt, in ein Menschenleben kommt,
ohne dass man etwas davon bemerkt? Der Beweis für geistliches
Leben besteht nicht einfach darin, dass man auf bestimmte Fragen
die richtigen Antworten weiß. Es erweist sich vielmehr an den
Früchten des Geistes: »Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit,
Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit« (Galater 5,22-23).
Ein junger Christ bekommt die Heilsgewissheit aus derselben
Quelle – vom Heiligen Geist:
»… und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den
Geist, den er uns gegeben hat« (1. Johannes 3,24).
134
20. Einflussreiche Kräfte bei der Bekehrung
Der Christ, der Heilige Geist und die Bibel
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Haupthindernis zum
Glauben die Auflehnung und nicht die Unkenntnis ist. Wenn das
stimmt, dann wird es sehr darauf ankommen, mit welchen Mitteln
Gott den Menschen zu sich zieht – was er unternimmt, um diese
Rebellion zu überwinden. Wie wir schon gesehen haben, greift
Gott in das Geschick von Völkern ein und wirkt durch Umstände
und Ereignisse, um Menschen für seine Botschaft vorzubereiten.
Außerdem hat Gott noch andere Einflussmöglichkeiten zur Verfügung:
den Heiligen Geist, die Bibel und den Christen. Das sind
die drei grundlegenden Werkzeuge, die Gott gebraucht, um Menschen
mit sich zu versöhnen.
Wir haben auch schon darüber nachgedacht, wie Gott den
Christen auf drei verschiedenen Ebenen einsetzt: durch das Zeugnis
seines Lebens, durch das gemeinschaftliche Zeugnis der Christen
und durch das gesprochene Zeugnis des Einzelnen. In diesem
Kapitel werden wir noch zwei andere einflussreiche Kräfte be -
trachten: den Heiligen Geist und die Bibel.
Der Heilige Geist
Zu Beginn unseres Dienstes in Curitiba 1964 war ich fast überwältigt
von der geistlichen Not in Brasilien – mir war klar, dass ich
etwas unternehmen musste. Neben den Versuchen, Kontakte zu
den Menschen dort zu bekommen, hatten wir jedoch auch noch
unser Familienleben zu bewältigen. Eines Tages, als ich auf dem
Gipfel meiner Frustration angekommen war, schrieb ich in mein
Tagebuch: »Ich bin jetzt ein ›ausgewachsener‹ Missionar. Ich habe
ein Haus, ein Auto und eine Kamera. Das Einzige, was mir fehlt,
135
sind die Menschen!« Wir waren Ausländer, Fremde in der Stadt
und kannten keine Menschenseele. Ich suchte verzweifelt nach
etwas, was ich tun konnte, um eine Daseinsberechtigung zu haben.
Ich entdeckte bald, dass es nicht schwer ist, eine Beschäftigung
zu finden, wenn man nicht wählerisch ist. Es taten sich Möglichkeiten
zum Kontakt auf. Aber während ich an diese offenen Türen
dachte, gab Gott mir einen beunruhigenden Gedanken aus Matthäus
15,13. Dieser Vers ließ mich bei all meinen Aktivitäten nicht
mehr los, und er spricht auch noch heute zu mir. Jesus sagte: »Jede
Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen
werden.« Wie einfach ist es doch, aus einem falsch verstandenen
evangelistischen Pflichtbewusstsein heraus irgend etwas
zu machen! Oder weil wir darum gebeten wurden und nicht Nein
sagen konnten, oder weil wir das Gefühl hatten, wir müssten aktiv
sein. Mir wurde klar: Wenn Gott nicht mit mir wäre in meinen
Aktivitäten, dann wären sie vergeblich. Nichts würde übrig bleiben.
Ich entschied mich, die Möglichkeiten, die ich sah, nicht zu
nutzen, sondern auf Gott zu hören. Er musste den ersten Schritt
tun und die Sache in Gang bringen. Ich wurde immer ver zweifelter,
und meine Abhängigkeit vom Heiligen Geist erreichte eine neue
Stufe. Ich sah mir einige Verheißungen in Jesaja 45,13-14 an. Sechs
Monate lang begann ich jeden Morgen damit, diese Verse zu lesen,
darüber zu beten und sie als Verheißungen für unsere Arbeit in
Brasilien in Anspruch zu nehmen. Jesus sagt: »… außer mir könnt
ihr nichts tun« (Johannes 15,5). Wenn der Heilige Geist nicht
deutlich er kennbar in unseren Aktivitäten dabei ist, dann sollten
wir he rausfinden, was falsch läuft, oder damit aufhören. Nachdem
Jesus auferstanden war, sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten
nach Jerusalem gehen und auf den Heiligen Geist warten (vgl.
Lukas 24,49). Das war alles, wozu sie fähig waren, bis der Heilige
Geist auf den Plan trat.
136
Die Rolle des Heiligen Geistes bei der Bekehrung
In Johannes 16,7-11 beschreibt Jesus, welche Rolle der Heilige Geist
bei der Versöhnung spielt. Er sagt, dass er den Jüngern den Heiligen
Geist senden würde und dass dieser die Welt über führen
würde »von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht«
(Jo hannes 16,8). Es sind genau diese drei Bereiche, die in dem »Erdreich«
des menschlichen Herzens verändert werden müssen, damit
der gute Same, d. h. das Wort Gottes, darin Frucht bringen kann.
Jesus holt weiter aus, indem er drei Zusammenhänge zwischen
Ursache und Wirkung beschreibt: »Von Sünde, weil sie nicht an
mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe
[…]; von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist«
(Johannes 16,9-11).
Die Beziehung von Ursache und Wirkung ist in diesen Versen
nicht sofort erkennbar. Was hat Überführung von Sünde durch den
Heiligen Geist mit Unglauben zu tun? Es gibt hier eine sehr enge
Verbindung, denn Unglaube ist die Wurzel aller Sünde. Unglaube
bedeutet so viel wie Auflehnung gegen Gott. In Lukas 16 lesen
wir von einem reichen Mann, der sich, nachdem er in den Hades
gekommen war, um seine Brüder sorgte. Er bat daher darum, dass
Lazarus, der Bettler, der vor seiner Tür gelebt hatte und ebenfalls
gestorben war, zu seinen Brüdern auf die Erde gesandt würde, um
sie zu warnen. Abrahams Antwort auf diese Bitte war mehr als
ungewöhnlich: »Sie haben Mose und die Propheten (das Alte Testament);
mögen sie auf diese hören. […] Wenn sie nicht auf Mose
und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden,
wenn jemand aus den Toten aufersteht« (Lukas 16,29.31).
Hier wird wieder deutlich, dass das Hauptproblem des Menschen
nicht seine Unwissenheit, sondern seine Auflehnung gegen
Gott ist. Wenn Menschen die frohe Botschaft, die sie gehört haben,
nicht glauben, dann deshalb, weil sie nicht wollen. Deshalb sendet
Gott den Heiligen Geist, um sie von ihrer Sünde zu überzeugen.
137
Was sagt Jesus weiter über Ursache und Wirkung? Er sagt,
dass der Heilige Geist die Menschen von ihrer Schuld überzeugt:
»… von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe«
(Jo hannes 16,10). Welche Beziehung sehen wir hier? Einfach dies,
dass Jesus der vollkommene Maßstab für Gerechtigkeit ist. Sein
Leben ist eine De finition von Gerechtigkeit. Während Jesus leibhaftig
in dieser Welt war, trat die Ungerechtigkeit des Menschen
offen zutage. Durch das, was er sagt, unterstrich er dies noch: »Ich
bin das Licht der Welt« (Johannes 8,12). Und: »Noch eine kleine
Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt,
damit nicht Finsternis euch ergreife!« (Johannes 12,35).
Als Jesus diese Welt verließ, schickte er den Heiligen Geist als
seinen Stellvertreter. Heute ist der Heilige Geist der Maßstab für
das, was wahre Gerechtigkeit ist. Er zeigt dem Menschen in seinem
Herzen, wie weit er von dem Ideal entfernt ist.
Und die Beziehung von Ursache und Wirkung bei der dritten
Aussage: »… von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt ge richtet
ist« (Johannes 16,11)? Wir leben in einer gefallenen Weit, die von
Sünde geplagt wird – die ganze Schöpfung wird gerichtet werden.
Satan, der Fürst dieser Welt, ist schon tödlich getroffen. Und trotzdem
lebt und handelt der Nichtchrist von heute so, als wären seine
Leistungen und sein Besitz ewig. Der Heilige Geist kann ihm unter
anderem seine unsichere Situation, die Sinnlosigkeit und kurze
Dauer seines Lebens bewusst machen.
Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Ge -
richt. Welch eine Erleichterung für uns, zu sehen, dass diese Verantwortung
auf ihm liegt – und nicht auf uns!
138
Die Rolle der Bibel bei der Bekehrung
Die Bibel ist unsere Autorität. Sie allein kann den Argumenten des
Nichtchristen standhalten. Unsere Aufgabe als Zeugen ist nicht, die
Bibel zu verteidigen, sondern ihr eine Gelegenheit zu geben, damit
sie wirken kann.
Aber wie gehen wir mit Nichtchristen um, die die Autorität der
Bibel nicht anerkennen wollen? Die Position der Nichtchristen
beweist entweder ihren Unglauben oder ihre bewusste Ablehnung
der Autorität der Bibel. Was sagen wir ihnen?
Wir sollten uns nicht in eine Diskussion über Inspiration und
Autorität der Bibel hineinziehen lassen. Nicht, weil dies kein wichtiges
Thema ist, sondern weil man damit nicht beginnen sollte. Bei
den Wahrheiten des Evangeliums sollte man eine gewisse Reihenfolge
beachten und das Pferd nicht von hinten aufzäumen!
Einer unserer Freunde, Jorge, wurde Christ. Kurze Zeit später
nahm auch seine Verlobte, Elisa, Christus an. Elisas deutscher
Vater, der immer noch ein treuer Anhänger des Dritten Reiches
war, war entsetzt. Er kam zu uns nach Hause, um heraus zufinden,
wer wir waren und was wir mit seiner Tochter machten. Er war so
wütend, dass er in unserem Wohnzimmer einen Holztisch übersah
und dagegenlief. In seiner Wut (zum Teil wegen seiner Tochter,
zum Teil wegen des heftigen Schmerzes am Schienbein) ver -
kündete er laut, dass er jetzt die Bibel von vorne bis hinten lesen
wolle, um ihre Glaubwürdigkeit zu widerlegen. Er wolle im 1. Buch
Mose anfangen und alle Irrtümer und Widersprüche ge nauestens
notieren. Natürlich hat er das nicht durchgehalten. Er gab irgendwo
in der »Wüste« zwischen 3. und 4. Mose auf. In der Zwischenzeit
wurde Elisa eine reife Christin.
Fast alle Leute, mit denen wir in den vergangenen 17 Jahren über
das Evangelium sprachen, waren zuerst nicht bereit, die Autorität
und Inspiration der Bibel anzuerkennen. Trotzdem musste ich nur
selten über dieses Thema mit Nichtchristen reden. Gelegent liche
Fragen dazu drehten sich einzig um den geschichtlichen Hinter
139
grund und die Quellen der Bibel, wie sie entstand und wann sie
geschrieben wurde.18
Wenn ein junger Christ anfängt, die Bibel zu lesen, erweist sie
ihre Autorität, weil sie wahr ist; er beugt sich nach und nach ihren
Ansprüchen. Die Bibel bringt Licht und Wahrheit in die Themen,
die sie anspricht. Wenn sie Aussagen über den Menschen,
das Leben, die Gesellschaft und die Welt macht, dann klingen
ihre Worte wahr. Aber die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Sie
deckt die Irrtümer und die Inkonsequenz in unseren persönlichen
Anschauungen auf.
»Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer
als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis
zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als
auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen
des Herzens …« (He bräer 4,12).
Was sonst könnte ein Nichtchrist angesichts dieser leben digen, aufdeckenden
und prophetischen Fähigkeiten der Bibel tun, als an -
zuerkennen, dass sie wirklich Autorität hat? Er wird sich ent weder
Christus unterwerfen oder aber zugeben, dass er einfach nicht will,
dass Christus in seinem Leben herrscht.
Womit fangen wir an?
Womit fangen wir an, wenn wir diese positive Reaktion beim Nichtchristen
hervorrufen möchten? Die Antwort auf diese Frage hängt
ganz davon ab, wo unser Zuhörer steht. Was weiß und versteht er?
Was glaubt er bereits? In jedem Fall lässt sich die ganze christliche
Botschaft und auch das Christsein in zwei Fragen zusammen fassen.
18 F. Bruce, Die Glaubwürdigkeit der Schriften des Neuen Testaments, Bad Liebenzell:
Verlag der Liebenzeller Mission, 1976.
140
Unser Ziel ist, dass wir unserem Gesprächspartner – egal, wie er zu
diesen beiden Fragen steht – anbieten wollen, mit ihm zu sammen
die Bibel zu studieren. Es sind die Fragen, die Paulus Jesus bei seiner
Begegnung mit ihm auf dem Weg nach Damaskus stellte: »Wer bist
du, Herr?« und: »Was soll ich tun, Herr?« (Apostel geschichte 22,8.10).
Anders ausgedrückt heißen die beiden Fragen: Wer ist Jesus?
Und was will er, dass ich tun soll?
Wer ist Jesus?
Die zentrale Gestalt der Bibel ist der historische Jesus von Nazareth.
Jesus sagte: »Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch
meinen Vater erkannt haben; und von jetzt an erkennt ihr ihn und
habt ihn gesehen. […] Wer mich gesehen hat, hat den Vater ge -
sehen …« (Johannes 14,7.9).
Die Hauptaussage des christlichen Glaubens ist, dass es möglich
ist, Gott zu erkennen. Denn Gott hat den ersten Schritt gemacht
und die Kluft zwischen sich und dem Menschen geschlossen. Wenn
das nicht wahr wäre, wäre der Mensch bei der Suche nach Gott sich
selbst überlassen. Er hätte nur seine eigenen, schwachen fünf Sinne
zur Verfügung, und er könnte so Gott nie erkennen. Auf eine Kurzformel
gebracht: Entweder Jesus war Gottes Sohn, oder aber es ist
unmöglich, Gott zu erkennen. Im letzteren Fall wären wir verloren
in einer Welt, in der alles relativ ist.
Die Bibel sagt, dass Gott sich in der Geschichte auf verschiedenste
Weise geoffenbart hat, bis dieser Prozess mit der
Menschwerdung Jesu abgeschlossen wurde:
»Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise
ge redet hat […] durch die Propheten, hat er in diesen letzten
Tagen zu uns geredet durch den Sohn […] Er ist der Abglanz
seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens …«
(He bräer 1,1-3; Luther 1984).
141
»Das Ebenbild seines Wesens«: Können Sie nicht an die Existenz
Gottes glauben? Dann stellen Sie sich die Frage: Wer war Jesus?
Macht Ihnen die Gerechtigkeit Gottes Probleme? Dann schauen Sie
auf Jesus – wie sah seine Gerechtigkeit aus? Angesichts des Bösen
in der Welt – wie verhielt sich Jesus? Ist die Bibel das von Gott eingegebene
Wort? Was sagte Jesus dazu?
Bis wir nicht die grundlegende Frage nach der Person Jesu
Christi geklärt haben, können wir nichts Schlüssiges über andere,
nebensächlichere Dinge sagen. Aber wenn wir zu dem Schluss
kommen, dass Jesus Gott ist, werden wir entdecken, dass viele
unserer vorher schier unlösbaren Fragen auf einmal überflüssig
oder leicht erklärbar sind.
Die Bibel überzeugt den Menschen davon, dass Jesus Gott ist.
Der Apostel Johannes sagte, er hätte sein Evangelium ge schrieben,
»damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist,
und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen«
(Johannes 20,31; Schlachter 2000).
Jesus wies die ungläubigen Juden zurecht, weil sie das Grundanliegen
der Heiligen Schrift nicht verstanden. Er sagte zu ihnen:
»Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben
zu haben …« Aber Jesus fügte hinzu, dass die Schriften von ihm
zeugen (vgl. Johannes 5,39).
Die erste Aufgabe, die die Bibel bei der Bekehrung erfüllt, ist
also, eine Antwort auf die Frage »Wer ist Jesus?« zu geben. Wenn
wir diese Frage beantwortet haben, wird uns die zweite Frage
immer wichtiger.
Was will Jesus, dass ich tun soll?
Es ist ganz klar, dass sich diese zweite Frage erübrigt, wenn der
Nichtchrist die Schlussfolgerung zieht, dass Jesus nicht Gottes
Sohn ist. Aber wenn er davon ausgeht, dass Jesus der ist, der er
zu sein beansprucht, dann wird jedes andere Problem vom Tisch
142
gefegt und es bleibt nur noch die eine Frage: Was will Jesus, dass
ich tun soll?
Wenn die Menschwerdung Jesu wahr ist, wenn Gott wirklich
Mensch wurde, muss diese Tatsache von größter Bedeutung für
jeden Menschen auf der Erde sein. Logischerweise müssen wir fragen:
Was erwartet Jesus von mir? Für den Nichtchristen gibt es nur
eine mögliche Antwort: Glauben.
Eines Tages stellte die Menge, die Jesus nachfolgte, ihm eine
ähnliche Frage: »Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken?«
Jesus antwortete: »Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den
glaubt, den er gesandt hat« (Johannes 6,28-29).
Ich werde nie den Tag vergessen, an dem mir die Antwort auf
die erste Frage, »Wer ist Jesus?«, deutlich wurde. Die erste logische
Reaktion, die mir einfiel, war, dass ich auch die zweite Frage be -
antworten und beides in meinen Alltag umsetzen wollte. Ich kaufte
mir ein Notizbuch und schrieb mir wochenlang aus den Evangelien
jedes Gebot, das ich finden konnte, auf. Als mein Heft fast
voll war, war ich verzweifelt. Ich erkannte, dass ich all diese Gebote
niemals befolgen konnte oder mich auch nur an alle erinnern
konnte. Ich war mir der lebendigen Eigendynamik meines Stoffes
nicht bewusst. Die Bibel ist ein lebendiges Buch, das in unser Leben
hi neinspricht, sofern wir das Gelesene anwenden. Die Bibel wird
unter Einwirkung des Heiligen Geistes lebendig, je nachdem, wie es
der Einzelne gerade braucht. In Wirklichkeit werden wir beide Fragen
nie endgültig und erschöpfend beantworten. Ständiges Wachstum
im Leben eines Christen ergibt sich aus wachsender Kenntnis
der Person Jesu Christi. »Wer ist er?« und »Was will er, dass ich
tun soll?« – diese Fragen sollten bei jeder Gelegenheit in unserem
Leben vorrangig sein. Sie sind auch die wichtigsten Fragen, die wir
uns in der täglichen Stillen Zeit stellen.
143
Zusammenfassung
Um sich dem Nichtchristen mitzuteilen, bedient sich Gott des
Heiligen Geistes, der Bibel und des Christen. Alle drei haben ihre
besondere Funktion. Der Christ bezeugt das, was er gesehen und
gehört hat (vgl. 1. Johannes 1,1-3). Er bringt Nichtchristen mit der
Bibel in Berührung. Dann übernimmt der Heilige Geist die Arbeit,
um Überzeugungen zu bewirken. Durch das »lebendige und wirksame
Wort Gottes« (vgl. Hebräer 4,12) kann ein Mensch erst wiedergeboren
werden. Es ist wichtig, dass wir diese »Arbeitsteilung«
ganz klar sehen. Es ist nutzlos, wenn wir versuchen, die Arbeit des
Heiligen Geistes oder der Bibel zu tun. Wenn ein Mensch vom Heiligen
Geist überführt worden ist und eine geistliche Wiedergeburt
durch das Wort Gottes erlebt hat, können wir ganz sicher sein, dass
neues Leben entstanden ist. Es wird Frucht bringen. Wir hatten
dabei nur das Vorrecht, den Menschen mit Gott in Berührung zu
bringen.
144
21. Das Beispiel von Abrahao
Ihr könnt meine Fragen nicht beantworten
Gott erlaubt in dem Dienst der Versöhnung eine gewisse »Arbeitsteilung«.
Die Christen geben – einzeln und als Gemeinschaft –
Zeugnis durch ihr Leben und Reden. Sie bringen den Nichtchristen
in Hörweite des Wortes Gottes. Die Bibel offenbart die Wahrheit,
und sie bezeugt Jesus Christus. Der Heilige Geist überführt, führt
den Menschen zur Buße und gibt neues Leben.
Wie wirkt nun dies alles zusammen? Und noch genauer gefragt:
Wie können wir vorgehen, um bei unserem Evangelisieren diese
Möglichkeiten am besten zur Auswirkung kommen zu lassen?
Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen:
Abrahao war Landwirtschaftsstudent an der Universität von
Parana in Brasilien. Er studierte weniger, um eine Ausbildung zu
bekommen, als vielmehr, um an der Universität politische Unruhe
zu stiften – er war Kommunist. Im Studentenwohnheim wohnte er
ausgerechnet mit einem jungen Christen, der Jark hieß, zusammen.
Abrahao machte sich auf unbarmherzige Weise über Jark lustig, bis
dieser so frustriert war, dass er Abrahao in einen unserer offenen
Bibelkreise einlud. Abrahao hatte erreicht, was er wollte – die Möglichkeit,
noch mehr Unruhe zu stiften. Er setzte sich in eine Ecke
unseres Wohnzimmers, wo der Hauskreis stattfand, und gab sich
betont gleichgültig gegenüber allem, was gesagt wurde. Plötzlich,
als das Gespräch fast zu Ende war und jeder sich schon mehr da rauf
freute, einen Kaffee zu trinken, als weiter zuzuhören, meldete sich
Abrahao zu Wort. Er stellte dem Gruppenleiter eine gezielte Frage.
Der Leiter musste einen Augenblick lang überlegen. Diese Gelegenheit
nutzte Abrahao aus, um eine zweite Frage loszulassen. Jetzt
standen schon zwei unbeantwortete Fragen im Raum, der Leiter
war ganz verwirrt, und Schweigen griff um sich. Abrahao ließ noch
zwei oder drei Fragen vom Stapel, und am Ende wusste der Leiter
145
gar nichts mehr zu sagen. Darauf Abrahao: »Sehen Sie, Sie wissen
noch nicht einmal, wovon Sie sprechen. Sie können meine Fragen
nicht beantworten.«
In den folgenden Wochen ließ Abrahao kein Treffen des Hauskreises
aus. Er tat sein Bestes, um so viel Verwirrung wie nur möglich
zu stiften. Ich spielte mit dem Gedanken, ihn zu bitten, doch
nicht mehr zu kommen. Aber ich wollte noch ein letztes Mal versuchen,
mich mit ihm zu verständigen.
Ich fragte ihn am Ende eines Abends: »Abrahao, wie stehen deiner
Meinung nach die Chancen für mich?«
Er fragte mich, was ich damit sagen wollte. Ich fuhr fort: »Was
meinst du: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit
richtig liege, dass es Gott gibt?« Er lachte: »Null Prozent!«
Dann sagte ich: »Willst du damit sagen, dass du alles, was man
heute hier weiß, und alles, was noch unbekannt ist, erforscht hast
und dass du das ganze Weltall durchkämmt hast und jetzt hier stehen
kannst mit der Behauptung: ›Beruhige dich, es gibt keinen
Gott‹?«
»Das würde ich nicht behaupten.«
»Dann musst du also zugeben, dass es eine Chance gibt, dass ich
recht habe und du unrecht?«
Er stimmte zu. Dann bedrängte ich ihn: »Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ich richtig liege? 20 %?« – »Nein!« Ich handelte
mit ihm um 15 %, 10 %, und dann sagte ich: »5 % musst du mir aber
mindestens geben!«
Er fragte, worauf ich hinauswollte. Ich ant wortete: »Wenn ich
recht habe und du unrecht, dann bist du tot. Und da diese Möglichkeit
besteht, wäre das einzig Vernünftige für dich, nachzuprüfen,
wer von uns recht hat.«
Er fragte: »Wie kann ich das tun?«
Ich antwortete: »Indem du zu den Urquellen zurückgehst. Jeder,
der ernsthaft forscht, lässt die Sekundärquellen beiseite (= das, was
Menschen zu einem Thema gesagt haben) und prüft stattdessen die
Originaldokumente.«
146
»Welches sind die Urquellen des Christentums?«
»Die Bibel.«
»Ich glaube nicht an die Bibel!«
Ich antwortete: »Dann hast du einen Vorteil mir gegenüber.
Die Bibel ist das einzige Originaldokument, das wir als Christen
be sitzen. Wenn du die Bibel widerlegen kannst, hast du ge -
wonnen.«
»Was schlägst du vor?«
Ich erklärte: »Die Bibel ist ein dickes, klein gedrucktes Buch. Du
kannst es nicht wie irgendein anderes Buch von vorne bis hinten
lesen. Die Bibel ist wie eine Bibliothek, die 66 Bücher umfasst. Du
wirst Hilfe brauchen, um zu wissen, welches Buch du zuerst ›aus
dem Regal‹ nehmen sollst. Ich biete dir an, dir zu zeigen, wo du
nachschauen musst, und ich will dir helfen, zu verstehen, was die
Bibel sagt.«
Abrahao nahm mein Angebot an, und wir machten ein erstes
Treffen aus. Ich führte ihn in das Johannesevangelium ein. Ich bat
ihn zu Beginn, die ersten drei Verse des 1. Kapitels vorzulesen: »Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe,
und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist«
(Johannes 1,1-3).
Ich fragte Abrahao, ob er verstehe, was dort gesagt wird. Er verstand
es nicht. Ich fragte ihn: »Worauf bezieht sich ›das Wort‹?« Er
wusste es nicht, also stellte ich den Bezug her zu Vers 14: »Und das
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns …« Mit meiner Hilfe
verstand er, dass dieser Abschnitt von Jesus Christus spricht. Als er
verstand, dass die Bibel den Anspruch erhebt, dass Jesus ewig war
und dass er alle Dinge erschaffen hat, war er zum Kampf bereit.
Ich nahm ihm den Wind aus den Segeln: »Ich verlange nicht von
dir, dass du glaubst und akzeptierst, was hier geschrieben steht. Ich
möchte nur sichergehen, dass du verstehst, was die Bibel sagt. Tust
du das?«
Er antwortete: »Ja, aber …«
147
Ich sagte: »Gut, dann lass uns den nächsten Absatz lesen.«
Während der nächsten Wochen arbeiteten wir uns so von Ab -
schnitt zu Abschnitt vorwärts, aber Abrahao schien sich um keinen
Fingerbreit zu bewegen. Jeden Anspruch in Bezug auf Christus
wies er als Märchen oder als übertriebenen Bericht ab. Ich blieb bei
meinem Ziel, ihm Verständnishilfen zu geben in Bezug auf das, was
die Bibel über die Person Jesu Christi aussagt. Und so waren unsere
Treffen, trotz seiner Auflehnung, zwar spannungsgeladen, aber frei
von unnützen Diskussionen.
In dieser Zeit betete ich mit meinen Freunden gemeinsam
darum, dass der Heilige Geist sein Werk der Überführung an ihm
vollbringen soll.
Nach einigen Monaten konnte ich schon erste Anzeichen von
Veränderung an ihm bemerken. Abrahao hörte damit auf, die Bibel
ständig anzugreifen. Er sah langsam die Querverbindungen zwischen
den einzelnen Bibeltexten. Er veränderte sich allmählich
von einer im Allgemeinen negativen Person zu einer positiven. Er
meldete sich freiwillig in seinen Sommerferien als Mitarbeiter bei
einem Regierungsprojekt für Arme. Nach diesem Sommer trafen
wir uns als alte Freunde wieder, nicht länger als Feinde. Ohne ein
Wort nahmen wir unser Studium des Johannesevangeliums wieder
auf. Schließlich hielt ich es vor Neugierde nicht mehr länger aus.
Er hatte sich so stark verändert. Als wir gerade Johannes 13 lasen,
fragte ich ihn: »Sag mal, Abrahao, was ist passiert?«
»Tja, es ist wahr.«
»Was ist wahr?«
»Dass Jesus Gott ist.«
»Na und?«
»Ja, ich denke, ich bin jetzt Christ, aber ich muss dir eins sagen:
Ich bin politisch aktiv und vertrete eine regierungsfeindliche Position.
Außerdem bin ich anti-amerikanisch eingestellt. Meine
Freunde kritisieren mich, weil ich mit dir verkehre.«
»Und weiter?«
»Das ist alles. Ich wollte nur, dass du das weißt.«
148
»Denkst du, dass das etwas zwischen uns verändert?«
»Nein.«
Dann sagte ich: »Ich möchte dir gerne einen Vers zeigen. Er
befindet sich gerade in dem Kapitel, das wir jetzt lesen wollten.«
Wir schlugen Johannes 13,13 auf: »Ihr nennt mich Meister und Herr
und sagt es mit Recht; denn ich bin es auch« (Schlachter 2000).
Ich fragte Abrahao: »Was bedeutet es, dass Jesus unser Meister
ist?«
Seine Antwort war vollkommen richtig: »Es bedeutet, dass das,
was wir denken und glauben, von ihm kommen muss. Wir be -
ziehen unsere Ideen und Vorstellungen von ihm.«
»Akzeptierst du das für dich persönlich?«
»Ja.«
»Was bedeutet es, dass Jesus Herr ist?«
Wieder war seine Antwort ausgezeichnet: »Dass er der Chef ist!«
»Akzeptierst du das?«
»Ja.«
Wir haben nie mehr über Politik oder Wirtschaft diskutiert.
Abrahao und ich lebten jetzt unter ein und demselben Meister und
unter demselben Herrn – Jesus Christus. Beide von uns antworteten
auf denselben Ruf: »Seid würdige Nachfolger des Herrn!«
Was kann uns dieses Beispiel lehren? Unsere Aufgabe ist es,
einem Menschen zu helfen, die Bibel zu verstehen. Die Beweislast
liegt nicht auf unseren Schultern, sondern auf der Bibel. Die Verantwortung,
jemanden zu überzeugen, liegt beim Heiligen Geist,
nicht bei mir. Ich bin allerdings dafür verantwortlich, diesem Menschen
treu zu bleiben und ihn beständig mit dem Wort Gottes zu
konfrontieren, bis er eine endgültige Entscheidung – pro oder kontra –
getroffen hat.
Ich habe einen christlichen Freund, der zu den bewunderns -
werten Menschen mit großer Ausstrahlungskraft gehört. Jeder,
der ihn traf, war begeistert. Er wusste immer zur richtigen Zeit
das rechte Wort zu sagen. Überall gab er mit Leichtigkeit sein
Zeugnis und hinterließ Menschen, die brennend daran interes
149
siert waren, mehr zu hören. Als wir vor Jahren Freunde wurden,
dachte ich: Hier ist endlich einmal jemand, der einen Einfluss ausüben
wird.
Das Erwartete traf jedoch nicht ein. Einen säkularisierten Menschen
zu Christus zu bringen, erfordert Ausdauer und Hartnäckigkeit.
Es bedeutet, eine Beziehung aufzubauen und sie auch dann
aufrechtzuerhalten, wenn der Nichtchrist mit inneren Widerständen
zu kämpfen hat. In solchen Zeiten ist es nur unsere Be -
ziehung zu ihm, die ihn davon abhält, den Heiligen Geist weg -
zustoßen und davonzurennen.
Natürlich kostet das etwas: Es kostet sowohl Zeit als auch
gefühlsmäßige und geistliche Kraft. Wenn wir nicht von dem
e wigen Wert eines Einzelnen überzeugt sind, werden wir so etwas
niemals tun.
150
22. Einige Tipps für die Praxis
Wie fangen wir an?
In diesem Buch habe ich besonders betont, dass es im Neuen Testament
zwei Evangelisationsformen gibt: Verkündigung und ge -
lebtes Zeugnis. Die Verkündigung ist wesentlich, denn ihre Hauptaufgabe
besteht darin, einen Brückenkopf zu bilden. Einige Christen
haben auf dem Gebiet der Verkündigung besondere Gaben,
die bestmöglich genutzt werden sollten. Dennoch ist die Verkündigung
nur begrenzt wirksam, da sie nur relativ wenige Menschen
anspricht – nämlich diejenigen, die schon zu einem frü heren
Zeitpunkt vorbereitet wurden, um die christliche Botschaft bereitwillig
aufzunehmen.
Das gelebte Zeugnis ist jedoch un erlässlich, wenn wir einen
Schritt weiter über diese anfängliche Aufgabe, vorbereitete Menschen
zu erreichen, hinauswollen. Wenn wir das erkennen, werden
wir ganz anders an das Evangelisieren heran gehen. Jeder Christ in
der Gemeinde, im Leib Christi, kann sich bei dieser Form der Evangelisation
beteiligen. Das Weitergeben des Evangeliums kann zu
einem normalen und spontanen Bestandteil unseres Lebens werden.
Diese Form des Evangelisierens ist nicht nur etwas für Leute,
die gut reden können. Hier liegt die Hauptlast der Ver antwortung
beim Heiligen Geist; außerdem spielt jede Art von christlicher
Gemeinschaft eine wesentliche Rolle. Wenn wir das ver stehen und
uns danach richten, werden wir weniger Angst, Schuld, Frustration
oder Versagen in diesem Bereich erleben.
Wie können wir uns denn nun bei dieser Art der Evangelisation
persönlich einbringen? Um diese Frage zu beantworten, möchte
ich noch einmal die Hauptaussagen des Buches wiederholen und
gleichzeitig Anleitungen und Vorschläge zur Praxis geben. Ich liefere
kein ausführliches Handbuch, aber eine Liste von Vorschlägen
zum Nachdenken und Anwenden.
151
1. Schritt: Begreifen Sie die geistliche Not der Welt
in Ihrer nächsten Umgebung.
Wir müssen das Problem in seiner ganzen Tragweite erkennen. Es
gibt Milliarden von Menschen, die überhaupt nicht von unseren
üblichen evangelistischen Einsätzen erreicht werden. Aber das Problem
beginnt schon auf der Stufe des Einzelnen und ist dort noch
gewichtiger: Wir alle sind von Menschen umgeben, mit denen wir
überhaupt keinen Kontakt haben, die geistig und gefühls mäßig
Welten von uns entfernt sind. Gibt es in Ihrer Umgebung Menschen,
die Sie nicht mit dem Evangelium beeinflussen? Werden
übliche Evangelisationsmethoden sie je erreichen? Ist es Ihre Verantwortung,
zu ihnen zu gehen, um ihnen das Evangelium nahezubringen?
Höchstwahrscheinlich werden Sie bald in Ihrer eigenen
Nachbarschaft oder Ihrer Familie oder bei ganzen Bevölkerungsschichten
Ihrer Stadt viele Menschen entdecken, die nicht auf Ihre
herkömmliche Art zu evangelisieren reagieren werden.
2. Schritt: Verstehen Sie die Grenzen der Verkündigung.
Verkündigung ist zwar sinnvoll; sie hat aber auch ihre Grenzen.
Erinnern Sie sich daran, dass Paulus in seiner Verkündigung nur
zu denen sprach, die eine religiöse Tradition hatten und also schon
vorbereitet waren. Wenn Sie an die Menschen in Ihrer Umgebung
denken: Wie viele würden mit Ihnen zusammen an einer öffentlichen
Veranstaltung teilnehmen, um dort das Evangelium zu
hören? Wie viele von ihnen würden verstehen und bejahen, was sie
dort hören? Selbst auf die beste Darstellung des Evangeliums, zum
Beispiel von Tür zu Tür, reagieren nur wenige Menschen mit Glauben.
Wenn wir unsere Bemühungen um Verkündigung vergrößern,
erreichen wir höchstens mehr vorbereitete Menschen. Das ist zwar
auch ein wertvolles Ziel, aber wir wollen mehr.
152
Sie haben vielleicht eine besondere Begabung im Bereich der
Verkündigung. Ihr Zeugnis bringt Frucht hervor. Gott hat Ihnen
genügend Kontakte zu Menschen gegeben, die er vorher auf Ihr
Zeugnis vorbereitet hat. Sie sind zufrieden mit der Richtung, die
Sie eingeschlagen haben. Andere von Ihnen sind vielleicht auch
zufrieden mit Ihrem Evangelisationsstil; Sie merken jedoch, dass
viele Leute in Ihrer näheren Umgebung nicht auf das gesprochene
Zeugnis reagieren. Sie haben das Bedürfnis, einen größeren Kreis
von Menschen zu erreichen.
Wieder andere fühlen sich frustriert in Sachen Evangelisation.
Im Laufe Ihres Lebens als Christ sind Sie immer wieder herausgefordert
worden, dass es doch Ihre Pflicht ist, Zeugnis zu geben.
Sie merken jedoch, dass Sie diese Gabe nicht haben. In diesem
Bereich Ihres Lebens haben Sie nur Niederlagen erlebt.
Eine andere Gruppe von Christen gehört vielleicht sogar zu
denjenigen, die überhaupt keine Hoffnung an diesem Punkt mehr
haben. Gott hat Sie in eine Umgebung gestellt, in der es so gut wie
keine vorbereiteten Menschen gibt. Ihre Schulung für Evangelisation
und Ihre bisherigen Erfahrungen beschränkten sich nur auf
Verkündigung, und das scheint hier nicht zu funktionieren. Viele
Missionare befinden sich in einer solchen Situation.
3. Schritt: Engagieren Sie sich bei der Evangelisation
durch Ihr gelebtes Zeugnis.
a) Erwarten Sie beim Evangelisieren nicht so schnell Bekehrungen.
Bedenken Sie, dass es sich um einen Prozess handelt. Der
Ernte geht das Pflanzen, das Bewässern und das Pflegen voraus.
Seien Sie bereit dazu und geben Sie sich damit zufrieden, nur bei
einer Etappe in diesem Prozess mitzuarbeiten. Für un vorbereitete
Menschen ist es ein langer Weg bis in das Reich Gottes. Versuchen
Sie, Ihren Bekannten zu helfen, damit diese den nächsten
Schritt auf die Bekehrung zu tun können, auch wenn sie nicht
153
gleich zu Gott Ja sagen. Erzwingen Sie keine oberflächlichen
Bekehrungen.
b) Bauen Sie Ihr Leben auf das Fundament des Wortes Gottes.
Wir haben schon davon gesprochen, dass wir mit unserem
Leben eine attraktive Alternative anbieten wollen – dass wir unser
Leben und unseren Glauben in Einklang bringen wollen und
mit unserem Leben gute Zeugen Christi werden. Unser gesamtes
Wertsystem, d. h. unsere moralischen und philosophischen An -
schauungen, sollten mit der Bibel übereinstimmen. Machen wir
doch unser Zeugnis nicht zu einer Karikatur, sondern lassen wir es
einen Hinweis auf Gottes Gnade sein.
Natürlich ist es unmöglich, hier Vollkommenheit zu er reichen.
Aber wenn wir uns ehrlich bemühen, in das Bild Christi verwandelt
zu werden, werden wir uns deutlich von der Welt abheben.
Es ist weder nötig noch erstrebenswert, vollkommen zu sein.
Paulus erkannte das: »Nicht, dass ich es schon ergriffen habe
oder schon vollendet sei …« (Philipper 3,12). Wir sollen der Welt
keine Vollkommenheit zeigen, sondern die Gnade Gottes. Wir
sollen den Glauben – trotz unserer Fehler – mit unserem Leben
weiter geben. Wenn wir uns als fromm und vollkommen ausgeben,
werden wir andere nur entmutigen. Wir sind doch unvollkommen
und haben Fehler, aber wir sind erlöst.
c) Stellen Sie sich den Problemen wie Abkapselung, Angst und An
passung.
Wenn Ihre Absonderung von der Welt zur Abkapselung ge -
worden ist, dann ändern Sie Ihren Lebensstil. Jesus war ein Freund
der Sünder und Zöllner. Wir müssen ebenfalls die Menschen so
akzeptieren, wie sie sind. Seien Sie realistisch in Bezug auf die
Menschen, und erwarten Sie nicht zu viel. Sie sind keine Christen
und werden sich dementsprechend verhalten. Versuchen Sie nicht,
sie umzukrempeln. Jemanden zu akzeptieren, heißt nicht, sein
Verhalten gutzuheißen. Der Unterschied zwischen Ihren Wert
154
vorstellungen und denen der Nichtchristen wird bald offen zutage
treten. Aber achten Sie darauf, dass dieser Unterschied auf in der
Schrift verwurzelten Dingen beruht und nicht auf neben säch lichen,
persönlichen Überzeugungen. Es ist unsere Ver antwortung, uns an
sie anzupassen – aber auf dem Boden der klaren Gebote Jesu. Tun
Sie alles, damit sich der andere bei Ihnen wohlfühlt. Seien Sie »allen
alles« (vgl. 1. Korinther 9,22). Erinnern Sie sich: Die Heiligung ist
eine Herzenshaltung und hat nichts mit der Um gebung zu tun. Vermeiden
Sie es, zu beurteilen, zu predigen, zu ver urteilen oder zu
moralisieren. »Nein, danke« ist eine sehr viel bessere Antwort als
»Ich rauche nicht, denn ich bin Christ und die Bibel sagt …« Das
Gebet vor dem Essen ist nicht zwingend ein gutes Zeugnis, wenn
es Ihren Gast in Verlegenheit bringt. Seien Sie gnädig, nicht gesetzlich!
Seien Sie sensibel dafür, wie Ihr Verhalten auf andere wirkt.
Lieben Sie die Menschen, wie sie sind, und zwar als einzelne, wertvolle
Personen, nicht als »Bekehrungsobjekte«. Lieben und be jahen
Sie, passen Sie sich an. Seien Sie ein Freund. Wir haben davon
gesprochen, dass wir unsere Haltung ändern wollen. Wir werden
uns auch andere Prioritäten setzen müssen. Gute Beziehungen mit
Menschen aufzubauen, erfordert Zeit. Die meisten Christen sind
unglaublich beschäftigt. Eine radikale Ver änderung in unserem
Terminkalender wird nötig sein.
Ein mir bekannter Prediger sagte seinen Gemeindegliedern,
dass ein Abend in der Gemeinde jede Woche genug ist, sonst würden
sie kostbare Zeit verlieren, die sie mit Nichtchristen verbringen
könnten. Wenn Ihr Nachbar mit Ihnen Pizza essen gehen will und
Sie in der Woche keinen freien Abend mehr haben, wird er eine
weitere Einladung nicht mehr wagen. Ein Schlüsselbegriff für den
Aufbau von Beziehungen ist »Zeit haben«.
d) Suchen Sie sich einige Gleichgesinnte.
Es gibt nur wenige von uns, die irgendetwas alleine bewerkstelligen
können. Wir brauchen gegenseitige Ermutigung und
Unterstützung. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Wir müssen
155
einander helfen, die richtigen Ziele zu verfolgen, und können nur
als Gemeinschaft wirksam handeln. Im Verlauf der Evangelisation
durch das gelebte Zeugnis wird es Zeiten geben, in denen es nötig
ist, die Nichtchristen mit anderen Christen zusammenzubringen.
Eine Institution kann diese Aufgabe bei säkularisierten Menschen
nicht übernehmen. Dieser Kontakt mit anderen Christen ist aus
folgenden Gründen sehr wichtig:
• Er verstärkt Ihr Zeugnis und gibt ihm mehr Glaubwürdigkeit.
• Er vergrößert die Möglichkeiten zum Zeugnis, denn nicht
jeder von uns hat die gleiche Gabe, sich auszudrücken.
• Ein anderer in der Gruppe kann sich vielleicht in einer
bestimmten Situation treffender und verständlicher ausdrücken.
So wird also diese Art des Evangelisierens eine Sache der
Gemeinschaft oder Gruppe. Jeder, der sich irgendwie in die Gruppe
einbringt, nimmt also an dem Evangelisationsprozess teil. Jeder
gebraucht seine Gaben und stellt sie in den Dienst der an deren.
Werfen Sie doch alle Ihre Gaben und Möglichkeiten in einen Topf.
Setzen Sie sich einmal zusammen und überlegen Sie, welche Gabe
jeder Einzelne hat.
e) Bereiten Sie sich darauf vor, das Evangelium auch mit Worten weiterzugeben.
Wenn schon die einfache Darstellung des Evangeliums nachweisbare
Erfolge bei den vorbereiteten Menschen erzielt, so ist auch
das gesprochene Zeugnis ein wesentlicher Bestandteil der Evangelisation
durch unser Leben. Es wird auf verschiedenen Ebenen zu
diesem gesprochenen Zeugnis kommen:
• gelegentliche Bemerkungen über den Einfluss Christi in un -
serem Leben und auf unsere Wertmaßstäbe;
• persönliches Zeugnis, wie wir Christus begegnet sind;
• klare Darstellung der Botschaft, die Gottes Versöhnungsplan
zusammenfassend erklärt;
156
• Studium der Schrift mit einer Person oder mehreren Personen
mit dem Ziel der Evangelisation.
Schauen Sie noch einmal auf diese Liste: Wo entdecken Sie
Schwächen und Fehler bei sich? In welchem dieser Punkte möchten
Sie gerne Fortschritte machen? Was könnten Sie tun, um das zu
erreichen? Wen kennen Sie, der Ihnen dabei helfen könnte? Welche
Bücher könnten eine Hilfe sein?
Das Ziel ist, unseren Glauben natürlich mitzuteilen. Das er -
fordert Vorbereitung und Erfahrung. Fangen Sie damit an. Wenn
es Ihnen über den Kopf zu wachsen scheint, holen Sie sich Rat und
Hilfe von jemandem, der schon mehr Erfahrung hat. Beobachten
Sie, wie diese Person es macht, und bald werden Sie es ebenso gut
beherrschen.
f) Ergreifen Sie von sich aus die Initiative und bauen Sie Beziehungen
auf.
Es ist schon ein großer Schritt vorwärts, wenn wir Augen für die
Menschen um uns her bekommen. Seien Sie der Erste, der »Guten
Tag« sagt. Seien Sie freundlich. Bauen Sie eine Vertrauensbasis auf.
Suchen Sie Gemeinsamkeiten. Eine Beziehung kann entstehen,
wenn zwei Menschen gemeinsame Interessen und/oder Schwierigkeiten
haben. Das wird Sie Zeit kosten und einen Teil Ihres Privatlebens,
aber wie können andere Menschen Gottes Gnade in uns
erkennen, wenn wir immer unseren »Sicherheitsabstand« wahren?
Lieben Sie! Gottes Liebe zum Menschen stellte keine Bedingungen.
Seine Liebe zeigt sich durch uns, wenn wir uns dafür hin geben,
das Gute in dem anderen zu sehen, egal wie er auf uns reagiert (vgl.
1. Johannes 3,16-18). Es liegt auf der Hand, dass Lieben und Dienen
eng miteinander verknüpft sind. Wenn Sie die Frage beantworten:
»Wie kann ich dieser Person dienen?«, beantworten Sie gleichzeitig
die Frage: »Wie kann ich sie lieben?«
Stärken Sie Ihre neu geknüpften Beziehungen und bereichern
Sie sie dadurch, dass Sie andere gleichgesinnte, christliche Freunde
mit einbeziehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir zu einer Grill
157
party einladen, in ein Jazzkonzert gehen oder einen Bibelgesprächskreis
durchführen.
g) Wählen Sie bestimmte Personen aus und beten Sie für sie.
»Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt
über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe […]
Dann spricht er zu seinen Jüngern: […] Bittet nun den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende« (Matthäus 9,36-38).
Sind Ihnen die Menschen, die ohne Gott verlorengehen, gleichgültig?
Fangen Sie doch an, die Menschen in Ihrer Umgebung zu
beobachten. Beten Sie. Bitten Sie Gott, konkret einzugreifen. Bieten
Sie ihm Ihre Dienste an und warten Sie ab, was passiert! Zuerst
wird er Sie wahrscheinlich auf einige bestimmte Menschen aufmerksam
machen. Er möchte, dass Sie für diese einzelnen Menschen
beten. Seien Sie treu darin. Beten Sie durch jeden Schritt des
Prozesses, vom Beginn des ersten Kontakts über eine offene Tür
zum Hören der Botschaft bis zu der Überführung durch den Heiligen
Geist in Bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Beten
Sie anhaltend und erwartungsvoll (vgl. Lukas 11,9-10). Georg Müller
schrieb einmal: »Das Wichtigste ist, dass man nie aufgibt, bis die
Antwort auf unser Gebet kommt. Ich habe 52 Jahre lang jeden Tag
für zwei Männer, Söhne eines Jugendfreundes, gebetet. Sie haben
sich noch nicht bekehrt, aber sie werden es tun! […] Die Christen
begehen den großen Fehler, dass sie nicht anhaltend beten. Sie
geben zu früh auf, weil sie kein Durchhaltevermögen haben. Wenn
sie wirklich etwas zu Gottes Ehre wünschen, dann sollten sie so
lange beten, bis Gott ihr Gebet erhört.«19
Einer dieser Männer bekehrte sich bei Georg Müllers Be -
erdigung, der andere einige Jahre später.
19 Georg Müller, George Mueller: Man of Faith, Warren Myers, 12 Siglap Close,
Singapore 15, S. 9.
158
h) Laden Sie Ihre Freunde ein, mit Ihnen zusammen in der Bibel zu
lesen.
Sie haben von Anfang an klar gesagt, woher Sie Ihren Lebensstil
beziehen. Ihre Freunde wissen, dass er auf der Bibel beruht. In
dem Maße, wie die Echtheit und Anwendbarkeit der Bibel in Ihrem
Leben sichtbar wird, wird die Neugierde und das Interesse Ihrer
Freunde zunehmen. Oft ist es eine Frucht Ihrer Gebete und Ihrer
praktizierten Liebe, die einen Menschen dazu bringt, Ihre Einladung
bereitwillig anzunehmen – als wenn er nur darauf ge wartet
hätte, dass Sie ihn einladen. Seien Sie offen und ehrlich in Ihrer Einladung.
Denken Sie daran: Sie wollen keine sofortige Entscheidung
für Christus erzwingen, sondern dem anderen nur die Möglichkeit
geben, selber aus erster Hand das Wort Gottes und den Sohn
Gottes kennenzulernen.
Bibellesen kann mit einem Einzelnen, mit einigen Ehe paaren
oder in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Wenn Sie sich
nicht zutrauen, selber ein Bibelstudium zu leiten, dann tun Sie sich
mit jemandem zusammen, der das kann. Aber wenn Sie es möglicherweise
doch können, dann tun Sie es selbst. Es gibt einige
Bücher, die hierzu Anleitung geben.20
Oder studieren Sie einfach
mit jemandem das Johannesevangelium oder den Römerbrief.
i) Rechnen Sie mit dem Wirken des Heiligen Geistes.
Lassen Sie ihm Zeit, zu arbeiten. Übernehmen Sie seinen Zeitplan,
nicht den Ihren. Ihre Aufgabe ist es, die Botschaft der Schrift
klar darzulegen. Danach muss der Heilige Geist weiter an diesem
Menschen wirken.
Achten Sie auf die Umstände, die im Leben eines Menschen eintreten,
der anfängt, in der Bibel zu lesen. Oft verschlechtert sich
seine Lage, und das ist ein Zeichen dafür, dass er mit seiner grundsätzlichen
Auflehnung gegen Gott zu kämpfen hat. Oder er gerät
in eine Krise und verliert die Kontrolle über sein Leben. Fassen Sie
20 Zum Beispiel Wie leite ich eine Bibelstudiengruppe?, Die Navigatoren, 1974.
159
Mut! Gott gebraucht solche Krisenzeiten, um uns unsere Bedürfnisse
klarzumachen und uns wachzurütteln. Seien Sie als Freund
zur Stelle, wenn solche Dinge passieren. Die Geborgenheit, die ihm
Ihr Verständnis, Ihre Liebe und Ihre Freundschaft schenkt, ist in
solchen Zeiten gewöhnlich wichtiger als gute Ratschläge.
j) Halten Sie Kontakt zu ihm.
Seien Sie beständig. Das Einfachste an einem evangelis tischen
Bibelstudium ist die eigentliche Bibelarbeit selbst. Die größere
Schwierigkeit besteht darin, den Wunsch zu wecken, an dem
Bibelstudium teilzunehmen und das Interesse auch über eine längere
Zeitspanne aufrechtzuerhalten. Sie werden nicht weit kommen,
wenn Sie den Kontakt nur während des Bibelstudiums pflegen.
Achten Sie darauf, auch außerhalb der Treffen ein informelles
Beisammensein zu pflegen. Dazu gehört nicht viel. Eigentlich sollten
Sie es damit auch nicht übertreiben: »Mache deinen Fuß selten
im Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht satt wird und dich
hasst« (Sprüche 25,17). Ein Besuch von 10 Minuten kann schon
genügen, um die Beziehung weiter zu vertiefen und Zeit und Ort
für das nächste Treffen zu vereinbaren. Dieser Kontakt außerhalb
des Bibelstudiums ist wesentlich. Es sind vielleicht solche kurzen
Augenblicke, die den Weg für tiefere Gespräche bereiten.
Schlussbemerkung
1937 wurde die erste Auflage des Buches »Think and Grow Rich«
von Napoleon Hill veröffentlicht. Dieses Buch war das Ergebnis
von 20 Jahren Forschungsarbeit unter der Leitung von Andrew
Carnegie. Napoleon Hill interviewte im Rahmen dieser Forschung
Hunderte von den erfolgreichsten Unternehmern der USA: Männer
wie Henry Ford, Thomas Edison und John D. Rockefeller. Er
suchte den gemeinsamen Nenner, die gemeinsamen Eigen schaften,
die zu ihrem Erfolg geführt hatten. Nachdem er diese Qualitäten
160
entdeckt, interpretiert und eingeordnet hatte, präsentierte Hill sie
als eine Philosophie für finanziellen Erfolg. Seit 1937 wurden über
15 Millionen Exemplare von »Think and Grow Rich« verkauft – ein
Beweis für den enormen Erfolg und Einfluss, den dieses Buch auf
die US-amerikanische Gesellschaft ausgeübt hat. Ich halte dieses
Buch allerdings für extrem gefährlich: Im Wesentlichen besteht
Hills Schlussfolgerung darin, dass, wenn jemand den Wunsch hat,
reich zu werden, er nur eine Leidenschaft für Geld entwickeln
muss, um zum Ziel zu kommen. Er sollte viel über Geld nachdenken,
planen und alles opfern, um es zu bekommen. Das Geld
muss die höchste Priorität in seinem Wertsystem bekommen. Aber
ich gebe Hill in einem Punkt recht: Das, worauf ich heute versessen
bin, wird morgen Realität werden!
»Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das
Leben« (Sprüche 4,23; Luther 1984). Von welcher Idee sind Sie
erfüllt? Sind es Gottes Ideen? Was tut Gott? Er bringt alle Dinge
zurecht und versöhnt alles mit ihm selbst (vgl. Kolosser 1,15-20).
Das, worum es in diesem Buch geht – verlorene, säkularisierte
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen –, ist auch das, was
Gott am Herzen liegt. Es lohnt sich, von dieser Idee beseelt zu sein.
Ravensberger Bleiche 6 · 33649 Bielefeld
0521 947240 · [email protected] · clv.de
Christliche Literatur-Verbreitung
Bücher, die weiterhelfen
Evangelisation: ein Lebensstil
Jim Petersen
Paperback, 160 Seiten
Artikel-Nr.: 256741
ISBN / EAN: 978-3-86699-741-7
Gute Nachricht für abgekämpfte
Schlachtenbummler der Evangelisation: Keiner muss mehr blitzkriegartig aus seinen frommen
Kreisen hervorbrechen, um nach einem nervenaufreibenden Spektakel in den Schoß der
Gemeinde zurückzukehren. Jesus, um den es doch geht, hat uns eigentlich eine ruhigere Rolle
zugedacht: Unsere Umwelt ist das Mehl, wir sind der Sauerteig.
Wie macht man das – »mitten in der Welt«? Was hilft mir, um der anderen willen täglich meine
Grenzen zu verlassen, mein Sprechen, Denken und Handeln zu ändern? Wie öffne ich mein
Leben, meine Familie, mein Haus, damit andere sehen, wie es bei mir wirklich aussieht?
Antworten auf diese...
Wenn Sie ein "echtes" Buch bevorzugen oder diesen Artikel verschenken möchten, können Sie
diesen Download-Artikel ggf. auch käuflich erwerben, solange verfügbar.
Artikel ansehen auf clv.de Jim Petersen
Evangelisation:
ein Lebensstil
Christliche Literatur-Verbreitung e. V.
Ravensberger Bleiche 6 · 33649 Bielefeld
Wenn nicht anders vermerkt, sind die Bibelzitate der Elberfelder
Übersetzung 2003, Edition CSV Hückeswagen, entnommen.
1. Auflage 2021 (CLV)
(früher erschienen im Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH, Marburg)
Originaltitel: Evangelism as a Lifestyle
(heutiger Titel: Living Proof: Sharing the Gospel Naturally)
Originalverlag: NavPress / Tyndale House Publishers, Inc., USA
© der deutschen Ausgabe 2021 by CLV
Christliche Literatur-Verbreitung
Ravensberger Bleiche 6 · 33649 Bielefeld
Internet: www.clv.de
Übersetzung: Ulrike Rosier
Satz: EDV- und Typoservice Dörwald, Steinhagen
Umschlag: Lucian Binder, Marienheide
Druck und Bindung: ARKA, Cieszyn, Polen
Artikel-Nr. 256741
ISBN 978-3-86699-741-7
Otto Funcke Ein echter Mensch ein ganzer Christ, Arno Pagel

Im Kinderland
Längst ist Wülfrath - am Rande des rheinisch-westfälischen Industriegebietes im lieblichen Bergischen Land zwischen Düsseldorf und Wuppertal gelegen - eine blühende Industriestadt geworden. Im Jahre 1836 aber, als dort Otto Funcke, der später als evangelischer Volksschriftsteller so bekannt geworden ist, geboren wurde, lag der Ort noch in ländlicher Stille und Abgeschiedenheit da. Es war ein herrliches Kinderparadies. Von den Höhen um Wülfrath konnte man bis in die Rheinebene hinuntersehen. Sicherlich ist der Bub Otto Funcke oft dort oben gestanden und hat in der Ferne das silberne Band des Rheinstromes aufblitzen sehen. Da ist ihm wohl früh das Fernweh ins Herz geschlichen und die Lust zum Reisen gekommen, die ihn später weit in der Welt umhergeführt hat.
Otto Funckes Vater ist ein Doktor gewesen, ein richtiger Landarzt der guten alten Zeit. Er hat sein Amt 45 Jahre verwaltet, aber vor ihm hatte sein Vater gar 55 Jahre die Praxis ausgeübt. Was lag näher, als daß auch unser Otto davon träumte, in des Vaters und des Großvaters Fußstapfen zu treten? Die Mutter allerdings hegte für ihren Zweitjüngsten ganz andere Hoffnungen: der sollte einmal ein Prediger des Evangeliums werden. Und tatsächlich, sie hat recht behalten!
Vater Funcke ist ein imponierender Mann gewesen. Wenn er auf seinem Pferd, das er zur Bewältigung der großen Praxis brauchte, dahergeritten kam, waren seine fünf Jungen immer unbändig stolz auf ihn. Er hatte eine starke, energische Natur. Es hat ein ganzes langes Leben gebraucht, bis er aus seinem allgemeinen Gottes- und Schöpfungsglauben in das Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus und in seine Gnade hineinfand. Religiös war er eigentlich immer. Er konnte Leute, die über Heiliges höhnten, rücksichtslos anfahren. Das erfuhr einmal ein junger Adliger, der in seinem Luderleben Leib und Seele verdorben hatte, sich aber gern seiner Bildung und Aufklärung rühmte und mit dummen Spottreden um sich warf. Doktor Funcke fauchte ihn an: „Sie sind noch nicht trocken hinter den Ohren und wollen das verlachen, was die Welt zusammenhält? Sie Hanswurst, Sie, Sie tragen das göttliche Gericht schon in Ihren faulen Knochen. Noch ein Wort wie vorhin, und ich werfe Sie einfach zum Tempel hinaus!"
Das ist eine herrliche Sache gewesen, wie die Gnade diesen Mann der Kraft und des überschäumenden Temperaments am Ende herumgeholt und still und voll Glaubensgewißheit gemacht hat. Mit 70 Jahren gab der Sanitätsrat Funcke seine Praxis in Wülfrath auf und zog an den Rhein nach Boppard. Dort in der Ruhe des Lebensabends leuchtete ihm das Geheimnis der Person und des Werkes Jesu Christi immer mehr auf'. Die längst vor ihm heimgegangene Mutter Funcke hatte in allen Wechselfällen an der Hoffnung festgehalten: Um den Abend wird es hell werden! Ja, das war in der Tat ein helles Durchbrechen der Sonne, als in den Briefen des alten Vaters an seine Söhne der Ruhm der Gnade des Heilandes immer mehr zur Geltung kam. Und das war eine volle, herrliche, lichte Stunde des Heils, als die um das Sterbelager des Vaters versammelten Söhne seine letzten abgebrochenen Sätze hörten:
„Meine Söhne verlassen mich nicht -, du, mein Heiland, aber verlässest mich erst recht nicht -. Du hast mir die Tür offen gemacht -, es scheint ganz hell herunter -, Kinder, Jesus steht in der Tür und sagt: Karl Funcke, du bist ein großer Sünder, aber ich lasse dich doch durch!*
Frommem Überschwang und geistlicher Übersteigerung ist Vater Funcke immer abhold gewesen. Wo er so etwas antraf, konnte er sich gelegentlich zu einem „Seelsorger" ganz eigener Prägung entwickeln. Einmal hatte er einen Pastor in der Kur, der auf der Kanzel sehr heftig und lieblos über einen Amtsbruder hergefallen war. Während der Arzt seinen Patienten gründlich beklopft und behorcht, erzählt dieser von seinem Kampf gegen den Kollegen. Er bekräftigt sein gutes Gewissen in dieser etwas fatalen Angelegenheit, indem er feststellt: „Der Heilige Geist hat mir eingegeben, so zu reden!" Da fährt aber Doktor Funcke in die Höhe:
„Herr Pastor, nicht der Heilige Geist, sondern Ihre total kranke Leber hat Ihnen das eingegeben, und daß Sie eine kranke Leber haben, ist das einzige, was Sie zu Ihrer Entschuldigung sagen können. "
Diese Spezialkur von „Seelsorge" hat der Pastor nicht verkraften können. Er ist spornstreichs ohne Abschiedsgruß davongelaufen!
Ja, so war der Vater Funcke. Und die Leser werden zugeben, daß solch ein Mann in einer Biographie Otto Funckes ein paar Zeilen verdient. In das Kinderland des kleinen Otto gehörte er jedenfalls sehr wesentlich hinein. Die Mutter allerdings können wir so kurz nicht abtun. Die kriegt ihr eigenes Kapitel.
*) Wörtliche Anführungen aus Otto Funckes Büchern sind in Schrägschrift wiedergegeben.
Nicht ganz vergessen dürfen wir Mutter Funckes Vater, den Wülfrather Pastor Johann Peter Neumann, der in Ottos Jugendzeit eine gewichtige und einflußreiche Rolle gespielt hat. Er war ein fest in der reformierten Orthodoxie der Dordrechter Artikel, der strengsten Ausprägung des reformierten Kirchentums und Bekenntnisstandes, verwurzelter Mann. Sein Lieblingsthema war die Erwählungslehre: Alles ist Gottes Werk. Als es zu den ersten zaghaften Ansätzen in der Inneren und Äußeren Mission kam, zog der gute Pastor Neumann kräftig gegen diese „neumodischen" Bestrebungen vom Leder. Er witterte da die fromme Betriebsamkeit des Menschen, durch die er Gottes Alleinwirksamkeit nicht gebührend respektiert sah. Später, im hohen Alter, hat er in dieser Sache aber noch willig umgelernt.
Man könnte noch manche andere interessante Gestalten aufmarschieren lassen, die ihren Platz und ihre Bedeutung in Otto Funckes Jugendland gehabt haben, aber die Leser sollen nun endlich etwas über den kleinen Otto selber hören. Ja, der Otto, was ist der für ein Bub gewesen? Lange Zeit hindurch war er sehr schwächlich und kränkelte viel. Darum haben ihm manche Leute nur ein kurzes Leben vorausgesagt. Zu der Mutter, die den damals Zehnjährigen gerade badete, sagte einmal ein „liebenswürdiger" Bauer folgende „trostvollen" Sätze:
„Ach, liebe Frau Dokter, wat es dat _för en erbärmlich Kenkt (Kind)! Dat süht ja ut wie 'nen avgetrockenen Has (wie ein abgezogener Hase). Do wert sin Leven nix vann!"
Da hat sich aber Mutter Funcke aufgerichtet und ist dem Ehrenmann wie eine Prophetin entgegengetreten:
„Lieber Herr, Ochsen und Hammel schätzt man nach dem Gewicht, nach Fleisch und Knochen. Beim Menschen aber kommt es auf Kopf und Herz an, und die sind bei meinem Jungen in Ordnung, und es könnte leicht passieren, daß er Euch und Eure Kinder noch lange überleben wird, denn ich will Euch was sagen: Er wird noch ein Prediger des Evangeliums werden. "
Diese beiden Weissagungen haben sich in der Tat erfüllt. Aber es ist ein weiter und schwerer Weg bis dahin gewesen. Die schwächliche Gesundheit hat unserem Otto in seinen Kinderjahren viel zu schaffen gemacht, hat manchen Verzicht von ihm gefordert und ihm manchen Seufzer ausgepreßt. Wie war das entmutigend und niederdrückend, wenn es immer hieß: „Das ist aber nichts für Otto ...!" Wie manche Schneeballschlacht, wie manche übermütige Fahrt auf der Eisbahn, wie manches Pfannkuchenessen - und sollte der Gaumen eines Jungen nicht Verlangen haben nach saftigen, speckigen Pfannkuchen? -, wie man eben Ausflug haben diese vier Wörtlein zunichte gemacht: „Otto darf das nicht!"
Und doch verbittet es sich Otto Funcke mehr als einmal in seinen Büchern, daß man ihn wegen der Entbehrungen und Enttäuschungen seiner Kinderjahre bedaure:
„Ganz falsch wäre es, wenn einer sich denken wollte, daß mein Leben also ein bedrücktes und nur auch ein armes gewesen sei. 0 nein, ich entbehrte nicht viel, da jede Kleinigkeit mich hoch erfreuen konnte; manchmal, wenn es unerwartet kam, ein Schmetterling, der ins Zimmerflog, ein Bratapfel, an den ich nicht gedacht, das freundliche Zunicken eines Menschen, der vorüber ging, ein neuer Trieb an einer scheinbar erstorbenen Blume, die ich pflegte - dergleichen konnte mich schnell aus der allergedrücktesten Stimmung in die aller-heiterste versetzen. Ich war zum Glück kindlich genug, in solchen unerwarteten Freuden das direkte Eingreifen des lieben Gottes zu sehen. Meine Mutter hatte mich das gelehrt. ‚Schau sagte sie dann wohl, jetzt grüßt dich der liebe Gott. Du siehst, er denkt an dich!"
Ist das keine beneidenswert herrliche Sache, wenn man sich so königlich über die kleinen und kleinsten Dinge freuen kann? Wer Otto Funckes Bücher liest, stößt immer wieder auf diesen beglückenden Zug in seinem Wesen, daß er einen dankbaren Blick für das Kleine hat, für die unscheinbaren Dinge und Begebenheiten und auch für so manche kleine und geringe, so leicht übersehene Menschen. Diese seine Gabe hat ihm selber - und den Lesern seiner Bücher! - manchen Freudenquell aufsprudeln lassen:
„Ja, die kleinen Sonnenstrahlen, die alle Tage auf unseren Weg fallen, sind der große Reichtum unseres Lebens, wenn wir darin den Abglanz des göttlichen Angesichts erkennen. Gott hat es in derHand, seine großen und kleinen Kinder auf Erden in allerlei Art zu segnen und zu erquicken. Und er kann dazu Sterne und Kieselsteine, Pappschachteln und Mammutknochen verwenden."
Das Bild der Mutter
Über alle andern Menschen, die durch sein Kinderland gingen, hat Otto Funcke die Mutter liebgehabt. Ihr verdankt er ja die Kunst, an den kleinen Dingen sich zu freuen und im dahin-huschenden Sonnenstrahl ein Grüßen Gottes zu sehen. Aber er verdankt ihr unendlich viel mehr, er verdankt ihr das Beste seines Wesens. Er hat das in seinen Büchern immer wieder bezeugt,
und man merkt, wie noch dem alten Mann das Herz höhor schlägt, wenn er von seiner Mutter erzählt.
Die Mutter ist die eigentliche Lehrerin und Professorin für ihren Ottobub gewesen. Wenn er auch durch Jahre hindurch wegen seiner Kränklichkeit in keine Schule gehen konnte, so hat er doch viel gelernt, eben im Umgang und zu den Füßen der Mutter. Viele Menschen haben sich im Lauf der Jahre um seine Seele gekümmert, viele lieb und zart, manche auch dreist und taktlos. Aber die erste und beste und die entscheidende Seelsorgerin ist die Mutter gewesen und geblieben. Mutter Funcke stellte in der Erziehung ihrer Kinder - und da stimmte auch der starke und temperamentvolle Vater zu - die Liebe und nicht das Gesetz obenan. Beide Eltern haben nicht ständig durch Ermahnungen und Verbote die Kinder gequält. Von harmlosen Bubenstreichen, von Spuren der Kinderspiele an Möbeln und Fensterscheiben und Kleidern wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Nur durfte nichts Gemeines und Unritterliches bei den Streichen und Spielen passieren. Mehr noch als der Vater ließ natürlich die Mutter in der Erziehung das Evangelium und die Liebe vorherrschen. Und das meiste von dieser mütterlichen Zartheit hat der Otto mitgekriegt, der durch sein vieles Kranksein nun einmal am meisten bei der Mutter war.
Die Mutter Funcke gehörte wirklich nicht zu den Leuten, von denen Paulus sagt, daß all ihr Haben und Tun, ihr Reden und Wissen unnütz ist, weil die Liebe drin fehlt. Nein, ihr ganzes Leben war ein großes Lieben. Der Otto erlebte die Äußerungen der Liebe der Mutter ja immer aus nächster Nähe mit, und er war zwar nicht das alleinige, wohl aber das bevorzugteste Wesen, dem die Liebe der Mutter sich zuwandte. Manchmal wollte es ihm vorkommen: Die Mutter macht es zu arg mit ihrem Lieb-sein. Sie verschwendet davon zu viel an Leute, die es gar nicht wert sind.
Besonderer Gegenstand ihres fürsorglichen Eintretens waren ihre Freunde aus den „Konventikeln", die „Pietisten", die „Stundenleute". Wenn Vater Funcke über die Gebrechen der „Heiligen" herfuhr, dann war die Mutter in ihrer Verteidigung unermüdlich. Diese Leute waren nun einmal ihre Brüder und Schwestern, und sie ging mit ihnen durch dick und dünn. Ihre Schwachheiten übersah sie nicht einfach, aber sie hielt dem Vater entgegen, daß auf dieser Erde dem guten Wollen eben noch zu oft die Schwachheit des Fleisches widerstünde. Nein, gegen die „Pietisten" bekam der Vater bei der Mutter niemals recht.
Dann waren da Vaters viele Patienten. Der Doktor machte sich nichts daraus, diesen und jenen gelegentlich sehr grob anzufahren. Vielleicht wäre mancher seiner Kundschaft für immer entlaufen, wenn nicht. die Mutter hinterher durch ein vermittelndes Wort oder eine kleine Liebestat die Sache wieder in Ordnung gebracht hätte. Die herrlichsten und unvergeßlichsten Stunden waren es aber, wenn der unerschöpfliche Liebesquell der Mutter so recht für das kranke Büblein Otto floß. Die Zeiten, in denen Otto mit der Mutter ganz allein war, waren die schönsten in seinem Kinderland. Die Mutter war voller Poesie. Aber es war eine himmlische Poesie, es war die Gabe, überall - auch in den geringsten Dingen - die Spur und die Hand und das Herz des himmlischen Vaters zu erleben. Es wurde der Mutter alles Irdische zu einem Abglani himmlischer und ewiger Wahrheiten und Wesenheiten:
‚Jeder schöne Gesang erinnerte sie an die Hymnen und Psalmen, die wir seinerzeit, vereint mit Cherubim und Seraphim, vor Gottes Thron singen werden. Das geheimnisvolle Rauschen des Waldes erinnerte sie an das Brausen der immergrünen Palmen am kristallnen Strom, jede schöne Blume war ihr eine Verheißung der entzückenden, unverweiklichen Himmelsflora. Aber auch jeder Pfannkuchen, der uns mundete, mußte uns auf das Hochzeitsmahl im Vaterhaus hinweisen, ja, jeder irdische Vorgang, und war es auch nur das beklagenswerte Zerbrechen eines Kochtopfes in der Küche oder das Verwelken einer Blume, die zu wenig Wasser bekommen, der heisere Ton einer Eisenbahnglocke, die zersprungen war, das Zerknicken eines Baumzweiges, der der Früchte zu viel hatte - überall vernahm sie eine Sprache und Rede von ewigen Gesetzen und innerlichen Dingen."
Der die Mutter verehrende Sohn gibt zu, daß in dieser Welt-und Himmelsbetrachtung gelegentlich auch Übertreibungen vorkamen, aber der beherrschende Eindruck bei der Mutter war und blieb, daß ihr die Welt Gottes, die Welt der Ewigkeit, so lieb, so nahe, so vertraut war, daß sie einfach nicht anders konnte, als alle Dinge im Lichte dieser Himmelswelt zu sehen. Dabei wurde die Erdenwelt nicht im geringsten entwertet oder verachtet. Echte Ewigkeitsmenschen sind ja niemals düstere Weltverneiner. Im Gegenteil, durch ihren Ewigkeitsblick bekam diese Welt für Mutter Funcke erst ihre Farbe, ihr Leuchten, ihre Schönheit Sie wurde von ihr froh hingenommen und in rechter, dankbarer Weise genossen. Sie hat ihrem Buben viel vom Himmel erzählt, aber darüber niemals vergessen, dem so viel Entbehrenden auch einen Anteil an den „Erdenfreuden" zu verschaffen.
Es ist der deutliche Einfluß und das Wesen der Mutter gewesen, die auch m Otto Funckes Lebensweg und Charakterbild jene harmonisch schone und beglückende Einheit von Himmelssinn und Erdentreue entwickelt und geprägt haben.
Die der Ewigkeitswelt so innig verbundene Mutter war voll herrlicher Tatkraft und Bereitschaft, die Menschen auf Erden mit ihrer Liebe zu erfreuen. Sie hätte es manchmal bequemer haben können, wenn sie nicht an soundso viel Leuten Aufgaben der Liebe entdeckt hätte. Manchmal kam es vor, daß sie sich in ihren Pflichten und Diensten fast verlor und einfach mit der Zeit nicht zurechtkam. Wie oft kam sie aus ihrer eifrigen Tätigkeit zu der großen Standuhr gerannt und stellte erschrocken fest: „Wie, so spät ist es schon!" Wenn es vor lauter Arbeit am Ende gar kein Durchkommen mehr geben wollte, dann konnte die Mutter zu einem letzten drastischen und originellen Mittel greifen: dann stellte sie die Uhr einfach still!
Durch das reiche, taten- und liebefrohe Leben der Mutter zog sich eine Grundsehnsucht:
„Die Sehnsucht, ein Kind Gottes zu werden und immer besser und wahrhaftiger ein Kind Gottes zu werden, war die Grundsehnsucht ihres Lebens. Es war der bleibende Wunsch in dem Wechsel der Zeiten und dem Wechsel der Wünsche."
Großmutter Neumann erzählte gerne aus der Kindheit ihrer Wilhelmina - Minchengenannt -. folgende schöne Geschichte, die zeigt, wie früh dieses Verlangen schon erwacht ist. Als die Kleine einmal einen Mann im Gespräch sagen hört: „Alles ist eitel", läuft sie zu ihrer Mutter und will wissen, was das Wort „eitel" bedeutet. Die Mutter erklärt: „Alles vergeht" - Da ist das Kind im ganzen Haus umhergegangen und hat auf den Kochherd, auf die Bratpfanne, auf den Besen das Fingerlein gelegt und gesagt: „Kochherd, du vergehst, Bratpfanne, du vergehst, Besen, du vergehst" Dann hebt sich der Kinderfinger zu den Dachziegeln und den Bäumen empor, dann zeigt er zur Sonne, und alle diese Werke der Schöpfung werden an ihre Vergänglichkeit gemahnt. Dann kehrt die Kleine von ihrem Gang zurück und wffl von der Mutter wissen, ob denn auch die Menschen alle vergehen. „Ja, freilich, nur Gott vergeht nicht, und wenn wir Kinder Gottes werden, vergehen wir auch nicht" 1,0, Vater, o Mutter", ruft da das Mädchen unter heißen, sehnsuchtsvollen Tränen, „so helft mir doch, daß ich ein Kind Gottes werde!" Und das kleine Minchen Neumann ist in der Tat eins geworden und hat ein Leben lang die Sehnsucht im Herzen getragen, ein immer besseres zu werden.
Die Mütter hatte &n feines Auge und eine zarte, liebevolle Hand, wenn ihr Otto irgend etwas Unrechtes getan hatte Das spürte sie gleich. Dann sah sie ihren Jungen wohl an und sagte: „Nun schau mich auch mal lustig an, mein Otto! Sieh, das kannst du nicht. Da ist wohl ein Splitterchen ins Auge geraten. Komm, wir wollen ihn zusammen herausholen. Ich will dein Doktor sein." Wie war's da dem kleinen Sünder leicht gemacht, seine Unart zu bekennen! Und wie ging's weiter?
„Die Mutter dachte nun nicht daran, mir eine Strafpredigt zu halten, sondern zeigte mir nur in tiefstem Mitleiden, wie unglücklich die Sünde uns mache; wie sie uns ruiniere in unserm innersten Wesen, uns verfinstere, uns stumm, starr, unbrauchbar mache, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut und alle Tugend in uns zerstöre. Sie wies mich hin auf die zarte Arbeit des Geistes Gottes, wie er mich vor der Sünde gewarnt habe, auf die sanften Schwinpngen der Magnetnadel des Herzens, auf die Unruhe des Gewissens, auf die innere Verdunkelung. Kurz, daß der Mensch ‚verlor' ist durch die Sünde, weil er sein eigentliches Lebenselement durch die Sünde verliert - das lernte ich frühe verstehen."
Wer das Bild einer solchen Mutter im Herzen trägt, erlebt seine mannigfach bewahrende Macht. Als der Otto später aus dem Elternhaus in die Welt hinausging, ist er oft in arge äußere und innere Not hineingeraten. Da ist ihm das stille und liebe Bild der Mutter iniitier ein großer Segen gewesen. Er sagt selber:
„In meinen Studentenjahren hat's Zeiten gegeben, wo ich in größter Gefahr war, am Glauben Schjffbruch zu leiden. Nicht nur am christlichen Glauben, nein, der Glaube an den Gott, der Gebete erhört, wurde mir erschüttert. Aber meinen Zweifeln war von vornherein ein Maulkorb umgehängt. Ich mußte mir nämlich sagen: ‚Ist dein Zweifel berechtigt, dann war deine Mutter die größte Närrin, die jemals auf zwei Füßen ging.' Gegen diesen Gedanken aber empörte sich sofort nicht nur jeder Blutstropfen, der in meinen Adern rollte -‚ nein, auch meine Vernunft empörte sich dagegen. Die Mutter, die durch ihren kindlichen Glauben so reich, so glücklich und beglückend war, sie hat mich' wer weiß wie oft, wieder zurechtgebracht, wenn ihr lichtes, wonniges Bild hinter meinem Arbeitstisch auftauchte. Ich fing dann bald an, meinen Zweifel zu bezweifeln; ich entschloß mich bald und sagte: Lieber will ich so wie meine Mutter irren, als recht haben mit denen, die nichts glauben und nichts hof-fen.
offen. - Das war ja nun freilich ein sehr ‚unkritisches' Verfahren, und ich sehe im Geist ehrwürdige Gelehrte, die darüber lächeln, und un-ehrwürdige, die darüber hohnlachen. Aber so oder so - ich bin gut dabei gefahren."
Die Leitbilder und Methoden, die für Vater und Mutter Funcke in der Erziehung ihrer Kinder galten, sind „evangelisch" gewesen. Die Rute. des Gesetzes, der Drohung, der Strafe wurde äußerst sparsam geschwungen. Die Liebe - vor allem der Mutter - erwies sich als eine ungemein starke und wirksame Bildungsmacht. Die Liebe schloß nicht aus, sondern ein, daß die Eltern klare und handfeste Erziehungsziele hatten, die sie ohne Abstriche verfolgten. Und die wenigen Ohrfeigen und Stockhiebe, die Otto Funcke in seinen Kindeijahren gekriegt hat, hängen mit seinen Abirrungen von diesen unverbrüchlichen Grundsätzen zusammen.
In der Überschrift über diesen Abschnitt finden wir einige der wichtigsten dieser Ziele zusammengestellt. Gern dienen, zu den Geringen sich halten und die Schwachen ehren - daß das christlich und mannhaft sei, haben die Funcke-Buben früh, wenn auch nicht immer ganz leicht und ohne Murren, gelernt. Vater Funcke war ein Mann mit einem ausgeprägten sozialen Empfinden. Er hatte ein warmes Herz für die armen Leute und galt gar manchen zugeknöpften und verbohrten Spießbürgern als ein gefährlicher Anwalt des Proletariats. Daß solch ein Mann auch seinen fünf Jungen soziales Verständnis beizubringen suchte, ist selbstverständich. Die Mutter hieb kräftig in dieselbe Kerbe. Nur war bei ihr der Ruf zum Lieben und Dienen mehr aus der Botschaft des Evangeliums und aus dem Umgang mit der Ewigkeitswelt geschöpft. Der Vater sagte: „Jeder Mensch muß etwas Ordentliches tun, damit die Welt im Gange bleibt." Die Mutter führte ihren Beweis so:
„Jesus Christus, unser Heiland, wollte nichts sein als ein Diener, und im Dienen ist er würdig geworden zur Herrlichkeit Gottes. Auch sein Leiden und Sterben war nicht mehr und nicht weniger als ein Dienen. Wir können auch nur auf dem Wege wie er zur Herrlichkeit und zur Herrschaft gelangen, also durch Dienen."
Die Funcke-Jungen mußten zu Hause tüchtig mit anpacken. In dem Fehlen einer Schwester schienen die Eltern einen Wink der Vorsehung zu sehen, daß ihre Jungen Buben und Mädchen• in einem sein sollten. Otto und seine Brüder sind durch ihre Mitarbeit im Hause nicht im geringsten weibisch geworden und erst recht nicht knechtisch. Natürlich lehnte sich gelegentlich ihre minnliche Würde gegen solche Aufgaben auf; die im allgemeinen den Mädchen zugewiesen -werden. Dann sagte Mutter Funcke lächelnd: „Ihr sollt sehen, ihr werdet es mir im Leben noch ein-
14 15
mal danken." Die Jungen haben das nicht immer gleich geglaubt, aber später im Leben vollauf bestätigt gefunden.
Wohl am schwersten war der Gehorsam, wenn die Buben, in jeder Hand einen Henkeltopf mit heißer Suppe - „Döppen" genannt -‚ von der Mutter in die Hütten der Armen und Kranken geschickt wurden. Sie waren dabei nicht nur Überbringer leiblicher Speisen, sie richteten gleichzeitig auch das Evangelium aus. Denn für jeden der durch ihre Mildtätigkeit Gespeisten hatte die Mutter auch einen Bibelspruch ausgewählt, der meist in die Lage des Empfängers trefflich hineinpaßte. Solche Aufträge bedeuteten oft bittere Gänge. Daß dadurch viel schöne Zeit zum Spielen verlorenging, war nicht das Schlimmste. Mehr wurmte es, wenn die Gassenbuben allerlei Spottworte nachriefen; Die Mutter gab ihren Jungen bei solchen Gelegenheiten folgenden originellen Rat: „Hört doch das blöde Babbeln der ollen Gassenjungens gar nicht. Denkt, sie wären lauter Kappes (Kohlköpfe). Wie könnt ihr je selbständige und tapfere Männer werden, die im Leben ihren Weg durchgehen, wenn ihr auf das Gerede der Leute hört! Man muß früh das Rechte tapfer tun und sich dabei um die Welt nicht kümmern." So hat die Mutter ihre Jungen kräftig bei ihrer Ehre zu packen gesucht - und nicht vergeblich. Die Buben sind gewiß wilde und richtige Buben gewesen, aber
• sie haben doch früher und mehr als die meisten andern Kinder
• eine Ahnung davon gekriegt, daß es eine schöne Sache ist, wenn man die Menschen durch Dienen und Lieben erfreut und sich durch keinen Spott der Toren davon abhalten läßt.
Otto Funcke berichtet darüber:
„Schließlich - ob auch langsam - gingen den Söhnen Mütterchens Argumente in Fleisch und Blut über, und sie gewannen dadurch einen grüßen Reichtum für das Leben. Ja, es ist ein gut Ding, wenn man früh lernt, der ganzen Welt, die ja doch im Argen liegt
• und vom Eitelkeitsgeist besessen ist, - ich sage, wenn man früh lernt, ihr ein Schnippchen zu schlagen, falls man nur weiß, daß man eine gute Sache vertritt. - Es ist noch ein größer Ding hängt aber mit je-nein eng zusammen, wenn man früh lernt, mit dem Vorbild Jesu Christi Ernst zu machen, und zwar da, wo es uns am wenigsten paßt. In dem Wort: ‚Geht's der Natur entgegen, so geht's gerad und
• fein liegt eine tiefe Wahrheit, solange unsere Natur so ist, wie sie
• ist; Sich selbst verleugnen und praktisch Jesus nachfolgen, das ist mehr wert als alle Orthodoxie und Theologie. Denn unser Herr Christus ist nicht herniede.'gekommen, um eine neue Lehre, sondern um ein neues Leben in die Welt und Menschheit zu bringen."
Einmal hat es eine gehörige Ohrfeige vom Vater gegeben, die den kleinen Otto und seinen Bruder Bernhard nachdrücklich daran erinnerte, wozu der Mensch auf der Welt ist Der Vater geht mit den beiden Jungen durch den Wald und erzählt so interessant und meisterhaft eine Geschichte, daß die Jungen ganz hingerissen sind. Da kommen die drei an einem alten, verhutzelten Weiblein vorbei, das im Walde Reisig gesammelt hat und sich nun vergeblich müht, sein Bündel auf den Kopf zu heben. Einen Augenblick wartet der Vater, dann aber, als die Buben sich nicht rühren, hat jeder patsch! patsch! seine Ohrfeige. weg. Der Vater geht selber hin und hilft der Frau, daß sie ihr Bündel auf den Kopf und ins richtige Gleichgewicht kriegt. Dann prägt er seinen Buben folgendes gute Sprüchlein ein: „Jungens, wißt ihr, wofür ihr in der Welt seid? Ich will es euch sagen: Die Menschen sind da, um einander zu dienen, und wo sie das nicht tun, da ist es schlechterdings nicht auszuhalten."
Außer dieser saftigen Ohrfeige hat der Otto noch einmalgründliche Webe bekommen. Und die hingen auch mit einem gröblichen Verstoß gegen das Gesetz zusammen, daß man immer für die Geringen und Verachteten mannhaft einzutreten habe. Da waren die Brüder mit bösem Spott über einen Mann, der einen Buckel trug, hergefallen. Das hatte eine handfeste Abreibung in Vaters Studierstube zur Folge. Es sei nur angedeutet, daß dabei eine Reitpeitsche eine sehr schmerzhafte Rolle spielte. Auf die Frage des Vaters, ob sie den. Grund wüßten, heulte ein mehrstimmiger Schmerzenschor los: „Ja, lieber Vater, ja!" Nachdem der Vater so seines Amtes gewaltet hatte, überließ er der Mutter das Feld zu weiterer Belehrung. Die machte nun ihren Jungen klar, daß sie mit ihrem schändlichen Verhalten geradezu dem Heiland selber ins Gesicht geschlagen hätten, der ja immer auf der Seite der Verachteten und Verstoßenen gestanden hätte. Und auf dieselbe Seite sich zu schlagen, das allein sei edel und mannhaft und christlich. Otto Funcke hat von dieser Züchtigung bezeugt, daß sie ihren Zweck vortrefflich erfüllt habe, und daß er
„seinen Eltern mehr dafür danke als für alle Pfeffernüsse, Honigkuchen und Marzipantorten, womit sie uns je und je traktiert haben. Es ging uns in Fleisch und Blut über, daß ein wahrhaft edler Mensch, geschweige denn ein Christ, überall und zu aller Zeit auf die Seite der Verachteten, Verlachten und Verspotteten treten müsse."
16
In Otto Funckes Jugendjahren war der Heimatort Wülfrath in der Hauptsache von allerlei biederen und braven kirchlichen. Leuten bewohnt. Deren Kirchlichkeit war aber oft nichts anderes als tote Gewöhnung, ein Stück „des eitlen Wandels nach väterlicher Weise". Es gab aber auch einige Kreise der „Stillen im Lande", der Konventikelleute, wie man sie auch nannte, der Pietisten. Mülheim an der Ruhr, wo der stille und gottinnige Gerhard Tersteegen in einer „Pilgerhütte" sein verborgenes Leben mit Gott geführt hatte und vielen Menschen Seelenführer geworden war, lag nicht allzuweit von Wülfrath entfernt Kein Wunder, daß Tersteegens Schriften und Lieder auch in Wülfrath manchen Christen willkommene Herzensnahrung waren. Die Tersteegenianer und andere Pietisten trafen sich gelegentlich an den Abenden in den Häusern. Die Pastoren von Wülfrath sahen das nicht allzu gerne. Auch Ottos Großvater, der streng reformierte Pastor Neumann, war den Konventikelleuten nicht sonderlich hold. Um so mehr aber liebte sie Ottos Mutter. Sosehr sonst Vater Neumann für seine Tochter Minchen Autorität war, in diesem Stück ging sie auf keine Belehrungen und Ermahnungen ein.
Wenn sie in die „Stunde" ging, nahm sie ihren Otto öfter mit. Er war damals 11 bis 12 Jahre alt. Man kann nicht gerade sagen, daß er sich in diesen Stunden immer wohlgefühlt hätte. Es war ihm darin manches zu schwer und zu fremdartig, aber eins merkte er doch, und das nötigte ihm Respekt ab: Hier sind Leute, die nehmen es mit ihrem Glauben ernst, und sie sind jederzeit bereit, für diesen Glauben zu Märtyrern zu werden.
In diesen Konventikeln, unter den Pietisten, gab es damals in Wülfrath und anderswo allerlei Originale. Gottlob sind diese auch heute hin und her im Lande noch nicht ganz ausgestorben. Funcke ist der Ansicht, daß
„es überhaupt unter 50 lebendigen Christen mehr Originale gibt als unter 500 Weltleuten, die sich nur vom Weltgeist, dem Zeitgeist und der öffentlichen Meinung bestimmen lassen."
Aber was sollen wir theoretisch von diesen Dingen reden? Wir wollen lebendigen Anschauungsunterricht nehmen und den jungen Otto Funcke in eine „Stunde" begleiten.
Wir befinden uns in der guten Stube eines bergischen Bauernhauses. Auf dem Tisch dampft der große „Kaffee-Pott". Der „Platz", das selbstgebackene Weißbrot, lädt zum Schmaus ein. Unter den Gästen am Tisch sitzt auch Mutter Funcke mit ihrem nun vierzehnjährigen Otto. Der Besitzer des Hofes ist ein Konventikelmann Er hat etliche seiner „Bruder" für den Nachmittag eingeladen. Zunächst wird das Genie des Hoferben bewundert,
der ganz aus eigenem Antrieb eine kleine Dampfmaschine zusammengebastelt hat Die Besucher raten alle dem Vater: „Du
mußt den Jungen lernen, studieren, Seine Gaben entwickeln las-
sen. Der kann noch einmal ein großer Erfinder werden." Der Bauer widerspricht lächelnd, aber bestimmt: „Der Junge wird
Bauer wie seine Väter und ich. Der Hof braucht ihn." (Der junge Künstler ist aber nie Bauer geworden, sondern wenig später an der Schwindsucht gestorben.)
Die Gäste widersprechen: Es wäre ein Jammer, wenn die schönen Anlagen des Jungen sich nicht entfalten könnten. Da.
beginnt der Vater eine längere Rede: „Die Anlagen verkümmern nicht. Die wird der Junge im Himmel gut gebrauchen können.
Auf Erden aber wird er Bauer. Hier auf Erden bleiben tausend
und abertausend edle Keime unentwickelt Vieles bleibt hier in den Anfängen stecken und kommt niemals zur Reife, zur Frucht,
zur vollen Ausgestaltung Aber Gott wäre ein unverantwortlich
schlechter und kümmerlicher Haushalter, wenn er all diese Anlagen und Keime; die er doch selber in die Menschen hineingelegt hat, für immer unentfaltet und verkümmert ließe. Darum ist die Ewigkeit da. In ihr kommen alle Anfänge zur Vollendung, wird aus dem Ringen und Mühen hier unten die herrliche Klarheit Dort oben ist die beste Luft und der beste Boden für jede Pflanze."
Da hat aber der junge Otto die Ohren gespitzt! Das waren ja ganz neue Gedanken, die da ausgebreitet wurden! Wir wissen,
durch wieviel Krankheit und Entbehrung es in Ottos Jugendjahren ging. Da waren dann oftmals allerlei Tröster erschienen und hatten den Jungen auf den Himmel verwiesen. Der aber hatte solche Reden nicht allzu erbaulich gefunden. Ihm kam - ehrlich gesagt - der Himmel ziemlich öde und gar nicht begehrenswert vor. „Immer nur Gott schauen und dreimal heilige Lieder singen, das schien mir doch langweilig", lesen wir in Funckes Lebenserinnerungen
Zwar war es nicht eigentlich das Spielen und Toben, das jedem gesunden Kind Wonne und Lebenselement ist, das Otto
im Himmel zu kurz zu kommen schien. Er war ja inzwischen
in die Jahre gekommen, wo sich übers Spielen hinaus die Freude am Schaffen und Gestalten in einem Jungen kräftig regt. Aber dieser Schaffenstrieb wurde immer wieder durch all die körperlichen Hemmungen und Rückschläge aufgehalten. Und nun sitzt
Verlag: Liebenzeller Mission
Jahr: 1982
Einband: Paperback
Seitenzahl: 80
Format: 12 x 18,5
Gewicht: 98 g
Pagel Arno, Krebs Hans, Du hast mein Leben so reich gemacht

In Mittelfranken, einem Teil des Freistaates Bayern, liegt das schöne, liebliche Altmühltal und in diesem Tal meine Heimatstadt Gunzenhausen. Dort erblickte ich als elftes von insgesamt vierzehn Kindern am 23. Mai 1902 das Licht der Welt. Meine Mutter hatte es in der Zeit vor meiner Geburt nicht leicht. Es lastete eine große Arbeitsfülle auf ihr, und es ging durch viele Sorgen und Nöte. Da blieb es nicht aus, daß sie manchmal traurig war, und es kam sie die Angst an, daß auch das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug, von trauriger, schwermütiger Wesensart sein könnte.
Meine Eltern hatten 1901 ein Haus gekauft. Mein Vater - Georg Kreb - war Töpfer und Ofensetzer. Um das Töpferhandwerk ausüben zu können, mußte er eine Werkstatt mit Brennofen anbauen. Dazu mußte ein Stück von dem angrenzenden Teich aufgefüllt werden. Es ging damals nicht so einfach wie heute, daß ein Lastkraftwagen den benötigten Schutt an die betreffende Stelle heranfuhr und dort auskippte. Die Arbeit mußte mit Schubkarren erledigt werden, und auch meine Mutter, die ihr elftes Kind erwartete, war an dieser schweren Mühe beteiligt. Dazu kam der ganze große Haushalt. Zu jener Zeit wurden kinderreiche Familien nicht unterstützt wie heute. Meine Eltern gingen durch viel finanzielle Not.
So kam es, daß meine Mutter oft mit wenig frohen Blicken nach mir Meinem Jungen schaute. Ich selber machte ihr aber auch dadurch Kummer, daß ich so winzig und elend war. Als ich geboren wurde, war ich gewissermaßen nur halb fertig. Ich wog kaum dreieinhalb Pfund. Heute würde man ein solches kümmerliches Wesen in den Kinderbrutkasten legen und fertig »ausbak-ken«, aber den gab es damals noch nicht. Mutter hat oft erzählt, daß sie manchmal fast vergessen hätte, mich zu füttern, weil ich mich nicht gerührt hätte. Ich hätte immer mit meinen Fingern und meinen Zehen gespielt und wäre immer zufrieden dagelegen.
Als ich sie dann aber nach einigen Monaten mit meinem ersten Lächeln erfreute, war ihr das ein besonderes Geschenk.
Erst nach einem Jahr bin ich eigentlich richtig lebendig geworden. So lange brauchte ich, um »fertig« zu werden. Es war meiner Mutter ein richtiges Wunder, daß so ein winziges Geschöpf überhaupt durchkam. Mein bin ich immer geblieben, und noch Jahre später hat Mutter oft zu meinen Geschwistern gesagt: »Ich bin bloß gespannt, was aus unserm Hans wird!«
Bei dem kärglichen Einkommen meines Vaters in seiner Töpferei und seinem Ofensetzergeschäft und bei der großen Kinderzahl war es selbstverständlich, daß wir Kinder zur Ernährung und Bekleidung mithelfen mußten. Ich kleiner, aber flinker Knirps hütete schon mit drei Jahren Gänseküken. Wir zogen jedes Jahr 50-60 solcher Küken auf. Ich kann mich noch gut an eine ältere Frau erinnern, die auch Gänse hütete. Zu der sagte meine Mutter: »Paß ein wenig auf den Kleinen auf!«
In Gunzenhausen liegt das bekannte Diakonissen-Mutterhaus »Hensoltshöhe«. Es wurde 1908 gegründet. In seiner Anfangszeit haben die jungen Schwestern auch Gänse gehütet, oft in meiner Nähe. Ich war inzwischen schon ein paar Jahre älter. Sie gaben mir öfter »Bildle« zum Anschauen.
Die Arbeit war nicht so sehr schwierig. Man mußte sich nur ab und zu ein wenig rühren, dann waren die Gänse ganz zufrieden und blieben beieinander. Nach der Schule kamen die größeren Geschwister dazu, hallen beim Hüten und sammelten Futter. Es wurden Brennesseln und Disteln gesucht und heimgebracht. Anschließend war noch einmal Schulunterricht bis 15 oder 16 Uhr. Die Gänse wurden großgezogen, bis sie das erstemal gerupft wurden. Danach wurden die meisten verkauft. Wir selber hatten viele Betten, und es wurden viele Federn gebraucht. Das Geld von den verkauften Gänsen mußte z. B. herhalten, um Kleider und Anzüge für die Konfirmation zu kaufen. Bei unserer großen Schar war ja jedes Jahr jemand »dran«, und das ging ganz schön ins Geld!
Gänsehüten war aber nur eine unserer Beschäftigungen. Eine andere war das Austragen von Brötchen für verschiedene Bäckereien. Wir waren morgens von 6 bis 1/48 Uhr unterwegs. Auf diese Weise verdienten wir schulpflichtigen Kinder uns das Frühstück und ein kleines Taschengeld. Wenn im Wald die Heidel-, Preisel-und Himbeeren— reif wurden, wurde jede schulfreie Stunde zum Pflücken ausgenutzt. Das war für die Kinderhände oft ein harter
Zwang, aber wenn dann am Abend die Körbe voll waren, zog die ganze Schar fröhlich singend mit ihrer Ausbeute nach Hause. Als Belohnung für den Fleiß gab es ein Ei, und dann machten wir uns an die Schularbeiten.
Mitte August war die Beerenzeit vorüber. Dann wurden wir Kinder zu verschiedenen Bauern zum Hopfenpflücken gegeben. Hier verdienten wir uns unser Essen und einige Mark, je nach Alter und Fleiß. Weiter folgte im Ablauf des Jahres das Ährenlesen und das Holzlesen. Bei dem letzteren achteten die Eltern scharf darauf, daß die Kinder nichts stahlen, um ihren Wagen rascher voll zu bekommen.
Einmal glaubte ich, beim Holzsammeln ein besonderes Glück zu haben, als ich im Spätherbst an ein kleines Wäldchen von jungen Lärchenbäumen kam. Diese waren zu jener Jahreszeit ohne Nadeln und sahen aus, als wären sie alle dürr. Ich hatte damals keine Ahnung, daß die Lärchen im Herbst ihre Nadeln verlieren. Das hatte uns Kindern nie jemand gesagt. Darum mein Irrtum: »Die Lärchen sind wertlos und nur noch als Brennholz zu verwenden.«
Ich machte mich mit einigen meiner Geschwister über die Bäumchen her, um sie abzuhauen. Ich freute mich sehr, daß der Wagen bald gefüllt sein würde. Aber o weh, da erschien auf einmal der Waldaufseher, und das war gut! Als wir heimkamen, setzte es eine solche Tracht Prügel, daß an diesem Abend keiner mehr sitzen konnte. Zu essen bekamen wir auch nichts mehr. Der Vater mußte eine Strafe von 20 Mark an das Forstamt bezahlen.
Das war damals viel Geld. Es waren noch mancherlei andere »Tätigkeiten«, die dafür sorgten, daß wir Krebskinder nie »arbeitslos« wurden. Wir kehrten Straßen und halfen im Winter beim Schneeräumen. Wir hüteten Ziegen, eigene und die von Nachbarn. Es waren oft 30-40 in unserer Herde. Wir hatten Kaninchen und mußten für sie Futter holen. Wir sammelten Alteisen, Lumpen und Knochen, und was es sonst noch gab. Wo Telegraphenarbeiter ihre Werkstatt hatten, wühlten wir in den Abfallhaufen herum nach jedem Zentimeter Kupferdraht oder nach Messing und anderm Metall. Das wurde alles verkaüft, und wir freuten uns, wenn wir 50 Pfennige oder eine Mark heimbringen konnten.
Während unserer Kinder- und Schulzeit halfen wir auch in der
Töpferwerkstatt mit. Damals wurde alles noch im Hand- und Fußbetrieb gemacht. Der Ton wurde zwei- bis dreimal durch die Tonwalze gedreht und dann wiederholt mit den Füßen durchgetreten, bis er fein und rein und ohne Unrat war. Dazu war viel Kraft und Mühe nötig.. Dann wurde er noch auf der Würgebank öfter durchgeknetet, bis er ganz teigartig war. Außerdem drehten wir oft stundenlang, meist zu zweien, die Glasurmühle. Das war eine Steinmühle, welche die Erzglasur fein mahlte.
Wir halfen Tiere: Hunde, Katzen, Pferde, Löwen usw. formen, zum Teil mit Gipsformen, zum Teil aber auch freihändig, und sie auch mit Grundton oder Glasur bemalen. Damit waren wir im Winter voll beschäftigt, und wir waren sehr froh, wenn wir z. B. auf dem Weihnachtsmarkt einige Hundert Tiere oder Kinderspiel-Zeuge, wie Tassen, Kaffeekännchen, Schüsselchen usw., die schön bemalt waren, verkaufen konnten. Zu unserer Kinderzeit waren alle diese Sachen noch sehr primitiv und einfach.
Der Ton wurde früher von den Töpfern in bestimmten Äckern gesucht und mit großer Mühe mit der Handschaufel ausgegraben. Ich habe das in meiner Lehrzeit noch selber gemacht. Es gab damals noch keine Bagger, die den Humus abheben konnten. Deshalb wurde der Acker vollkommen durchwühlt, um die Tonadern, die manches Mal metertief lagerten; mit der Schaufel auszuheben. Aus diesem Grunde wurden solche Äcker zum größten Teil unfruchtbar und waren die billigsten im Ortsgebiet. In den meisten Fällen wurden sie als Friedhofsacker verwendt.
Diese Tatsache hilft zum Verständnis von Matthäus 27, 7. Mit dem Verrätergeld des Judas wurde der billige Töpfersacker gekauft. Dieser sogenannte Blutacker wurde zum Begräbnis der Pilger verwandt. Er war sicherlich der billigste Acker in der ganzen Umgebung.
Nun muß ich noch den Pflasterzoll erwähnen. Unsere Eltern mußten ja alles daran setzen, um ihre zahlreichen Kinder zu ernähren. So hatten sie auch drei Jahre lang zwei Straßen ersteigert, um dort den sog. Pflasterzoll einzukassieren. Für eine solche Straße mußten 1500-1800 Mark an die Stadtkasse entrichtet werden. Das war damals eine große Summe. Es sollte bei der Sache ja auch noch etwas verdient werden. Den Pflasterzoll mußten die Bauern bezahlen, wenn sie von den Dörfern in die Stadt kamen. Die Summen waren genau festgelegt: Ein Pferd kostete 15, eine Kuh 10, ein Leiterwagen 5 und eine Schubkarre 3 Pfennige. Der betreffende Bauer erhielt eine Quittung mit Tagesstempel.
Bei Brücken- und Straßeneingängen war jeweils ein kleines Zollhäuschen errichtet. Dort, wo die Nürnberger Straße und die Ansbacher Straße aufeinander stießen, hatte das Zollhäuschen vier Fenster, so daß man in beide Richtungen sehen und für beide Straßen den Zoll kassieren konnte. In diesem Häuschen verbrachten wir Kinder viele Stunden und erledigten dort auch unsere Schularbeiten. Wenn wir Jungen in der Schule waren, mußten die Mutter oder eine Schwester den Zoll »eintreiben«.
An guten Tagen, z. B. wenn Wochenmarkt war, betrug unsere Einnahme 12-15 Mark. Den besten Erfolg hatten wir jedoch zur Zeit der Pferdemusterungen im Ersten Weltkrieg. Den Rekord erbrachte ein Dezembertag im Jahre 1915: 37 Mark! Ich stand an einer Ecke, von wo ich auch die Fuß- und Feldwege übersehen konnte. Es gab nämlich Bauern, die gerne auf Um- und Nebenwegen angeritten kamen, um dem Zoll zu entgehen. Vor lauter Freude über die. große Einnahmequelle an jenem Tage ließ ich mein Frühstück und Mittagessen im Zollhäuschen unberührt stehen. Weil ich mich von sechs Uhr in der Frühe bis zum Abend draußen in der Kälte aufhielt, zog ich mir einige schmerzhafte Erfrierungen zu.
Nicht nur an jenem Rekordtag, auch sonst mußten wir scharf aufpassen, daß uns kein »sparsamer« Bauer entwischte. Entkam aber doch einer und wurde bei einer Kontrolle durch einen städtischen Beamten oder einen Polizisten ertappt, dann mußte er 10-20 Mark Strafe bezahlen.
Die Erfahrungen meiner Kindheit am Zoll ließen mich später meinen Freund Zachäus, den Oberzöllner von Jericho, mit dem ich die körperliche Kleinheit teilte, besser verstehen, als das die meisten vermögen, die von ihm lesen oder hören. Er mußte ja auch eine gewiß nicht kleine Summe aufbringen, die von der römischen Besatzungsmacht, von der er den Zoll gepachtet hatte, von ihm verlangt wurde. Dabei griff er auch zu betrügerischen und ausbeuterischen Mitteln. Durch die Begegnung mit Jesus aber wurde sein Leben neu.
All das Geschilderte macht deutlich, auf wie mannigfache Weise wir Kinder zum täglichen Brot in der großen Familie
beitrugen, und das machte uns glücklich. Ich will allerdings nicht verschweigen, daß sich meine Geschwister auch manchmal geärgert und über die Eltern geschimpft haben, weil sie so wenig Zeit zum Spielen hatten und immer zum Arbeiten angehalten wurden. Ich selber habe das nie so empfunden, weil ich am Arbeiten Spaß hatte. Auch die dreckigsten Sachen habe ich mit Freuden getan. Schon von frühester Jugend an habe ich jede Arbeit als Spiel betrachtet. So ist mir eigentlich nie im Leben eine Aufgabe schwer gefallen oder gar zuwider gewesen - in der Jugend nicht und auch später nicht. Ich habe oft zu meinen Kindern gesagt: »Ihr müßt jede Arbeit als Spiel ansehen, dann fällt euch keine schwer, und wenn sie noch so mühselig und schmutzig ist.«
Ich ziehe Bilanz: Ich sehe auf meine arbeitsreiche Kindheit und Jugend ohne Ärger und Bitterkeit, vielmehr mit Dank und Freude zurück. Sie hat mir nicht geschadet.
Mein erster Flug
Jetzt muß ich noch von einem Erlebnis berichten, das für die damalige Zeit eine einzigartige Sensation darstellte. Ich bin als Dreizehnjähriger zum erstenmal geflogen! Und das kam so:
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg bekamen wir Kinder selten einmal ein Auto zu sehen. Es wurden die ersten offenen Mercedes-Benz-Wagen gebaut, deren Höchstgeschwindigkeit etwa 30-40 Kilometer in der Stunde betrug. 1912 flog eins der ersten Zeppelin-Luftschiffe über Gunzenhausen hinweg. Da stand fast die ganze Einwohnerschaft auf den Straßen und bestaunte die großartige technische Errungenschaft. Am allersel-tensten waren damals Flugzeuge, meist als Eindecker konstruiert. Und solch ein Eindecker, der zu der kleinen Luftwaffe des Ersten Weltkrieges gehörte, mußte ausgerechnet in der Nähe unseres Städtchens im Sommer 1915 notlanden!
Das geschah ganz in der Nähe des Waldes, in dem wir gerade beim Heidelbeerpflücken waren. Schnell ließen wir unsere Körbe stehen und rannten zu dem in einer Wiese heranrollendcn Flugzeug. Es war das erste, daß wir so nahe sehen und beobachten konnten. Kaum war der Pilot ausgestiegen, da fragte er uns, ob einer von uns sich in das Flugzeug setzen und darauf aufpassen wolle. Er selber wollte sich in Brand, dem nächsten Ort, ein Fahrrad leihen. Mit diesem wollte er die vier Kilometer bis nach Gunzenhausen radeln und dort einen Schutzmann als Wachtposten holen. Wir hatten damals bei einer Einwohnerschaft von 5000 nur zwei Polizisten. Ich meldete mich sofort, die Wachaufgabe war mir lieber als Heidelbeerptlücken. Wie ich mich fühlte, in einem Flugzeug zu sitzen, zumal bald von allen Seiten die Leute herbeigeeilt kamen, um die Maschine zu bestaunen!
Von Gunzenhausen aus mußte der Pilot seinen Standort (Fliegerhorst) anrufen, um einen Monteur und Ersatzteile anzufordern. Am nächsten Tag erschienen sämtliche Schüler aus der Stadt und der Umgebung, um das notgelandete Flugzeug zu bewundern. Noch einen Tag später stellten auch wir uns mit unserer Klasse ein. Der Pilot wollte wissen, ob der »Kleine« dabei war, der
@1981 Francke-Buchhandlung
Petersen Jim,Evangelisation ein Lebensstil
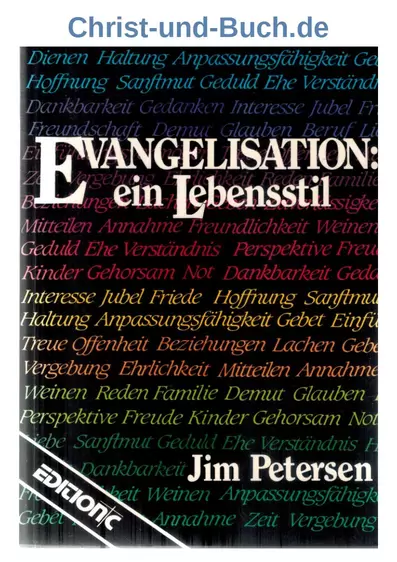
Der Autor Jim Petersen ist Leiter der Navigatorenarbeit in Lateinamerika, wo er seit 1963 mit seiner Familie in Brasilien lebt. Er hat dort erlebt, wie viele junge Leute aus einer vollkommen säkularisierten Gesellschaft zum lebendigen Glauben an Christus gefunden haben. Er bietet keine Patentrezepte an, sondern eine biblische Fundierung und praktische Beispiele, wie das Evangelium in einer säkularisierten Gesellschaft vermittelt werden kann.
Einleitung
Einige Beobachtungen zu den herkömmlichen Evangclisationsmethoden
- Unser Evangelisationsstil ist in Traditionen steckengeblieben
I. Teil: Einige Schwierigkeiten
1. Sich der Wirklichkeit einer unerreichten Welt stellen - Bewegen wir uns in die richtige Richtung?
2. Schlimmes Erwachen - Sind wir geduldig genug?
3. Unser missionarischer Übereifer - Sind wir zu sehr erfoigsorientiert?
4. Wirkliche Verständigung - Verstehen die Menschen unsere Sprache?
II. Teil: Evangelisation durch Verkündigung
5. Verkündigung des Evangeliums - Biblisch, am Wesentlichen orientiert
6. Das religiöse Erbe - Bestandsaufnahme: Voraussetzung für wirksame Verkündigung
7. Reichweite der Verkündigung - Grenzen der Wirksamkeit
III. Teil: Evangelisieren durch ein gelebtes Zeugnis
8. Die rätselhaften Briefe der Apostel - Wo werden wir in den Briefen aufgefordert, zu verkündigen?
9. Israel - ein lebendiges Zeugnis an die Welt - Das auserwählte Volk Gottes
10. Das Zeugnis der Gemeinde Jesu - Ein einzigartiges Volk
IV. Teil: Evangelistischer Lebensstil - praktisch
11. Ein gutes Zeugnis - Oft nur eine Karikatur
12. Eine attraktive Alternative anbieten - Das Christsein praktisch vorleben
13. Einheit von Glaube und Leben - Das Wertsystem der Christen
14. Die Gefahr der Abkapselung - Wenn Absonderung zur Abkapselung wird
15. Angst voreinander - Ein Hindernis für ehrliche Beziehungen
16. Wer paßt sich wem an? - Eine offene Atmosphäre für den anderen schaffen
17. Das Prinzip des Leibes Christi Ergänzung durch verschiedene Gaben
18. Drei Bereiche, die zusammenwirken - Leben, Gemeinschaft und gesprochenes Zeugnis
19. Die biblische Grundlage für den Glauben - Bewußter Gehorsam gegenüber Gott durch sein Wort
20. Die dynamischen Kräfte bei der Bekehrung Der Christ, der Heilige Geist und die Bibel
21. Das Beispiel von Abrahao - Ihr könnt meine Fragen nicht beantworten
22. Einige Tips für die Praxis - Wie fangen wir an?
Noch ein Buch über Evangelisation?
Um das Anliegen dieses Buches zu verstehen, muß man sich einige Tatsachen und Beobachtungen vor Augen führen, die jeden verantwortungsbewußten Christen bewegen sollten.
1. Die letzten 10 Jahre sind in Deutschland gekennzeichnet von einer evangelistischen Großoffensive: Überall gibt es große und kleine Evangelisationen; evangelistische Verteilschriften werden zu Hunderttausenden gedruckt und verteilt; fast keine Fußgängerzone ohne singende Jugendgruppe im Einsatz. Dabei hat sich ein ganz bestimmtes Verständnis von Evangelisation entwickelt. „Mission als Sonderaktion, die -.der Name sagt es schon - nicht im normalen Leben zu Hause ist, sondern zusätzlich, extra geleistet wird. Der gute Christ engagiert sich dem ‚Ideal' folgend an Feiertagen, Wochenenden und Abenden: Er steht an Informationsständen, geht mit Traktaten von Haus zu Haus und findet sich abends im Evangelisationszelt ein, wo er ‚Zeugnis gibt'. Das Gespräch über den Gartenzaun, der Abend in der Familie, das Plauderstündchen mit Bekannten und Nachbarn (bei denen man ja auch über Gott reden könnte, und zwar sehr glaubwürdig) werden zweitrangig, es lebe die ‚Action' ‚das Besondere, Außergewöhnliche." *
2. Laut einer Umfrage, die „der Spiegel" 1967 und 1979 in Auftrag gegeben hat, haben innerhalb des letzten Jahrzehntes ca. „12 Millionen Deutsche (d. h. jeder Fünfte) ihre christliche Überzeugung oder ihre prochristliche Einstellung aufgegeben zugunsten der Haltung: Christsein? Das bringt mir nichts!"**
In keinem anderen Bereich unserer Gesellschaft hat sich in so kurzer Zeit ein so drastischer Wandel vollzogen. Menschen, die so weit säkularisiert (d. h. verweltlicht) sind, können mit den oben beschriebenen Aktionen nicht erreicht werden. Sie gehen vollkommen an ihnen vorbei. Das führt zu der erschreckenden Situation, daß alle evangeli-stischen Bemühungen auf einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung beschränkt bleiben (ca. 20-30%, nämlich die, bei denen durch das Elternhaus noch christliche Vorstellungen gelebt und gelehrt wurden). 70-80% der Menschen bleiben trotz aller Einsätze und Aktionen vom Evangelium unberührt!
Vor einigen Jahren lautete die Jahreslosung: „Gott will, daß die r: Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen" (1. Tim. 2,4). Wenn wir dieses Anliegen wirklich ernstnehmen, ist eine tiefgreifende Neubesinnung im Bereich der Evan-gelisation nötig. Gott möchte, daß alle Menschen gerettet werden - nicht nur der kleine Prozentsatz derer, denen ein religiöses Erbe mitgegeben worden ist.
Ansatzpunkt für diese Neubesinnung bietet das schlichte Gleichnis Jesu aus Matthäus 13, Vers 33: „Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchsäuert ward". In diesem Gleichnis Jesu geht es um das Wachstum des Reiches Gottes, dabei werden die Christen mit Sauerteig verglichen, die Welt mit Mehlteig; die Form, in der die Christen die „Welt" beeinflussen sollen, ist das „Unter-gemengt-sein", das Ziel st die vollständige „Durchsäuerung". Dieses Gleichnis ist eine radikale Aufforderung zum Leben in der Welt; nicht durch Anpassung, sondern durch Beeinflussung. Es ist der Aufruf wider den Rückzug in die frommen Kreise, wo die Evangeli-sation zum „Blitzkrieg" wird, zu einer Aktion, mit der man sich punktuell in die Welt vorwagt, um schnell in die Geborgenheit der christlichen Gemeinschaft zurückzukehren.
„Untermischen" ist keine Rechtfertigung für die Halbherzigen, denen die ganzen evangelistischen Programme schon immer suspekt waren, weil sie selbst zu den gehören, denen die Welt mehr bedeutet als die gehorsame Nachfolge, Stattdessen ist es die Anfrage an die, denen es am Herzen liegt, daß Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist die Anfrage, wie weit ich bereit bin, die Abgrenzung und Bewahrung aufzugeben, liebgewor-dene Sprachweisen, Denkstrukturen und Verhaltensweisen abzulegen, um des anderen willen. Wie weit will ich den anderen wirklich verstehen und annehmen? Wie weit will ich die Gemeinschaft mit ihm suchen, um Gemeinsamkeiten aufzubauen? Wie weit öffne ich mein Leben, meine Familie, mein Haus, damit andere sehen können, wie es bei mir wirklich aussieht?
Wieviel Geduld habe ich, jemandem mit Ausdauer und Glauben über Monate und Jahre schrittweise zum Vertrauen in das Evangelium zu helfen. Fragen, zu deren Beantwortung dieses Buch helfen will - nicht durch Patentrezepte, sondern durch biblische Fundierung und - durch viele Beispiele aus einer reichen Erfahrung.
Horst Günzel
Leiter der Navigatorenarbeit
Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit den Navigatoren. Die Navigatoren wollen bei der Erfüllung des Missionsbefehls mithelfen, indem sie Menschen für Christus gewinnen und ihnen Hilfe in der Jüngerschaft anbieten. 2. Timotheus 2,2: '>Und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren«, kennzeichnet ihre Arbeit.
Sie arbeiten unter Schülern, Studenten und Berufstätigen. Sie tun dies innerhalb des Leibes Christi, im Rahmen der evangelischen Allianz in Verbindung mit anderen christlichen Werken und Gemeinden. Sie sind Mitglied im RMJ (Ring missionarischer Jugendbewegungen), einem Zusammenschluß vieler evangelikaler Missionswerke Deutschlands.
Die verschiedenen Materialveröffentlichungen sollen dazu dienen, daß Gläubige die biblischen Prinzipien der Jüngerschaft kennenlernen und dazu motiviert werden, sie in ihrem Leben und im Dienst für den Herrn anzuwenden.
Weitere Informationen über die Arbeit der Navigatoren erhalten Sie von:
DIE NAVIGATOREN
Seufertstr. 5 5300 Bonn 2
Einleitung
Einige Beobachtungen zu den herkömmlichen Evangelisationsmethoden
Unser Evangelisationsstil ist in Traditionen steckengeblieben
1963 reisten wir als Familie mit dem Schiff von Amerika nach Brasilien. Wie erwartet stellte diese Reise für uns einen Neuanfang dar. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, daß wir schon während der 16 Tage auf dem Schiff entscheidende, neue Erkenntnisse sammeln würden. Dieser Lernprozeß dauert bis heute an. Das vorliegende Buch ist der Versuch, das weiterzugeben, was ich seit dieser Reise darüber gelernt habe, wie man das Evangelium weitergeben kann. Wir waren 120 Passagiere an Bord, eine Hälfte Touristen, die andere Hälfte Missionare - 60 Touristen und 60 Missionare! Ein ideales Verhältnis! An Bord kann man nicht vielmehr unternehmen als spazieren gehen, lesen oder Gespräche führen. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, daß auch nur ein Tourist an das Ziel der Reise gelangen konnte, ohne nicht gründlich mit der christlichen Botschaft konfrontiert worden zu sein. Idealere Bedingungen, um das Evangelium weiterzugeben, konnte es nicht geben.
Während der ersten drei Tage versuchten meine Frau und ich, die anderen Passagiere kennenzulernen. Unsere Gespräche standen nicht unter Zeitdruck und schon bald diskutierten wir ernsthaft mit unseren Bekannten über Christus. Am dritten Tag wurde mir klar, daß wir die Passagiere bald total überfordern würden, wenn alle anderen 58 Missionare dasselbe tun würden wie wir.
Ich entschloß mich, mit den anderen darüber zu reden, wie wir unsere evangelistischen Bemühungen aufeinander abstimmen könnten. Die erste Gelegenheit zu einem solchen Gespräch ergab sich, als ich sechs Missionare traf, die auf dem Oberdeck zusammensaßen. Ich setzte mich zu ihnen und erzählte ihnen von meinen Überlegungen. Mein Vorschlag war, daß wir uns absprechen sollten, wie wir die Passagiere am besten erreichen könnten, ohne sie dabei zu überrennen.
Ich hatte die Lage völlig falsch eingeschätzt. Als ich ihnen erklärte, was mir auf dem Herzen lag, haben sich die sechs befremdet ange-Schaut. Anscheinend war es ihnen noch nicht in den Sinn gekom-män, mit den anderen 60 Passagieren über Christus zu sprechen. Schließlich sagte einer von ihnen: „Wir haben gerade erst unser Theologiestudium hinter uns gebracht. Wir haben dort nicht gelernt, wie man so etwas macht." Ein anderer sagte: „Ich weiß nicht so recht. In mir sträubt sich alles gegen die Vorstellung, daß man sich bekehren soll." Ein Dritter sagte: „Ich bin jetzt seit drei Jahren Pastor, aber ich habe noch nie jemand persönlich auf den Glauben hin angesprochen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie man das macht."
Ich sagte ihnen daraufhin, daß wir die 95 Millionen Brasilianer vergessen könnten, wenn es uns nicht gelingen würde, diesen 60 Leuten innerhalb von 16 Tagen und mit so vielen Missionaren das Evangelium nahezubringen. Dann sollten wir doch lieber gleich das nächse Schiff zurück nach Hause nehmen.
Nach einigen Stunden klopfte es an unserer Kabinentür. Da waren drei der sechs, mit denen ich gerade gesprochen hatte. Sie wollten mir mitteilen, daß sie vom Kapitän die Erlaubnis bekommen hätten, am Sonntag einen Gottesdienst für die Schiffsmannschaft durchzuführen. Sie baten mich, die Predigt zu halten.
Als sie mir ihr Vorhaben erklärten, kam mir ein Gespräch in den Sinn, das ich vor drei Wochen mit einem befreundeten Pfarrer geführt hatte. Dieser Pfarrer erzählte mir, daß seine Gemeindeglieder kürzlich angefangen hätten, Zeugnis von ihrem Glauben abzulegen. Die jungen Leute gingen jetzt jeden Sonntag in ein Altersheim, um dort einen Gottesdienst zu halten. Einige der Gemeindeglieder hielten jede Woche Gefängnisgottesdienste; am Ende dieser Gottesdienste boten sie den Gefangenen persönliche Seelsorge an.
Natürlich ist nichts Falsches daran, Gottesdienste in Gefängnissen irnd Altersheimen zu halten. Aber wenn das allein den evangelisti-schen Einsatz einer Gemeinde ausmacht, dann entsteht ein Problem. Ich fragte den Pfarrer: »Laufen Sie nicht Gefahr, Ihrer Gemeinde beizubringen, daß das Evangelium nur für Menschen in schwierigen Umständen bestimmt ist, für diejenigen, bei denen uns das Zeugnis-geben leichter fällt? Sollten Christen nicht lernen, die Botschaft gerade auch den Menschen zu bringen und sich um die zu kümmern, mit denen sie es täglich zu tun haben?"
Diese Gedanken gab ich an die drei Missionare in meiner Kabine weiter. Hieran Bord standen wir in der Gefahr, in das gleiche Denken zu verfallen. Ich sagtei „Durch unser Gespräch haben Sie Gewissensbisse bekommen. Da haben Sie sich jetzt diese armen Seeleute ausgesucht, die nie zur Kirche gehen, und haben einen Gottesdienst für sie geplant. Das ist gut. Aber ich denke, wir können uns vor der Verantwortung für die anderen Passagiere nicht drücken." Sie verstanden, was ich sagen wollte. Aber sie hatten jetzt schon zugesagt, diesen Gottesdienst für die Mannschaft zu halten. Der Kapitän machte einen Anschlag in den Mannschaftsunterkünften und der Speisesaal wurde für den Anlaß hergerichtet. Ich sagte zu, zu kommen, aber nicht um zu predigen.
Wir vier Missionare waren rechtzeitig im Speisesaal. Es war niemand gekommen. Hin und wieder liefen Seeleute ganz geschäftig durch den Raum. Sie waren jedoch sehr darauf bedacht, nicht von uns „abgefangen" zu werden. Schließlich kam ein Seemann herein und setzte sich. Er war Baptist. Das war also unser Gottesdienst. Vier Missionare und ein baptistischer Seemann. Nach diesem Abend fingen meine drei Freunde an, ernsthaft darüber nachzudenken, wie sie auf die Touristen zugehen könnten.
Unter den Passagieren befand sich auch ein älteres, gläubiges Ehepaar. Der Mann hatte Geburtstag, und aus diesem Anlaß veranstalteten die drei Missionare einen traditionellen Liederabend. Ich wußte, was einen da erwartete und hielt es für besser, weg zu bleiben, um nicht die Beziehungen zu den Leuten, mit denen ich im Gespräch über den Glauben war, aufs Spiel zu setzen. Als sie mit ihrem Abendprogramm anfingen, war ich auf dem Oberdeck. Ein anderer Passagier wollte wie ich die Abendluft genießen. Wir fingen an, uns über das Neue Testament zu unterhalten, das ich zum Lesen bei mir hatte.
Wir hörten deutlich, was unten vor sich ging. Es wurden zunächst Volkslieder gesungen, dann kamen geistliche Lieder, und schließlich wurden Glaubenszeugnisse gegeben und eine Ansprache gehalten. Meine drei Freunde waren hinterher ganz begeistert. Es war ihnen gelungen, zu fast allen Passagieren zu »predigen". Natürlich organisierten sie am übernächsten Abend wieder einen Liederabend. Wieder ging ich auf das Oberdeck, aber dieses Mal leisteten mir noch 60 andere Passagiere Gesellschaft. Sie wollten nicht ein zweites Mal in dieselbe Falle gehen!
Als ich später noch einmal über diese 16 Tage nachdachte, ging mir auf, daß unsere Situation auf dem Schiff die Situation der Kirche im Kleinen widerspiegelte. Durch diese Erkenntnis und die Erlebnisse der darauffolgendenJahre, in denen mein missionarischer Dienst die Eingewöhnung in eine neue Kultur mit einer neuen Sprache notwendig machte, ergaben sich Hunderte von Fragen. Seitdem bin ich auf der Suche nach Antworten. Ich möchte herausfinden, wie man das Evangelium wirklich in die Welt hineintragen kann. Das ist der Gegenstand dieses Buches.
1. Teil: Einige Schwierigkeiten
1. Sich der Wirklichkeit einer unerreichten Welt stellen
Bewegen wir uns in die richtige Richtung?
„Gehet hin in alle Welt" (Markus 16,15). Wenn Sie diese WorteJesu lesen, wie stellen Sie sich diese Welt vor?.
Sie könnten sich z. B. darunter ein riesiges Gebiet vorstellen, das von mehr als 4 Milliarden Menschen bewohnt wird, die sich einzig und allein dadurch voneinander unterscheiden, ob sie eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus haben oder nicht. Wir haben eine Main-mutaufgabe vor uns, die sich allerdings auf eine leichte Formel bringen läßt: die Botschaft des Evangeliums all denen zu bringen, die Christus nicht kennen. Oder aber Sie haben eine geographische Vorstellung von der Welt. Es gibt heute 165 unabhängige Länder auf der Welt. Wir müssen nationale Grenzen überschreiten, unsere Arbeit in so vielen dieser Länder wie nur möglich aufnehmen und dort als Zeugen Christi leben.
Wie oft messen wir den Erfolg unserer missionarischen Arbeit an der Zahl der Länder, in denen wir arbeiten! Die Aufgabe der Weltmission wird dann dahingehend vereinfacht, daß lediglich schon bestehende Formen und Ausprägungen von missionarischer Arbeit in andere Länder der Welt getragen und überall dieselben evangelistischen Methoden angewandt werden.
Statt dessen sollten wir unser Augenmerk mehr auf die einzelnen Menschen richten. In einem Bericht der Organisation „World Vision" heißt es u. a.:
„Gott hat in Christus jeden Menschen zur Mission verpflichtet, nicht zur Mission der Länder der Welt, sondern der ta ethne, der Volksgruppen der Welt.
Die Sünde, die tief in unseren Herzen wohnt, hat uns für die wunderbare Tatsache blind gemacht, daß Gott nicht nur alle
Völker der Welt liebt, sondern daß er sie gerade in ihrer Verschiedenheit voneinander liebt - so wie sich ein Gärtner über die verschiedenen Farben und Arten der Blumen, die Gottfür
seinen Garten geschaffen hat, freut.
Das missionarische Konzept des Apostels Faulus hatte vor allem die Volksgruppen im Blick. (...) Erarbeitete als Jude mit dem gebührenden Respekt vor der jüdischen, kulturellen Tradition. (...) Er respektierte den Lebensstil der Griechen, solange wie dieser Jesus Christus als Herrn in einem tiefen biblischen und geistlichen Sinne unterworfen war.
Mission sollte die Farben und Schattierungen, die Grundzüge und Wesensarten der verschiedenartigen Völker ernst rieb-men. Viele Missionare haben die Tatsache, daß Gott alle Völker ohne Unterschied liebt, mißverstanden und setzen sich statt dessen für ein falsches Ideal derAusräumung aller Unterschiede ein. (...) Glücklicherweise wächst die Wertschätzung der vielen verschiedenen und erstaunlich reichen Sprachen und Kulturen auf der ganzen Welt. Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, daß wir in der Mission das rechte Feingefühlfür die Verschiedenartigkeit der Völker entwickeln.
Dr. Charles R. Taber, Herausgeber der Zeitschrift „Practical Anthropology" und Übersetzungsberater für die „United Bible So-cieties", kommt auch in diesem Bericht zu Wort: „Da Gesellschaften, Kulturen und Menschen derart große Unterschiede aufweisen, geht man am besten an die Mission heran, indem man sich möglichst genau auf die jeweilige Situation des Zuhörers einstellt. Der Evangelist muß herausfinden, von welchen Voraussetzungen der Zuhörer in bezug auf Begriffe wie Realität und Wahrheit ausgeht und welche Wertvorstellungen er hat."
Es ist sehr ermutigend, daß in der heutigen Mission eine evangelisti-sche Strategie betont wird, die an die jeweilige Situation angepaßt ist. Wir brauchen solche, biblisch fundierten Missionsstrategien, die die ethnischen und kulturellen Unterschiede sowie die Denkvoraussetzungen in bezug auf Begriffe wie Realität, Wahrheit und Wertmaßstäbe mit einbeziehen. Ein Mitarbeiter von World Vision hat es so formuliert: »MARC hat richtig erkannt, daß man nur mit einer klar umrissenen Strategie zur Erreichung der unerreichten Völker mis-
sionarische Durchschlagskraft haben kann. MARC fordert, daß im Mittelpunkt einer solchen Missionsstrategie das einzelne Volk und nicht der Evangelist oder Missionar stehen sollte."
Bei all diesen Betrachtungen geht es darum, wie das Evangelium weitergesagt werden kann. Dr. Taber drückt das folgendermaßen aus: „Wir sollten uns darum bemühen, daß wir bei der Darstellung des Evangeliums möglichst genau auf die Bedürfnisse des Zuhörers eingehen." In diesen zitierten Untersuchungen geht es hauptsächlich darum, daß die „Völker" und ihre Kultur verstanden werden, damit wir fähig werden, die verbale Verkündigung des Evangeliums der jeweiligen Ausgangssituation genau anzupassen.
Mit diesem Buch möchte ich eine biblisch fundierte Strategie für Evangelisation darstellen. Ich bin jedoch der Meinung, daß wir noch einen Schritt über das bloße Verkündigen hinausgehen müssen, um eine wirkungsvolle Strategie zu finden, die sich auf die Schrift stützt. Wir müssen erkennen, daß die Verkündigung des Evangeliums nur der erste Schritt in der Missionsstrategie des Paulus war. Wir brauchen für diese unerreichten Völlker etwas, was über die bloße Verkündigung hinausgeht und mehr Durchschlagskraft besitzt.
Heute leben 800 Millionen Menschen in Ländern mit Namenschri-stentum - dieser Begriff „Namenschrist" ist zum Synonym für die westliche Zivilisation geworden. MARC ordnet die anderen 3,2 Milliarden Menschen in sieben Kategorien ein: Animisten, Buddhisten, christlich-heidniche Synkretisten, Hinduisten, Mohammedaner, Menschen mit traditionellem Stammesglauben, und die säkularisierten Menschen.
Die Verwendung des Begriffes »säkularisiert" finde ich besonders interessant. In meinem Buch behandele ich die Frage, wie die unerreichten Menschen mit dem Evangelium erreicht werden können. Hierzu habe ich in Amerika und in den entwickelten Gebieten Brasiliens reichliche Erfahrungen gesammelt. Die größte unerreichte Gruppe ist in beiden Ländern der säkularisierte Teil der Bevölkerung. In diesem Buch geht es darum, wie die säkularisierten Menschen mit dem Evangelium angesprochen werden können. Wir verwenden dieses Wort „säkularisiert" an einigen Stellen in einer neuen Bedeutung. Deshalb sollten wir es erst einmal genau definieren.
„Säkular" wird definiert als „zur Welt gehörend, oder zu Dingen, die nicht als religiös, geistlich oder heilig angesehen werden können". „Säkularisiert" bedeutet „profan geworden, losgelöst von jeglicher Religion oder geistlichen Zusammenhängen oder Einflüssen, weltlich oder ungeistlich geworden", Die erste Definition beschreibt
ein Leben ohne einen Glauben. Die zweite beinhaltet, daß sich ein Gesinnungswandel von einem gottesfürchtigen Leben zu einem un-geistlichen Leben vollzogen hat.
Wir können diese Definitionen miteinander verknüpfen und damit einen großen Teil der Weltbevölkerung wie folgt beschreiben: »Menschen, die außerhalb eines christlichen Rahmens leben." Der christliche Glaube ist kein wichtiger Bestandteil ihres Lebens mehr. Ihre persönliche Lebensphilosophie gründet sich nicht auf christli-
che Vorstellungen. -
Mit dieser Definition hätten wir die rein „weltlichen" Menschen - jene, die nach einer nichtchristlichen Philosophie leben - umfaßt Sie
würde aber auch die Atheisten, die Agnostiker und diejenigen mit einschließen, für die der Materialismus zur Pseudo-Religion geworden ist - sowie auch der Marxismus eigentlich eine Pseudo-Religion ist.
Sie würde auch die untschließen, die erst später weltlich „geworden" sind, bei denen sich ein Gesinnungswandel von einer christlichen
Philosophie zu einer nichtchristlichen Lebensauffassung vollzogen
hat. Einige Menschen haben diesen Wandel selber erlebt. Aber meist erstreckt er sich über mehrere Generationen, die vom Christentum
enttäuscht wurden Bei vielen ist es schon mehr als 25 Jahre her, daß sie ein Leben innerhalb christlicher Strukturen kennengelernt haben. Sie sind der Meinung, daß der christliche Glaube als gültiges Fundament für eine persönliche Lebensphilosophie ausgedient hat. Sie leben in einem nachchristlichen Zeitalter.
Sie wissen vielleicht traditionsgemäß einiges über den Glauben, aber das hat keine Auswirkungen auf ihr persönliches Leben. Einige die-
ser Leute verfügen vielleicht sogar über ein breites Wissen in bezug auf Glaubensinhalte. Sie haben z. B. den Katechismus gelernt. Wenn man sie auf den christlichen Glauben hin anspricht, werden sie die „richtigen" Antworten geben. Aber diese Glaubensinhalte haben für sie persönlich keine Bedeutung mehr.
Andere wissen überhaupt nichts von Glaubensinhalten oder davon, daß es den christlichen Glauben gibt. Viele von uns können sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, daß das sogar noch auf ganze Bevölkerungsschichten Nordamerikas zutrifft.
Es gibt natürlich verschiedene Grade der Säkularisierung. Die Extreme lassen sich immer leicht aufzeigen - aber oft sind die Unterschiede nicht so deutlich erkennbar. Zwischen Schwarz und Weiß gibt es unendlich viele Grauzonen. Viele Menschen sind teilweise säkularisiert und teilweise christlich.
Wie viele Nordamerikaner könnten als säkularisiert bezeichnet werden? Bei einer Meinungsumfrage der Zeitschrift „Christianity Today" unter Nordamerikanern über 18 im Jahre 1979 wurde festgestellt, daß 94% der Amerikaner an Gott oder an ein höchstes Wesen, das sie als Gott ansehen, glauben. Die Hälfte von ihnen sagte, daß dieser Glaube ihnen großen Trost spendet. Ungefähr ein Viertel glaubte, daß Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. 45% sagten, daß ein persönlicher Glaube an Christus die einzige Hoffnung der Erlösung ist.
In Amerika gehören heute 67% der Bevölkerung einer Kirche an. Die Hälfte dieser Leute geht zumindest einmal im Monat zur Kirche. Diese Zahl behinhaltet Protestanten, Katholiken und andere christliche Gemeinschaften. Jeder fünfte amerikanische Erwachsene bezeichnet sich selber als evangelikal.*
Wie können wir die Ergebnisse dieser Umfrage auswerten? Sie zeigen ganz deutlich, daß die christliche Botschaft guten Anklang gefunden hat. Aber was ist mit der Hälfte dieser 94%, die wenig oder keinen Trost in dem Gott finden, an den sie glauben. Scheinbar sind sie Anhänger eines einfachen Deismus, eines Glaubens an einen Gott, der vielleicht einmal die Welt erschaffen hat, sich dann aber zurückgezogen hat; für sie ist Gott nicht jemand, der aktiv in das Leben der Menschen eingreift.
In dem angeführten Bericht stellt Dr. Taber die Frage: „Wie sehen diese unerreichten Volksgruppen aus?" Er führt weitet aus: „Damit sind nicht winzige und einheitliche Volksgruppen gemeint, ähnlich den entlegenen Dschungelstämmen, sondern hier handelt es sich vielmehr um klar abgrenzbare Untergruppen innerhalb schon gründlich missionierter Gesellschaftsgruppen oder um Gruppen, die in einer früheren Generation oder in einem anderenJahrhundert missioniert wurden. Unter ihnen befinden sich z. B. viele Kirchgänger aus den reichen westlichen Ländern, die trotz all ihrer Kirchlichkeit nie das Evangelium klar und deutlich gehört haben... In der Praxis sind dieseMenschen eigentlich genauso wenig erreicht wie die Dschungelstämme oder die in den Ghettos unserer Städte lebenden (,ne Chrisdanicy Today-Gailup Pol An Overview", Christianity Today Vol. XXItt, Decernber 24, 1979, S. 12.)
Menschenmassen."
Der Theologe Reinhold Niebuhr hat uns davor gewarnt, „uns nicht mit der allgemein vorherrschenden Religiosität unseres Volkes zufrieden zu geben. Sehr vieles davon ist einfach eine Verfälschung der christlichen Botschaft."'
Ich möchte gerne aus meiner Erfahrung heraus die Lage wie folgt be-urteilen: Angesichts solcher Statistiken, meiner eigenen Erfahrung und unserer Definition des Wortes „säkular", müssen wir da nicht konsequenterweise die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung als „säkularisiert" ansehen - als Menschen, die dem Christentum fern stehen?
Ich habe meine Erfahrungen als Missionar unter säkularisierten Menschen gemacht. Ich stehe im Dienst einer christlichen Organisation, die weltweit arbeitet. Meine Freunde, die unter anderen unerreichten Völkern arbeiten, machen ähnliche Erfahrungen wie ich. Ich glaube, daß die gleichen Prinzipien angewendet werden können, wann und wo immer wir unsere Gesellschafts- und Kulturschicht verlassen und versuchen, den Menschen die gute Nachricht zu bringen; und zwar zu den Menschen, die nicht die gleichen Denkvoraussetzungen wie wir haben und bei denen noch keine Vorarbeit geleistet würde, die eine Tür für das Evangelium geöffnet hätte. Wir tun uns schwer damit, diese kulturellen Grenzen zu überschreiten. Es findet keine echte Kommunikation statt - wir reden eigentlich nur zu uns selber!
Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung, für heute und für morgen. Nur das Evangelium bietet grundlegende Antworten auf persönliche und gesellschaftliche Probleme. Das Evangelium ist die gute Nachricht, daß Gott durch seine Gnade die Versöhnung all derer, die durch den Sündenfall verdorben waren, möglich gemacht hat (vgl. Röm. 8,19-32).
Wenn das so ist, dann sollten wir uns genau überlegen, wie wir diese Sache andern vermitteln können. Es gibt kein schwierigeres Pro-
blem. Eine wirkungsvollere Verkündigung des Evangeliums wird vor allem dadurch beeinträchtigt, daß wir glauben, wir hätten im Grunde die Patentlösung gefunden, wie wir die Verlorenen gewinnen können. Das ist aber nicht der Fall. Wir scheinen genau zu
* (Reinhold Niebuhr, ‚Religiosity and the Christian Faith", Christianity in Cd ay
28, 1951.)
*Idea 23/81 Kommentar von Thielmann ‚Das Miss.Jahr 1980—Die Abkehrvon Holzwegen"
*Spiegel 52/79
*Unreached Peoples Directory', Monrovia, California, MARC, 1974, S. 12— vorgelegt auf dem Weltevangelisationskongreß in Lausanne (Schweiz)
@ der deutschsprachigen Ausgabe
1983 hy Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH,
Plock Wilfried, Gott ist nicht pragmatisch
Was ist Pragmatismus?
Kapitel 1 - Die Geschichte des Pragmatismus
Es war einmal eine christliche Gemeinde. Jahrzehntelang ging sie treu ihren Weg. Ihre Glieder bezeugten Jesus Christus in ihrem persönlichen Umfeld. Immer wieder bekehrten sich Menschen, ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Die Zusammenkünfte der Gemeinde waren von der Verherrlichung Gottes geprägt. Das Wort der Schrift wurde reichlich verkündigt. Gesunde Lehre hatte ihren festen Platz im Gemeindeleben. Die Gläubigen dienten einander mit ihren Gaben. Die Gemeinde wurde erbaut. Sie wuchs unspektakulär, aber sie wuchs.
Eines Tages kam ein neuer Wind in die Versammlung. Einige Christen hatten bestimmte Bücher gelesen. Andere hatten Kongresse besucht. Die Veränderer gewannen langsam die Oberhand. Eine neue Philosophie wurde eingeführt: wir wollen jetzt »Gemeinde für Entkirchlichte« sein. Völlig unbemerkt vollzog sich ein Denkmusterwechsel. Die sonntäglichen Zusammenkünfte wurden schrittweise zu »Gästegottesdiensten« umgebaut. Die Musik wurde lauter. Die Predigt kürzer. Der Mensch eroberte den Mittelpunkt des Geschehens. Die Lehre wurde angepasst.
Einige zumeist ältere Christen verließen schweren Herzens die Gemeinde. Sie konnten nicht fassen, was sich binnen weniger Jahre ereignet hatte.
Was ich mit wenigen Sätzen beschrieb, ereignete sich in den letzten zehn Jahren in vielen Gemeinden des deutschsprachigen Europa. Das könnte ich mit einer Anzahl trauriger Briefe dokumentieren.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Brach sie aus heiterem Himmel über die Gemeinden herein? Oder gab es eine Vorgeschichte? Gibt es Zusammenhänge, die das Auftreten der »besucherfreundlichen Bewegung« erklären könnten? Ich meine, ja. Ein vorbereitendes und zugleich verbindendes Element ist die Philosophie des »Pragmatismus«.
Die Geschichte des Pragmatismus
Pragmatismus kommt von dem griechischen Begriff »pragma« und bedeutet Tat, Handlung. Im weitesten Sinn ist Pragmatismus zunächst einmal eine philosophische Richtung. Sie meint ein Absehen von einer vorgegebenen Wahrheit zugunsten von Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit. »Wahr« ist, was nützt und was sich gerade bewährt.
»Das Große Neue Fremdwörterbuch« erklärt:
»Pragmatismus« ist die Überzeugung, dass nur »wahr« ist, was für das Handeln zweckmäßig ist.'
John MacArthur dient bereits seit etwa fünfunddreißig Jahren der »Grace Church« in Los Angeles. Er schrieb weit über sechzig Bücher. Viele Amerikaner kennen ihn von seinen Radiopredigten. In Deutschland wurde er den Christen durch einige seiner Bücher sowie durch die MacArthur-Studienbibel bekannt. Er definiert wie folgt:
Pragmatismus ist die Behauptung, Bedeutung und Wert einer Sache würden durch ihre praktischen Konsequenzen bestimmt. Er ist nahe verwandt mit dem Utilitarismus, dem Glauben, dass alles, was nützt, auch gut ist. Für einen Pragmatiker und Utilitaristen ist jede Technik oder jede Methode gut, wenn sie nur den gewünschten Erfolg hat. Wenn's nicht funktioniert, muss die Sache schlecht sein.2
Dieser weit gefasste Pragmatismus findet sich bereits bei den Philosophen der Aufklärung und deren Nachfolgern. So meinte etwa Friedrich Nietzsche, dass in dem Augenblick, wo ein Begriff seine praktische Bedeutung verlöre, ein neuer erschiene.
Wahrheit sei folglich nicht etwas, das zu entdecken und aufzufinden, sondern vielmehr etwas, das zu schaffen wäre.
Von Immanuel Kant zu Charles Peirce
Die engere Fassung des Begriffes Pragmatismus entstammt der jüngeren amerikanischen Philosophie. Charles S. Peirce (1839-1914) führte den Begriff »pragmatisch« ein. Aber Peir-ce war nicht im eigentlichen Sinn originell. Er übernahm den Terminus von Immanuel Kant, der damit seine experimentale, auf mögliche Erfahrung bezogene Denkweise beschrieben hatte. Peirce, von Haus aus Chemiker, war vor allem von Kants »Kritik der reinen Vernunft« angetan und nannte sie seine »Muttermilch in der Philosophie«. Der Pragmatiker Peirce betonte wie Kant die enge Verbindung von Mittel und praktischem Zweck. Jedoch wehrten sich beide dagegen, den Pragmatismus als Anweisung zum nützlichen Handeln in Einzelfällen aufzufassen. Höchster Zweck war bei Kant und Peirce die »Entwicklung korrekter Vernünftigkeit«, nicht die zweckmäßige Einzelhandlung.
Peirce entwickelte seine Lehre übrigens in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aus einer agnostischen Grundhaltung heraus.3 Als zusätzliche Quellen des Pragmatismus nannte er Platon, Sokrates, Aristoteles, Spinoza, Berkeley und den englischen Psychologen Bain.
David F. Wells stellt fest, dass sich um die damalige Jahrhundertwende ein Denkmusterwechsel vollzog. Während im 18. und 19. Jahrhundert die dominanten Namen noch die der Theologen waren (Jonathan Edwards, Charles Hodge, etc.), glänzten im Amerika des 20. Jahrhundert vor allem die der Philosophen: Peirce, James, Dewey, und andere.4 Diese Wende sollte in der Folgezeit noch einen erheblichen Beitrag zur Schädigung der Gemeinde Jesu Christi leisten.
Wihiam James
Der Peirce-Schüler William James (1842-1910) studierte zunächst Chemie und Medizin. Er promovierte 1868 an der Harvard-Universität in Boston. Zwölf Jahre später wurde er dort Professor für Psychologie und Philosophie. Sein berühmtester Schüler war übrigens John B. Watson, der Begründer der Verhaltenspsychologie. James baute den Pragmatismus zu einer weithin bekannten philosophischen Richtung aus. Seit seinen Pragmatismus-Vorlesungen von 1906 galt James vielfach als Begründer dieser Richtung. Er wies aber stets auf Peirce als den wirklichen Urheber des Pragmatismus hin.
Während Peirce noch die traditionelle Wahrheitsauffassung vertrat, nach der Wahrheit die Übereinstimmung von Denken und Wirklichkeit ist, schuf William James eine neue Wahrheitstheorie. 1907 schrieb er sein Hauptwerk »Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking«.5 Die Kernaussage lautete folgendermaßen:
Die Wahrheit einer Behauptung oder einer Theorie steckt völlig in ihrer praktischen Wirkung. Wenn eine bestimmte Behauptung wirkt, so liegt darin nicht nur ihre Bedeutung, sondern auch ihre Wahrheit. Indem sie wirkt, wird sie zur Wahrheit. Wenn sie nicht wirkt, so ist sie unwahr.'
Und weiter:
Die Wahrheit einer Idee ist nicht ein fester, innewohnender Besitz. Wahrheit geschieht einer Idee. Sie wird wahr, wird wahr gemacht durch Ereignisse. Ihr Wahrheitsgehalt ist in der Tat ein Ereignis, ein Prozess: nämlich der Prozess der Selbstbewahrheitung, ihre Verifikation (Hervorhebungen im Original) .7
Fortan wurde Wahrheit als »Verifikation« (Bewahrheitung) verstanden. Diese vollzieht sich durch Handlungen. Sind die Handlungen von praktischer Bedeutung, also lebensfördernd, so erweisen sich die Ausgangsvorstellungen als »wahr«.
James definierte Wahrheit als »eine Art des Guten«. Das Wahrheitskriterium besteht für ihn allein in dem Nützlichen und Lebensförderlichen. In diesem Zusammenhang gebrauchte er den heftig kritisierten Ausdruck »cash value« (Barwert): »Truth is the cash value of an idea« (Wahrheit ist der Barwert einer Idee) .8 Für James lag also die Wahrheit einer Vorstellung allein in ihren praktischen Wirkungen. Wahrheit wurde für ihn zum Mittel der Befriedigung von Lebensbedürfnissen.
Pragmatismus und Religion
William James scheute sich nicht, diesen Denkansatz auch auf religiöse Weltanschauung anzuwenden. Er lehrte: »Nach pragmatischen Grundsätzen ist die Hypothese von Gott wahr, wenn sie im weitesten Sinn des Wortes befriedigend wirkt.«9
In seinem berühmten Buch »Varieties of Religious Experi-ence« (Vielfalt religiöser Erfahrungen) führt er Folgendes aus:
Wenn sich jemand in seiner Lebenspraxis .mit dem Gedanken tröstet, dass es eine Seelenwanderung oder einen Gott gibt, dann ist ein solcher Glaube für den Beteiligten nützlich und somit wahr (Hervorhebung vom Verf.), auch wenn weder der Glaube an eine Seelenwanderung noch der Glaube an einen Gott objektiv-wissenschaftlich verifizierbar ist.'°
James bekannte sich zwar zum »Glauben an Gott«, blieb jedoch immer bei einem sehr diffusen Glauben. Am Ende seiner Vorlesung über »Pragmatismus und Religion« sagte er den Studenten:
Sie sehen, dass Pragmatismus »religiös« genannt werden kann, wenn Sie der Religion erlauben, dass sie pluralistisch sein kann ... Pragmatismus muss dogmatische Antworten hinten anstellen, da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher wissen, welcher Typ von Religion auf lange Zeit gesehen am besten funktionieren wird.1'
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Theorien von Peirce und James wiederum von John Dewey (1859-1952) aufgegriffen und weitergeführt wurden. Dewey, ebenfalls ein überzeugter Evolutionist, übertrug Darwins Ideen in die amerikanischen Erziehungswissenschaften und behauptet bis heute einen verheerenden Einfluss auf dem Gebiet der Ethik.
Weitere Bedeutungen des Begriffs »Pragmatismus«
Zur babylonischen Sprachenverwirrung unserer Tage gehört der Umstand, dass ein und derselbe Begriff je nach Bezug verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Damit befasst sich die wissenschaftliche Disziplin der »Semantik«, die Wortbedeutungen erforscht und festlegt.
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier wenigstens zwei alternative Bedeutungen erwähnen. Im Umfeld der Sozialwissenschaften versteht man unter »pragmatisch« in der Regel »das Gegenteil von ideologisch, auf praktische Vorteile ausgerichtet, realitätsnah«. So beschreiben zum Beispiel die Autoren der 14. Shell-Jugendstudie den Wertewandel der »pragmatischen Generation« wie folgt:
Im Unterschied zu den 80er Jahren nehmen Jugendliche heute eine stärker pragmatische Haltung ein. Sie wollen praktische Probleme in Angriff nehmen, die aus ihrer Sicht mit persönlichen Chancen verbunden sind. Übergreifende Ziele der Gesellschaftsreform (das wäre ideologisch - Anm. d. V.) oder die Ökologie stehen hingegen nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der meisten Jugendlichen.12
Im technisch-betriebswirtschaftlichen Bereich kann »pragmatisch« durchaus die Bedeutung von »geschäftskundig, sachkundig, tüchtig« annehmen. Das Wort beschreibt in diesem Zusammenhang sogar manchmal das Gegenteil von »theoretisch«.
Der Pragmatismus und die Währheitsfrage
Der bibel- und christusgläubige holländische Philosophieprofessor Jacob Klapwijk kommt zu folgender Bewertung:
Der Pragmatismus bindet das Denken an die Pseudonorm der Anpassung, des Wachstums und des praktischen Erfolges. Das Denken ist aber an eine eigene Norm, die Wahrheitsnorm gebunden. Irrtümer bleiben Irrtümer, auch wenn sie gedeihen wie Unkraut und auch wenn praktischer Erfolg gewährleistet ist ... Umgekehrt bleibt Wahrheit immer Wahrheit, auch dann, wenn sie vergessen oder in den Staub getreten wird.13
Selbst wenn der Pragmatismus insgesamt mit Recht gezeigt hat, dass theoretisches Denken und praktisches Handeln nicht
auseinander gerissen werden dürfen, so lehrt er leider auf der anderen Seite ein völlig falsches Wahrheitsverständnis. In der Heiligen Schrift ist Wahrheit immer an Gottes Offenbarungshandeln in der Geschichte gebunden - und nicht zuletzt an die Person Jesus Christus (Job 14,6; 17,17).
Pragmatischer Glaube
Im Ergebnis ist der Pragmatismus weit von der Wahrheit der Bibel entfernt. Glaube hat hier nichts mehr mit realen Tatsachen zu tun. Er verkümmert zu einer Erziehungshilfe für Kinder, zu einer Sterbehilfe für Alte und zu einer Krücke für Versager, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Glaube ist für den Pragmatiker nur noch ein Pülverchen zur Daseinsbewältigung.
Os Guinness, ein brillanter Denker, ein gläubiger Intellektueller und Schüler des Theologen und Philosophen Francis Schaeffer, unterscheidet »schlechten Glauben« und »armen Glauben«. Letzteren beschreibt er wie folgt:
Während die Bibel: und die besten Denker der Kirchengeschichte die Suchenden einluden, an Gott zu glauben, weil die Botschaft, welche diese Einladung transportiert, wahr ist, glauben ungezählte Christen heute aus verschiedenen anderen Gründen. Zum Beispiel glauben manche, der Glaube sei wahr »weil er funktioniert« (Pragmatismus), andere, weil sie »spüren, er ist wahr in ihrer Erfahrung« (Subjektivismus), wieder andere, weil sie ernstlich glauben, er sei »wahr für sie persönlich« (Relativismus), und so weiter.14
Guinness beschreibt das Wahrheitsverständnis der Bibel in prägnanter Weise:
sie (die Wahrheit) ist überall wahr, für jedermann, unter allen Bedingungen. ... Geschaffen von Gott, nicht von uns, wird sie schrittweise entdeckt und erschlossen. Sie steht im Singular (»Wahrheit«), nicht im Plural (»Wahrheiten«); gewiss, nicht zweifelhaft, absolut und bedingungslos, nicht relativ; und sie gründet in Gottes unbegrenztem Wissen, nicht in unserer winzigen Fähigkeit, irgendetwas zu wissen."
@2004 Plock W.
Führen oder ver-führen? Führungsmodelle im modernen Management, Walter Paulsen
Unternehmenskultur und ganzheitliches Denken Unternehmenskultur und Wertewandel im Management
Ob wir die Philosophie derVernetzung alles Seins anerkennen wollen oder nicht, wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, daß Wirtschaft und Gesellschaft, Politik und Umwelt unmittelbar im Zusammenhang betrachtet werden müssen. Industrie, Handel und Dienstleistung haben mit der Politik viele Gemeinsamkeiten, ebenso mit der durch alle geprägten Umwelt. Unternehmer ziehen aus diesen Zusammenhängen ihre Schlüsse und gründeten beispielsweise den Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbe-wußtes Management (B .A.U.M. e.V.) oder machen sich innerhalb des Umweltausschusses im Bundesverband der Deutschen Industrie für eine umweltorientierte Unternehmensführung stark.
Allerdings können sich vorausdenkende Unternehmer nicht in allen Bereichen durchsetzen. Nach wie vor erkennt etwa die chemische Industrie nicht die Gefährdung der Ozonschicht durch FCKWan. Sie kann sich nur mühsam zu einem endgültigen Stop der Produktion von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen durchringen. Anders dagegen der Chef des großen amerikanischen Konzerns Johnson & Son (Johnson Wax), Samuel Curtis Johnson. Er hatte bereits 1975 den sofortigen Stop der FCKW-Produktion angeordnet, nachdem er erfahren hatte, das dieses Mittel im Verdacht steht, die Ozonschicht der Erde zu gefährden!
Damais brachte ihm diese konsequente Haltung viel Unmut unter der eigenen Führungsmannschaft ein. Ähnliches Verantwortungsbewußtsein läßt sich auch bei dem größten Computerhersteller der Welt bzw seinem deutschen Tochterunternehmen erkennen. Hier stellt die Geschäftsleitung quasi als Leihgabe seit 1985 ausgewählte Mitarbeiter im Rahmen des „Secondment"-Programmes gemeinnützigen Organisationen zurVerfügung. Das Gehalt bekommen die „Gastarbeiter" weiter von ihrem Unternehmen ausgezahlt. Bisher haben 14 Mitarbeiter (darunter eine Frau) als Secondee eine Aufgabe übernommen, davon vier in Sport und Kultur, drei im Umweltschutz, drei zur Nachwuchsförderung und einer in der Wissenschaft. Geplant ist, einen Secondee-Kandidaten für je tausend Mitarbeiter zurVerfügung zu stellen. Um zu belegen, daß es nicht um Geschäftsinteressen, sondern um „gesellschaftlicheVer-antwortung" geht, dürfen mit Secondments keinerlei Vertriebsaktivitäten vermischt sein (2)
Es gibt jedoch auch Zeitgenossen, die diese Entwicklung zu mehr ethischem Handeln bei Konzernen und deren Führungskräften mit recht großem Argwohn beobachten. Ist dies alles nicht nur ein Zeichen dafür, daß die Manager wieder einmal am Ende ihres Lateins sind und neue Leitbilder suchen? Lohnt es sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber überhaupt, das eigene Denken und Handeln ethisch auszurichten? Kommt nicht der weiter, der sich über Werte, Normen und Grenzen hinwegsetzt?
Diese und weitere Fragen wurden kürzlich auf einerVeran-staltung der Schweizerischen Studiengesellschaft für Kommunikation und Administration (SSKA) gestellt und, wie es weiter heißt, aus kompetentem Munde auch beantwortet. Dabei wurde bemerkt, daß sich heute nicht nurTheologen und Philosophen, sondern auch Naturwissenschaftler, Ökonomen und Wirtschaftler mit Ethik beschäftigen.Wie die Literatur zeige, werde offenbar der Glaube zunehmend durch Erkenntnis ersetzt. Ethik solle aber nicht nur „erdacht" werden, sie müsse vielmehr vor- und ausgelebt werden.(3)
Das betrifft auch Christen. Sie sollten sich nun nicht einfach beleidigt abwenden, sondern selbstkritisch nachhaken, um festzustellen, woraus diese negative Feststellung erwachsen sein könnte. Daß es im christlichenWesteuropa - besonders bei pietistischer Prägung - und in den USA immer schon Unternehmer gegeben hat, die sich von ihrem Gott verantwortlich zu ethisch einwandfreiem Handeln führen ließen, ist unbestreitbar.4 Über Jahrzehnte hinweg ist es jedoch nicht gelungen, diese Haltung und die Wurzeln dieses Handelns der großen Mehrheit der Gesellschaft deutlich zu machen. Erst seit kurzer Zeit scheinen sich einige Beobachter im Zusammenhang mit der Diskussion um Unternehmensethik auch auf die Grundlage der Heiligen Schrift zu besinnen, wenngleich ihre Überlegungen oft über die besondere Stellung der Zehn Gebote nicht hinausgehen.
Kritischen Menschen fällt es schwer zu glauben, die Kapitaleigner bzw. deren Vertreter hätten plötzlich ihre Verantwortung für all ihrTun und Handeln auch über den Bereich des Unternehmens hinaus erkannt. Sind es nicht vielmehr rein kapitalistische Zwänge, die zu einer verstärkten Hinwendung zur Verantwortung führen? Nach welcher Moral treffen Unternehmer ihre Entscheidungen? Welchen Einfluß hat eine religiöse Orientierung auf ihr Gewissen? Lassen ihnen die wirtschaftlichen Sachzwänge überhaupt noch genügend Freiheit für ethische Überlegungen? Diese Fragen wurden in einer aktuellen Umfrage unter Managern gestellt und erstaunlich offen und ehrlich beantwortet. Wir leben in einer Zeit der Gegensätze: zum einen wird über Sonntagsarbeit diskutiert, zum anderen über Kultur in Unternehmen, die auf ethisch einwandfreier Grundlage aufgebaut sein soll!
Von der Stamineskultur zur Kreditkultur
Zunächst muß einmal festgehalten werden, daß die allgemeine Unternehmenslehre im Gegensatz zu christlich geprägten Wissenschaftlern von einer wertneutralen Kultur der Unternehmen ausgeht. Diesem Begriff wird demnach in den Institutionen keine tiefere innere Bedeutung zugemessen. Die meisten Unternehmensführer werden jegliche Abhängigkeit von weltanschaulichen Systemen bestreiten, die überwiegende Mehrheit nicht aus böser Absicht, sondern schlicht aus Unwissenheit.
Fragen wir also, was unter „Unternehmenskultur" zu verstehen ist. Sie wird charakterisiert als „konsistente Gesamtheit aus Werten, Normen und Symbolen, die sich in einer Unternehmung als Antwort auf Anforderungen an die Unternehmung sowie Bedürfnisse der in ihr arbeitenden Menschen im Verlaufe der Unternehmungsgeschichte entwik-kelt, neuen Unternehmungsmitgliedern über das symbolhafte Verhalten von Vorbildern (dominanten Kulturträgern) bewußt oder unbewußt vermittelt wird und die Denk-undVerhaltensweise der in der Unternehmung tätigen Menschen auf unverwechselbare Weise prägt. "6 Diese konsistente - d.h. dichte, haltbare - Gesamtheit von Werten, Normen und Symbolen hat ihre besondere Bedeutung. So bilden die Werte den Kern einer Unternehmenskultur und bezeichnen das grundsätzlich Wünschenswerte in einer Unternehmung. Normen leiten sich aus denWerten ab und formulieren bestimmte Verhaltenserwartungen in definierten, typischen Situationen des Unternehmensalltags. In Symbolen konkretisieren sich Werte und Normen in Form von Sprache, wiederkehrenden Handlungen und Gegenständen; Symbole bilden daher den direkt wahrnehmbaren Bereich einer Kultur.
Letzteres nun läßt Ethnologen vermuten, dieses direkt Sichtbare einer Unternehmenskultur, die Symbole, verberge tiefgehende Erkenntnisse. Sie behaupten kurzerhand, zwischen Firmen- und Stammeskulturen mehr oder weniger exotischer Völker gebe es vielfältige Übereinstimmungen, so daß die eingehende Beschäftigung mit Stam-messymbolen, Mythen, Clanzeichen, Initiationen oder Ritualen der Stammesabgrenzung zu wertvollen Hinweisen für die Pflege von Firmenkulturen führt. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Symposium der Initiative für Industriekultur e.V. und des Rates für Formgebung, auf dem Gemeinsamkeiten zwischen Firmenkulturen und Stammeskulturen festgestellt worden sind. So werden zum Beispiel gegenübergestellt:
N Konferenzen und geheiligte Rituale
N das Firmenemblem und das Stammessymbol
N die Firmenkrawatte und die stammesübliche Körperbemalung
N das Logo und dasTotem der Firmenname und das Clanzeichen
Man kann solcheVergleiche belächeln und muß sie nicht unbedingt weiter beachten. Aber was wird mit diesem „magischen Brimboriüm117 eigentlich bezweckt? Der Personalchef eines großen Kaufhauses brachte es auf den Punkt:
denn Mitarbeiter wie Stammesangehörige sind Gemeinwesen, die ein und dasselbe wollen: einem Winning Team angehören und stolz darauf sein!"
Allerdings gibt es auch hierzu kritische Stimmen. So befürchten manche Praktiker und Wissenschaftler, mit der Kulturdiskussion werde der gleiche (gefährliche) Unfug angerichtet wie nach dem Ersten Weltkrieg mit Volks- und Be-triebsgemeinschaftsgedanken. Heute wie damals fühlten sich die arbeitenden Menschen entfremdet, zerfielen vertraute Umgebungen und Sozialbindungen durch fortschreitende Technisierung und Automation, herrschte Sehnsucht nach der überschaubaren Idylle, nach dem kleinen Glück im Winkel, nach sinnstiftender Betätigung, wie es das Jagen, Fischen oder Speereschmieden in früheren Kulturen angeblich noch war. Die Geschichte habe immer wieder gezeigt, daß mit solchen Bewegungen irrationalerArt ganz bestimmten Leuten - und hierbei denkt man an das Dritte Reich - gedient wurde. Auch hier erhebt sich die Frage nach der Verantwortung der Christen in unserer Gesellschaft.
Geben sie den nach Gemeinschaft strebenden und nach Sinn fragenden Mitmenschen Wegweisung? Selbst Exper-
die dem christlichen Glauben fernstehen, sehen in dem Rückgriff auf Stammeskulturen erneut die Tendenz, sich selbst für unmündig erklären zulassen.
Mittlerweile haben die Befürworter einer ausgeprägten Unternehmenskultur in allen Fachbereichen Anhänger gewonnen. Interessanterweise steht in allen Kulturdiskussionen der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtungen. Es geht nicht primär um den Einsatz bestimmter Technik, sondern um die Beeinflussung des Mitarbeiters, um mit seiner dann „richtigen" Einstellung zu mehr Erfolg zu kommen. „Nur mit guten Setzlingen läßt sich eine starke Kultur entwickeln." Ein Beispiel für diese Aussage eines Verantwortlichen kann die Neuorientierung im Kreditgeschäft der Banken und Sparkassen sein.8 Die starke Per-sonenbezogenheit des Kreditgeschäftes setze die Beachtung kultureller Fragestellungen voraus. Der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Kreditgeschäftes komme eine immer größere Bedeutung zu. Aus der Unternehmens-wird eine Kreditkultur. Dies stecke bereits im Begriff selbst: Kredit bedeutet nämlich —Vertrauen! Die Kultur im Kreditgeschäft zu verändern heißt nichts anderes, als die Wertvorstellungen vieler Mitarbeiter im Kreditgeschäft zu verändern.
Nachdem sich die Diskussion um Unternehmenskultur bisher fast ausschließlich aus der Praxis entwickelt hat, beschäftigt sich nun auch dieWissenschaft mit diesemThema. Dabei fällt auf, daß in einem Atemzug Fritjof Capra und sein Buch Wendezeit sowie Gedankengebäude und übergeordnete Ansätze der New-Age-Bewegung oder auch von Religions- und Sektengemeinschaften zur Erklärung herangezogen werden. Unternehmenskultur habe sich in den vergangenen Jahren als besonders aussagekräftiges Konzept durchgesetzt, das neben den bekannten, „rationalen" Konzepten „Organisation", „Strategie" und „Führung" erkläre, wie Unternehmen unter dem Einfluß situativer Fak toren ihre Ziele erreichen und damit (langfristig) ihren Fortbestand sichern könnten.
Die alten kaufmännischenWerte, etwa das Handeln nach „Treu und Glauben", die nicht zuletzt aus der christlichen Soziallehre abgeleitet wurden, scheinen ihre Bedeutung verloren zu haben. Eine „postchristliche" Orientierung setzt ein. In diesem Zusammenhang finden sich Behauptungen, „postmaterialistischeWerte" seien im Kommen, wobei „postmaterialistisch". bedeutet: mehr Sinn für zwischenmenschliche Beziehungen, Treue, Verläßlichkeit undTrans-zendenz, damit aber auch mehr Sinn für Religion, wenngleich nicht für die christliche. Daß gesamtgesellschaftlich eine völlig gegenteilige Entwicklung - nämlich weniger Treue im partnerschaftlichen Zusammensein, weg von Ehe und Trauschein - im Gange ist und Befragungen von Führungskräften ebenfalls in andere Richtungen zeigen, scheint die Befürworter eines Wertewandels nicht zu beeindrucken. Was in der Tat im Kommen ist, ist stärkere Ich-Zentrierung und innerhalb dieser Ich-Zentrierung wiederum eine auf Erfolg, Güter und Genuß eingeengte Sicht. Zumindest bei der gesellschaftlichen Elite entpuppt sich damit der vielgepriesene Wertewandel eher als ein geschickt verschleierter Egotrip.
Wertewandel in Gesellschaft und Unternehmen
Auch führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft leben nicht in abgeschlossenen, antiseptischen Räumen. Sie werden beeinflußt durch die sie umgebende Umwelt. Folgerichtig ist an dieser Stelle die Frage nach dem Wertewandel in unserer Gesellschaft. Nur so können das Handeln und die zugrunde liegenden Motive der Verantwortlichen verstanden werden.
Unerwartete Ereignisse, wie die Katastrophe vonTscher-nobyl, und erwartete Entwicklungen, etwa die voranschreitende Genforschung, zwingen uns dazu, grundsätzlich über unsere Werte in Theorie und Praxis nachzudenken.
Immer stärker scheinen die rein wirtschaftlich geprägtenWerte hinter den ethischen, kulturellen und moralischen Werten zurückzubleiben. Capras „Wendezeit", Ingelhardts „Silent Revolution" oder FrommsWandel von „Haben-" zu „Sein-Werten" zeigen diese Tendenz an. Management hat sich heute auch mit nicht-wirtschaftlichen Werten auseinander-zusetzen.9
Und zu solchen nicht-wirtschaftlichen Werten wird auch die Unternehmenskultur gezählt. Firmen nehmen moralisch-ethische Werte in ihre Leitbilder auf und verpflichten Mitarbeiter zu moralisch-ethisch bestimmten Verhaltensweisen. Dazu gehören denn auch praktische Konsequenzen wie der Rückzug aus bestimmten Geschäftsgebieten (zum Beispiel Südafrika) und der Verzicht auf die Herstellung bzw. Verwendung von bestimmten Materialien (zum Beispiel Asbest und DDT). Für den Erfolg, der mit der Besinnung auf moralisch-ethische Werte angestrebt wird, wird auch schon mal eine christliche Gemeinde als Vorbild herangezogen. Diese und andere karitative Organisationen erlangen nämlich innerhalb kürzester Zeit für bestimmte Projekte Finanzierungspotentiale, die mit solchen erwerbswirtschaftlicher Organisationen unvergleichbar sind.
Wer jetzt allerdings annimmt, diese Erkenntnis würde zu einer starken Ausrichtung an christlichen Werten führen, sieht sich getäuscht. Vielmehr erfolgt eine stärkere Hinwendung zu allem Transzendentalen. Dabei spielt das Gedankengut derAnthroposophie und des NewAge eine entscheidende Rolle.
Das Weltbild der neuen Kultur
Wenn von dem „Weltbild einer neuen Kultur" gesprochen wird, bedeutet dies, daß es eine wie auch immer geartete „alte" Kultur geben muß. Die beiden Begriffe bergen bereits eineWertung in sich. Mit der alten Kultur ist die christ-
hohe gemeint. Sie ist angeblich vergangen bzw. im Übergang begriffen. In der Managementliteratur liest sich das zum Beispiel so: „Im Laufe der letzten 2000 Jahre hat sich das Göttliche im offiziellen Christentum von Natur, Erde und dem Weiblichen getrennt. Vereinfacht gesagt ist das Göttliche in den Himmel erhöht, und das Teuflische, d. h. unter anderem ‚unpassende' Seiten unserer menschlichen Naturhaftigkeit, unter die Erde verbannt und verdrängt worden. Die Religion wurde somit zu einer fast ausschließlich geistigen und zum Teil intellektuellen Angelegenheit mit ausgesprochen ‚männlichen' Aspekten .....10 Da die Astrologie von jeher davon ausgeht, daß alle 2000 Jahre ein neues Weltzeitalter anbricht, und zwar analog dem Frühlingspunkt, der sich in diesen Zeitabständen von einem Sternbild ins nächste verschiebt, spricht man heute von einer „Wendezeit". Danach sind die Menschen eben im Begriff, vom Fischezeitalter, dem „Zeitalter des Christentums" und zugleich jenem „der Kriege und Ängste", ins Wassermannzeitalter zu wechseln, das sich durch Werte wie Brüderlichkeit, Frieden, Einheit und Ganzheit auszeichnen soll. „Viele Menschen verbinden diese Wende mit dem positiven Glauben an einen bevorstehenden, tiefgreifenden geistigen Entwicklungsschritt des Menschen, hin zu einem ganzheitlichen Leben, zur Einheit von Mensch und Natur, zurVereinigung des individuellen Ichs mit dem höheren kosmischen Sein.''°
Von Rudolf Steiner bis Jack Rosenberg alias Werner Erhard
Auf welchen Grundlagen basiert nunmehr die angeblich „neue" Kultur? Um dieser Frage nachzugehen, reicht es nicht aus, in einem Buch nachzuschlagen. Vielfältig und nur für aufmerksame Beobachter nachvollziehbar ist das Geflecht von Wurzeln und geistigen Ursachen des Weltbildes, das hinter der neuen Kultur steht. Rudolf Steiner und Jack Rosenberg wurden deshalb auch nur exemplarisch ausgewählt, um nachzuspüren, worauf sich die neue Kultur gründet
Inhalt
Vorwort 7
L Unternehmenskultur und ganzheitliches Denken 13
Unternehmenskultur ündWertewandel im Management 13
Das Weltbild der neuen Kultur 20
Die Notwendigkeit der Neu-Orientierung 27
Kultur als Unternehmensstrategie 31
Beispiele aus der Praxis 36
Die Gestaltung der Unternehmenskultur 42
Personalentwicklung als Folge neuen Denkens 48
2. Management und ganzheitliches Denken . 73
Führung 74
Führungsmodelle / Führungsstile und ihre geistigen Grundlagen 79
3. Psychotechniken im Personalbereich 107
Situationsbeschreibung und Versuch der Zuordnung 107
Menschenbilder 110
Psychotechniken (Auswahl) 122
Kritische Stellungnahme 134
4. Konsequenzen und Alternativen aus christlicher Sicht 139
DieVerantwortung der Manager und Mitarbeiter 147
Veränderung durch Glauben 151
Biblische Aus- und Weiterbildung 156
Praktische Ausübung christlicher Ethik in Unternehmen und Beruf 166
Anmerkungen 169
ISBN 3-89437-168-4
1 Auflage 1991
Umschlaggestaltung: Wolfram S.C. Heidenreich, Mainz
Satz:Typostudio Rücker & Schmidt
Druck und Verarbeitung: Ebner Ulm
Priated in Germäny
Ein Lächeln auf dem Gesicht Gottes Das ungewöhnliche Leben des Philip Ilott, Adrian Plass
1. Kapitel Kriegsfolgen - ein missbrauchtes Kind (1936-1945)
Klein-Philip hasste Adolf Hitler. Nicht, weil er einer anderen politischen Ideologie angehangen hätte; noch nicht einmal deshalb weil der wahnsinnige Diktator drohte, einen Großteil der freien westlichen Welt zu besetzen und zu unterdrücken. Nichts so Triviales war der Grund für den tiefen Zorn, den der Sechsjährige für den Führer Nazideutschlands empfand. Philip Ilott hasste Hitler, weil Papa seinetwegen nicht mehr die ganze Zeit zu Hause sein konnte. Papa war als Soldat im Krieg. Aber Philip brauchte ihn gerade jetzt, weil merkwürdige und schreckliche Sachen passierten. Sie geschahen nachts und sie machten ihm Angst.
Es gab nur zwei Dinge, die sie aufhalten konnten.
Das eine waren Adolf Hitlers Flugzeuge, die kamen, um Newcastle zu bombardieren. Wenn das geschah, heulte eine Sirene, und jeder musste schnell nach unten in die Luftschutzräume, um dort die Nacht zu verbringen. Philip hatte keine Angst vor den Bomben. Lieber wäre er in die Luft gejagt worden, als die Nacht in seinem eigenen Haus verbringen zu müssen - viel lieber. Manchmal, wenn das Licht des Tages langsam verblasste, saß er ordentlich in seinem ordentlichen Schlafzimmer und bat Gott, dass Herr Hitler doch seine Bomber zum Angriff auf Newcastle schicken möge. Es wäre ihm auch egal gewesen, wenn eine Bombe auf sein Haus gefallen wäre, während er drin war. Dann wäre alles zu Ende, das wäre gut!
Die andere Sache, die die Furcht einflößenden Nächte abwenden konnte, war, dass Papa nach Hause kam. Das war aufregend.
Philip kriegte so ein lustiges, ungewöhnlich warmes Gefühl im Bauch, wenn er sah, wie ein „Ich hab dich lieb - ich bin so froh, dich zu sehen" aus Papas Augen kam. Aber das hielt nicht lange an, weil als Nächstes die Streitereien wieder losgingen und - wenn sie einmal angefangen hatten - Papa nicht mehr richtig mit Philip zusammen sein durfte. Er durfte ihn dann nur noch anlächeln und ihn fragen, ob es ihm gut ginge. Aber diese Zeiten, wenn Papa nach Hause kam, waren wunderbar, besonders, wenn er ihn ganz fest in den Arm nahm und sagte: „Hallo, mein Käfer!" Das war Papas Name nur für ihn.
Niemand sonst nannte ihn Käfer - niemand. Aber das Beste an Papas Rückkehr, das, was die Sorge, die ihn sonst den ganzen Tag begleitet hatte, und die furchtbare Angst nachts wegnahm, war, dass, solange Papa Heimaturlaub hatte, Philip in seinem eigenen Bett und in seinem eigenen Schlafzimmer schlafen konnte - und nicht bei Mama
Er hatte es einfach nicht verstehen können. Am Anfang, als Papa in den Krieg zog, war er froh, dass Mama ihn zu sich in ihr großes Bett holte, auf die Seite, wo Papa normalerweise lag. Er war froh, weil er dachte, dass das vielleicht bedeutete, dass Mama ihn doch lieb hatte.
Er gab sich große Mühe, Mama zu gefallen, ganz große Mühe. Im Haus ging er nur äußerst vorsichtig umher, passte auf, dass er keinen der wertvollen Gegenstände kaputt machte, und gab sein Bestes, so sauber und gepflegt zu sein wie sie. Mama war eine sehr gepflegte Lady mit glänzendem Haar, die tote Füchse trug und Schuhe mit großen, langen Absätzen. Sie rauchte vornehme Zigaretten an einem langen, dünnen, schwarzen Röhrchen, und ihre Fingernägel waren leuchtend rot, als ob sie sie in eine Schüssel voller Blut getaucht hätte.
Er wusste, wie wichtig es für Mama war, dass alles gut aussah, und er versuchte ihr immer dabei zu helfen. Aber wie leicht machte er etwas falsch! Dann schrie sie ihn an oder sagte etwas, sodass er sich klein und dumm vorkam, oder sie schloss ihn in sein Zimmer ein oder in den Schrank unter der Treppe ohne Licht, bis er seine Lektion gelernt hatte. Das war das Schlimmste; wie eine Statue in der Dunkelheit zu stehen mit weit aufgerissenen Augen,
unfähig, etwas zu sehen - und zu ängstlich, sich zu bewegen, weil er dann etwas umstoßen könnte und sie wieder wütend wurde, wenn sie zurückkam.
Er hasste das.
Manchmal dachte er, dass er einmal vor langer Zeit seiner Mama etwas so Schlimmes, etwas so furchtbar Unrechtes getan haben musste, dass sie ihn für immer bestrafen würde, indem sie ihn nicht wichtig sein ließ; indem sie ihn immer im Weg oder eine Plage sein ließ. Er fragte sich, was das wohl gewesen sein mochte.
Vielleicht das, was er damals im Kinderwagen gesagt hatte. Er wurde innerlich immer ganz blass, wenn er an diesen schrecklichen Tag zurückdachte - das Erste, woran er sich überhaupt erinnern konnte.
Er war ein ganz kleiner Junge gewesen, der in seinem Kinderwagen in der Sonne vor dem Haus gesessen hatte. Eine Dame kam auf dem Bürgersteig entlangspaziert. Er beobachtete sie, während sie immer näher kam. Sie hatte eine große Hakennase und ein hervorstehendes Kinn, so wie die Hexen in seinen Bilderbüchern. Er mochte sie nicht. Als sie auf der Höhe seines Hauses war, blieb sie stehen und beugte sich über den Kinderwagen. Sie sagte: „Hallo, mein Schatz, du bist aber ein süßes kleines Baby, was?"
Philip wollte, dass die Frau wieder ginge, und so sagte er das Erste, was ihm einfiel: „Zieh Leine!"
Die Gesichtszüge der Hexe verhärteten sich. Sie klopfte an die Haustüre und Mama kam raus. Sie entschuldigte sich und versuchte einen kleinen unechten Lacher, als die Hexe ihr erzählte, was passiert war. Danach, drinnen, war Mama sehr böse gewesen, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, was sie gesagt hatte. Er fragte sich, woher er dieses schlimme Wort kannte. Er war doch immer nur bei Mama gewesen.
Vielleicht war das ja das furchtbare Unrecht, das Mama ihm nie vergeben hatte. Aber er glaubte es eigentlich nicht.
Es gab noch etwas anderes, etwas, das sogar noch früher passiert war. Er konnte sich nur nicht daran erinnern, aber manchmal, wenn er in den Spiegel sah, um zu kontrollieren, ob er für Mama in Ordnung war, fühlte er mit seinen Fingerspitzen eine komische kleine Beule an der Wange, und dann war es so, als ob er sich wieder daran erinnerte. Aber nur fast.
Vielleicht hatte es ja damit etwas zu tun. Vielleicht ... Vielleicht auch nicht. Und es gab da noch etwas, noch tiefer und weiter zurück, etwas, das er nicht mit seinen Augen oder seinem Gedächtnis sehen konnte. Nach einem wirklich schlimmen Tag konnte er es nachts fühlen, wenn er in der Dunkelheit wach lag - eine tiefere Dunkelheit in ihm, angefüllt mit einem verlorenen, hoffnungslosen Schluchzen, das niemals an die Oberfläche kam und niemals richtig Mut fasste. Es hatte was mit Zugehörigkeit zu tun, oder, besser gesagt, mit Nichtzugehörigkeit. Etwas ganz am Anfang...
Wenn er neben Mama schlief, schien es, als ob schließlich doch alles wieder in Ordnung kommen würde. Vielleicht könnte er ja hier wieder glücklich werden. Vielleicht würde Mama ihn wieder beachten und sich erneut mit ihm beschäftigen. Es würde so sein, wie es sein sollte zwischen einer Mama und ihrem kleinen Jungen. Aber nach einer Zeit schienen die Dinge, die passierten - die Sachen, die Mama machte -‚ falsch und schlimm zu sein. Seine Stirn legte sich in sorgenvolle Falten, wenn er daran dachte. Er wollte nicht Mamas Teddybär sein.
Warum musste es am Ende eines jeden Tages eine Nacht geben? Warum konnte der Krieg nicht zu Ende sein und Papa für immer nach Hause kommen?
Später, als er anfing, in die Schule zu gehen, und Mama einen Job bekam, zu dem sie jeden Tag ging, gab es etwas Neues, an das er sich gewöhnen musste: den Schuppen.
Mamas Haus war mit Sicherheit das Wichtigste überhaupt in der Welt. Sie putzte es und wischte Staub und stellte alles genau so, wie sie es haben wollte. Manchmal schob sie einen Gegenstand mit der Spitze eines ihrer roten Fingernägel ein ganz, ganz kleines Stückchen weiter auf dem Kaminsims, bis er sich genau an der richtigen Stelle befand.
Es schien sie nicht besonders glücklich zu machen, alles so sauber und ordentlich zu haben, aber wenn irgendetwas bewegt oder dreckig gemacht wurde, dann war das schlimmer als alles, was Mister Hitler tun konnte- Sie sagte Philip oft, wie schwierig und lästig es wäre, einen kleinen Jungen zu haben, der immer darauf bestünde, die Stühle zu zerknittern, indem er sich draufsetzte, oder der Wände oder die Tischplatte oder Türgriffe mit Fingern anfassen wollte, die möglicherweise nicht so sauber waren, wie sie eigentlich sein konnten. Manchmal dachte er, dass sie ihn am liebsten morgens in der Mitte des Wohnzimmerteppichs abstellen und ihn dann bis zur Schlafenszeit dort stehen lassen würde, wo sie schließlich eine Verwendung für ihn hatte.
Nun, da sie zur Arbeit ging, sagte Mama Philip, dass sie ihn nach der Schule unmöglich ins Haus lassen könne. Er müsse in die Gartenlaube gehen und dort warten, bis sie abends nach Hause käme. Auf diese Weise könne dem Haus kein Schaden zugefügt oder es in ihrer Abwesenheit in Unordnung gebracht werden. Er solle sich selbst Zugang zu dem Schuppen verschaffen mit einem Schlüssel, den sie ihm geben wolle, sich dann mitten auf den Boden an den kleinen Tisch Setzen und ein paar Brote mit Marmelade schmieren, die sie ihm bereitstellen würde.
Und wenn Papa zum nächsten Heimaturlaub aus: dem Krieg zurückkommen würde, dürfe Philip ihm nichts davon sagen, dass er jeden Tag in den Schuppen ginge; und er dürfe ihm nicht sagen, was mit Mami und ihm nachts passierte; und er dürfe ihm nicht sagen, dass Mami die Haustüre immer zuschließt, sodass Philip nicht auf dem weißen Klavier mit seinen möglicherweise nicht ganz sauberen Fingern üben könnte; und er dürfe ihm nicht sagen, dass seine Spielsachen - besonders das Fort und das Marionettentheater, das Papa extra für ihn gemacht hatte - weggeräumt wurden, sobald Papa wieder in den Krieg zog; und ganz besonders dürfe er ihm nicht erzählen, wie traurig und einsam er sich fühlte, weil das etwas von Papas Freundlichkeit aufbrauchen würde, denn Papas ganze Freundlichkeit gehörte Mama und sonst niemandem.
Am Anfang war es schlimm im Schuppen. Es war Winter und deshalb schon ziemlich dunkel, wenn Philip nach der Schule nach Hause kam. Nachdem er die Schuppentür aufgeschlossen hatte, schlich er immer ängstlich in die Dunkelheit und suchte mit seinem Fuß nach dem Tisch.
Darm tastete er mit seiner Hand auf der flachen Tischplatte nach der Streichholzschachtel, die sich immer dort befand. Es war eine riesige Erleichterung, wenn er sie gefunden hatte, sie in die Hand nahm und die Streichhölzer rascheln hörte. Dann gab es immer eine kleine blendende Explosion, wenn er den Streichholzkopf an der rauen gelben Fläche an der Seite der Schachtel entlanggerieben hatte. Es zischte ein bisschen, wenn er die Flamme an den Docht seines Kerzenstummels hielt. Er wedelte das Streichholz aus und legte es vorsichtig auf den Boden des Kerzenständers.
Dann war es Zeit für das Brot und die Marmelade. Das Schneiden, das Bestreichen und das Essen - alles musste sehr vorsichtig geschehen.
Während er in dem kleinen Lichtkegel saß, den die Kerze warf, langsam sein Brot mampfte und das Hüpfen und Tanzen der Schatten an den Wänden beobachtete, war Philip sich bewusst, dass Mama später den Boden nach Krümeln absuchen würde. (Der Schuppen war innen fast genauso penibel sauber wie das Innere des Hauses.) Wenn er seinen Mund vorsichtig abgeputzt hatte, während er sich über den Teller beugte, stand er auf, nahm den Kerzenständer in die Hand und kontrollierte jeden Quadratzentimeter unter und um den Tisch, damit Mama bloß keinen Grund hätte, sich zu beschweren.
Schließlich setzte er sich wieder auf seinen Stuhl, nahm Sebby in seine Arme und wartete darauf, dass Mama nach Hause kommen würde. Sebby war ein Panda, der ihn liebte und der nie etwas sagte. Eigentlich hieß er Sebastian. Philip hatte einmal eine Geschichte über ein Pferd namens Sebastian gelesen. Der Name hatte ihm gefallen.
Erst nachdem Philip eine ganze Zeit regelmäßig den Schuppen aufgesucht hatte, bemerkte er, dass er nicht nur traurig war, sondern langsam auch wütend wurde. Das Gefühl war zunächst ganz klein, wie ein Kitzeln im Hals, bevor man husten muss, aber dann wurde es immer größer, bis es schließlich irgendwie rausmusste.
Er war wütend auf Papa, weil er sich Mama gegenüber nie behauptete, wenn sie ihre Launen hatte. Als Papa das letzte Mal zu Hause gewesen war, war er in Philips Schlafzimmer gekommen.
Weil er dachte, dass Philip schlafen würde, kniete er sich an sein Bett und weinte und weinte, wie ein kleines Baby. Warum hatte er das getan? Warum konnte er nicht stark und souverän sein, so wie Papas das sein sollten?
Philip war auch auf sich selbst wütend, weil er sich gegenüber Mama ebenfalls nicht behaupten konnte. Er wurde immer zu Wackelpudding, wenn er vor seiner Mutter stand und versuchte, das zu sagen oder zu tun oder zu sein, was er wollte. Sie war stark und groß, wie ein Riese. Er war klein und dumm und zählte eigentlich gar nicht.
Am meisten war er wütend auf Mama - wütend, weil sie ihn nicht lieb hatte, nicht merkte, wie sehr er sich Mühe gab, ihn immer nur so sein ließ, wie sie ihn haben wollte, und auch Papa daran hinderte, ihn richtig lieb zu haben; weil er sich immer innerlich verkrampfte, wenn er an die Nächte dachte, wo sie ihn wie eine Puppe benutzte, ohne etwas zu fühlen
Er beschloss, sie zu feuern.
Manchmal, samstagabends, saßen er und Mama vor dem Radio und hörten sich das Saturday Night Theatre an. Philip verstand nicht immer, worum es ging, aber das war auch nicht so wichtig. Es war eines der ganz wenigen Male, wo er das Gefühl hatte, dass er und Mama tatsächlich etwas zusammen taten, selbst wenn sie dabei noch nicht einmal redeten. Eines der Stücke handelte von jemandem, der seinen Job verloren hatte und jemandem erzählte, dass sein furchtbarer Chef ihn „gefeuert" hatte.
Philip wurde zum furchtbaren Chef des Schuppens. Jeden Abend, wenn er das Marmeladenbrot aufgegessen und den Boden nach Krümeln abgesucht hatte, saß er kerzengerade auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch und stellte Mama zur Rede. Mama kroch durch die Tür, ganz blass und zitternd, kniete vor seinem Schreibtisch und flehte, doch bleiben zu dürfen.
„Nein!", schrie der furchtbare Chef. „Sie sind gefeuert! Ich feuere Sie, weil Sie nicht gut waren! Verstanden? Sie sind gefeuert! Gefeuert! Gefeuert! Raus hier!"
Das Gefühl, Mama zu feuern, war wunderbar. Es kam tief aus seinem Bauch und schoss aus seinem Mund wie das Öl, das auf
Vorwort
1. Kriegsfolgen - ein missbrauchtes Kind (1936-1945)
2. Kirche, Kaufhaus und „Nellie aus der Mietwohnung" (1945-1954)
3. Durchbruch in Deutschland - Die Bekehrung des Gefreiten ilott (1954-1956)
4. London - eine andere Armee (1956-1958)
5. Margaret ziert sich
6. Cornwall - Persönlichkeiten (1958-1959)
7. Ashford - Ein Fahrrad, eine Braut und ein Baby (1959-1962)
8. Leavesden - Ein Ruf, ein dunkles Geheimnis und eine Gabe Gottes (1962-1971)
9. Isle of Wight - Härten und Heilung (1971-1978)
10. Isle of Wight —Wunder
11. Isle of Wight - Erinnerungen
12. Die „Filymead-Erfahrung" (1978-1981)
13. Bexhill - Durch die Tür des Leids (1981-1989)
14. Ein unerwartetes Nachwort
ISBN 3-87067-853-5
C 2001 by Brendow Verlag, D 47443 Moers
Originalausgabe: "A smile on the face of God"
Copyright © 2000 by Adrian Plass
Pagel Arno, Er weiß den Weg
Nun haben sich aus dem Leserkreis Stimmen erhoben, die gefragt haben: »Warum diese enge zeitliche Beschränkung? Wir würden gern in ähnlich gestraffter Form weitere Mitarbeiter Gottes in dem Wichtigsten ihres Wesens und Wirkens kennenlernen.« Das macht mir Mut, drei weitere Bände herauszugeben.
zeitliche Beschränkung? Wir würden gern in ähnlich gestraffter Form weitere Mitarbeiter Gottes in dem Wichtigsten ihres Wesens und Wirkens kennenlernen.« Das macht mir Mut, drei weitere Bände herauszugeben.
Wieder sind Gestalten aus dem Raum des neueren Pietismus berücksichtigt. Auch dieses Mal muß eine zeitliche Begrenzung festgehalten werden. Der Heimgang der dargestellten Männer und Frauen fällt in die Jahre 1914-1945 (Beginn des Ersten und Ende des
Zweiten Weltkrieges). .
Allerdings sind von dieser Regel zwei Ausnahmen gemacht worden, die in einem Anhang ihren Platz finden. Es lag nahe, dem Lebensbild von Alfred Christlieb das seines Vaters Theodor (gest.1889) hinzuzufügen. Dieser ist einer der bedeutendsten evangelikalen Theologen des 19. Jahrhunderts gewesen und hat sehr nachhaltig und höchst praktisch in den Bereich der Evangelisation und Gemeinschaftsbildung hineingewirkt. - Von Carl Lange, dem Gründer des Brüderhauses Preußisch Bahnau, ist nicht zu trennen sein Mitarbeiter, Lehrer Ernst Aeschlimann (gest. 1963). Beide haben Generationen von Brüdern weit über die Ausbildungszeit hinaus geprägt. Sie erscheinen in diesem Band noch einmal Seite an Seite.
»Er weiß den Weg.« So heißt der Titel des Buches. Ja, unser Gott hat für jedes seiner Kinder und jeden seiner Boten einen besonderen Plan und W ego WeIcher Reichtum seiner Führungen wird sichtbar! Auch wir, von denen nie ein gedrucktes Lebensbild vorliegen wird, dürfen uns dessen freuen und getrösten. Die beiden weiteren Bände werden die Titel tragen: »Er bricht die Bahn« und »Er führt zum Ziek Beiträge sind u. a. vorgesehen über: Johannes Seitz, ütto Stockmayer, Georg von Viebahn,
Johannes Warns, Christi an Dietrich, Traugott Hahn (Vater und Sohn), Ernst Lohmann, Dora Rappard, Minna Popken. Wenn Gott auch diese zweite Reihe gelingen läßt, dann liegen nach Abschluß in insgesamt sechs Bänden 126 Kurzbiographien vor. Damit ist dann ein großer Teil des neueren Pietismus im landes- und freikirchlichen Raum in Lebensbildern dargestellt und zugänglich. Arno Pagel
Fritz Coerper
Geb. 10. 5. 1847 in Meisenheim am Glan als Sohn eines Pfarrers. Studium der Theologie in Erlangen, Utrecht, Tübingen und Bonn. Nach der ersten theol. Prüfung Vertreter für den erkrankten Pfarrer in Eschweiler bei Düren. 1870 Oberhelfer am Rauhen Haus in Hamburg. Oktober 1871 Vikar in Boppard am Rhein und ab Februar 1873 Pfarrvikar, später Pfarrer in der Diasporagemeinde Köln Ehrenfeld. Im März 1885 Inspektor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland und ab November 1887 Pfarrer der Unterbarmer Gemeinde in Wuppertal-Barmen. 36 Jahre Präses der Ev. Gesellschaft. Gest. 12. 11. 1924.
Das schönste Bild
Im heimatlichen Pfarrhaus wurde der vierzehnjährige Fritz Coerper von einer schweren Krankheit - wahrscheinlich Typhus - ergriffen. Er schwebte lange Wochen zwischen Leben und Tod. Die Mutter gab ihm in dieser Zeit das Neue Testament und das Büchlein über die Nachfolge Christi von Thomas a Kempis zu lesen. über das letztere schrieb er später als Student von Utrecht nach Hause: » Wie oft danke ich Dir, liebe Mutter, für dies herrliche Buch im Stillen, das mir Deine Liebe schenkte!« Tiefer und bleibender noch wirkte aber auf das Herz des kranken Jungen das Bild Jesu aus den Evangelien. »Blitzartig« leuchtete ihm die göttliche Herrlichkeit des Heilandes auf. Die rettende Wahrheit drückte sich ihm in die Seele: »Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.« Hören wir seine spätere Erinnerung an diese erste Begegnung mit Jesus:
»Ein Maler des Altertums hatte ein so schönes Bild gemalt, daß ein Dichter meinte, wer das Bild ansähe, der werde in seinem Elend seines Elendes, in der Krankheit seiner Krankheit, ja im Sterben des Todes vergessen. Schade, daß wir dies schöne Bild nie gesehen haben und nie sehen werden. Ich kenne aber ein anderes Bild, von dem wirklich wahr ist, was jener Dichter von dem Bild des Malers sagte. Ich habe es selbst erfahren; ins tiefste Dunkel des Unglücks leuchtete es mir wie die Sonne in einen Abgrund. Als ich vor den Pforten des Todes stand, vergaß ich die Schrecken des Sterbens über dem Anblick dieses Bildes. Und welches ist das Bild? Es ist das Bild, das der Heilige Geist durch die Evangelisten uns gezeichnet hat von unserem Heiland Jesus Christus, ja, das er selbst uns gezeichnet hat durch seine Taten und Worte, durch die wir einen Blick tun dürfen in sein gottmenschliches Heilandsherz.«
Fritz Coeper ist damals wieder genesen. Das Bild Jesu, das sich in jener kindheitlichen Erweckung in sein Herz senkte, ist ihm später immer heller und schöner aufgeleuchtet. Es gab auch Zeiten der Verdunkelung, der Anfechtungen und der Glaubenskämpfe. Aber das Licht brach immer wieder durch. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen: Immer wieder ragte der Fels des Glaubens aus dem Meer der Fragen und Zweifel. In einem Brief aus Utrecht an den Vater hieß es: »Wie steht's mit Christus? Das ist doch der Kernpunkt von all dem Streit, der die bedeutendsten Köpfe in der Wissenschaft beschäftigt. Und doch ist die Hauptfrage die, ob sich Christus nach den Köpfen oder die Köpfe nach ihm richten sollen. Wenn wir eben von einem Katheder zum andern gehen, so finden wir da einen Christus, der von dem andern, den wir dort kennenlernen, so verschieden ist wie Tag und Nacht. Ich brauche Dir nicht zu sagen, dass da der Kampf im Inneren gleichen Schritt hält, wenn ich auch trotzdem zugeben muß, daß, wie oft auch der kleine Fels des Glaubens vom Meer verschlungen scheint, er doch immer wieder herausragt. Schon oft dachte ich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich
Naturwissenschaft oder irgendein anderes Studium ergriffen hätte, und doch, wenn ich an eine Vorsehung glaube, kann es nur gut für mich sein, daß ich hier in Holland Theologie studiere.«
Der erst zweiundzwanzigjährige Gehilfe des erkrankten Pfarrers von Eschweiler zeigt schon erstaunliche geistliche Erkenntnisse: »Ich habe einsehen gelernt, daß, wenn wir stehen, wir am kleinsten sind, wenn wir knien größer, und wenn wir uns in den Staub beugen, am größten sind.« Dem Oberhelfer im Rauhen Haus in Hamburg - auf den die Begegnung mit Johann Hinrich Wichern, dem Vater der Inneren Mission, einen tiefen Eindruck machte - sind schwierig zu erziehende Kinder aus sozial höhergestellten Familien anvertraut. Er vergißt aber nicht, wie sehr er selber der Erziehung durch den größten Pädagogen, den Heiligen Geist, bedarf: »Wer den Geist Gottes betrübt, dem wird er nicht beistehen. Wer um ihn bittet, der muß ihn auch in sich und andern wirken lassen und nicht die Spitze abbrechen.«
Hat es der Steinklopfer besser?
Der Vikar in Boppard verlegt sich eifrig auf Hausbesuche. Er will dabei nicht bloßer Unterhalter, sondern Zeuge J esu sein Und stellt sich die Gewissensfrage: »Es gibt Häuser, wo man gewünscht wird und wo doch Christus nicht gewünscht wird. Rücke ich wirklich mit meinem Bekenntnis noch nicht heraus? Bin ich noch zu vorsichtig?« Manchmal zeigt er einen tapferen Freimut. Ein wohlhabender Mann, der ein großer Freund der Jagd und der Waffen ist, hört davon, daß der Vikar Coerper nach und nach alle seine Gemeindeglieder besucht. Er trumpft im Wirtshaus wild auf: »Wenn der Pfaffe zu mir kommt, dann schieße ich ihn nieder!« Bald aber ist er an der Reihe, und der Besucher schellt an seiner Tür. Es wird ihm auch aufgetan. Die beiden Männer gehen die Treppe hinauf ins Wohnzimmer. überall hängen die Wände voller Waffen. Der Jäger stellt sich vor den Vikar und schreit ihn mit großer Stimmkraft an: »Nichts hat in der Welt mehr Unheil angerichtet als der Glaube!«
Hören wir Coerper zu, wie es weiterging:
Herr. . ., Sie haben ganz recht, wenn Sie dem Wort Glaube nur ein paar Silben vorsetzen: Unglaube und Aberglaube. Der Aberglaube hat gewiß schon großes Unheil angerichtet. Denken Sie an die Tausende, die in Spanien von der Inquisition hingerichtet und verbrannt worden sind! Und denken Sie an die Hunderttausende, die der Unglaube in der französischen Revolution auf die Guillotine, unter das Fallbeil brachte! Aber daß der wahre, lebendige Christenglaube der Welt geschadet hätte, davon habe ich noch nie gehört. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Glauben und seinen bösen Stiefbrüdern, dem Aberglauben und dem Unglauben. Einen Augenblick besinnt sich der Hausherr, dann geht er zur Tür und
ruft seiner Haushälterin zu: Katharin, mach Kaffee! Wir unterhalten uns noch weiter über das Thema, dann entläßt er mich im Frieden aus seinem waffenstarrenden Haus.« - Diese Begebenheit zeigt die volksmissionarische, schlagfertige Art, die Fritz Coerper eigen war.
Begleiten wir ihn nun in die Arbeit in der Kölner Vorstadt Ehrenfeld! Die evangelische Gemeinde dort war erst im Werden, und Coerper hat sie aufbauen helfen. Sein klares Zeugnis rief bei vielen lebhaften Widerspruch hervor. Leute blieben weg, weil der junge Pfarrer zu ernst und zu entschieden von Sünde, Bekehrung und Glauben predigte. Gerade diesen Widerwilligen galten seine Hausbesuche. Einen Mann hatte er veranlassen können, einige Male die Gottesdienste zu besuchen. Dann blieb er jedoch weg. Coerper fragte ihn, als er ihm auf der Straße begegnete, warum er nicht mehr komme, nachdem er doch einen Anfang gemacht habe. Die Antwort lautete: »Herr Prediger, ich merkte, wenn ich noch ein paarmal käme, dann müßte ich mich bekehren, und das will ich nicht!«
Gott sei Dank, manche andere wollten! Coerpers Arbeit blieb nicht ohne Frucht. Aber es gab auch tiefe Stunden der Verzagtheit, wie wir sie von Elia und vielen andern Gestalten der Bibel und der Reichgottesgeschichte kennen. Lassen wir ihn davon erzählen: »Als ich Pfarrer in Ehrenfeld war, kam ich einst in große Anfechtung, so daß ich alles, auch mein Amt, aufgeben wollte. Ich wäre so gern etwas Tüchtiges geworden: ein ordentlicher Prediger, ein treuer Seelsorger, ein gesegneter Lehrer. Jeder Tag lehrte mich aber mehr, dass ich nicht wurde, was ich werden sollte. So kam ich in Not und wollte verzagen. Ich dachte, der Steinklopfer auf der Straße hat's besser als du. Er sieht doch, was er schafft. Ich dachte daran, einen der Geschäftsherren zu bitten, mich auf seinem Kontor zu beschäftigen. Da besuchte mich Stadtmissionar Pfenniger aus Köln, der aus der Brüdergemeine stammte. Ich klagte ihm meine Seelennot. Als Antwort schüttete er eine ganze Fülle von Liederversen über mich aus, die meiner Seele Balsam waren. Als er zur Tür hinausgegangen war, lief ich hinter ihm her und bat ihn, mir das Büchlein zu leihen, in dem diese Trostworte standen. Es war der Psalter von Ernst Gottlieb Woltersdorf. Er versprach mir, das Buch noch am selben Tage zu bringen. Am Abend hatte ich es schon in den Händen. Ich las und las die ganze Nacht durch. über dem Lesen der herrlichen Lieder von der Gnade kam mir die Frage in die Seele: Was willst du denn doch eigentlich? Was willst du sein und werden? Ich fand die Antwort: Nichts, gar nichts als ein armer, verlorener, aber durch Gottes Erbarmen begnadigter Sünder. Als mir das recht klar geworden war, hatte ich das köstliche Ding, das in der Gnade fest werdende Herz wiedergefunden und konnte fröhlich und getrost weiterarbeiten.«
Der »Inspektor« und die »Boten«
Zweieinhalb Jahre ist Fritz Coerper Inspektor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, eines der größten innerkirchlichen Gemeinschaftsverbände, gewesen. In diesem Amt mußte er viel reisen: »Wenn ich an die gemeinsamen Wanderungen denke über Berg und Tal, über Schnee und Eis, bei Sonnenschein und Regen, durch die schönsten Gaue unseres Landes, an all das gemeinsam Erlebte in Kirchen, in Gemeinden und Vereinshäusern, in Bauernhütten, in großen Hallen, in Feld und Wald, auf der Dorfstraße oder in den engen Straßen großer Städte, an Krankenbetten, bei Angefochtenen, in Vereinen und Gemeinschaften, so möchte ich unsern schlimmsten Widersachern wünschen, sie dürften nur einmal ein Jahr Inspektor der Evangelischen Gesellschaft sein. Ich wünschte es ihnen, weil ich ihnen Gutes gönne. Die Arbeit blieb darum immer doch eine einfache und einheitliche, weil es sich im Grunde nie um etwas anderes handeln konnte, als das Wort zur Geltung zu bringen in mannigfacher Weise. Auf solchen Wegen lernt man erstaunt, wie reich das Wort unseres Gottes ist.«
Immer wieder betont Coerper in seinen Inspektorberichten: »Das Wort muß es tun, und das Wort tut es.« Hören wir ihn: »Wer sollte sich nicht freuen, vor allerlei Volk in den Kirchen die großen Taten Gottes verkündigen zu dürfen? Und doch, mir schien oft in den kleinen Hütten der Himmel noch näher und die Wahrheit kräftiger und mächtiger. Einmal weinte nach einer Versammlung ein Junge die hellen Tränen. Niemand konnte herausbringen, warum er weinte. Endlich sagte er: >Weil meine Schwester nicht dabei war.< Ein anderer Junge war ein anderes Mal dabei gewesen. An einem der nächsten Abende quälte er seine Mutter so lange, bis die den weiten Weg mit ihm ging, um noch einmal dabei sein zu dürfen. Es ist ein
Irrtum, wenn man meint, man müsse Mummenschanz treiben, um die Jugend zu fesseln. Was einfach, aber wahr ist, das ist dazu auch das Beste.«
An der Seite des Inspektors standen die »Boten«. Das waren schlichte Männer aus dem Volk, voll brennender Jesusliebe. Eine Ausbildung, wie sie heute unseren Predigern und Stadtmissionaren zuteil wird und zuteil werden muß, hatten sie in den seltensten Fällen erfahren. Sie hingen sich die Büchertasche um, machten eifrig Hausbesuche und boten dabei Bibeln und christliche Schriften an. Sie waren treu in der Einzelseelsorge. Es öffneten sich ihnen hin und her Häuser zu Versammlungen. Aus diesen gingen im Lauf der Zeit dann organisierte Gemeinschaften hervor. Am Beginn des Inspektorats von Coerper standen 23 Boten im Dienst der Evangelischen Gesellschaft, davon 15 in der Rheinprovinz, 6 in Westfalen, außerdem je einer in Lippe-Detmold und in Thüringen. Prachtvolle Originale waren darunter. Einer pries seinen Beruf mit den folgenden
Worten: »Ich kann mir keine schönere Aufgabe denken, als ein Bibelbote zu sein. Ein Fürst oder König kann keine gesegneteren Stunden haben, nicht fröhlicher in seinem Gott sein als solch ein geringer Bibelbote . . . Die Tage meiner Leiden wie die Tage meiner Gesundheit, jeder einzelne hat mir das Lob Gottes unseres Heilandes gemehrt.« So voll vom Lob Gottes war auch der gesegnete Bruder Scheffels aus dem Oberbergischen, der einmal seinem Inspektor schrieb: »Ich habe in den Meinigen hinlängliche Kräfte für mein Haus und meine Ackerwirtschaft, so daß ich unbesorgt hinaus auf mein Arbeitsfeld wandern kann. Die Büchertasche auf dem Rücken und den Frieden Gottes im Herzen, so wandert sich's gut in Mesechs Land, wenn der Herr, unser Gott, vorangeht und die Harfe unseres Herzens stimmt und wir singen können: ,Die Sach' ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach', an der wir stehn, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehn.«<
Der Inspektor schärfte es seinen Boten ein: »In der letzten Zeit ist es mir besonders wichtig geworden, daß demütige Liebe doch für alle Arbeit das Größte ist. Es ist mir ein Anliegen, daß uns der Herr durch seinen Heiligen Geist mehr davon gebe als bisher.« Frei sollten die Boten auftreten, auch den Herren Pfarrern gegenüber. Aber Freiheit sollte nie in Frechheit ausarten. Wie Inspektor Coerper sich seine Boten geistlich wünschte, dafür das folgende Beispiel: »Einer unserer Boten kam zu einem Schuhmacher und bot ihm seine Bücher an. Der schimpfte ihn und sagte: ,Du Faulenzer, du Taugenichts!< Der Bote sagte: ,Lieber Freund, beruhigen Sie sich. Sie sagen mit leider gar nichts Neues. Das weiß ich schon seit Jahren, dass ich nicht tauge. Aber gerade deshalb freue ich mich so sehr, daß ich einen Heiland habe, und wenn Sie auch nicht taugen und gern einen Helfer hätten, dann dürften wir uns noch etwas unterhalten.< Der Schuhmacher, der zuvor dem Boten den Hammer an den Kopf werfen wollte, rief ihn nun herein, unterhielt sich und kaufte ein Buch.«
Nach der kurzen Zeit als Inspektor blieb Coerper 36 Jahre lang der nebenamtliche Präses (Vorsitzende) der Evangelischen Gesellschaft. Er kehrte nie den Vorgesetzten bei den Boten heraus, er war immer ihr Bruder und Seelsorger. Er mahnte sie: »Benutzt eure Zeit und wagt alle Kräfte des Leibes und der Seele an die Sache des Königs! Es ist gut, wenn wir die Gläubigen besuchen und uns mit ihnen im Glauben stärken. Aber das Sitzen in gläubigen Kreisen kann und darf nur unsere Erholung sein. Unsere eigentliche Arbeit ist unter den in der Irre Gehenden, zum Teil noch ganz Fernstehenden.« Völlige Hingabe und Drangabe hieß aber nicht nur, sich mit aller Kraft in die Arbeit werfen. Das hielt Coerper noch für verhältnismäßig leicht. Er wies auf das Wichtigere hin: »Die größte und schwierigste Arbeit ist doch die Drangabe des eigenen Ichs. Diese Arbeit darf nicht ruhen, bis wir ganz daheim beim Herrn sind. Aber in dem Maße, als wir Gemeinschaft mit ihm haben, wird sie doch gelingen. Wer bereit ist, den untersten Weg zu gehen, wird immer noch einen Weg finden. Laßt uns unsern alten Menschen da halten, wo er hingehört, am Kreuz!«
Die Evangelische Gesellschaft sah sich in der Landeskirche zum Dienst, zum Aufbau von Gemeinschaften und zum Bau des Reiches Gottes berufen. Coerper hielt seine Boten an, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, was zu einem guten Verhältnis mit den Gemeindepfarrern beitrug. Diese aber erinnerte er daran: »Es hängt unendlich viel davon ab, ob die Pastoren ReichsteIlung aus Gnaden oder Amtsstellung mit Verfügungsrecht über Seelen haben! Hier liegt der Kardinalpunkt, an dem sich vieles zum Heil oder Unheil der Kirche entscheidet. «
»Haltet euch herunter zu den Niedrigen!«
Diese biblische Mahnung hat Fritz Coerper sein Leben hindurch gehört und zu praktizieren versucht. Das gilt für die Stationen seines Lebens und Dienstes, die wir schon haben vorüberziehen sehen. Das bezieht sich auch auf den langen Zeitraum von Jahrzehnten, den er als Gemeindepfarrer in Unterbarmen verbrachte. So sehr ihn der freie Reisedienst in der Gemeinschaftsarbeit lockte, es zog ihn dann wieder die härtere Aufgabe der Gemeindearbeit an einem Ort an. Er dachte auch an die Familie, von der er so viel getrennt gewesen war. Da er zum Präses gewählt wurde, blieb der Kontakt mit der Gemeinschaftsarbeit sehr eng.
In Unterbarmen lebten überwiegend Arbeiter, einfache Leute. Ihnen galt Coerpers ganze Liebe. Wie er es von früher her gewohnt war, so besuchte er auch jetzt die Gemeinde durch, so gut er konnte. So sehr ihm die ewige Errettung der Menschen am Herzen lag, so hatte er doch auch ein waches Auge und ein offenes Herz für die allgemeinen Nöte sozialer und politischer Art. Seine persönliche Anspruchslosigkeit, die ihm viel Gutestun an andern erlaubte, war stadtbekannt. Auch im Wuppertal war die zu einem großen Teil sozialdemokratisch gesinnte Arbeiterschaft voller - z. T. berechtigter - Kritik an der Kirche und ihren Pfarrern. Aber »unser Fritz« - wie Coerper volkstümlich oft genannt wurde - wurde dabei meistens ausgenommen. Ein Genosse sagte, auf die Revolution anspielend, von der man träumte: »Wenn der große Kladderadatsch kommt, dann geht es den Pfaffen an den Kragen. Wer aber unsern Fritz antastet, dem schlage ich alle Knochen kaputt!«
»Gott schenkte seinen Sohn nicht in die Staatsstube, sondern in den Stall- also unter das Volk! Meine Lage weist mich zu den Kleinen und Kleinsten. Haltet euch herunter zu den niedrigen!« So und ähnlich hörte man Fritz Coerper immer wieder reden, so sah man ihn immer wieder handeln. Dazu zählten auch die Kinder in der Kinderlehre. Wenige Wochen vor seinem Tode kam er mit bestaubtem Mantel nach Hause. »Was hast du nur gemacht?« fragte ihn seine Gattin. Er sah sich die Bescherung verwundert an. Endlich sagte er: »Ich habe nach der Kinderlehre meine Knie noch gebeugt, um die Kinder alle dem Herrn zu bringen.«
Welch treuen Freund hatten die Kranken an ihm! Und der Gebundenen nahm er sich an. Oft weilten Trinker, denen er helfen wollte, für längere Zeit in seinem Hause. Es lebte in ihm die Liebe, die keinen aufgibt. Sein Herz war weit für alle Menschen, ganz gleich ob sie schon den Heiland kannten oder noch vor der engen Pforte standen: »Ich meine, je mehr Menschen wir kennenlernen, umso weiter müßte unser Herz werden. Jeder Mensch hat irgend ein Leid oder einen Schmerz, um deswillen er unsere Anteilnahme braucht. Und jeder hat auch irgend etwas, was ihn liebenswert macht. . . Wir haben keinen Grund, mutlos zu sein. Im Laufe der Jahre habe ich mit so vielen Menschen verkehrt. Ich habe viele kirchenlose gefunden,
aber ganz christuslose kaum. Es ist merkwürdig, wie sie doch noch mit Jesus Christus zusammenhängen.«
Auch Coerper hat den Kampf der Heiligung kämpfen müssen. Auch bei ihm gelüstete das Fleisch immer noch und immer wieder gegen den Geist. Sein von Hause aus leidenschaftliches und rasches Temperament konnte sich im Wort und Urteil manchmal jäh und heftig äußern. Auch er brauchte die Erziehung durch seinen Herrn. Dabei halfen auch die eigenen Kinder mit. Was er einmal sagte, haben viele andere Eltern ebenso erfahren: »Nichts demütigt mehr als die Erziehung der eigenen Kinder.« So wie Fritz Coerper war und wirkte, haben ihn seine Gemeindeglieder geliebt. Der Unterbarmer Kirchmeister bezeugte am Grabe:
»Was einer auch bei dir suchte, den Pastor, den Freund oder den Vater, du hast ihm geholfen, und darum war dein Leben ein Dienst, den wir dir danken. Nisi Christus, frustra! (Wenn nicht Christus, dann ist alles umsonst.) Diese deine lebendige Predigt wollen wir nicht vergessen.«
Arno Pagel
Georg Dreisbachgeorg%20dreisbach.jpg
Geb. 8. 12. 1852 in dem Dörflein Rinthe im Wittgensteiner Land (Westfalen). Aufgewachsen in ländlicher Stille und Abgeschiedenheit. Nach der Schulentlassung einige Jahre Schafhirte. Später Fuhrmann und Fabrikarbeiter in Weidenau im Siegerland. Nach einer klaren Bekehrung Mitarbeiter in der Gemeinschaft und landauf, landab als Bote Jesu tätig. Gest. 26. 7. 1933.
Da hob das Danken an
Bald nach seiner Schulentlassung zog Georg mit der Einwilligung des Vaters und dem seufzenden Jawort der Mutter ein Jahr lang mit einem Schäfer als dessen Gehilfe durch das Siegerland dem Rhein zu. Das war die Erfüllung seines höchsten Wunsches und Jugendtraumes. Er lebte mit den Tieren, freute sich ihres Wohlergehens, teilte ihre Not. Es ging durch Frost und Nässe, durch Hunger und Entbehrung, durch schlaflose Nächte und mancherlei Schwierigkeiten. Das Jahr war für ihn eine harte Schule. Nach demselben hütete er zwei Jahre die Schafe eines Gast- und Landwirts im Wittgensteiner Land. Dabei hat ihn die Gastwirtschaft in mancherlei innere Gefahren gebracht. Aber über seinem Leben waltete die gute, verborgene Hand Gottes. Nach dem Abschluß seiner Militärdienstzeit begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Er trat die Stelle eines Fuhrmanns bei einem Fuhrunternehmer und Gastwirt in Weidenau im Siegerland an und heiratete bald. Das junge Glück der beiden wurde jedoch schon bald von Krankheitsnot überschattet. Der Ehemann wurde plötzlich von einem derartig heftigen Gelenkrheumatismus befallen, daß er steif wie ein Brett unter furchtbaren Schmerzen auf seinem Lager liegen mußte. Da kam ihm eines Tages der Gedanke: »Solltest du nicht einmal den Namen des Herrn anrufen? Er hat einst doch den Kranken in schwerer Not geholfen.« So wandte er sich nach einer langen gebetslosen Zeit an den Heiland: »Herr, erbarme dich meiner!« Und der Herr half. Plötzlich konnte er aufstehen. Das war kein Zufall, das war die gnädige Hilfe von oben, für die er von ganzem Herzen dankbar war. Sein fester Vorsatz war, es allen Leuten zu sagen, wie sich der Herr über ihn erbarmt habe. Doch dann fehlte ihm der Mut dazu. Das alte Leben begann wieder. Jörg (Georg) und seine fleißige Frau konnten es bald wagen, ein eigenes Haus zu bauen. Zu ihrem Sohn gesellte sich noch ein gesundes Töchterlein. Die Freude der Eltern war groß. Aber dann kam neue Krankheitsnot. Es stellte sich wieder Gelenkrheumatismus ein, schlimmer als das erste Mal. Doch damit nicht genug. Auch die junge Frau wurde schwer krank. Da dachte der Jörg an seine vorige Krankheit, an das herrliche Erleben der göttlichen Hilfe, aber auch an seine Undankbarkeit.
»Solltest du es nicht noch einmal wagen dürfen, Gott anzurufen?« So fragte er sich. 0, wie schämte und scheute er sich! Aber die Not wurde größer. Und sie lehrte beten: »Sieh nicht an meine Sünde, erbarme dich meiner Not und laß mich vor dir Gnade finden!« Noch während des Gebetes faßte er Vertrauen. Es wurde ihm wohl, und er empfing die Zuversicht: Gott wird helfen. Und Gott half. Nicht nur durch Heilung des Leibes, sondern vor allem durch das Geschenk des inneren Friedens und der Sündenvergebung. Da hob das Danken an und hörte nie wieder auf. Bald folgte ihm auch seine Frau auf dem neuen Wege. In dem neuen Haus wohnten nun neue Menschen und ein neues Glück.
Zeuge für Jesus
Durch seinen Beruf als Fuhrmann war der Jörg im ganzen Ort bekannt. Nach seiner Bekehrung wurde er Mitarbeiter in der örtlichen Gemeinschaft. Er suchte auch anderen Menschen den Weg zu J esus zu zeigen. Das brachte ihm manchen Hohn und Spott ein, vor allem, nachdem er Arbeiter in einer Fabrik geworden war. Unter seinen neuen Arbeitskameraden war besonders einer, der ihm hart zusetzte. »Ich habe dich immer«, so sagte dieser ihm einst in einer Frühstückspause, »für einen vernünftigen Kerl gehalten, und nun glaubst du auch an die Märc~en, die dir die Pfaffen und Mucker erzählen?« Unter viel Gebet und Seufzen versuchte der Jörg, dem Spötter zu antworten. Einmal nahte sich dieser wieder mit einigen Gleichgesinnten, um seine Bosheit an ihm auszulassen. Da sagte unser Freund: »Ich möchte dich einmal etwas fragen, sei ehrlich! Bist du wirklich deiner Sache so gewiß, wie du behauptest? Kommen dir nicht, wenn du allein bist auf dem Wege oder wenn du nachts nicht schlafen kannst, manchmal zweifelnde Gedanken an dem, was dein Unglaube behauptet und du den Leuten vormachst?«
Aller Augen schauten auf den Mann. Es folgte ein große Stille. Der Spötter war getroffen. Er drehte sich dann um und sagte nur: »Sieh an, der Dreisbach !« Von da an hatte Jörg Ruhe vor ihm. Bald wurde der Arbeitskamerad krank. Georg besuchte ihn. Erstaunt sagte er: »Du kommst? Von den andern sind noch wenige hiergewesen.« Nun hatte Georg Veranlassung, ihm zu bezeugen, wie die Welt ihre Diener lohnt und wie Jesus selig und glücklich macht. Danach sang sein mitgekommenes kleines Töchterchen dem Kranken ein Lied vom Heiland, das sie im Kindergarten gelernt hatte. Der Vater begleitete die zweite Strophe mit seiner Tenorstimme. Dem einstigen Spötter standen die Tränen in den Augen. Fortan besuchte ihn Georg öfter. Und es dauerte nicht lange, da kam er zum lebendigen Glauben. Es war die Erstlingsfrucht, die Georg für seinen Herrn gewinnen durfte. Ihr folgten viele weitere. Bald darauf ist der Mann selig heimgegangen.
Ernst Modersohn über Jörg Dreisbach
Als Pastor Ernst Modersohn, der spätere gesegnete Evangelist, 1895 als junger Pfarrer nach Weidenau kam, da hatte er schon manches gelernt und allerlei studiert. Aber Einsicht und Erfahrung in der praktischen Seelsorge fehlten ihm noch. Er war demütig genug, sich zu den Füßen der alten Brüder zu setzen und von ihnen zu lernen. Er nannte sie seine »Professoren im Schurzfell mit der schwieligen Faust«.
Modersohn erzählt darüber folgendes: »In dieser Zeit gab es in der Gemeinde hauptsächlich zwei Häuser, die man aufsuchte, wenn man in Sündennot war und Rat und Hilfe für seine Seele suchte. Das war einmal das Haus von >Ohm Michel<, dem früheren Zuchthäusler, der zehn Jahre lang im Zuchthaus in Münster gesessen hatte, bis er begnadigt wurde, und das andere war das Haus von Georg Dreisbach in der Querstraße. Wie oft, wenn ich zu Ohm Michel kam, fand ich dort Menschen, mit denen er redete, um ihnen den Weg zum Heiland zu zeigen! Er verstand es in besonderer Weise, ihnen das Heil in Christo nahezubringen und sie zu ermuntern, das Heil im Glauben anzunehmen.
ISBN: 3882240563 (ISBN-13: 9783882240566)
Verlag: Francke-Buchhandlung
Format: 20,5 x 13,5 cm
Seiten: 200
Erschienen: 1978
Einband: Paperback
ISBN: 3882240563 (ISBN-13: 9783882240566) Verlag: Francke-Buchhandlung Format: 20,5 x 13,5 cm Seiten: 200 Erschienen: 1978 Einband: Paperback
