W Schriftsteller
- Wagner Alois
- Walch Elsbeth
- Walter Käte
- Waltersbacher Paul
- Walvoord John F.
- Wanner Walter
- Watson David
- Wedemeyer Max
- Wesley John
- Whitcomb John C.
- White John
- White Paul
- Wienbruch Anny
- Wiersbe Warren W.
- Wilder-Smith A E
- Willis G C
- Wilson Dorothy C.
- Winterfeld-Platen Leontine von
- Witemeyer Karen
- Witt Dietrich
- Witter Traudel
- Wjst Walter
- Woerden Peter van
- Woerner Charlotte
- Worm Heinz Lothar
- Wunderlich Adolf
- Wurmbrand Richard
- Wynne Barry
Finger an Gottes Hand Chirurg Leprologe Paul Brand, Dorothy C Wilson
Sadagopan wurde in Südindiens heiliger Tempelstadt Katschipuran geboren, von der man in alten Zeiten sagte: „Glücklich bist du, wenn du in Katschipuran geboren bist, auch wenn du ein Esel wärest."
Aber Sadagopan war nicht glücklich; denn er lebte sechs Jahre lang als Ausgestoßener, gemieden von der Gesellschaft, von seinen Feunden, ja sogar von den eigenen Verwandten.
Er stammte aus einer geachteten, gebildeten und künstlerisch begabten Familie. Sein Vater war Redakteur bei einer der führenden Tamil-Zeitungen. Seine Mutter, seine Tanten und zwei ältere Schwestern waren Musiker. Als sein Vater in Nordindien arbeitete, wohnte Sada-gupan bei seiner Großmutter. Vorher hatte er eine Zeitlang im Hause eines Onkels gelebt, wo er sich wahrscheinlich den Aussatz zuzog.
Er war acht Jahre alt, als der Fleck auf seinem Rücken bemerkt wurde; zu jung noch, um zu wissen, was das bedeutete. Man schickte ihn zur Behandlung ins Regierungskrankenhaus. Er ging aber weiter in die Schule und verlebte eine normale, glückliche Kindheit. Die Krankheit machte ihm bis ungefähr zu seinem vierzehnten Lebensjahr wenig Beschwerden. Dann begannen seine Hände wie Klauen zu werden. Infolge fortschreitender Lähmung der Armmuskulatur konnte er die Finger nicht mehr normal beugen und strecken, und es wurde ihm immer schwerer, etwas festzuhalten. Zu seinem Schrecken merkte er auch eines Tages, daß er kein Gefühl mehr in den Fingern hatte. Und bald darauf entdeckte er eine blutende Wunde an seinem Fuß, die von einem scharfen Stein herrührte, der, ohne daß er es gemerkt hatte, in seinen Schuh geraten war.
Als er die sechste Klasse der Grundschule beendet hatte und in eine höhere Schule eintreten wollte, begann das Unheil.
Der neue Rektor begrüßte ihn stirnrunzelnd.
„Du mußt mir ein ärztliches Zeugnis bringen", sagte er kurz.
Sadagopans Großmutter ging mit ihm zu dem Arzt, der ihn im Regierungskrankenhaus behandelt hatte. Er schien über ihre Bitte ärgerlich zu sein.
„Und. was könnte einem Aussätzigen eine Ausbildung nützen?” sagte er zu der Frau, drehte sich um und ließ sie stehen.
Sadagopan ging nach Hause. Aber das Haus wurde ihm zum Gefängnis, in dem all seine Hoffnungen und Träume eingesperrt waren. Keine Ausbildung? Kein Beruf? Keine Freunde? Wohin er jetzt auch ging, sah er kalte Blicke, abgewandte Augen. Alte Bekannte wichen vor ihm auf die andere Straßenseite aus, Fremde sahen entsetzt auf seine Hände. Er verließ das Haus fast nur noch, um ins Krankenhaus zu gehen. Aber auch dort bemerkte er, was er vorher nicht bemerkt hatte: daß er in einem besonderen Raum behandelt und immer so schnell wie möglich abgeschoben wurde.
Eines Tages ging er auf dem Rückweg vom Krankenhaus in ein Cafe und bestellte eine Tasse Kaffee. Der Ober, der seine Bestellung entgegennahm, kam nicht wieder. Zehn Minuten vergingen, fünfzehn Minuten. Empfindlich und nervös, wie er war, glaubte Sadagopan, jeder sähe ihn spöttisch an. Er wäre am liebsten fortgelaufen, nahm sich aber zusammen und fragte einen anderen Ober, warum er nicht bedient werde.
„Du bekommst keinen Kaffee", erwiderte dieser.
Vernichtet stolperte Sadagopan aus dem Cafe.
Von da an verließ er sechs Jahre lang nur selten das Haus. Seine Mutter starb in Nordindien. Er konnte sich kaum noch daran erinnern, wie sie aussah. Hätte er nicht seine ältere Schwester gehabt, die ebenfalls aussätzig war, eine Frau mit starker Willens- und Geisteskraft, dann hätte er das Leben unerträglich gefunden. Als sie - nicht an Aussatz, sondern an Tuberkulose - starb, war das ein neuer harter Schlag für ihn. Aber jetzt begann er schon abzustumpfen und gefühllos zu werden, wie seine Hände und Füße gefühllos geworden waren.
Sechs Jahre später, als seine Krankheit längst nicht mehr ansteckend war, - wenn sie das überhaupt jemals gewesen war -‚ zeigte sich ein Hoffnungsstrahl. Ein christlicher Arzt sorgte dafür, daß er eine Oberschule besuchen durfte. Mit äußerster Anstrengung schaffte er das Examen und hoffte nun sein Brot verdienen zu können. Aber er hätte es wissen sollen: Niemand wollte ihn anstellen.
Monate der Einsamkeit und des Ausgestoßenseins folgten. Da fiel wieder ein, Sonnenstrahl in die Dunkelheit. Er lernte in Madras den Sekretär des indischen Aussätzigen-Hilfswerks, Sri T. N. Jagadisan, kennen. Sein neuer Freund, der selbst an Aussatz litt, war erschüttert über den Zustand von Sadagopans Händen und Füßen.
Die Finger zeigten jetzt nicht nur völlige Krallenstellung, sondern waren zum großen Teil verstümmelt. Die Füße eiterten seit Jahren fast ständig.
„In Vellore gibt es einen neuen Ätzt, Dr. 'Paul Brand", erzählte ihm Jagadisan. „Er ist ein englischer Chirurg, der Hände wie deine operiert und wieder tauglich gemacht hat. Du könntest ihn einmal aufsuchen." Im Februar 1951 machte sich Sadagopan mit einem Brief von Sri Jaga-disan an Dr. Brand auf den Weg nach Vellore.
Die Reise war nicht angenehm. Während der Busfahrt war er den üblichen Angst und Abscheu verratenden Blicken ausgesetzt. Aber ‚er mußte froh sein, daß er überhaupt fahren durfte. Häufig wurden Leprakranke aus den öffentlichen Verkehrsmitteln hinausgewiesen. Als er in Vellore ankam und im Krankenhaus des Christian Medical College nach Dr. Brand fragte, wurde er nach dem vier Meilen entfernten College weitergeschickt. Er wollte wieder einen Bus benutzen, aber diesmal nahm ihn der Fahrer nicht mit.
Es war ein heißer Tag. Sadagopan war müde. Seine Kleider waren zerknüllt und mit Staub bedeckt. Als er im College ankam, waren die Verbände um seine Füße vom Eiter so durchnäßt, daß er bei jedem Schritt feuchte Spuren hinterließ.
Vor dem Eingang des College-Büros sah er eine ausländische Frau mit freundlichem Gesicht.
Verzeihung!" Er ging schüchtern einen Schritt auf sie zu. „Ich heiße Sadagopan und möchte zu Dr. Brand. Ich habe einen Brief für ihn von Sri Jagadisan."
Die Frau trat nicht zurück, obwohl Sadagopan überzeugt war, daß sie seine kranken Hände und Füße bemerkt hatte. Sie sagte ihm, daß Dr. Brand verreist sei, in ein oder zwei Tagen aber wiederkomme. Ob Sadagopan irgendwo in Vellore übernachten und morgen oder übermorgen noch einmal nachfragen wolle.
Er versuchte sein furchtbare Enttäuschung zu verbergen. Als er sich wortlos abwandte, um den Weg zurückzugehen, sagte sie zögernd, aber besorgt:
„Sie - Sie finden doch wohl eine Unterkunft, nicht wahr?"
Er drehte sich wieder um und sah, daß sie auf ihn zugekommen war. Ihre blauen Augen schauten ihn verständnisvoll an. Sadagopan hätte am liebsten geweint. Seit Jahren 'hatte ihn keine Frau so angesehen, ohne Angst oder Ekel - oder auch Mitleid, sondern so, als ob sie sich um ihn sorge wie um ein anderes menschliches Wesen.
Und ehe er sich's versah, erzählte er ihr, wie es ihm mit dem Bus ergangen sei und wie unmöglich es für ihn sein werde, in der Stadt eine Unterkunft zu finden.
Er konnte kaum fassen, was nun folgte.
»Kommen Sie mit mir!" sagte sie. „Ich bin Dr. Brands Frau. Bleiben Sie bei uns, bis mein Mann zurückkommt."
Sie machte ihm ein bequemes Lager auf der Veranda zurecht.
„Ich hoffe, Sie verstehen, daß ich Sie der Kinder wegen nicht ins Haus bitten darf", sagte sie freimütig zu ihm.
‚Q Ja!" erwiderte er bescheiden. „Es ist mehr, als ich erwarten kann." Sie brachte ihm zu essen und setzte sich auch manchmal zu ihm und unterhielt sich mit ihm.
Nach drei Tagen kam Dr. Brand nach Hause. Es war spät in der Nacht, aber er ging sofort zu Sadagopan, begrüßte ihn freundlich und untersuchte seine Hände und Füße. Er sagte ihm, es bestehe die Möglichkeit, daß die Geschwüre wieder verheilten, weil, wie er glaube, nicht der Aussatz selbst sie verursacht habe, sondern unvorsichtiges Laufen. Und die Klauenhände, so schlimm sie seien, könnten durch Operationen wiederhergestellt werden. Sadagopan werde seine Finger wieder beugen und strecken, er werde wieder schreiben und wie ein normaler Mensch essen können. Schon morgen würden sie mit seiner. Rehabilitation beginnen.
„Nun schlafen Sie gut!" sagte Dr. Brand und legte seinen Arm freundschaftlich um die Schultern des Jungen Mannes.
Zum ersten Male seit Jahren schlief Sadagopan gut; nicht nur, weil er in seiner Hoffnungslosigkeit Hoffnung gefunden, sondern weil er in seiner Verlassenheit Freunde gefunden hatte. Er war wieder wie ein Mensch behandelt worden.
Etwa zwölf Jahre später lernte ich Sadagopan im Büro eines Sanatoriums in Südtndien kennen. Als Stenotypist und Sekretär verdiente er dort den Lebensunterhalt für sich, seine Frau und seinen gesunden Jungen.
Ich fragte ihn, ob er mir helfen wolle, Material für mein geplantes Buch zu sammeln. Seine Augen leuchteten auf. Ja, das wollte er!
Und dies ist nun die Geschichte des Mannes, der Sadagopan und vielen seiner zwölf Millionen Leidensgenossen in aller Welt einen neuen Lebensinhalt gab.
Wenn Paul Brand zurückschaut, . staunt er, daß das oft unbedacht gewobene Muster seines Lebens einen so wohlüberlegten Plan verrät. Ganz deutlich lassen einige der Fäden eine sorgfältige Meisterhand erkennen, und die Kettenfäden liefen schon lange vor seiner Geburt zwischen England und Indien hin und her.
Sein Urgroßvater, Josef Brand, hatte die ersten Fäden gespannt. Es gab die widersprechendsten Geschichten über ihn. Bei der, die Pauls Phantasie am meisten erregte, heuerte er im Alter von achtzehn Jahren als Fähnrich zur See an. Auf dem Wege nach Indien ließ er sich etwas zu Schulden kommen und wurde eingesperrt. Als das Schiff In Bombay vor Anker ging, gelang es ihm, zu entfliehen und zur Küste zu schwimmen. Dort fand er Stellung bei einem reichen Kaufmann, arbeitete sich in dem Geschäft empor und heiratete die Tochter seines Chefs. Nach einigen Jahren reiste er mit seiner Familie und einem Beutel Juwelen nach England zurück. Sein Geld hatte er auf einer Bank in Bombay stehenlassen. Das Schiff ging in einem Sturm
unter, aber er, seine Familie und die Juwelen wurden gerettet. -
Nach ihrer Ankunft in Southampton stiegen Josef, seine Frau und die Kinder mit dem Beutel Juwelen in eine Droschke. Dem Droschken-kutscher gelang es, die Juwelen zu stehlen. Die Bank in Bombay hatte inzwischen Bankrott gemacht, und die Familie kam ohne einen Pfennig an ihrem Bestimmungsort an.
Pauls Großvater, Henry Brand, wollte als Junge von noch nicht zehn Jahren die Schule verlassen und das Familienvermögen wieder einbringen helfen. Aber sein Vater, Josef Brand, erlaubte es ihm nicht. Da lief Henry von Hause fort. Er hatte gehört, daß Verwandte von ihm in Surrey lebten. Teils zu Fuß, teils per Anhalter mit dem Wagen eines Farmers kam er zu seinen Verwandten, die ein Bau- und Möbelgeschäft besaßen. Seine erste Aufgabe bestand darin, Späne zu fegen. Dabei bewies er Energie und Ausdauer und wurde als Tischlerlehrling eingestellt. Wie sein Vater arbeitete er sich in seinem Beruf empor und heiratete die Tochter seines Chefs, Lydia Mann.
Da ihm das Bauhandwerk mehr lag als das Tischlerhandwerk, mit dem sich sein Schwiegervater vorwiegend beschäftigte, gründete er in Guild-ford ein eigenes Unternehmen und wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein konstruktiver Bürger der Stadt. Viele Gebäude zeugten von seiner Geschicklichkeit als Baumeister. Er war etwa zwölf Jahre in der Stadtverordnetenversammlung tätig, wurde Ratsherr und Bürgermeister und zog sich nur deshalb vom öffentlichen Dienst zurück, weil ihm sein Arzt sagte, er müsse entweder die Arbeit im Stadtrat oder sein Geschäft aufgeben. Er hätte wahrscheinlich das letztere getan, wem nicht fünf seiner sieben Kinder Mädchen gewesen wären, von denen nur zwei heirateten, oder wenn einer seiner beiden Söhne ihm den Wunsch erfüllt hätte, in das Geschäft einzutreten. Aber Ski-ney, der jüngere, wollte lieber Elektroingenieur werden. Und gerade, als Henry das Geschäft Jesse, seinem Ältesten, übertragen wollte, der geborener Baumeister und im Baufach ausgebildet war, hörte Jesse den Klang ferner Trommeln und begann, an die Millionen von Menschen in der Welt zu denken, die noch nichts von der Frohen Botschaft gehört hatten.
Diesmal war es nicht Abenteuerlust, die einen Brand nach dem Orient lockte, sondern das Verlangen, Menschenseelen zu retten. Jesse bereitete sich auf den von ihm erwählten Beruf vor, indem er ein Jahr Tropenmedizin in der Livingstone-Medical-School, einem kleinen Spezial-Institut zur Ausbildung junger Missionare, studierte.
Dann fuhr die Familie Brand an einem nebligen Freitag im November 1907 von Guildford nach London, um Jesse nach Indien abreisen zu sehen, wo er unter dem Schutz der Strict Baptist Mission arbeiten wollte.
Unterstützt von seiner dritten Tochter, Daisy, die bald seine tüchtige Sekretärin wurde, führte Henry nun das Geschäftweiter. Wenn es ihm auch leid tat, daß er auf seinen Sohn verzichten mußte, so zeigte er es doch nicht. Er war es ja selbst gewesen, der den Gedanken an die Millionen, die Christus brauchten, in Jesse geweckt und dafür gesorgt hatte, daß er den Ruf der fernen Trommeln hörte. Denn Henry Brand war ein frommer Mann, der, obwohl er in der Woche schwer arbeiten mußte, Sonntag für Sonntag überall in Surrey in winzigen Baptisten-kapellen predigte.
Eine große Freude war ihm der Brief, den er zwölf Jahre später von seinem Sohn erhielt und sorgfältig aufbewahrte.
„Mein liebster Vater!" schrieb Jesse von einer einsamen Missions- atlon auf dem Gipfel eines indischen Berges. „Idt möchte Dir noch nmal sagen, wie sehr ich Dir dafür danke, daß Du mich für die Mis-ifonsarbeit in Indien frei gegeben hast. Wenn ich im Geschäft geblieben wäre, wäre Dein Leben in den letzten zehn Jahren leichter gewesen. Ich fing gerade an, Dir die Kuliarbeit abzunehmen, wie wir es hier nennen, als für mich der Ruf nach Indien kam und Du wieder die ganze Last auf Dich nehmen mußtest. Du tatst es ohne Klage und hast sie auch die schweren Kriegsjahre hindurch getragen, so daß nicht id ein Opfer brachte, indem ich hierherging, sondern Du und Mut-
)esse Brand kam kurz vor Weihnachten 1907 in Madras an. Ausge-
stet mit Energie, Glaubenseifer, einem einjährigen Kursus in Tropenmedizin, zweiundzwanzig Jahren strenger Erziehung und einem hübschen schwarzen Schnurrbart, stürzte sich der junge Missionar in die Aufgabe seines ersten Jahres, die Tamilsprache zu lernen. Am nächsten Weihnachtsfest war er in Sendamangalam, einer Missionsstation 150 Meilen südwestlich von Madras.
Jesse besaß einen kühnen Pioniergeist. Selbst die Fülle der Aufflben auf diesem Vorposten befriedigte ihn nicht. Immer wieder blickte er hinauf zu den benachbarten Bergen, die steil aus der Ebene emporragten. Kohl Malai, Berge des Todes, wurden sie genannt. Die Bewohner der Ebene scheuten sie wie die Pest, weil man, wie es hieß, nach einer einzigen Nacht, die man dort verbrachte, tödliches Malaria-fieber bekam. Aber was war mit den zwanzigtausend Menschen, die oberhalb jener dichten Wälder und steilen, von Wolken umgebenen Abhänge leben sollten? Monate vergingen, und sie blieben in Geheimnisse gehüllt. Bis eines Tages ein kranker Mann an der Tür des Missionshauses erschien.
„Wo kommst du her?" fragte Jesse, dem die Kleidung und das Aussehen des Mannes ungewöhnlich vorkamen.
„Aus den Bergen."
Die Augen des jungen Missionars leuchteten auf.
„Ist niemand dort oben, der dir helfen kann?"
„Niemand."
Nun hatte Jesse keine Ruhe mehr.
„Wir müssen hinauf", drängte er Morling, den älteren Missionar der Station.
Sie brachen eines Morgens um drei Uhr auf, fuhren zuerst mit einem Ochenwagen bis zum Fuß der Berge, luden dann ihr Gepäck auf die Köpfe der Kulis und kletterten einen steilen Pfad hinauf, durch dichten Wald und an steinigen Abhängen entlang. Nachdem sie fünf Meilen zurückgelegt hatten, gelangten sie auf eine grüne, wellige Hochebene mit bewaldeten Hügeln, gewundenen Tälern und hier und da einem Dorf aus braunen Hüften mit spitzen Strohdächern. Wo sie hinkamen, flohen die Leute vor ihnen, bis in einem Dorf Jesses Patient mit strahlendem Gesicht auf ihn zukam und rief: „Es ist der Doktor!" Da versammelten sich alle und hießen die Fremden als Freunde willkommen.
Vierzehn Tage lang blieben die Missionare bei dem Bergvolk, wohnten in Strohhütten und Kuhställen und versuchten die tamilsprechen-den Dorfbewohner zu überzeugen, daß es einen Gott gebe, der sie mehr liebte als ihre „swamis", Götter, die in rohen Tempeln und Steinhaufen wohnten. Viele der Eingeborenen schienen die Botschaft gern zu hören. Nach diesem Besuch befriedigte es Jesse nicht mehr, in der Ebene zu arbeiten. Bei seinem Urlaub in England im Jahre 1911 versuchte er das Interesse an einer Mission in den Bergen zu wecken. Als er zurückkehrte und ein Missionar aus Madras auf Urlaub ging, tat es ihm leid um die Zeit, die er dort verbringen mußte, um ihn zu vertreten. Aber er wurde entschädigt. In Madras fand er eine begeisterte Zuhörerin für seine Pläne.
Sie war ihm nicht völlig fremd.
Er hatte Miß Evelyn Constance Hat-ris in England im Hause ihres Vaters kennengelernt, eines strengen Baptisten, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jeden werdenden oder auf Urlaub befindlichen Missionar, der seine Gemeinde in St. John's Wood besuchte, zum Essen mit nach Hause zu nehmen. Jetzt war die junge Missionarin mit einjähriger medizinischer Ausbildung hier in Madras. Sie hatte wahrscheinlich einen sehr starken eigenen Willen; denn Jesse konnte es sich nicht vorstellen, daß der besorgte Mr. Harns einer seiner neun behüteten Töchter freiwillig erlauben würde, sich allein mit dn Schwierigkeiten in Indien herumzuschlagen. Jesse und Evelyn haften mehr miteinander gemeinsam als ein oberflächliches medizinisches Wissen und den Wunsch, Menschen zu heilen und Indiens Millionen evangelisieren zu helfen. Jesse sah es an dem Aufleuchten ihrer Augen, als er von den „Bergen des Todes" mit ihren einsamen Pfaden und Dörfern erzählte.
Die Räder der Verwaltung begannen sich zu drehen, und Jesse wurde schließlich auf ein ganz einsames Missionsfeld geschickt. In der Ebene baute er die Einzelteile für sein Haus und ließ sie von Kulis auf dem
Kopf hinauftragen. Oben mußte er die Einzelteile vorwiegend allein zusammensetzen, da die meisten Kulis solche Angst vor dem Berg--fieber hatten, daß sie vor Einbruch der Nacht wieder in die Ebene zurückliefen.
Im August 1913 heirateten Jesse Brand und Evelyn Hanis in Senda-mangalan. Es war ein richtiges „tamasha", ein großes Volksfest. Denn Jesse hatte sich bei vielen durch seinen unermüdlichen, fruchtlosen Dienst, besonders während der jüngsten Pocken- und Choleraepidemien, sehr beliebt gemacht. Das junge Paar war so mit Girlanden beladen, daß es sie mehr als einmal abnehmen und dann von neuem umhängen mußte. Nach einem späten Hochzeitsfrühstück brachen die Braut und der Bräutigam in ihren Hochzeitskleidern zu ihrem neuen Heim in den Bergen auf. Die ersten fünf Meilen bis zum Fuß des Gebirges fuhren sie in einer Jutka, einem kleinen, von einem weidengeflochtenen Baldachin überdachten und von einem Pony gezogenen Wagen.
„Ich habe zwei Dhoolies gemietet", sagte Jesse stolz zu seiner jungen Frau. „So werden wir eine richtige Hochzeitsprozession haben'
Die Dhoolies, Sänften aus Segeltuch und Bambusstäben, waren da; aber keine Kulis, um sie zu tragen. Es stellte sich heraus, daß die gemieteten Männer alle fortgelaufen waren, um ein Wildschwein zu jagen. Jesse ließ seine junge Frau beim Gepäck zurück und rannte davon, sein indischer Kollege in entgegengesetzte Richtung, um Kulis zu suchen. Sie konnten nur vier finden.
Es war fast vier Uhr nachmittags, als sie fertig waren zum Aufbruch. Monsunwolken sammelten sich am Himmel. Es donnerte. Jesse sah seine junge Frau besorgt an. Er hatte alles so gut vorbereitet, hatte alles richtig machen wollen.
„Wir könnten umkehren und morgen in die Berge aufbrechen."
Aber Evelyn wollte das nicht. Sie setzte sich in ihrem langen, weißen Hochzeitskleid auf den Dhoolie und stemmte die Füße fest gegen den vorderen Bambus-Querbalken. Stöhnend hoben die Kulis das plumpe Gestell auf die Schultern und trotteten davon, um vor Einbruch der Dunkelheit auf dem schmalen Bergpfad so weit wie möglich voranzukommen und bald in kühlere Gegenden zu gelangen. Ihre braunen, nur von einem Lendentuch bedeckten Körper glänzten bald von Schweiß. Auch die junge Frau, die mit den Händen die seitlichen Stangen umklammerte, um die ungewohnten rollenden Bewegungen etwas abzufangen, merkte bald, wie ihr ordentlich gescheiteltes Haar unter
Verlag: Oncken
Jahr: 1966
Einband: Hardcover
Seitenzahl: 240
Format: 14 x 21 CM
W. Lee Warren Entscheidungen an der Schwelle des Todes
Prolog Wenn das Leben chaotisch wird
Die schwierigste und gefährlichste Operation, die ich je durchgeführt habe, hatte ich vorher nicht ein einziges Mal geübt. Ich musste etwas tun, was ein Chirurg im OP niemals tun würde: etwas Neues dazulernen, während er operiert.
In diesem Buch beschäftige ich mich mit einer besonderen Art von Hirntumor – dem sogenannten »Glioblastoma multiforme« –, der fast hundertprozentig zum Tod führt. Aufgrund meiner Erfahrungen mit diesem Tumor habe ich mich gefragt, welche Aussicht auf Erfolg meine Gebete für diese Patienten überhaupt hatten oder wie es um meine Glaubwürdigkeit und Seriosität stand, wenn ich ihnen auch gute Nachrichten gab, obwohl ich doch wusste, dass sie sterben würden. Dieses moralische Dilemma führte dazu, dass ich zu meinem geistlichen Mentor Philip Yancey Kontakt aufnahm, der mich dazu ermutigte, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben.
Das habe ich getan, doch herausgekommen ist ein anderes Buch als ursprünglich geplant.
Ich dachte, mein Leben als Militärchirurg, der auf der Balad Air Base im Irak Soldaten, Zivilisten und Terroristen gleichermaßen operierte und gleichzeitig damit fertig werden musste, dass sein bisheriges Leben gerade zu Ende gegangen war und ein neues begann –, wäre die packende Story für ein Buch. Doch oft ist das, was ich so sicher weiß, nur vermeintlich so sicher.
Mein ganzes Leben lang bin ich ein gläubiger Mensch gewesen.
Allerdings musste ich in den Schützengräben einer zerbrechenden Ehe und den Bunkern des Irakkrieges relativ früh lernen, dass ein von Dogmen geprägter Glaube dem Leben wenig geben kann. Nur an die Gnade zu glauben, hielt ich für wirklich wertvoll. Irgendwann aber war der Ansturm der brutalen Realität so groß, dass der Glaube an einen gnädigen Gott im Hinblick auf meine Patienten und meine eigene Geschichte unter die Räder kam.
Wenn ich mir das MRT meiner Patienten ansah und ich ein Glioblastom diagnostizierte, wusste ich, dass es innerhalb weniger Monate ihren Geist verwüsten und ihr Leben zerstören würde. Und ich dachte so bei mir: Ich kann schon jetzt dein Ende vo-raussehen. Dann aber bekam ich die Nachwirkungen des Krieges, meiner Scheidung und eines unvorstellbar schweren Verlustes zu spüren, der mein Privatleben erschütterte. Da merkte ich, dass ich am Sterbebett meines zerbrochenen Glaubens stand.
Und ich sah auch mein Ende voraus.
So war ich mit der größten chirurgischen Herausforderung meines Lebens konfrontiert: Ich versuchte, die fatalen Fälle von Krebs, all die Kinder, die im Sterben lagen, und die christlichen Klischees in meinem Kopf auf einen Nenner zu bringen, um den Glauben wiederzufinden, den ich verloren hatte. Ich hoffte da-rauf, dass er auf eine mir noch unbekannte Art und Weise wiederauferstehen würde.
Aber was passiert, wenn unser chaotisches Leben mit dem, was wir für unseren Glauben halten, einfach nicht klarkommt?
Teil 1
Zuvor
Die Hoffnung ist ein viel größeres Stimulans im Leben als irgendein Glück.
Friedrich Nietzsche, Der Antichrist
Kapitel 1
Reißende Flut
Wenn du Fragen hast, stell sie einfach. Sei aber darauf gefasst, dass Gott antwortet.
Craig Groeschel, Hope in the Dark
Rosemary Beach, Florida
Sommer 2017
»Nicht so weit raus!« Ich musste brüllen, um den Wind und das Krachen der Brandung zu übertönen. Die Kinder spielten in den Wellen, lachten, machten Faxen und tauchten sich gegenseitig unter. Ich sah ihre Köpfe, die wie der Schwimmer an einer Angel aus dem Wasser hochkamen und immer wieder untertauchten.
Der Tag war märchenhaft verlaufen. Die Mitglieder unserer Familie lebten übers ganze Land verstreut und es glich einem Wunder, dass sie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Meine Frau Lisa und ich saßen am Strand und genossen die Sonne, die Liebe, die uns verband, und die Gemeinschaft, nach der wir uns so sehr sehnten.
Josh, unser Ältester, war zweiundzwanzig und gerade dabei, von Alabama zurück nach San Antonio zu ziehen, um bei seinem leiblichen Vater zu arbeiten. Caity war achtzehn und hatte sich Hals über Kopf in Nate verliebt, der mit mir im Irak gedient hatte und nun mein chirurgisch-technischer Assistent war. Er war nach dem Krieg zu uns gekommen, um für uns zu arbeiten, und hatte sich jahrelang bemüht, keine Gefühle für die Tochter seines Chefs zu entwickeln, war damit aber kläglich gescheitert.
Kimber war fünfzehn und lebte bei ihrer Mutter in der Nähe von uns, genauso wie ihr Bruder Mitch, dreizehn Jahre alt, und unsere jüngste Tochter Kalyn, die gerade zehn geworden war. Unsere Familie war ein einziges Durcheinander, aber es war unsere Familie und es bedeutete uns so viel, diesen Tag am Strand gemeinsam zu verbringen.
Nachdem Gott Lisa in mein Leben gebracht hatte, wurden ihre Kinder (Josh und Caity) und meine Kinder (Kimber, Mitch und Kalyn) sofort zu unseren Kindern, und als wir heirateten, gelobten sie sich sogar geschwisterliche Treue. Doch während die Jahre vergingen und wir älter wurden, merkten wir immer deutlicher, dass ein Tag wie dieser aufgrund unserer vollen Terminkalender immer seltener wurde und damit auch wertvoller.
Eine Stunde zuvor hatte Dennis – Lisas Vater – Nate im Meer getauft. Wir hatten alle hüfttief im Wasser gestanden und uns an den Händen gehalten, während Dennis betete und Gott für diesen Tag und die Sonne und die Liebe dankte, die uns wie die rauschenden Wellen umgaben. Nate war als Säugling nicht getauft worden. Er hatte Dennis angesprochen und ihn gefragt, ob er das übernehmen würde. Dennis wurde von allen unseren Kindern seit der Zeit, als der Dreikäsehoch Josh vergeblich versucht hatte, »Opa« zu ihm zu sagen, nur »Tata« genannt.
Nate bekannte seinen Glauben an Jesus, Tata tauchte ihn unter und wir sangen dort am Golf von Mexiko Glaubenslieder.
Ein Sturm, der ein paar Meilen vor der Küste tobte, trieb immer höhere Wellen ans Ufer. Für die Surfer bedeutete das eine Menge Spaß, doch gleichzeitig spülte die aufgewühlte See auch massenweise Seetang und Quallen an Land. Josh und Mitch waren die Ersten, die das zu spüren bekamen und kreischend aus dem Wasser liefen, während glibberige Meerestiere aus ihren Bermudashorts plumpsten. Wir lachten darüber und gleichzeitig schüttelten wir uns vor Ekel.
Während die Sonne in einem wundervollen Farbenspiel immer weiter gen Westen wanderte und der Tag, der uns in so schöner Erinnerung bleiben würde, langsam zu Ende ging, fiel mir auf, dass Mitch sich immer weiter von der Stelle entfernte, an der die anderen Kinder herumplanschten.
»Komm jetzt zurück!«, rief ich, so laut ich konnte. Doch Mitch schien mich gar nicht zu hören. Er winkte kurz und tauchte kopfüber in die Brandung.
Ich machte ein paar Schritte hinaus ins Wasser und merkte, wie der Sog hinaus aufs Meer mit jeder Welle, die zurückströmte, stärker wurde.
Mitch war kein besonders guter Schwimmer und ich wusste, dass er gefährlich weit draußen war. Also watete ich in die Brandung, doch als Josh hörte, dass ich nach seinem kleinen Bruder rief, schwamm er hinaus, um ihn zu holen.
Schließlich stapften sie grinsend und lachend Arm in Arm an Land. Lisa machte ein paar Schnappschüsse, die bis heute gerahmt auf Joshs Schreibtisch stehen.
Bis heute, zehn Jahre später, sehe ich diese Szene noch vor mir. So macht man das bei uns, man schwimmt einfach raus und hilft sich gegenseitig. Seit dem Augenblick, an dem Lisa und ich beschlossen, unsere beiden Familien zusammenzuführen, haben alle, die das betraf, an einem Strang gezogen. Die Kinder haben sich nie als Stiefgeschwister bezeichnet. Es war eine wunderbare und heilsame Erfahrung zu sehen, wie Gott aus zwei seelisch verwundeten Familienteilen eine neue Einheit formte.
Während die anderen über den Hügel zu dem Haus zurückkehrten, das wir gemietet hatten, blieben Lisa und ich noch eine Weile am Strand, um den Sonnenuntergang zu genießen. Händchenhaltend saßen wir da und sprachen darüber, wie wichtig in unseren Augen der Glaube, die Familie und Zeiten wie die waren, die wir gerade erlebten.
Als es allmählich dunkel wurde und sich ein Tag, der mich ungeheuer dankbar machte, dem Ende neigte, machten auch wir uns auf den Rückweg.
An diesem Abend vereinte ich vor meinem inneren Auge alle meine fünf Kinder wie in einem Bilderrahmen. Ich sah ihr Lächeln, hörte ihre Stimmen und spürte die Liebe, die Nates Taufe und diese ganz besondere gemeinsame Zeit geprägt hatten. Am nächsten Morgen würden wir heimfahren nach Auburn, Alabama, und ich wusste, dass unser Urlaub schon nach wenigen Tagen intensiver Arbeit nur noch eine Erinnerung sein würde. Lisa leitete unsere neurologische Privatpaxis, die uns mehr abverlangte, als wir uns jemals vorgestellt hatten.
Bevor ich einschlief, ging mir wieder das Bild meiner Kinder in der Brandung durch den Kopf. Ich sah sie spielen, bemerkte, wie die Wellen immer höherschlugen, erkannte all die Gefahren, die dort lauerten – giftige Quallen oder Meeresströmungen –, und erlebte noch einmal, wie Mitch hinausgezogen und von Josh gerettet wurde. Ich unterhielt mich mit Lisa darüber, wie schade es war, dass wir sie nicht jeden Tag um uns haben konnten, und wie sehr wir uns wünschten, es wäre anders.
Als wir jünger waren, konnte ich sie noch alle fünf zusammen in meine Arme schließen, konnte sie retten, wenn sie in Schwierigkeiten steckten, und ihnen Geborgenheit schenken. Nun waren sie flügge geworden, sie waren groß und lebten über das ganze Land verstreut. Josh zog es nach San Antonio, Caity kam mit zu uns nach Hause und Kimber, Mitch und Kalyn fuhren wieder zu ihrer Mutter, die etwa eine Stunde von Auburn entfernt lebte. Bis zu einem Wiedersehen würde es wohl eine ganze Weile dauern.
Wie sollte ich sie unter diesen Umständen vor all den Gefahren und den Unterströmungen der Zeit, des Wachsens und des Wandels behüten?
In meiner eigenen Kindheit und Jugendzeit lebten mir meine Eltern einen einfachen Glauben vor. Sie lehrten mich, darauf zu vertrauen, dass Gott auf uns aufpassen und alles gut machen würde. Man kann nicht sagen, dass meine Eltern den Problemen dieser Welt gegenüber naiv gewesen wären, aber wir glaubten, dass wir alle Teil eines Plans waren und dass Gott uns stets versorgen würde, so wie er es schon immer getan hatte. In der gleichen Haltung ging ich auch die Erziehung meiner Kinder an und bemühte mich, ihnen den Frieden zu vermitteln, den nur der Glaube schenken kann.
Doch es ist eine Sache, den Kindern dieses Grundvertrauen zu vermitteln. Eine ganz andere Sache ist die Frage, wie real das Ganze für einen selbst aussieht, wenn man abends das Licht löscht und mit sich und seinen Gedanken allein ist.
Wir machten uns also daran, in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen, an unsere Arbeit zu gehen und ein Leben auf Distanz zu führen. Josh würde nicht mehr zur Stelle sein, um Mitch aus dem Meer zu retten, Caity und Kimber konnten sich nicht mehr ein Zimmer teilen und Kaley würde nicht mehr in unserer Nähe wohnen, wie sie es in unserem Ferienhaus getan hatte.
Doch Gott blieb bei uns, er war immer da gewesen, egal wie stürmisch die Zeiten waren – ob im Irakkrieg, während meiner Scheidung oder im Alltagsstress.
Im Dunkeln tastete ich nach Lisas Hand und drückte sie ganz fest.
»Es wird alles gut!«
»Ja, das wird es.«
Ich glaubte fest daran – damals.
ISBN: 9783963623554
Verlag: Francke
Erschienen: 2024
Einband: Paperback
Format: 20,5 x 13,5 cm
Seiten: 378
Autor/in
W. Lee WarrenW. Lee Warren
Dr. W. Lee Warren ist Gehirnchirurg und Autor. Er spielt Gitarre und liebt es, Verbindungen zwischen dem christlichen Glauben, der Wissenschaft und der Realität des Lebens herzustellen. Er lebt mit seiner Frau Lisa in Wyoming.
Wenn Männer nicht Führen.. James Walker Brennpunkt Die Familie
Ich lernte meinen Mann beim Tanzen kennen. Nun, nachdem Jahre vergangen sind, habe ich noch immer das Gefühl, im Dunkeln mit einem vollkommen fremden Mann zu tanzen. Ich möchte gerne die Lichter anzünden und mir diesen Mann anschauen oder einfach dav,pn und ausruhen, aber ich kann es nicht So bleibe ich ständig in Bewegung, tue so, als ginge es mir gut, und warte darauf daß er mit mir spricht. Ich glaube, ich werde einfach weitertanzen, bis ich tot bin. Anonymer Brief einer Ehefrau
1. Tanz im Dunkel
Viele Ehefrauen führen heute das gleiche leere, einsame Leben wie die eine, die den zitierten Brief schrieb. Mit Schmerz in der Seele beschließen sie, weiterzumachen, ohne Hoffnung, daß ihr Mann sich ändern werde. Sie sind überzeugt, daß er niemals in ihrer Ehe oder bei den Kindern die Führung übernehmen - geschweige denn seelischeVer-trautheit zu seiner Frau - entwickeln wird. Vielleicht haben sie jede Berührung mit dem, was Frausein wirklich bedeutet, verloren. Schlimmer noch ist es, wenn sie beschließen, niemals mehr für einen Mann verwundbar zu sein, weil sie den Schmerz der Enttäuschung nicht ertragen können.
Das kann bei mancher Frau zu dem Entschluß führen, „Feuer mit Feuer zu bekämpfen". Ihre Haltung besagt dann: „Wenn du dich wei-rät, in meinem Leben die Führung zu übernehmen - wenn du meine Bedürfnisse und die der Kinder nicht erfüllen kannst .oder willst, - dann nehme ich die Sache selbst in die Hand.' Diese Konsequenz erfährt in der modernen Gesellschaft zweifellos eine Bestati-gung. „Sei unabhängig und selbstsicher", ist das Motto, unter dem für die Frauen von heute zum Sammeln geblasen wird
Und wie steht es mit dem Mann von heute? Er „stellt etwas dar" in ein Maßanzug mit dezenter Krawatte, und jeden Morgen ein-*Jiwindet er in eine völlig andere Welt als die, die er mit seiner Familie
In seiner Arbeitsumwelt ist er meist verantwortungsbewußt und geschäftsfähig, und am Abend kehrt er in die andere Welt der Familie
in Wirklichkeit muß der Mann von heute feststellen, daß seine Rolle im Vergleich zu seinem Vater oder Großvater radikal neu definiert
wurde. Für Männer ist es heute schwer, die Einzigartigkeit ihrer gottgegebenen Stellung in der Familie auch nur zu verstehen Die traditionelle Männlichkeit - die zugegebenermaßen auch mit einem gewissen
Teil kultureller Last befrachtet ist -‚ schloß auch die Vorstellung vom
Vater als wichtigstem Leitbild mit ein, der Integrität, Treue und Selbstaufopferung mit verkörperte. inzwischen reduziert sich Männlichkeit
auf das lächerliche „Macho-Image", das in Bierreklamen oder den
„harten Burschen von der Polizei" in Krimis über unsere Fernsehschirme flimmert. Der „Mann von heute" kann sich durchs Leben
schlängeln, indem er Frauen benutzt, Kinder vermeidet und sich niemals durch irgendwelche Verpflichtungen oder Gefühlsbindungen anketten läßt. Das andere Image der Medien zeigt einen etwas einfältigen, dümmilchen Vater, der nicht genau weiß, was eigentlich los ist, aber zu allem witzige, ausgefallene Kommentare liefert.
Gleichgültig, ob der Main von heute ein Muskelprotz mit rücksichtslosem Gebaren in Konkurrenzkampf und Geschäft ist oder eine interessierte, aber faselige Randfigur im Leben seiner Familie - die Rolle des Mannes in der Familie ist weder klar umrissen noch wird sie überhaupt verstanden. Ohne eine eindeutig gezeichnete und vorgelebte Rollenfigur der Männlichkeit bleibt nur eine in der Medienphantasie entstandene Karikatur übrig.
Wenn Männer und Frauen zu beweisen suchen, daß sie zäh genug sind, es auch allein zu schaffen, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Ehe für viele nicht viel mehr ist als ein Kampf zwischen Spar-ringspartnern, - oder in dem Schweigen, das jede Konfrontation umgibt, eine Ursache für Einsamkeit und Verzweiflung liegt.
Können Ehepartner den Spannungszyklus durchbrechen und eine Antwort auf das Gefühl von Einsamkeit, Verlassenheit und Rich-tungslosigkeit finden? ich glaube schon. Die Ehe ist noch immer eine der schönsten Gaben des Schöpfers an seine Kinder. Seinem Plan für die Ehe -. der weltk1ugenmodernen Menschen „antiquiert" erscheinen mag - liegt der Konstruktionsplan für die Neugestaltung von Einigkeit, gegenseitigem Vertrauen und dem Potential, Ebenbild der Beziehung Gottes zu seiner Braut, der Gemeinde, zu sein, zugrunde.
Wo finden wir nun diesen Konstruktionsplan? Es überrascht nicht, daß Gott einiges von seinem Plan unmittelbar in Natur und Charakter von Mann und Frau hineingelegt hat. Außer den offenkundigen physischen Unterschieden gibt es grundlegende Gegensätze im geistigen und seelischen Bereich mit vielerlei Zwischenstufen, die sichtbar sein können, oft aber auch nicht. Wenn wir zum. Schöpfungsbericht zurückgehen, sehen wir, daß Adam auf eine, Eva auf eine andere Weise erschaffen wurde. Mann und Frau wurden so erschaffen, daß sie mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Gaben und Bedürfnissen zueinander passen. Gott selbst ist zwar die letzte Antwort auf die tiefsten Bedürfnisse aller Menschen, doch unabhängig davon erschuf er Mann und Frau: Den Mann mit der Aufgabe zu führen, zu versorgen und zu beschützen, die Frau mit der Aufgabe zu • unterstützen, zu nähren und auf die Gesellschaft moralischen Einfluß auszuüben.
Wie ich weiter oben bereits erwähnte, hat sich unsere moderne „Ansicht" von den Rollen von Mann und Frau radikal gewandelt. Doch es bleibt eine unverrückbare Tatsache, daß sich die grundlegenden Eigenschaften und angeborenen sexuellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen nie verändert haben. Meine Frage lautet daher-Wenn
aherWenn so viele Ehen sich auf einem Kollisionskurs mit zerstörerischen Folgen befinden, wie können wir es uns da leisten, die neu entdeckten Haltungen von Unabhängigkeit und seelischer Loslösung weiter beizubehalten?
Gott, unser Schöpfer, gibt uns die besten Anweisungen flur. unsere Beziehungen zueinander.
Gottes Konstruktionsplan für dich und mich
Im Schöpfungsbericht (1.Mose 2) gestaltet Gott einen Menschen. Nach den Worten unseres Herrn selbst ist es »nicht gut, daß der Mensch allein sei" (1. Mos. 2, 18). Adams Zustand des Alleinseins bewog Gott, ihm »eine Gehilfin [zu] machen, die um ihn sei".
Für viele Frauen hat das Wort „Gehilfin" heute etwas Erniedrigendes. Wie kann jemand „Gehilfin" und trotzdem in Funktion und Wert gleich sein? So wie Gott das Wort gebraucht, erhält es eine Bedeutung der Wertschätzung. Es unterstellt nicht, daß die Gehilfin nur Assistentin für jemanden ist, der seinerseits die Kompetenz besitzt. Vielmehr bedeutet es, daß ein Mensch einem anderen die Fähigkeit verleiht, etwas zu tun, wozu dieser sonst nicht imstande wäre.
Das Wort ist weit davon entfernt, einen Bürger zweiter Klasse zu bezeichnen. Ja, Gott benutzt es sogar für sich selbst'
Im 70 Psalm ruft David m Vers 6 „Ich aber bin elend und arm, Gott, eile zu mir Du bist mein Helfer und Erretter, Herr, säume nicht!" Jesus bezog sich auf den Heiligen Geist als „Beistand" (Joh 14, 16).
Wenn die Rolle des Helfenden für den Schöpfer des Universums legitim ist, dann kann sie kaum eine geringere Rolle haben oder einen erniedrigenden Begriff darstellen, wenn damit eine Frau in der Partnerschaft mit einem Mann als seine Gehilfin angesprochen wird.
Als unser Herr ein Gegenüber für den Mann erdachte, berechnete er den besten Weg, eine passendePartnerin zu gestalten. Seine unendliche Weisheit erkannte in der Natur des Mannes etwas, das ohne weibliches Gegenstück keine Erfüllung finden konnte. Das tiefe Verlangen in der mannlichen Natur Adams konnte nur durch Eva gestillt und erfüllt werden. Das gleiche galt für Eva; ehe die Sünde in die Welt Einzug hielt, gab es für sie keine Probleme in ihrer Beziehung zu Adam, ihm mit Achtung zu begegnen. Niemals kam ihr der Gedanke, sie sei ihm nicht gleich, sondern etwas Minderes. Es gab nichts zu beweisen. Sie konnte auf angenehme Weise weiblich sein und Adam eine zufriedene Männlichkeit gestatten.
Tatsächlich scheint ihre Zufriedenheit in dem kühnen Begriff eingefangen zu sein, der in dem Wort „geeignet" zum Ausdruck kommt. Was bedeutet es, geeignet zu sein? Heißt das, getreten und herumge-scheucht zu werden? Bedeutet es, daß die Rollen von Mann und Frau austauschbar sind je nachdem, wie die Erfordernisse und die Fähigkeiten der einzelnen Partner beschaffen sind?
Ehe wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, müssen wir das Thema der Geschlechterrollen und sexuellen Unterschiede eingehender untersuchen.
Im Grunde des Herzens
Tief drin schlummert in jedem Mann und jeder Frau eine gemeinsame Sehnsucht: Der Wunsch, Geborgenheit, Gemeinschaft und Erfüllung zu finden. Gott hat uns diese Sehnsucht aus einem bestimmten Zweck eingepflanzt. Für den Mann liegt der Sinn: der Ehe unter anderem darin, so männlich, wie möglich zu werden. Gleicherweise liegt die
Erfüllung der Frau in der Ehe darin, so ausgeprägt weiblich wie möglich zu werden. Jedem fällt dabei eine einzigartige Rolle und eine klar umrissene Funktion zu. Gottes Entwurf für die Ehe sieht vor, daß ein Mann die geistigen, seelischen und körperlichen Bedürfnisse seiner Frau erfüllt und umgekehrt Außerhalb der Ehe hat Gott wiederum andere Wege, Menschen zu vollem Potential 'als Mann und Frau zu führen.
Gottes „Blaupause" für eine Ehe ist die Verbindung von zwei unterschiedlichen Entwürfen, einem männlichen und einem weiblichen. Wenn die Einmaligkeit der Geschlechter geleugnet und die Grundregeln Gottes für die Geschlechter durch den mißgeleiteten Kampf um einen Rollentausch oder die Leugnung überhaupt ersetzt werden, muß dies zu schwerwiegenden Konsequenzen fuhren.
Eine männliche und eine weibliche Welt
Mann und Frau können vielleicht die gleiche Arbeit ausführen, aber dennoch oftmals ganz unterschiedliche Ansichten vom Leben haben und völlig andere seelische Belohnungen anstreben. In der Zeit ihrer ersten Liebe waren sie unter Umständen von diesen Unterschieden fasziniert, in der Ehe jedoch können die gleichen Eigenschaften als Bedrohung erscheinen. 'Wenn Reibungen auftreten, werden Differenzen leicht als Mangel an Liebe gewertet und nicht als 'das, was sie wirklich sind.
Um unseren Partner zu verstehen, müssen wir zuerst seine oder ihre Sexualität begreifen. Es gibt einzigartige Unterschiede, die selbst bei oberflächlicher Betrachtung der männlichen und weiblichen Anatomie ins Auge fallen. In Kapitel 3 werden wir uns eingehender mit den feineren Besonderheiten von Mann und Frau befassen. Ohne allzu sehr ins Bildhafte zu gehen, erkennen wir in Gottes Plan für den männlichen und weiblichen Körper Hinweise, die auf tiefere Rückschlüsse darüber weisen, wer wir als Menschen sind.
(Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen sollen nicht als absoluter Standard für jeden einzelnen gelten. Es gibt allgemeine Faktoren und Trends, die sich über die Zeiten hinweg nicht verändert haben trotz der gegenwärtigen Theorien von einer eingeschlechtlichen Gesellschaft.)
Zuerst erkennen wir aus der Stärke des männlichen Körpers, daß..
Inhalt
1. Tanz im Dunkel 7
2. Wer ist hier Herr im Haus? - 18
Der Kampf um die Kontrolle
3. Warum Männer »Hü« und Frauen »Hott« sagen ....30
4. Bausteine des passiven Widerstands 44
5. Der introvertierte Mann - 58
6. Der Arbeitssüchtige 70
7. Flucht vor der Wirklichkeit 82
8. Der Mann David — ein Porträt 95
9. Abigail, der Fußabtreter 109
10. Die Frau auf dem Kriegspfad 126
11. Bathseba, die Manipulations-Künstlerin 144
12. Die berufstätige Frau ..................161
13. Durchbrechen Sie den Teufelskreis bei Ihren Kindern . 177
ISBN: 9783882248692
Verlag: Francke
Erschienen: 1991
Einband: Paperback
Format: 13,5 x 20,5 cm
Seiten: 198
Selbst ist die Frau! Witemeyer Karen Leseprobe
Prolog Winter 1882, Cooke County, Texas
Malachi Shaw schaffte den beschwerlichen Weg zurück aus der Bewusstlosigkeit nur mit aller größter Anstrengung. Doch bisher hatte alles, was Mal, wie er genannt wurde, in seinen dreizehn Lebensjahren erreicht hatte, größte Anstrengungen verlangt. Und dabei hatte er noch nicht einmal etwas Nennenswertes vorzuweisen. Er war verwaist. Halb verhungert.
Und … er fror. Das spürten seine Sinne als Allererstes. Die Kälte. Und nicht die bekannte Kälte, die man fühlte, wenn man sich während einer Kältewelle in einem viel zu dünnen Mantel unter der Saloon-Treppe versteckte. Nein. Um ihn herum herrschte eine Kälte, die regelrecht brannte. Doch das ergab überhaupt keinen Sinn. Mit einem Stöhnen hob Mal den Kopf und versuchte, seine Arme unter sich zu ziehen, um sich hochzustemmen. In diesem Augenblick traf ihn erst die volle Wucht seiner Schmerzen. Die Schulter pochte, die Rippen brannten und sein Kopf fühlte sich an, als sei er mit einem Zug kollidiert. Ach … richtig … das war er ja auch. Bruchstückhafte Erinnerungen wirbelten durch seinen Kopf, während er langsam aus der Schneewehe kroch, die seinen Sturz aufgefangen haben musste.
Er war auf den Zug aufgesprungen wie schon ein Dutzend Mal zuvor, seit sein Trunkenbold von einem Vater es geschafft hatte, sich umbringen zu lassen – von einem Fuhrwerk überrollt, als er die Straße überqueren wollte. Der Alte war sowieso zu nichts zu gebrauchen gewesen. Hatte seinen Sohn in Mülleimern nach Essensresten suchen lassen, während er selbst jede noch so kleine Münze in Whiskey umgesetzt hatte. Doch immerhin hatte er ihnen ein Dach über dem Kopf besorgt – ein heruntergekommenes, undichtes Dach, das auf zwei baufällige Wände gesetzt war, die nicht einmal den Wind abhalten konnten – aber immerhin ein Dach. An dem Morgen, nachdem sein Vater beerdigt worden war, hatte die Frau, der die Hütte gehörte, Mal vor die Tür gesetzt. Sie hatte ihm kaum Zeit gelassen, seinen Sack zu holen, in dem er die wenigen Habseligkeiten aufbewahrte, die er besaß. Doch als er sich hektisch umgeschaut hatte, war der Sack nirgends zu finden gewesen.
„Nein!“ Er schlug mit der Faust auf den gefrorenen Grund neben sich und sank in sich zusammen. Was hatte er erwartet? Dass Gott sich plötzlich seiner Existenz erinnern und einen Finger krümmen würde, um ihm zu helfen? Ha! Nichts da! Der Große Mann hatte sich noch nie um ihn geschert. Warum sollte er plötzlich damit anfangen? Es war doch viel bequemer, sich dort oben im Himmel zurückzulehnen und sich darüber zu amüsieren, wie der arme Malachi Shaw sich durchs Leben kämpfte. Er hatte ihm die Mutter so früh genommen, dass Mal sich nicht einmal daran erinnern konnte, wie sie ausgesehen hatte. Hatte ihm einen Vater gegeben, der sich mehr für den nächsten Drink als für sein eigen Fleisch und Blut interessierte. Und dann hatte er ihm auch noch diesen Menschen weggenommen.
Jetzt stand er alleine da. Ohne Zuhause. Niemand wollte ihm Arbeit geben. Ihm blieb nichts anderes übrig, als heimlich, als blinder Passagier, mit dem Zug zu reisen und nach einem Ort zu suchen, an dem er eine faire Chance bekommen würde. Und was hatte ihm das bisher gebracht? Einen Zusammenstoß mit einer Bande von Vagabunden, denen es gar nicht gefallen hatte, dass er in ihr Territorium eingedrungen war. Mal fasste sich vorsichtig an die schmerzende Beule auf seiner Stirn. Es waren vier gewesen. Alle doppelt so groß wie er. Und jeder war einmal an der Reihe gewesen zuzuschlagen. Bis der vierte Kerl Mals Kopf gegen den stählernen Türrahmen gedonnert hatte. An das, was danach gekommen war, hatte Malachi keine Erinnerung mehr. Offensichtlich war er von den Vagabunden aus dem Zug geworfen worden. Er konnte die Gleise oben auf der Böschung kaum ausmachen. Zu schade, dass Gott die Sache nicht endlich beendet hatte. Hätte Mal sich nicht einfach den Hals brechen können? Aber nein, wo bliebe denn da der Spaß, den Gott sich offensichtlich mit ihm machte?
„Du willst dich wohl noch länger über mich lustig machen?“ Er funkelte den dunkelgrauen Himmel, der bald ganz in Schwarz versinken würde, böse an. „Dass es dir und den Engeln da oben bloß nicht langweilig wird!“ Mal klopfte sich den Schnee aus den Haaren und von den Armen und kämpfte sich auf die Füße. Er schlug sich auch auf die Hose, um den weißen Staub loszuwerden, und biss die Zähne zusammen. Seine Finger brannten, als hätte er sie in eine offene Flamme gehalten. Seine Ohren und die Nase stachen ebenfalls. Seine Füße konnte er nicht einmal mehr spüren. Das war gar nicht gut. Er stampfte ein paarmal auf und legte die Hände an den Mund, um hineinzuhauchen.
Es brachte allerdings nicht viel. Das Einzige, was ihn davor bewahren konnte, zu einem menschlichen Eisklotz zu werden, war ein Unterschlupf. Ein Feuer. Und ein Mantel. Das dicke Flanellhemd, das er aus der Armenkiste der Kirche hatte, tat nichts, um den schneidenden Wind abzuhalten. Und jetzt, wo es vom Schnee durchnässt war, entzog es ihm eher die Wärme, als dass es ihn schützte. Immerhin hatte er keine Löcher in den Schuhen. Die Sohlen waren dünn, aber unversehrt. Wenn er die guten Dinge aufzählen sollte, die ihm in seinem Leben widerfahren waren, dann konnte er immerhin den Prediger nennen, der sie ihm gegeben hatte. Das war vermutlich besser als nichts. Wenn diese Mistkerle ihm nur seinen Beutel gelassen hätten! Dann wäre er jetzt noch im Besitz von trockener Kleidung, Essen und einem Feuerstein.
„Hör auf zu jammern“, murmelte er sich selber zu. „Das wird deinen Magen nicht füllen. Wenn du dich aufwärmen willst, tu etwas dafür.“
Malachi reckte seine Schultern und hob den Kopf, um sich umzuschauen. Er suchte nach einem Gebäude irgendwo in der Nähe. Am besten eine Scheune, wo Tiere die Luft erwärmten. Doch er sah nichts. Nichts als schneebedeckte Prärie, aus der hier und da weiß gefärbte Bäume hervorstachen. Was hatte er auch erwartet? Dass eine geschlossene Kutsche mit einem dieser vornehmen Lenker vorfahren würde, um ihn zu fragen, wohin er reisen wolle? In diesem Moment stellte Mal sich vor, wie er zu ihm sagen würde: „Bringen Sie mich zur nächsten Scheune, guter Mann. Und schonen Sie bloß nicht die Pferde.“ Mit einem Schnauben schlug Mal den Kragen seines Hemdes hoch, schob die Hände in die Hosentaschen und fing an, nach Osten zu trotten. Gainesville konnte nicht weit weg sein. Dort war ihm die brillante Idee gekommen, von hinten auf den dritten Zugwaggon aufzuspringen.
Das war nicht gerade seine beste Entscheidung gewesen. Die Kerle, die den Waggon schon belegt hatten, waren sofort auf ihn losgegangen. Der Zug konnte also keine weite Strecke zurückgelegt haben, bis sie ihn rausgeschmissen hatten. Bestimmt würde es eine Farm oder Ranch in der Nähe geben, wo er sich ein oder zwei Nächte in der Scheune verstecken konnte. Er musste es nur schaffen, sie zu erreichen, bevor die Nacht anbrach und man nicht mehr die Hand vor den Augen sehen konnte.
Zu dem Zeitpunkt, als Mal die ersten Gebäude erreichte, zitterte er so stark, dass er kaum noch das Gleichgewicht halten konnte. Der Wind, der aus Norden heranbrauste, warf ihn immer wieder aus der Bahn. Doch immerhin, es schneite es nicht! Der Prediger wäre stolz auf ihn. Er hatte gerade die Liste der guten Dinge, die ihm bisher in seinem Leben widerfahren waren, verdoppelt. Mal kicherte, doch der Laut wandelte sich in ein Husten. Eines, das seine Brust schmerzen ließ. Er krümmte die Schultern, zog den Kopf ein und drehte sich voll in den Wind. Er stakste über ein Feld, um den Weg zur Scheune abzukürzen.
Licht schimmerte aus dem Haus, das etwas entfernt stand. Rauch, ebenfalls ein Spielball des Windes wie er, wurde im scharfen Winkel aus dem Schornstein geblasen. Normalerweise vermied Mal es, in die Nähe von Menschen zu kommen. Doch in diesem Fall war ihm zu kalt, um sich nach einem besseren Unterschlupf umzuschauen. Wenn er sich einfach ins Heu betten und aufwärmen könnte, wäre er wieder verschwunden, bevor die Besitzer am Morgen aufwachten. Plötzlich dankbar für die aufkommende Dunkelheit, presste sich Malachi gegen die vom Haus abgewandte Seite der Scheune und schlich in Richtung des Tores an der Vorderseite.
Er öffnete es gerade so weit, dass er hindurchpasste, schlüpfte nach drinnen und hielt den Griff fest, damit der Wind das Tor nicht zuschlug. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war ein lautes Geräusch, das den Farmer alarmierte. Farmer trugen normalerweise Gewehre bei sich und Malachi war nicht gerade erpicht darauf, sich eine Ladung Schrot einzufangen. Er spähte durch den offenen Schlitz und beobachtete das Haus, bereit, in Richtung Feld davonzustürmen, sollte es nötig sein. Doch nichts geschah. Er ließ den angehaltenen Atem entweichen und schloss leise das Tor. Es sah aus, als könnte er seiner Liste noch eine Nummer drei hinzufügen. Mal grinste und schlich sich in die dunkelste Ecke des Stalles, die er finden konnte.
Der Heugeruch kitzelte ihn in der Nase, doch er war so glücklich, dem Wind entkommen zu sein, dass er sich nicht darum kümmerte. Mit tauben, zitternden Fingern schaffte er es, die Knöpfe seines Flanellhemdes zu öffnen. Er zog es zusammen mit seinem wollenen Unterhemd aus und hängte es über die Tür einer leeren Box. Danach versuchte er auch, die Senkel seiner Schuhe zu öffnen, doch seine Finger waren zu taub, um den Knoten zu lösen. Seine Füße würden warten müssen, bis seine Gliedmaßen etwas Gefühl zurückgewonnen hatten. Er blies sich in die Hände, dann betrat er die Box und verbarg sich in einem Haufen Stroh. Er lag einige Zeit lang ruhig da, die knochigen Arme vor der Brust verschränkt, die Knie fest angezogen. Die nasse Hose ließ seine Zähne unkontrolliert klappern.
Er schloss die Augen und stellte sich alles Wärmende vor, an das er nur denken konnte. Ein Lagerfeuer. Eine Wolldecke. Aber nicht eine von diesen kratzigen Dingern. Nein, einen Quilt. Einen dicken, weichen, mit Daunen gefüllten Quilt mit gesäumten Kanten, wie er ihn einmal in einem Geschäft gesehen hatte. Und eine dampfende Schüssel mit Eintopf. Doch der Gedanke daran ließ seinen Magen sofort laut knurren. Na großartig! Eigentlich wusste er es doch besser. Er durfte nicht ans Essen denken. Jetzt würde er keinen anderen Gedanken mehr haben. Mal öffnete die Augen und ließ seinen Blick durch die Schatten der Scheune wandern. Vielleicht gab es noch Futter in dem Trog, an dem er vorbeigekommen war. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich ein Abendessen aus Getreide gönnte, das er dem Vieh stibitzt hatte. Schreckliches Zeug. Hart und trocken und es blieb immer zwischen den Zähnen hängen. Aber es würde seinen knurrenden Magen beruhigen und ihm vielleicht sogar etwas Schlaf bringen.
Zögernd streckte sich Malachi und klopfte sich das Heu ab. Er biss die Zähne zusammen, damit sie endlich zu klappern aufhörten, und ging langsam dorthin zurück, wo er den Trog gesehen hatte. Eines der Pferde schnaubte und trat gegen seine Boxentür. „Ganz ruhig, Junge“, murmelte Mal leise. „Ich tu dir nichts.“ Im Dämmerlicht, das durch die Fenster fiel, konnte Mal die großen braunen Augen des Pferdes sehen und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Doch das Tier beruhigte sich wieder. Malachi entspannte sich, hielt seinen Blick aber weiter auf das Tier gerichtet, da es ihm nicht gefiel, wie es ihn anstarrte.
So hochnäsig. Wie die Besitzerin des Ladens, auf dessen Hinterhof er in den Mülleimern nach Essen gesucht hatte. Er war von ihr mit dem Besen vertrieben worden – wie Ungeziefer. So in Gedanken versunken bemerkte Mal die Schaufel nicht, bis sein Fuß dagegenstieß. Sie polterte laut zu Boden. Das Echo dröhnte von den Wänden. Mal erstarrte, sein Herz schlug lauter als der Hammer eines Schmieds. Angeln quietschten. Er fuhr herum in Richtung des Geräusches. Es ertönte zu seiner Linken. Zwischen ihm und der Tür. Er hörte Schritte auf sich zukommen. Malachi schnappte sich die umgefallene Schaufel und hob sie hoch. Er würde zuschlagen und loslaufen, sobald der Farmer sich zeigte. Eine Silhouette erschien vor der ersten Pferdebox. Eine kleine Gestalt mit großen, runden Augen und einem Heiligenschein aus lockigem schwarzem Haar. Blasse Haut. Volle, rosige Wangen.
Mal ließ seine Arme langsam sinken und stellte die Schaufel weg. Es würde nicht zuschlagen und weglaufen. Nicht, wenn Gott ihm einen Engel gesandt hatte. „Wer bist du?“, fragte der Engel mit kindlich neugieriger Stimme. Keine Vorwürfe. Mal konnte nicht antworten. Der Engel fragte nicht weiter. Starrte ihn nur an. Da erst erinnerte Mal sich, dass er kein Hemd anhatte. Er schlang die Arme um seine Mitte und versuchte, seine abgemagerte Brust zu verstecken. Er wollte den Engel nicht beleidigen. Oder ihm seine dürren Rippen zeigen.
Ein Mann hatte schließlich seinen Stolz. „Du musst schrecklich frieren“, sagte der kleine Engel endlich. Dann fing er an, seinen zugeknöpften Mantel zu öffnen, und bevor Mal verstand, was geschah, wurde ihm das schwere Ding um die Schultern gelegt. Die dicke Wolle fühlte sich himmlisch an und war immer noch angewärmt von der Körperwärme des Engels. Hitze stieg in seinem Körper auf, bis er sich wie eine Kerze fühlte, deren Wachs zerschmolz.
„Steh nicht einfach da herum und starr mich an, als hättest du noch nie ein Mädchen gesehen“, verlangte die Engelsgestalt. „Steck deine Arme in die Ärmel!“ Die Gestalt funkelte ihn an und schob die Unterlippe vor. Dann, weil Mal keine Anstalten machte, sich zu bewegen, stopfte der Engel Mals Hände in die viel zu kurzen Ärmel des Mantels. „Du bist ja halb erfroren“, beschwerte sich der Engel, nachdem er Mal wieder losgelassen hatte. Schnell fing er an, den Mantel zuzuknöpfen, dann rieb er Mals Arme. Durch die Reibung wurde Mal noch wärmer und seine Haut fing förmlich an zu brennen.
Er starrte auf den Kopf des Engels hinunter. Er reichte ihm gerade bis zum Kinn. Ganz schön klein, dieser Engel. Und ziemlich rechthaberisch. Vielleicht war es doch nur ein Mädchen, wie die Gestalt eben selbst behauptet hatte. Die Kleine schien fertig zu sein und trat zurück. „Hm. Das reicht noch nicht.“ Sie stapfte zur Scheunenwand hinüber, schnappte sich eine Satteldecke und kam zurück. „Setz dich!“, befahl sie, ohne einen Widerspruch zu dulden und reichte ihm die Decke. Als er ihr gehorcht hatte, wickelte sie die Decke um ihn und betrachtete ihn kritisch. Ihr Blick kam auf seinen nackten Händen zum Ruhen. „Oh! Meine Handschuhe!“ Ein Grinsen trat auf ihr Gesicht und sie lief in die Box, aus der sie zuvor gekommen war. Eilig kam sie zurück und warf ihm ein Paar knallroter Handschuhe zu. „Hier. Zieh die an.“ Ihr Gesicht verdunkelte sich kurz. „Und mein Schal!“ Sie wickelte sich den langen, gestrickten Streifen vom Hals und band ihn ihm um Hals und Kopf. „Das ist schon besser.“ Der Triumph in ihrer Stimme ließ Mal lächeln.
Sie betrachtete ihn noch einmal, wobei sich erneut Sorgenfalten auf ihrer Stirn zeigten. Er fing an, sich wie einer dieser Schneemänner zu fühlen, die die Kinder in der Schulpause bauten. Er erwartete fast, dass sie ihm gleich noch eine Karotte ins Gesicht drücken würde. Das hätte ihm allerdings nichts ausgemacht. Eine Karotte schmeckte viel besser als Getreide. „Deine Füße“, sagte sie endlich.
„Die Schnürsenkel sind immer noch ganz schneeverkrustet. Tante Henry macht immer einen Riesenwirbel darum, dass ich meine nassen Stiefel und Socken ausziehe, bevor meine Füße schrumpelig werden. Aber wenn du da draußen im Schnee herumgelaufen bist, gibt es viel mehr, um das wir uns Sorgen machen müssen, als schrumpelige Füße.“ Tante Henry? Wer war das denn? Das Mädchen blickte von seinen Füßen auf und richtete ernst ihren Blick auf Mal. „Der alte Tarleton ist vor ein paar Jahren in einen Eissturm geraten und seine Füße sind so kalt geworden, dass sie eingefroren waren. Drei seiner Zehen sind schwarz geworden und abgefallen.“ Sie berichtete diese schreckliche Geschichte mit einem großen Maß an ganz und gar nicht engelsgleichem Enthusiasmus. „Also ziehen wir die Schuhe lieber aus.“ Sie kniete sich vor ihn hin und begann, an den Schnürsenkeln herumzuzupfen.
Das war genug. Er konnte nicht erlauben, dass sein Engel seine stinkenden Füße berührte. Er wusste ja nicht, in welchen Mist er getreten war. „Das mache ich selbst“, knurrte er. Mal versuchte, das Engelsmädchen wegzuschieben und die flauschigen roten Handschuhe auszuziehen, doch sie ließ ihn nicht. „Lass die Handschuhe an!“ Sie funkelte ihn so böse an, dass er nicht zu widersprechen wagte. „Ich werde nicht zulassen, dass du dir unter meiner Aufsicht den Tod holst.“ Warum tat sie das? Warum half sie ihm, anstatt ihren Vater um Hilfe zu rufen, damit er ihn verjagte? Warum gab sie ihm ihre Kleidung? Sprach mit ihm, als wäre er jemand anderes? Als wäre er nicht der Abschaum, von dem er selber wusste, dass er es war? Endlich hatte sie die Schnürsenkel aufgebunden und zog ihm die Schuhe aus. Mal versuchte, seine Füße unter der Pferdedecke zu verstecken, bevor sie die erbärmlichen Socken sah, doch sie ließ es nicht zu. Langsam zog sie ihm die löchrigen Dinger aus und zischte immer wieder ungehalten wegen seiner eisigen Zehen. Mal war froh, dass sie noch nicht so schwarz waren wie die vom alten Tarleton.
Doch sie waren schmutzig. Hässlich. Er entzog sie ihren sauberen weißen Händen und versteckte sie so gut wie möglich unter der Satteldecke. Sie sagte nichts, sondern ließ sich einfach auf den schmutzigen Boden fallen und zog ihre Schuhe aus. Was wollte sie …? Dann zog sein Engel sich auch noch die dicken Wollsocken aus und suchte unter der Decke nach seinen Füßen. Bevor er reagieren und sich vor ihr zurückziehen konnte, hatte sie sich seinen rechten Fuß geschnappt, zog ihn hervor und stülpte einen Strumpf darüber. Dann suchte sie seinen linken Fuß und verfuhr damit ebenso. Bis dahin hatte er schon vollkommen aufgegeben, sich zu wehren. Selbst sein halb eingefrorenes Gehirn erkannte, wenn er einen Kampf verloren hatte.
Die Wärme der Strümpfe brachte das Gefühl zurück in seine Füße. Schon nach wenigen Augenblicken fingen sie an, heftig zu stechen und zu pochen. Der Schmerz war so schlimm, dass er das Mädchen am liebsten weggeschubst und ihm verboten hätte, ihn zu berühren. Doch das tat er nicht. Das würde er niemals tun. Niemals. Ihm wurde gerade der größte Segen zuteil, den sein jämmerliches Leben bisher erfahren hatte. Auf keinen Fall würde er etwas tun, das sie verletzte. Also biss er die Zähne zusammen und hielt still, während sie die Pferdedecke über seine Füße legte. „Und jetzt etwas Wärme für das Innere.“ Sie erhob sich und schob ihre nackten Füße zurück in ihre Stiefel. Dann verschwand sie erneut in der Box. Als sie wieder auftauchte, trug sie wankend einen vollen Eimer Milch vor sich her.
Er sprang auf, um ihr zu helfen und nahm ihr den Eimer ab. „Sie ist noch warm“, sagte sie. „Aber ich habe keine Tasse.“ Malachi war bei dem Gedanken daran, frische Milch zu trinken, schon längst das Wasser im Mund zusammengelaufen. „Ich brauche keine Tasse.“ Er würde seinen Mund einfach direkt an den Eimerrand legen und ihn langsam kippen, bis die sahnige Flüssigkeit seinen ausgetrockneten Hals hinunterströmen würde. Doch nein! Das konnte er nicht tun. Er würde vor ihr nicht wie ein Tier trinken. Er würde die Milch nicht mit seinen schmutzigen Lippen verderben.
Er sah sich um. Dort. Auf der Werkbank. Da stand ein Glas voller Nägel, Reißzwecken und anderer Kleinteile. Malachi lief zu dem Tisch, drehte das Glas um und ließ den Inhalt vorsichtig auf die Tischplatte kullern, damit nichts auf den Boden fiel. Dann wischte er den Staub mit seiner immer noch feuchten Hose ab. „Das wird gehen.“ Sie zog die Nase kraus. „Aber das ist schmutzig.“ Er grinste. „Ein bisschen Schmutz hat mir noch nie geschadet.“ Sie lächelte ebenfalls, was Mal fast umgeworfen hätte. Noch nie hatte er so etwas Schönes, so etwas Gutes gesehen, das für ihn gedacht war. Ein Lächeln wie dieses war normalerweise anderen vorbehalten. Menschen, die es verdienten. Nicht ihm. Er räusperte sich und ging an ihr vorbei zurück zu dem Eimer. Mal wollte nicht den Rest der Milch verderben, indem er das Glas in den Eimer tunkte, deshalb stellte er es auf den Boden und hob den Eimer an. „Ich halte es“, zirpte das Mädchen und grinste immer noch, als erlebe sie gerade das beste Abenteuer ihres Lebens. Geschwächt durch sein Martyrium, zitterten Mals Arme, während er den Eimer hielt.
Etwas von der Milch schwappte über den Rand des Glases. Mals Blick flog sofort zu dem Mädchen und seine Brust wurde eng. „Mach weiter“, sagte sie und schien überhaupt nicht erbost darüber zu sein, dass die Milch über ihre Finger gelaufen war. „Füll es bis zum Rand.“ Die Enge in seiner Brust ließ nach. Mal folgte ihrer Anweisung, dann stellte er den Eimer ab und nahm das Glas entgegen.
Er hob es an die Lippen und schloss die Augen, als die frische, sahnige Milch über seine Zunge strömte. Er genoss die Süße, trank langsam, gezügelt. Und als nur noch ein Drittel übrig war, hielt er inne und stellte das Glas beiseite. „Willst du nicht austrinken? Tante Bertie sagt immer, dass ich austrinken muss, bevor ich vom Tisch aufstehen darf.“ War es vorhin nicht noch Tante Henry gewesen? Malachi schüttelte den Gedanken ab. Der Name der Tante war vollkommen egal. „Ich hebe es für später auf.“ Er hatte gelernt, dass er niemals alles auf einmal essen durfte, wenn er etwas zu essen hatte, denn man konnte nie wissen, wann es das nächste Mal etwas geben würde. Es war besser, sich Vorräte anzulegen. „Aber wir haben doch noch viel mehr.“ Sie nickte in Richtung des Eimers.
„Das gehört dir. Deiner Familie.“
Das Mädchen sah ihn seltsam an, als verstehe es nicht, was er damit meinte. „Den Tanten wird es nichts ausmachen.“
Mal schüttelte den Kopf. „Wie du meinst.“ Sein kleiner Engel sah sich in der Scheune um und wirkte zum ersten Mal, seit Mal ihn getroffen hatte, nicht so, als hätte er alles im Griff. Das Mädchen schlang die Arme um sich und versuchte, ein Zittern zu unterdrücken. „Du frierst“, warf Mal ihr viel rauer vor, als er es hätte tun sollen, doch verflixt noch mal, das Mädchen hätte ihm sagen sollen, dass es fror! Sofort warf er ihr die Decke zu und zog den Mantel aus. „Du musst zurück ins Haus, Mädchen. Setz dich neben den Ofen oder so.“
„Ich bin kein Baby!“ Sie schob schmollend ihre Unterlippe vor, aber seine Entschlossenheit verstärkte sich noch. Sie war viel zu jung, um hier in der Kälte zu zittern, während es nebenan im Haus schön warm war.
„Hau ab, Mädchen. Mir geht es gut.“ Sie zog ihren Mantel an und schob ihre kleinen Hände in die Handschuhe. „Wie heißt du?“, wollte sie wissen.
Er starrte sie an, dann antwortete er zögerlich. „Malachi.“
Jetzt lächelte sie wieder. „Und ich bin Emma.“
„Schön für dich“, knurrte er und fühlte sich immer noch schlecht, weil sie seinetwegen hatte frieren müssen.
„Und jetzt verschwinde.“ Und genau das tat sie. Und alles Licht verschwand mit ihr. Jetzt war Mal wieder alleine. In der Dunkelheit. Wo er hingehörte. An diesen Umstand hatte er sich gewöhnt. Eigentlich dürfte ihm das nichts mehr ausmachen. Jahrelang hatte es ihm nichts ausgemacht. Doch jetzt war es plötzlich anders. Denn jetzt wusste er, was ihm entgangen war.
Mal nahm die Satteldecke und warf sie sich über die Schultern. Dann griff er nach dem Glas mit der Milch und wollte zurück zu seinem Heulager gehen, doch der Anblick des Milcheimers ließ ihn innehalten. Sie hatte ihn zurückgelassen. Sein Herz fing an zu klopfen. Bedeutete das etwa, dass sie zurückkommen würde? Oder hatte sie die Milch einfach vergessen? Wie ihn? Vielleicht sollte er sie zum Haus tragen. Um ihr für ihre Hilfe zu danken. Er bückte sich, um den Henkel zu nehmen.
Da flog die Scheunentür auf. „Gute Neuigkeiten, Malachi!“ Emma stand in der Tür und lachte so strahlend, dass er sich fast die Hand vor die Augen halten musste. „Die Tanten haben mir erlaubt, dich zu behalten!“
Kapitel 1
Sommer 1894
Harpers Station
Baylor County, Texas
Emma Chandler riss den Zettel mit der Schmähbotschaft von dem Nagel, der in der Kirchentür steckte. Sie zerknüllte das abscheuliche Ding in der Faust und stopfte es in die Rocktasche, obwohl sie es am liebsten mitten auf die Straße geschmissen, es mit fünfzig Pferden niedergetrampelt, daraufgespuckt und es anschließend in Brand gesteckt hätte, damit es als harmlose Asche vom Wind verweht würde. Wie konnte es jemand wagen, ihre Damen zu bedrohen? Dazu hatte dieser Unmensch kein Recht! „Er wird immer dreister.“ Die stoische Stimme ihrer Freundin durchbrach Emmas wütende Gedanken und erinnerte sie daran, dass es ihr nichts bringen würde, sich in ihre Wut hineinzusteigern. Sie musste mit kühlem Kopf agieren. Bedacht und besonnen.
„Ja, das stimmt.“ Emma sah sich nach dem Feigling um, obwohl sie wusste, dass sie niemanden entdecken würde. Das hatte sie noch nie. Und das war immerhin schon die dritte Botschaft innerhalb der letzten zwei Wochen. Und jedes Mal war der Ort für die Botschaft so gewählt, dass er die Gemeinschaft etwas mehr ins Herz traf. „Aber es sind nur Worte.“
„Wir haben keine Garantie dafür, dass es dabei bleiben wird.“ Victoria Adams fasste Emmas größte Angst in Worte. „Wenn ihn seine Worte nicht weiterbringen, wird er härtere Maßnahmen ergreifen.“ In Toris Stimme schwang eine Sicherheit mit, als hätte sie etwas Ähnliches schon selbst erlebt. „Lass mich den Zettel sehen, Emma.“ Sie streckte die Hand aus.
Emma seufzte und zog ihn aus der Tasche. Sie ließ ihn in die Hand ihrer Freundin fallen und wusste, dass Tori sofort erkennen würde, dass die „härteren Maßnahmen“ bereits ergriffen worden waren.
Victoria strich die Notiz glatt und überflog die knappen Zeilen. Leise flüsterte sie die Worte, die dort geschrieben standen.
„‚Frauen von Harpers Station,
verschwindet heute noch von hier oder ich werde euch verschwinden lassen. Das ist meine letzte Warnung!‘“
„Wir müssen ein Treffen einberufen.“ Emma stampfte die Kirchentreppe hinunter und marschierte über den Vorplatz.
Tori folgte ihr die Treppe hinunter, blieb dann jedoch stehen. Sie lehnte sich an das Geländer und wartete darauf, dass Emma zurückkam. „Was willst du ihnen sagen?“
Die leise Frage ließ Emma innehalten. Sie wirbelte zu ihrer Freundin herum. „Ich werde nicht aufgeben, Tori. Ich werde mich nicht von einem Rüpel einschüchtern lassen!“ Sie streckte die Arme in Richtung der kleinen Ansammlung von Gebäuden aus, die sich um die alte Postkutschenstation herum gruppierten, die schon vor zwanzig Jahren die ersten Siedler hierher gelockt hatte. „Harpers Station ist eine Zuflucht für Frauen, die genau dieser Art von Bedrohung entkommen wollen. Wir haben so hart dafür gearbeitet, hier alles aufzubauen, die Frauen herzubringen, ihnen ein neues Leben zu bieten. Ich werde mich nicht wie ein Mäuschen einschüchtern lassen, nur weil ein sturer, uneinsichtiger Mann seine Muskeln spielen lässt!“
Tori machte keine Anstalten, Emmas leidenschaftliche Rede zu unterbrechen.
Sie sah ihre Freundin nur still an und wartete da-rauf, bis sie genug Dampf abgelassen hatte. Das war dann schließlich auch der Fall. Emma mochte sich zwar dagegen wehren, ihre Prinzipien über den Haufen zu werfen, doch sie würde niemals die Sicherheit ihrer Frauen aufs Spiel setzen. Niemals. Nicht einmal für das hehre Ideal, das sie hier alle zusammengeführt hatte.
Sie ging dorthin zurück, wo Tori noch immer auf sie wartete, und ließ ihre Verärgerung so weit verpuffen, dass ihre Gedanken wieder klar wurden. „Ich werde die Mütter mit Kindern ermutigen, dem Rat des Sheriffs zu folgen und – vorübergehend – in eine der Nachbarstädte zu ziehen.“ Emmas Schultern sanken etwas herab, als sie Tori in die Augen sah. „Das schließt auch dich mit ein.“ Wie sehr sie es hasste, ihre engste Freundin, die mit ihr diese Kolonie der Frauen aufgebaut hatte, wegzuschicken. Doch Tori hatte einen vierjährigen Sohn und wenn dem kleinen Lewis irgendetwas zustoßen würde … Nun, daran wollte sie nicht einmal denken.
Toris Augen verengten sich.
„Ich werde nirgendwo hingehen.“ Die Härte in ihrer Stimme ließ keinen Raum für Widerspruch. „Ich werde dich in diesem Kampf nicht alleine lassen. Außerdem, wohin sollten wir gehen? All meine Ersparnisse stecken in meinem Laden. Ich kann wohl kaum das Geschäft mitnehmen. Und wenn ich das verliere, verliere ich alles.“
„Ich werde mich für dich um alles kümmern“, bot Emma an, doch ihre Freundin schnitt ihr das Wort mit einem knappen Kopfschütteln ab.
„Du musst die Bank leiten. Du brauchst nicht noch eine zusätzliche Belastung. Ich werde Lewis an der kurzen Leine halten. Uns wird schon nichts passieren.“ Toris Hände ballten sich zu Fäusten und Emma wusste, dass sie sich nicht mehr umstimmen lassen würde.
Victoria zeigte niemals Emotionen – außer freundschaftlicher Zuneigung und der Liebe zu ihrem Sohn. Sonst nichts. Keine Angst, keinen Zorn, keine Überraschung. Nichts, was jemandem ihr gegenüber einen Vorteil verschaffen könnte. Wenn sie also so erzürnt war, dass sie ihre Fäuste ballte, mussten ihre Gefühle am Brodeln sein.
„Ich will meinem Sohn zeigen, dass man für die Dinge kämpfen muss, an die man glaubt, auch wenn es einen in Gefahr bringt. Wir verstecken uns nicht.“
Eine Welt des Schmerzes steckte hinter dieser Aussage, eines Schmerzes, den Emma sich gar nicht vorstellen konnte. Tori kämpfte seit dem Tag, an dem sie entdeckt hatte, dass sie schwanger war. Ungewollt schwanger durch den Angriff eines Mannes, der überall in ihrer Heimatstadt beliebt war. Sie hatte um eine Heimat gekämpft, nachdem ihr Vater sie vor die Tür gesetzt hatte. Um den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn. Und gegen die Angst, wieder einmal den Charakter eines Mannes falsch einzuschätzen und den gleichen Albtraum noch einmal durchleben zu müssen.
Emma trat dicht an Victoria heran und berührte ihren Arm. Da erst entspannten sich Toris Hände wieder und sie legte eine Hand auf Emmas.
„Wir halten zusammen“, versprach Emma.
Tori nickte. „Ja, das tun wir.“
Zwei Stunden später, kurz nach Mittag, stand Emma vorn in der Kirche, hatte sich gegen die Wand gelehnt und beobachtete, wie die Frauen langsam hereinkamen. Ihr Herz wurde schwer, als sie in die vertrauten Gesichter blickte. Wer würde weggehen? Wer würde bleiben?
Betty Cooper stampfte den Mittelgang entlang, ihre stämmige Figur und der zügige Schritt bereiteten den Weg für die vier jüngeren Frauen, die ihr folgten. Die Matrone mittleren Alters überwachte die Legehennen, die den Frauen von Harpers Station einen Großteil ihres Einkommens brachten. Sie war seit den ersten Tagen hier in Harpers Station an Emmas Seite. Verwitwet, kinderlos, doch sie hatte eines der größten Herzen, denen Emma jemals begegnet war. Sie versteckte es gut hinter ihrer schroffen Art und ihrem Beharren auf harter Arbeit, doch sie gluckte über den Frauen, als wären es ihre eigenen Küken.
Die Damen des Nähkreises, von denen einige ihre Kinder dabeihatten, redeten miteinander, während sie ihre angestammten Plätze in den mittleren Reihen auf der rechten Seite einnahmen. Sie fertigten exquisite Quiltdecken, die in Fort Worth zu Höchstpreisen verkauft wurden. Wenn die Hälfte von ihnen die Gemeinschaft verließ, wie sollten die übrigen Frauen dann noch ihre Quote erfüllen? Der Händler verlangte fünfzehn Quilts im Monat, was leicht zu bewerkstelligen war, wenn alle zehn Frauen täglich zu Nadel und Faden griffen. Aber wenn ihre Zahl auf fünf fiel …?
Grace Mallory kam durch die Tür, wie immer mit gesenktem Kopf, den Blick auf die Füße gerichtet, als sie in die hinterste Bank schlüpfte. Die stille Frau war erst seit sechs Monaten in der Stadt und blieb am liebsten für sich, doch dank ihrer Fähigkeiten als Telegrafistin hatte Harpers Station endlich einen funktionierenden Draht zur Außenwelt. Das Land hatte ihnen noch kein Postamt zugesagt, also mussten Briefe immer noch aus Seymour versandt werden, was stets mit Reisekosten verbunden war. Doch nun konnte jede der Frauen hier für weniger als einen Nickel pro Wort ein Telegramm verschicken. Falls Grace sich entscheiden sollte zu gehen, wäre das ein schwerer Verlust.
Emmas Aufmerksamkeit wanderte zu den anderen, die sich schon versammelt hatten. Diejenigen, die sich um den Gemeindegarten kümmerten und Obst und Gemüse einmachten, das dann verkauft wurde. Die Damen, die das Café führten. Die Besitzerin der Pension. Die Geburtshelferin, die als Stadtärztin arbeitete.
Und natürlich die „Tanten“: Henrietta und Alberta Chandler saßen in der ersten Reihe, so entschlossen und eisern, wie sie es immer in ihrer Unterstützung gewesen waren. Tante Henrys Augen waren von einem klaren, fast kämpferischen Licht erleuchtet, als sie steif wie ein Brett in der Bank saß. Wie immer, wenn es um Frauenrechte ging, trug sie ihre Pluderhose. Tante Bertie wirkte dagegen viel weicher und weiblicher, als sie dort neben ihrer älteren Schwester saß. Sie lächelte Emma aufmunternd zu und winkte mit dem kleinen Finger.
Die Tanten hatten Emma großgezogen, seit sie acht Jahre alt gewesen war. Tante Henry hatte in ihr den Wunsch geweckt, sich gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen, und Tante Bertie ihr beigebracht, wie man sich von seinem Herzen leiten ließ. Sie waren diejenigen gewesen, die Emma geholfen hatten, ihren Traum von einer Stadt für Frauen wahrzumachen. Einem Ort, der von Frauen geführt und an dem Frauen beigestanden wurde. Eine Zuflucht für diejenigen, die Hilfe brauchten, und ein Ort der Unterstützung für jene, die niemanden hatten, an den sie sich wenden konnten – oder wollten.
Vor zwei Jahren, als Emma an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag in den Besitz ihres Erbes gelangt war, hatte sie von einer alten, verlassenen Stadt gehört, die für einen lächerlich niedrigen Preis verkauft werden sollte. Die Siedler hatten die alte Postkutschenstadt verlassen und waren in das nahe Seymor gezogen, das an die Eisenbahnlinie angeschlossen worden war. Die Tanten und Emma hatten ihre Ersparnisse zusammengelegt und gemeinsam das Land und die Stadt gekauft. Dank einiger wohlplatzierter Anzeigen in lokalen Zeitungen im ersten Jahr und ihrer wachsenden Bekanntheit als Gemeinschaft von Frauen – im positiven wie im negativen Sinne – zählte die Stadt mittlerweile schon fünfzig Bewohner.
Frauen und Kinder, die erfolgreich auf sich selbst gestellt lebten, indem sie sich gegenseitig unterstützten.
Und jetzt drohte ein uneinsichtiger, hasserfüllter Mann damit, alles zu zerstören, was sie hier aufgebaut hatten. Emma biss die Zähne zusammen. Nicht unter meiner Obhut.
Als alle Frauen sich gesetzt hatten, suchte Emma noch einmal nach himmlischem Beistand. Du siehst, was mir verborgen bleibt, Herr. Du weißt, was für uns alle am besten ist. Bitte lass mich diesen Frauen keinen schlechten Rat geben. Leite uns, damit wir uns von unseren Feinden nicht unterkriegen lassen.
„Emma?“ Victoria berührte ihren Arm. Das sanfte Einvernehmen, das sich in dieser Berührung ausdrückte, beruhigte und tröstete sie. „Wir sind so weit.“
Emma nickte und lächelte ihre Freundin an. Dann stieß sie sich von der Wand ab und zog ihr blaues Jackett glatt, das sie immer trug, wenn sie eine gewisse Autorität ausstrahlen wollte. Sie trat an das kleine Pult, das der reisende Prediger nutzte, wenn er sonntags die Predigt hielt. Wenn es doch am kommenden Sonntag diese Stadt noch geben würde!
Alle im Raum wurden still.
Emma räusperte sich. „Danke, Frauen von Harpers Station, dass ihr so kurzfristig zusammenkommen konntet. Wir haben etwas sehr Wichtiges zu besprechen.“
Sie sah in die vertrauten Gesichter, manche nervös, andere neugierig, einige vorwurfsvoll, als wäre diese dringende Angelegenheit Emmas Schuld. Schnell blickte Emma wieder zurück zu ihren Tanten. Henry nickte ihr zu und ihre Augen funkelten vor Vertrauen. Bertie lächelte nur, doch diese Regung kam sichtlich aus tiefstem Herzen, sodass Emma sich sofort gestärkt fühlte.
„Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon wisst, dass heute Morgen ein dritter Zettel gefunden wurde. Der Schreiber der Nachricht hat seine Drohungen konkretisiert und uns ein Ultimatum gesetzt. Wir sollen noch heute von hier verschwinden.“
Lautes Gemurmel erhob sich, als die Frauen sich zueinander umwandten und ihre Fragen austauschten.
„Ladys, bitte.“ Emma hob ihre Stimme, um gehört zu werden. „Ich werde gleich alle eure Fragen beantworten. Aber zuerst will ich euch sagen, dass ihr nicht dazu gezwungen seid, hierzubleiben. Jede von euch muss für sich entscheiden, was am besten für sie ist. Und ihr sollt wissen, dass ich eure Entscheidungen annehmen werde, egal wie sie ausfallen.“ Sie blickte sich wieder um. „Jetzt, wo das geklärt ist, will ich euch sagen, dass wir immer noch keine Ahnung haben, wer der Mann ist, der hinter diesen Drohungen steckt. Miss Adams und ich haben uns mit dem Sheriff getroffen, als wir die erste Botschaft erhalten hatten.
Er hat sich damals in der direkten Umgebung umgeschaut, konnte aber keine verdächtigen Hinweise finden. Heute haben wir ihm wieder telegrafiert, genau wie vor einigen Tagen, als wir den zweiten Zettel gefunden hatten. Aufgrund der gehäuften Viehdiebstähle im südlichen Teil des Baylor Countys kann er uns keinen Schutz schicken. Er hat aber noch einmal darauf hingewiesen, dass es sicherer für uns wäre, unsere Sachen zu packen und von hier wegzugehen. Dass wir uns vor der Gefahr in Sicherheit bringen und nach Seymour oder Wichita Falls ziehen sollen oder zurück nach Hause zu unseren Familien gehen müssen.“
„Aber ich habe keine Familie“, rief eine der Frauen von hinten. „Deshalb bin ich ja hierhergekommen.“
„Für mich gibt es nichts in Seymour“, rief eine andere. „Ich war schon dort. Ohne das Geld von Bettys Eierfarm könnte ich meine Kleinen nicht ernähren.“
Andere panische Stimme kamen hinzu und erfüllten den Raum mit Verzweiflung.
Eine Frau in braunem Kleid erhob sich. Flora Johnson, eines der neueren Mitglieder der Stadt, die sich mit anderen um den Garten kümmerte. Sie war vor etwa zwei Wochen mit blauem Auge und anderen körperlichen Verletzungen hier aufgetaucht. „Sie haben uns gesagt, dass wir hier sicher sind.“ Sie verschränkte die Arme vor der Brust. „Und jetzt sagen Sie uns, dass wir auf uns alleine gestellt sind? Dass der Sheriff keinen Finger rührt, um uns zu schützen?“ Sie sah sich im Raum um, der mittlerweile wieder still geworden war. „Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich habe erfahren, was einer Frau passiert, wenn sie einen Mann davon abzuhalten versucht, sich einfach zu nehmen, was er will. Es ist alles andere als angenehm. Wenn ich einen Ort hätte, an den ich gehen könnte, wäre ich schon am Packen.“ Sie wandte sich wieder nach vorn und zeigte anklagend auf Emma. „Sie können uns nicht beschützen, Miss Chandler. Das kann niemand.“
Mit pochendem Herzen, aber erhobenem Kinn sah Emma ihre Frauen an. „Sie haben recht, Flora. Ich kann Ihnen … keiner von Ihnen … versprechen, dass Sie hier sicher sind. Ich weiß nicht einmal, ob wir einen oder mehrere Widersacher haben. Es wird gefährlich werden hierzubleiben und es kann sein, dass jemand verletzt wird. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass ich hierbleiben und kämpfen werde.“ Sie ließ den Blick schweifen. „Harpers Station ist mein Traum und meine Verantwortung. Meine Tanten und ich lieben dieses Stück Land und ich werde mich nicht von meinem Grund und Boden vertreiben lassen. Wir haben mit Widerständen zu kämpfen, ganz ähnlich wie die mutigen Familien, die vor uns dieses Land besiedelt hatten. Sie mussten damals Überfälle und Angriffe der Comanchen abwehren. Einige starben. Einige gingen weg. Doch die meisten sind hiergeblieben und haben ihr Land verteidigt.
Und genau das werde auch ich tun.“ Sie nickte fest. „Ich werde standhalten und beschützen, was wir aufgebaut haben. Doch ich werde von keiner von euch verlangen, diesen Kampf mitzukämpfen. Jede von euch muss ganz allein für sich entscheiden … doch ich empfehle dringend, dass diejenigen von euch, die Kinder haben, anderswo Schutz suchen, wenn es möglich ist. Die Kleinen müssen beschützt werden. Und auch, wenn ihr vorübergehend weggeht, verspreche ich euch, dass ihr jederzeit zurückkehren könnt, wenn die Gefahr gebannt ist. Ihr werdet immer einen Platz hier in Harpers Station haben.“
„Es sei denn, Harpers Station existiert dann nicht mehr“, donnerte eine laute Männerstimme von draußen.
Emmas Blick fuhr zum Fenster zu ihrer Linken, wo ein Mann mit schwerem Ledermantel stand, ein dunkles Tuch verbarg sein Gesicht. Dann sah sie ein metallenes Blitzen.
„Alle auf den Boden!“, schrie Emma und sprang von der Stufe hinüber zu ihren Tanten. Sie riss die beiden mit sich zu Boden, als auch schon ein Schuss die Luft zerriss.
Übersetzt von Rebekka Jilg
Originaltitel: No other will do
326 Seiten, Buch, Paperback
Format: 13,5 x 20,5 cm
Bestellnummer: 331662
ISBN: 978-3-86827-662-6
Warum läßt Gott das zu? aus "Herold seines Kommens" E.A. Wilder-Smith
Der Ursprung des Bösen
Warum läßt Gott das Böse zu?
Was ist das Wesen der Liebe?
Was nun?
Der Ausweg Gottes
Ist das nicht ganz genau die Frage vieler Menschen heutzutage? Warum ist es so, wenn Gott allmächtig ist – und wenn Er Gott ist, muss Er eben so sein – warum bringt Er nicht all dieses Chaos zum Stillstand, all diese Kriege, all den Betrug, die Ungerechtigkeiten, das Elend und die Krankheiten in der Welt? Es ist so, wie mir vor Jahren ein Student sagte: „Wenn Sie wollen, dass ich an Ihren Gott glauben soll, erwarte ich zuallererst, dass Er eine bessere Welt erschafft!“
Falls Er uns Menschen liebt, wie uns die Bibel versichert, warum lässt Er nicht all das Elend verschwinden und bringt alles anständig in Ordnung? Weil Er sich nicht mehr um uns kümmert? – Wenn Er allmächtig wäre, könnte Er natürlich alles sofort ändern. Er wäre nicht länger Gott, wenn Er nicht allmächtig wäre, und wenn es sich so mit Ihm verhält, warum brauchen wir uns dann um Ihn zu bemühen? Gerade deshalb, weil Er es zulässt, dass das Böse neben dem Guten existiert, werden so viele zu Atheisten, wie es tatsächlich bei meinem Freund der Fall ist.
Wir sollten uns nicht verleiten lassen zu denken, dass solche Fragen besonders modern seien und dass wir sehr fortschrittliche Denker seien, wenn wir so fragen. Als nach dem Sündenfall Disteln und Dornen aus der Erde emporwuchsen, hätten Adam und Eva leicht dieselben Fragen stellen können. Warum ließ Gott all dieses zu? Liebt Er uns nicht mehr und sorgt Er nicht mehr für uns? Hiob stellte dieselbe Frage, als das Unheil über ihn und seine Familie hereinbrach. Er ist Gott, Er hätte es verhindern können, wenn Er gewollt hätte. Denn sicher muss Er allmächtig Sein, weil Er Gott ist, und muss es deshalb können. Wollte Er es noch? Sorgte Er noch für Hiob? Wenn nicht, warum sollte Hiob sich dann so lange um Ihn kümmern und Ihm dienen?
Zugegeben, es gab noch eine Menge Dinge in Adams und Hiobs Leben, die darauf hindeuteten, dass Gott sich doch noch um sie sorgte trotz Disteln und Dornen und Familienkatastrophen, aber es war kein klares Bild mehr vorhanden. Es gab nun Beweise für und gegen Gottes Liebe und Fürsorge, wenn man sich in der Umwelt des Menschen umsah. So erhob sich damals derselbe Widerspruch wie jetzt, und die Frage bleibt heute wie damals: „Warum soll man trotz aller gegenteiligen Beweise an einen guten Gott glauben und Ihm vertrauen?“
Um zu unserem ersten Gedankengang zurückzukehren, lautet die Frage: Wenn ein und dasselbe Wesen sowohl das Gute als auch das Böse, sowohl das Schöne als auch das Hässliche zulässt und plant, dann ist alles ernsthafte Denken über Ihn mit den uns gegebenen Denkfähigkeiten unmöglich.
Bevor wir fortfahren, lasst uns fragen, was die Bibel über den Stand dieser Dinge lehrt. Das erste Kapitel des Römerbriefes lehrt vollständig klar und kompromisslos, dass die Schöpfung überhaupt keine Widersprüche enthält, und gibt uns nur eine einzige Vorstellung von Gott, nämlich dass Er ein herrlicher, allmächtiger Schöpfer-Gott ist und dass Sein Universum nur Seinen Ruhm verkündet. „Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist Seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an Seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben“ (Römer 1,19.20).
Demnach lehrt also die Bibel, dass ein Mensch, der das Weltall betrachtet und nicht gleichzeitig die ewige Macht der herrlichen Gottheit sieht, der, wenn er das Sichtbare sieht, keine Rückschlüsse auf das Unsichtbare zieht, ohne Entschuldigung ist. Ja, die Bibel geht in dieser Richtung noch einen Schritt weiter, indem sie in demselben Kapitel (Römer 1,21) lehrt, dass ein Mensch, der Gott durch Seine so herrlich geschaffene Welt sieht und Ihm nicht dafür dankt und Ihn preist, überwältigt von den Wundern, die des Schöpfers Weisheit offenbaren, dass ein solcher Mensch seine Gedanken dem Nichtigen zuwendet und dass sein unverständiges Herz verfinstert wird. Das heißt, wenn ein Mensch das Weltall betrachtet und nicht von selbst vor Dank zu Gott überfließt und ein Gottesverehrer wird, dann wird dieser Mensch im Laufe der Zeit unfähig, seine höheren Fähigkeiten, wie etwa sein Denken, auf rechte Weise zu gebrauchen. Außerdem wird sein „Herz“ verfinstert, d. h. seine Sittlichkeit wird abgestumpft. Nach dem Maßstab der Heiligen Schrift sollte ein Blick auf das Universum für jeden Menschen von durchschnittlicher Intelligenz genügen, um von der Existenz Gottes überzeugt zu werden, und sollte ferner dazu ausreichen, aus ihm einen eifrigen Gottesverehrer zu machen.
Der Ursprung des Bösen
Stehen denn dem Glauben an den Gott der Bibel unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege? Vielleicht kann ein persönliches Erlebnis diese Fragen besser klären als weitere theoretische Erörterungen.
Vor dem zweiten Weltkrieg besichtigte ich oft den Kölner Dom. Dieses schöne gotische Bauwerk bewunderte ich besonders, manchmal stundenlang, mit den anmutigen emporstrebenden Pfeilern, dem prächtigen hochgewölbten Dach, den mittelalterlich bunten Glasfenstern und der Orgel. Je mehr ich diesen Bau bewunderte, desto mehr bewunderte ich auch die Baumeister und Maurer, die im Laufe von Jahrhunderten diesen schönen Dom entwarfen und erbauten. Denn all diese anmutigen Linien waren offenbar sorgfältig von Experten entworfen worden, die nicht nur die mathematischen Grundlagen solch eines Baues kannten, sondern auch einen hohen Schönheitssinn besaßen. Auch die Qualität dieser handwerklichen Kunst war wirklich erstklassig, abgesehen von der Schönheit der allgemeinen Konstruktion. So bewunderte ich unsere Vorfahren, als ich ihr Handwerk untersuchte. Wenn man bedenkt, dass sie keine modernen maschinellen Vorrichtungen besaßen, die ihre Arbeit erleichterten, muss man ihr damaliges Werk als ein Wunderwerk betrachten.
So zeigt die Struktur dieses Domes zweifellos etwas von dem Geist, der dahintersteckte. Sich vorzustellen, dass solch ein wohlbedachtes Gebäude so einfach entstanden wäre, ohne dem Geiste von Sachkennern entsprungen zu sein, hieße, am eigenen Verstand zu zweifeln.
Während des 2. Weltkrieges war Köln das Ziel von vielleicht mehr schweren Luftangriffen als jede andere Stadt in Westeuropa, und da der Dom direkt am Rangierbahnhof steht, der regelmäßig schwer bombardiert wurde, wurde er oft getroffen und viele Male schwer beschädigt.
Ich erinnere mich noch gut an die Enttäuschung, als ich den Dom im Herbst 1946 zum ersten Mal nach dem Kriege wiedersah. Die beiden berühmten Türme standen noch und ragten aus dem furchtbaren, unvorstellbaren Trümmerfeld empor. Außer dem Dom selbst war fast alles dem Erdboden gleichgemacht oder in Trümmer zerfallen. Von ferne sahen die Türme noch gut aus, aber wenn man sich ihnen näherte, sah man riesige Löcher in ihrem massiven Mauerwerk. Mehrere hundert Tonnen Beton und Ziegelsteine waren in ein Riesenloch hoch oben in einem Turm hineingebaut worden, um das Mauerwerk teilweise wieder zu ersetzen, das von einer Sprengbombe weggerissen worden war. Das Dach war in Trümmern, die Orgel zerstört, die Fenster herausgefallen, und überall lag knietief eine unbeschreibliche Masse von Trümmern, zerfetztem Holz, pulverisiertem Mauerwerk und riesigen Steinblöcken, die teilweise Bombenlöcher zudeckten.
Dieses drastische Bild machte einen tiefen Eindruck auf mich, als ich an die frühere Schönheit und Ordnung dieses Fleckchens Erde dachte. Aber während diese Gedanken durch meinen Kopf gingen, kam doch ein Gedanke nie in mir auf – nie verband ich irgendwie das Trümmerfeld dieses einst so schönen Gebäudes mit der Unfähigkeit oder einer Absicht der Architekten oder Handwerker, die es erbaut hatten. Ebenso wenig begann ich, an der Existenz dieser Baumeister zu zweifeln, weil ihr Werk nun vor meinen Augen in Trümmern lag. Man hätte wahrscheinlich lange Zeit angestrengt nachdenken müssen, um auf solch eine absurde Idee zu kommen. Fürwahr, selbst inmitten des allgemeinen Trümmerfeldes zeigten die Überreste, die auf die frühere Schönheit dieses Gebäudes hindeuteten, wie gut die Architekten alles geplant hatten. Die mächtigen aufstrebenden Pfeiler standen noch, die anmutigen gotischen Bogen waren noch da; sogar die Bombenlöcher im Mauerwerk machten es offenbar, wie gut die Architekten es entworfen und wie fachmännisch die Männer gebaut hatten, selbst an Stellen, die jahrhundertelang menschlichen Blicken entzogen waren. Bis in ihre innersten Teile zeigte die ganze Ruine gerade das Entgegengesetzte zu dem obigen absurden Gedanken und tat kund, wie gut das ganze Gebäude erdacht und konstruiert worden war. – Man könnte noch weitergehen und behaupten, dass der zerstörte Bau in gewisser Hinsicht noch besser als das unversehrte Gebäude die Vollkommenheit der Planung und Konstruktion zeigte. Das war kein mit Stuck versehenes Gebäude, außen fein, aber innen, wo niemand normalerweise hinsehen konnte, ganz minderwertig, wie bei vielen modernen Gebäuden.
Sehr wahrscheinlich würde niemand die Architekten beschuldigen, eine Ruine gebaut zu haben. Ganz offenbar war der Dom nie als eine solche geplant – dies würde auch nicht zu der Tatsache passen, dass er jetzt eine Ruine ist. Es war im allgemeinen leicht, zwischen dem zu unterscheiden, was Ruine und was geplant war.
Obwohl der Dom gleichzeitig Vollkommenheit und Zerfall zeigte und ein gemischtes Bild darbot, hätte diese Tatsache doch nie zur Entstehung der beiden folgenden Gedanken geführt,
1. dass, weil der Dom eine Ruine, eine Mischung von Chaos und Ordnung war, kein erfinderischer Geist, kein Architekt dahinter stand,
2. dass, weil das Gebäude ein Gemisch von Zerfall und Ordnung war, man nicht mehr hoffen konnte, irgendwelche charakteristischen Merkmale des dahinterstehenden Geistes zu erkennen.
Der zerbombte Dom erinnert mich oft an den Zustand der Schöpfung, wie wir sie heute sehen, wahrlich ein gemischtes Bild, ein Durcheinander von Ordnung und Chaos, Schönheit und Hässlichkeit, Liebe und Hass, alles unentwirrbar miteinander verzahnt. Aber an diesem Punkt sei daran erinnert, wie unlogisch es wäre, automatisch daraus zu folgern,
1. deshalb stehe hinter dem Gebäude der Schöpfung kein Geist, kein Schöpfer. Und doch ist genau dies die Einstellung unseres Atheisten, wie oben ausgeführt wurde. Wir erinnern uns, dass der Atheist sagte, er sehe nichts als Widersprüche, und er schließe deshalb den für ihn verwirrenden Gottesbegriff ganz aus seiner Gedankenwelt aus.
2. deshalb könne man keinerlei charakteristischen Merkmale des hinter der Natur stehenden Geistes erkennen.
Im Allgemeinen ist es ziemlich leicht, zwischen dem Plan und der dazwischengetretenen Unordnung zu unterscheiden, auch in der Natur. In einem Trümmerfeld erkennt man oft die wirklichen Absichten des dahinterstehenden Erbauers noch besser als in dem unbeschädigten Gebäude. Zum Beispiel hat das Studium der Krebszellen („ruinierte“ Zellen jenes „Körper“ genannten Gebäudes) viele unvermutete Geheimnisse über den Aufbau und die Struktur der gesunden Körperzellen zu Tage gebracht, die auf andere Weise nicht so leicht entdeckt worden wären. Also, obwohl die Schöpfung ein (aus Gut und Böse) gemischtes Bild darbietet, ist es unhaltbar, daraus zu schließen, dass deshalb kein Schöpfer existiere und keine Eigenschaften Seines Geistes in ihr zu sehen seien. Oft zeigt das zerstörte Gebäude diese Eigenschaften besser als der unbeschädigte Bau. Der „Schaden“ in der Schöpfung bringt oft die charakteristischen Eigenschaften des dahinterstehenden Geistes besser ans Tageslicht als ihr ursprünglicher Zustand.
Und doch behaupten die Atheisten und Agnostiker, dass man durch den Blick ins Weltall nichts über den Geist des Schöpfers erfahren könne, angeblich größtenteils wegen des aus Gut und Böse, Ordnung und Unordnung bestehenden Bildes, das das Universum darstellt. Aber dass diese Einstellung unlogisch ist, tritt deutlich zu Tage. Römer 1 lehrt auch die Unhaltbarkeit dieser These. Ja, die Bibel lehrt in demselben Kapitel, dass Krankheit, Tod, Hass und Hässlichkeit alles äußere Zeichen eines Zustandes der „Unordnung“ sind, und dass sie sich ziemlich leicht von Gesundheit, Leben, Liebe und Schönheit, dem ursprünglichen, unbeschädigten Zustand, unterscheiden lassen.
Also ist die Lehre von Römer 1, dass die Schöpfung, sogar die gefallene oder „zerstörte“ Schöpfung, genug von Gott offenbart, um jeden ehrlich denkenden Menschen zu Dank und Anbetung zu veranlassen, zweifellos nicht unlogisch, sondern vielmehr eine wahre Darstellung der gegebenen Tatsachen.
Warum lässt Gott das Böse zu?
Natürlich sind alle Veranschaulichungen und Gleichnisse in der Art, wie sie bisher gebracht wurden, unvollständig, und unser Dom ist keine Ausnahme. Eine Unvollständigkeit in unserer Darstellung liegt natürlich darin, dass die Erbauer des Doms seit langem tot sind und nicht die Bombardierung ihres Meisterwerkes verhindern konnten. Gott ist nicht tot, wie wir voraussetzen. Deshalb taucht jetzt die Frage auf, warum ein allmächtiger Gott, der, wie wir annehmen, Sein Meisterwerk, die Schöpfung, liebt, nicht die „Bombardierung“ Seines Meisterwerkes verhindern konnte. Hier kann uns natürlich unser Gleichnis vom Kölner Dom nicht mehr helfen.
Fragen dieser Art „Warum gebietet Gott diesem nicht Einhalt?“ tauchen gewöhnlich dann auf, wenn der Fragende sich nicht die Mühe gemacht hat, genau zu überlegen, wie die Liebe Gottes beschaffen ist. Wenn man genau überlegt, was die Liebe ist, löst sich das Problem meist ganz schnell von selbst, und zwar auf eine Weise, die den Verstand durchaus zufriedenstellt. Deshalb wollen wir uns sogleich folgende Frage stellen:
Was ist das Wesen der Liebe?
Die Liebe des Sohnes Gottes, Jesus Christus, zu uns Menschen wird oft mit der Liebe verglichen, die ein junger Mann für seine Braut empfindet. Christus bezeichnet sich wiederholt als der Bräutigam und die Gemeinde als Seine Braut.
Wie begann die Liebe zwischen Braut und Bräutigam? Eines schönen Tages sah der junge Mann das Mädchen und empfand eine Zuneigung zu ihr, die sich besser erleben als beschreiben lässt. Zuerst mag die junge Dame seine Zuneigung nicht bemerkt haben, bis zu dem Augenblick, da er begann, sie zu umwerben, vielleicht, indem er ihr Blumen schickte, oder auf eine andere Weise. Eine brennende Frage möchte der junge Mann in diesem Zustand vor allen anderen Fragen beantwortet haben: Wird meine Zuneigung von ihr erwidert?
Aber um Liebe zu wecken und erwidern zu können, muss ganz sicher Folgendes beachtet werden: Der junge Mann muss und wird das junge Mädchen umwerben. Sobald jedoch an die Stelle des Werbens Zwang tritt, hören Freude und Liebe auf, und an ihre Stelle treten oft Hass und Leid. Ihrem ganzen Wesen nach beruht die Liebe auf der freien gegenseitigen Zustimmung, verbunden mit absoluter Achtung des freien Willens des Partners. Anders ausgedrückt, die Grundlage für die Liebe ist die Freiheit zu lieben, gegenseitige Einwilligung, die absolute Freiwilligkeit bei beiden Partnern, sich ihrer gegenseitigen Zuneigung zu versichern. Ohne diese Freiheit ist wahre Liebe unmöglich.
Nun überlege einmal einen wichtigen Punkt in Form einer Frage. Was würde geschehen, wenn Gott den Menschen so geschaffen hätte, dass er keine eigene sittliche Entscheidung treffen, sondern nur automatisch Gottes Willen tun könnte, gerade so, wie wenn sich ein Schloss öffnet, wenn man den richtigen Schlüssel hineinsteckt? Oder gerade so, wie ein Verkaufsautomat einen Riegel Schokolade liefert, wenn man den richtigen Geldbetrag hineinsteckt. Wenn der Mensch so beschaffen wäre, dass er Liebe gäbe, wenn Gott den richtigen Knopf drückte, wäre das dann tatsächlich Liebe? Um unserer Liebe sicher zu sein, muss Gott uns die freie Willensentscheidung zum Lieben oder Nichtlieben, unserem Wunsch gemäß, gestatten; dies liegt notwendigerweise dem Wesen der Liebe – und in der Tat auch jeder anderen Tugend – zugrunde. Gewöhnlich schieben gerade die Menschen, die nicht viel über das Wesen der Liebe nachgedacht haben, Gott so gern die Rolle des Diktators zu und meinen, Er würde auch in unseren Tagen brutale Gewalt ausüben.
Als Gott die himmlische Welt und die Engel erschuf, wollte Er damit das Allerbeste erschaffen und gründete deshalb ein Reich der Liebe und der Tugend. Aber um dies zu verwirklichen, musste Er den Einwohnern echte Freiheit garantieren, was Er auch tat. Die Engel und ihr Oberster, Luzifer, erhielten einen Charakter, der sie zu echter Liebe zu ihrem Schöpfer und ihren Gefährten befähigte. Sie hatten damit die Möglichkeit, echte Liebe auszuüben, um Liebe zu werben und mit Liebe umworben zu werden, was natürlich auch die entsprechenden entgegengesetzten Möglichkeiten mit einschließt, – die Möglichkeit, all dies abzulehnen. Die Bibel berichtet es als eine Tatsache, dass ein großer Teil der Engel ihrem Obersten, Luzifer, folgte, als er sich in Willensfreiheit entschloss, nicht zu lieben und dem Liebeswerben des Schöpfers den Rücken zu kehren. Dadurch, dass sie sich Ihm, dem einigen und alleinigen Gott, verschlossen, wurden sie natürlich böse, lieblos und fielen dem Verdammungsurteil anheim.
Also zeigt das bloße Vorhandensein des Bösen in einer Welt, die von einem allmächtigen Gott geschaffen wurde, dass das Gute und die Tugend an sich wirklich echt sind und dass die Liebe an sich wirklich Liebe ist und nichts anderes – wie manchmal gelehrt wird („Liebe ist eine versteckte Form des Egoismus“). Das bloße Vorhandensein des Bösen in der Welt eines allmächtigen Gottes ist in der Tat ein guter Beweis, dass Gott wirklich Liebe ist.
Nachdem Luzifer, der Oberste der Engel, sich für das Böse entschieden hatte, wollte er missionarisch tätig sein und suchte Gefährten für sich zu gewinnen, indem er andere dazu veranlasste, denselben Weg einzuschlagen. Deshalb ging er zu Adam und Eva, die auch mit einem zur Liebe fähigen Charakter erschaffen worden waren und deshalb frei wählen konnten. Es ergab sich, dass auch sie eine falsche Wahl trafen. Weil sie dem alleinigen Gott den Rücken kehrten, wurden sie böse und brachten Sünde und Leid in die Schöpfung hinein.
Zeigt all dies nicht, wie hoch Gott die Menschen achtet? Er nimmt uns selbst, unsere Entscheidungen und unsere Liebe wirklich ernst genug, um darum zu werben, was wiederum das Wesen Seiner Liebe offenbart. Denn wahre Liebe achtet und respektiert immer den Partner, um den sie wirbt. Dies erklärt auch, warum Gott die Menschen durch „törichte Predigt“ ruft und sucht und nicht dadurch, dass Er uns mächtige Engel oder Geisteserscheinungen von anderen Welten schickt. Er wendet im Allgemeinen keine Methode an, die die Menschen dazu zwingen würde, Seine Liebe anzunehmen; denn niemand kann zu der Liebe zwingen, die von Gott gesucht wird.
Zusammenfassend können wir sagen, dass Gott es zuließ, dass das Universum „bombardiert“ wurde (um das Bild vom Kölner Dom wiederum zu gebrauchen), weil der Plan für eine Welt, die zu echter Liebe und Tugend fähig ist, dieses Risiko mit einschließt, der Plan, ein Reich der Liebe, ein Reich der völligen Freiheit zu errichten. Ohne diese Möglichkeit freier Willensentscheidung kann man eben gerade das Beste überhaupt nicht erreichen.
Was nun?
Die Bibel sagt, dass Gott in Seiner Allwissenheit natürlich schon über alles Bescheid wusste, sogar bevor der Mensch und die Engel die falsche Wahl getroffen hatten, und dass Er für diesen Fall sogar schon sorgfältige Vorkehrungen getroffen hatte. Diese Tatsache, dass Gott den Sündenfall deutlich vorausgesehen hatte, lange bevor er stattfand, ist für viele zu einem Stein des Anstoßes geworden. In Wirklichkeit sind hier aber nur wenig intellektuelle Schwierigkeiten, wenn man die Sache sorgfältig betrachtet, und zwar aus folgenden Gründen:
Wenn ich einen Menschen eine Zeit lang sehr genau beobachte, kann ich kleine Wesenseigentümlichkeiten an ihm feststellen. Er sagt zum Beispiel jedes Mal „Ah“ bevor er ein schwieriges Wort ausspricht. Oder er kneift die Augenbrauen zusammen, bevor er einen netten Witz erzählt. Im Laufe der Zeit kann ich auf Grund meiner vorhergehenden Beobachtungen voraussagen, was er gleich tun wird, noch bevor er es wirklich tut.
Aber meine Fähigkeit, das vorauszusagen, was er tun wird, macht mich keineswegs für sein Tun verantwortlich. Ebenso macht die Tatsache, dass Gott voraussehen konnte, was Adam und Eva und das Menschengeschlecht überhaupt tun würden, Ihn nicht notwendigerweise dafür verantwortlich, besonders darum nicht, weil Er ihnen ausdrücklich den freien Willen gegeben hat. Gott sah den Sündenfall der Engel und der Menschen voraus und war sogar schon vor der Erschaffung der Welt dazu bereit, Seinen Sohn als Opfer für die Sünde zu senden. Jedoch meinen viele, dass dieses Vorherwissen Gott notwendigerweise in die Schuld des Sündenfalles mit hineinverwickeln muss. Wie wir sahen, macht Ihn jedoch das Vorherwissen keineswegs für den Sündenfall verantwortlich, und doch bilden es sich viele ein. Ganz im Gegenteil, die echte Möglichkeit der freien Willensentscheidung, die Er uns verliehen hat, damit wir lieben und uns in wahrer Tugend üben können, entscheidet, dass die Geschöpfe schuldig sind und der Schöpfer unschuldig ist.
Viele werden sich an dieser Stelle fragen, warum denn Gott überhaupt die Engel, den Menschen und die Welt erschuf, obwohl Er das Chaos voraussah, das der Möglichkeit zur freien Willensentscheidung folgen würde, wo Er doch all den Hass, das Elend und den Kummer voraussah. War das nicht ziemlich schadenfroh, so zu handeln, obwohl Er die Folgen kannte? Wäre es nicht besser gewesen, dies alles ungeschehen sein zu lassen angesichts dieses kommenden Unheils? – Im Prinzip erheben sich dieselben Fragen in unserem eigenen Leben, zum Beispiel in der Ehe. Bei der Trauung wissen wir, dass wir einmal den Schmerz der Trennung durch den Tod erleben werden. Und doch nehmen wir all diesen Kummer und das Herzeleid auf uns, von dem wir wissen, dass es kommen wird, – weil wir glauben, dass die Freude der Liebe und die Bereicherung des Lebens, die dadurch entsteht, dass wir uns dem Geliebten zur Verfügung stellen – sei es auch nur für einen Tag (und vierzig oder fünfzig Jahre gehen dahin wie ein Tag) –, besser ist als überhaupt keine Liebe.
Augenscheinlich denkt der Schöpfer, der die Liebe in Person ist, ebenso, denn Er erschuf uns tatsächlich trotz allem und wagte den gewaltigen Versuch, weil Er davon überzeugt war, dass die Wärme der Liebe die Bitterkeit des Leidens weit übertrifft. Liebe für einen Tag ist unendlich mehr wert als überhaupt keine Liebe, und wo Leben ist, ist Gelegenheit zur Liebe vorhanden. Außerdem währen Anfechtungen und Leid hier auf Erden nur eine kurze Zeit, während die Wesensveränderung derer, die durch Leiden vollkommen gemacht werden, ewig währt.
Der Ausweg Gottes
Aber was kommt nun, nachdem der Sündenfall stattgefunden hat und die Sünde in die Welt gekommen ist? Was tut der Gott, der die Liebe in Person ist? Lasst uns die Frage auf eine andere Art stellen. Was tut ein Mensch, der einen anderen sehr lieb hat, der missverstanden und abgewiesen wurde? Die Bibel sagt: „... die Liebe ist langmütig und freundlich ... sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu ... sie verträgt alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf“ (1. Korinther 13,4-8). Gott sah die falsche Willensentscheidung, die Chaos und Verderben in die Welt brachte, lange voraus, und als es dann so weit kam, brauste Er nicht auf und vernichtete alles auf der Stelle, wie viele es erwartet hätten, die selber so handeln, wenn ihnen etwas Ungehöriges oder Unrechtes zustößt. Er versuchte vielmehr durch Seine liebevolle Geduld zu retten, was Er aus dem furchtbaren Verderben retten konnte. Er hat in Treue und mit großem Ernst Menschen und Engel vor den Folgen einer falschen Entscheidung gewarnt, aber Er versperrte sich natürlich nicht selbst den Weg zu unseren Herzen, indem Er versuchte, uns zurückzuzwingen. Dies hätte bedeutet, dass die Möglichkeit zu echter Liebe für immer ausgeschaltet worden wäre. Er versuchte stets in Langmut und Geduld, uns wieder zur Liebe und zur Vernunft zu bringen. Dieser Versuch erreichte seinen Höhepunkt, als Er Seinen Sohn sandte, der freiwillig Sein Leben für uns alle opferte. Denn der Sohn ging freiwillig und aus eigener Entscheidung in den Tod. Er versuchte nicht einmal, sich zu verteidigen, sondern kam, wie Er selbst sagte, um für die Sünde vieler zu sterben.
Jetzt wartet Er und wirbt um uns in der Hoffnung, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen: „Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Timotheus 2,4). „Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre“ (2. Petrus 3,9). Das ist so gemeint, wie es dasteht, und schließt nicht notwendigerweise ein, dass sich tatsächlich alle Menschen zur Buße kehren werden. Gott aber ist bereit und willens, alle anzunehmen, die sich von ihren eigenen Wegen abwenden und zu Ihm bekehren.
Ein Leben für Gustav Adolf, Anny Wienbruch

Das schwedische Rätsel
»Sie fährt in Kleeburg ein wie eine Prinzessin«, sagte mein lieber Vater stolz. »Wie eine Prinzessin aus dem Schneekönigreich«, fügte meine poetisch angehauchte Mama lachend hinzu. Ich thronte mit einem weißen Pelzkäppchen, einem weißen Muff und weißem Mantel in einem weißen Wagen. Wir waren von der Landstraße links abgebogen, und nun ging es durch einen weißen Winterwald zu Tal dem langgestreckten Dorf unten zu.
Doch ich kam nicht aus einem Schneekönigreich, sondern aus meiner etwa 7 Kilometer entfernten Heimatstadt Weißenburg, und eine Prinzessin war ich durchaus nicht, sondern ein kleines dreijähriges Mädchen, das allerdings auf seine weißen Weihnachtsgeschenke sehr stolz war, besonders auf den großen zweisitzigen Sportwagen, den Patenonkel Heinrich geschenkt hatte und den meine Eltern abwechselnd oder gemeinsam fröhlich schoben. Sie und noch weniger ich winziges Ding hatten eine Ahnung, daß wirklich einmal vor etwa dreihundert Jahren eine wirkliche Prinzessin aus dem Schneekönigreich diesen Weg gefahren und in Kleeburg Einzug gehalten hatte.
Auch als ich heranwuchs, wußte ich nichts von solch einem Ereignis, dachte auch gar nicht daran, und niemand redete zu mir davon, obwohl mir Kleeburg so vertraut wurde, als wenn ich darin aufgewachsen wäre.
Wie viele Sonntage verlebte ich dort, wie viele Ferientage in jener Zeit, da man nicht wer weiß wie weite Urlaubsreisen unternahm, sondern noch dem Vers Goethes folgte: »Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.«
Das Ziel meiner Kleeburger Fahrten oder Wanderungen war nicht eines der behäbigen Bauernhäuser an der langen Dorfstraße, die mit ihrem weißgetünchten Fachwerk, dem braunen Gebälk, dem üppigen Geraniumschmuck vor den Fenstern und den sie umrankenden
Reben einander so ähnlich sahen, daß ich schon in der Eile anstatt in Haurys Hoftor »ins Rubys« oder »ins Jackys« gelaufen war. Die Besitzer konnten wohl so stolz auf ihr Anwesen sein wie ein Fürst auf sein Schloß und Land. Aber Prinzessinnen, nein, die vermutete man in keinem dieser Häuser.
Meine Ferienheimat lag abseits dieser Reihe von Wohlhabenheit zeugenden Höfen. Ein steiniges, holperiges Gäßlein nahe der alten Kirche führte rechts »ins krumme Eck«, zu dem Häusel, wo meine Tante Kättel Ruffy wohnte. Es war wirklich nur ein Häusel, nicht zwei- bis zweieinhalbgeschoßig wie die andern drunten an der Straße. Und sein einziges Stockwerk schien aus lauter gebogenen, verbogenen Wänden und einem ebenso drollig geschweiften Dach zu bestehen.
Aber dies kleine Häusel täuschte wie das kleine Kättel, das darin hauste: auswendig schien sie so unscheinbar, winzig, hinfällig. Aber welch starker Glaube, welche Klugheit, ja Weisheit, Mutterwitz, Humor verbarg sich in dem so klitzekleinen Kättel, die der Pfarrer selber als die »große Beterin« des Dorfes bezeichnete.
Und welches Behagen, welche wertvolle Einrichtung umschlossen die beiden großen Stuben rechts und links von der Haustür mit je zwei Alkoven (Bettnischen), an die sich noch zwei Kammern anschlossen. Ich schlief immer in dem Zimmer an der rechten Seite in dem Alkoven, dessen Seitenfenster mit Reben umrankt waren, deren süße goldgelbe Trauben Kättel jedes Jahr für mich zum Pflükken aufhob. Ich schaute von meinem Bett aus durch das Rankwerk zu einem wuchtigen grauen Gebäude jenseits des Stolperpfädleins. Es schien im Gegensatz zu dem Häusel aus lauter unerschütterlichen Granitbrocken aufgetürmt zu sein.
»Was ist das eigentlich?« fragte ich an einem Ferienmorgen. »Gehört das dir auch?«
Kättel machte gerade mein Bett, mit dessen Riesenfederbergen ich nicht fertig werden konnte, obwohl ich schon fast erwachsen war, schon das Lehrerinnenseminar besuchte. »Hm«, sagte sie. »Ist der Weinkeller. «
»Was hebst du darin auf? Du hast doch keinen Wein«, forschte ich weiter.
»Meine Kleinode«, scherzte sie.
»Aha«, lachte ich zurück, »so wie in deinem Wunderschrank.«
Dabei warf ich wieder mal einen sehnsüchtigen Blick durch die geöffneten Türen über den schmalen Hausflur in das andere Zimmer hinüber. Ich schaute geradewegs auf diesen »Wunderschrank«.
Er war wirklich zum Wundern, Verwundern und Bewundern. Er war ein Ungetüm, aber ein prächtiges, staunenswertes. Man hätte darin Kättels winzige Küche, die am Ende des Flurs lag, bequem unterbringen können und erst recht unsere heutigen modernen Kochnischen. In ein Zimmer einer städtischen Durchschnittswohnung würde er gar nicht hineinpassen. Wunderschön war dieser Wunderschrank auch. Er hatte gar keine Schnitzereien und Ornamente aufzuweisen. Er war ohne Verzierungen von Menschenhand einfach an sich vollkommen. Das honigfarbene glatte Holz seiner beiden Flügel, die Scharniere und das Schloß aus uraltem goldartigem Metall glänzten.
Mächtig, mich geradezu beeindruckend, beherrschend stand dieser Riese da. Barg er nicht auch Wunderbares? Kättel hatte mich noch nie hineinschauen lassen. Ihr »Getüch« (Leinen) bewahrte sie in der Wohnkammer auf.
»Was hast du eigentlich in diesem Wunderschrank?« wagte ich auch an jenem Morgen, wie schon oft, zu fragen. Und wieder antwortete Kättel mit ihrem schelmischen Lächeln. »Eh, allerlei Wunder. Demnächst zeig ich dir was davon.«
»Das versprichst du immer«, murrte ich, »was man verspricht, muß man auch halten. «
»Ist ja nix als altes Dings! Stell dir nit zu viel vor! Es ist uraltes Dings, wovon du doch nichts verstehst. Ist aber auch wiederum etwas Kostbares, je nach dem, der's versteht.«
Das waren zwar Worte, die wenig verständlich waren. Ich nahm in meiner jugendlichen Überheblichkeit jedoch an, daß ich nun im Bilde war.
»Ach«, sagte ich, »jetzt weiß ich's. In den Dörfern rings um Weißenburg, wo man noch wenigstens am Pfingstmontag zum Festzug
Tracht trägt, da heben sie diese Kleidung von Urururgroßmüttern auf. Die vererbt sich von einer Generation zur andern. Zu unserer Schulfeier hab ich mir von Rubys in Hunspach die Kindertracht mit der Rüsche überm Kopf >gelehnt<, und die Liesel die der jungen Mädchen mit der Schleife. Ha, das war eine Pracht, als die Gret die dicken schweren Seidenschürzen und Tücher zeigte. So was gibt's jetzt nicht mehr. Das hält hunderte von Jahren.«
»Na, so weißt du's halt«, schmunzelte Kättel.
»Aber in Kleeburg gibt's ja gar keine Tracht«, fiel mir ein. »Oder? Was hast du denn im Schrank?«
>;Wart's halt ab!« antwortete Kättel ungerührt. »Jetzt hab ich noch keine Zeit dazu. Vielleicht ist's noch kostbarer!«
Ich wußte, daß Kättel sich nie drängen ließ, so lieb sie auch war. Ich mußte halt warten.
Dicht unter meinem Fenster erklangen jetzt Kinderstimmen. Unten an der Straße, wo das Holpergäßchen rüber zum krummen Eck führte, war die Schule, und der Hof dahinter reichte bis an Kättels Haus. Auf dem Land hatten sie andere Ferien als wir in der Stadt. Es war Pause. Die Mädchen spielten Kreis und sangen.
Da hatte ich schon wieder eine Frage bereit: »Was singen die da?
Wir sind die Schwedenbauern, bekannt im ganzen Land, kaputt sind Schloß und Mauern, ist das nicht allerhand?
Warum Schwedenbauern?«
»Ei, so heißen wir halt im Unterland«, erklärte Kättel gleichmütig.
»Hast du nicht gesagt, alle, deren Familiennamen mit y endet, wären aus der Schweiz eingewandert, die Ruffy, Ruby, Jacky und all die andern? Da müßtet ihr doch Schweizerbauern heißen; warum Schwedenbauern?«
»Ach, du liebe Zeit«, klagte Kättel, »was hast du heut wieder eine Fragerei. Ist am End eine Verwechslung.«
»Warum seid ihr denn aus der Schweiz hierhergekommen?« gab ich meine Fragerei nicht auf.
Kättel hatte wieder ihr humorvolles Lächeln. »Am End hat man uns
eingeladen. Ich war halt nach dem großen Krieg vor mehr als zweihundert Jahren noch nicht dabei. So alt bin ich halt auch noch nicht. «
»Vielleicht sollten deine Vorfahren hier wieder aufbauen, urbar machen«, ließ ich die Weisheit meiner siebzehn Jahre leuchten. »Ob euch der französische König eingeladen hat?«
»Gewiß nicht«, meinte sie, »hier war's damals noch nicht französisch. Es waren auch Evangelische, und der französische Louis hätt solche nicht gewollt.« Sie schmunzelte wieder.
»Am End war's der schwedische König«, schlug ich vor.
»Was bist du ein kluges Maidel«, lobte sie spöttisch. »Ich glaub als, der wohnt ein bissel arg weit von hier.«
Ich spürte, daß ich einen heißen Kopf bekam. So dumme Einfälle zu haben! Doch ich hatte an jenem Tag meine Fragekrankheit, wie Kättel es mit dem lustigen Blinken ihrer blanken Kastanien-Augen bezeichnete.
Am Nachmittag bestimmte sie in ihrer diktatorischen Art, die bei ihrer schelmischen Liebenswürdigkeit keinen Widerspruch aufkommen ließ: »Wir machen nachher beim Lenel im Schloß einen Krankenbesuch. Du mußt natürlich mitgehen. Du hast halt ein Mundwerk wie deine Mama, tust es bloß nicht so gern auf. Aber wenn du willst, kannst du die nettesten Späßle erzählen, wenn siemit Verlaub zu sagen - auch zuweilen geschwindelt sind.«
Ins Schloß! Natürlich kannte ich den ansehnlichen Bauernhof, der etwas hinter Bäumen versteckt und ein wenig abseits der Straße und des Platzes um die große Linde inmitten des Dorfes lag. Aber warum hieß dieses Anwesen eigentlich Schloß? Ich hatte mir als Kind keine Gedanken darüber gemacht, hatte den wohlbekannten Namen einfach nachgeplappert. Doch nun fragte ich danach.
Kättel zuckte die Achseln. »Ich hab noch keinen König drin gesehen«, scherzte sie, »nur Bauersleut.«
Ich krauste die Stirn, überlegte. »Eigentlich sieht es aber nicht so recht wie ein Bauernhaus aus«, meinte ich. »Die breite Doppeltreppe außen, die weiten Flure und Gänge, die Kamine mit den halb zerbröckelten Verzierungen, die hohen Fenster. Ein Fach
ISBN:9783501010488
Format:13,5 x 20,5 cm
Seiten:200
Gewicht:270 g
Verlag:Johannis Druckerei
Erschienen:1974
Einband:Paperback
Witt Dietrich, Der ewig reiche Gott 1
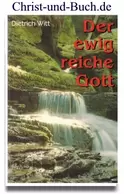
Gleichnis vom Sämann (Mt 13, 3-23)
1 ». das ist der, bei dem auf den Weg ges/fr ist« (V. 19)
Ein Bauemknecht kam eines Soimtagvornüttags aus der Kirche und erzählte bei Tisch seinem Herrn, der an jenem Morgen vom Kirchgang abgehalten gewesen war, wie schön der Pastor gepredigt habe. »Über welches Wort hat der Pastor denn gepredigt?« fragte der Bauer, dem es daran lag, auf diese Weise noch einen Segen zu bekommen.
»Das habe ich vergessen«, gab der Knecht zur Antwort.
»Was war denn der Schluß der Predigt?« war die weitere Frage des Hausherrn.
»Ach, den habe ich nicht mehr gehört, ich mußte vor Schluß schon die Kirche verlassen«, sagte der Knecht.
»Wovon hat der Pastor in der Predigt denn hauptsächlich gesprochen?« fragte der Mann noch einmal.
»Das kann ich nicht sagen«, erwiderte der schlechte Hörer des Wortes, »denn ich war so müde, daß ich nicht alles gehört habe.«
2 »... da kamen die Vögel und fraßen's auf« (V. 4)
Als Moody, der gesegnete amerikanische Evangelist, in Irland Versammlungen hielt, hatte er großen
Zulauf. Auch ein junger Mann hatte ihn gehört und war aufs tiefste ergriffen worden. Am Tag darauf suchte ein älterer Mitarbeiter ihn zu sofortiger Übergabe an den Herrn zu bewegen, und der junge Mann war auch von der Notwendigkeit völlig überzeugt. Im selben Augenblick aber kam die Tochter des Arbeitgebers hinzu und zog die Bekehrung ins Lächerliche und zählte Fromme auf, die nicht ihrem Bekenntnis gemäß lebten. Diese spöttischen Bemerkungen beeinflußten den jungen Mann leider derartig, daß er sich nicht mehr zur Übergabe seines Lebens an Jesus entschließen konnte. Und er war dem Reich Gottes doch so nahe gewesen!
Das Erschütterndste dieser Geschichte: Es war seine letzte Gelegenheit gewesen, sich für Jesus zu entscheiden, denn nur eine knappe Woche nach diesen Ereignissen fand ihn seine Frau morgens tot im Bett.
3 ». . die Sorge der Welt« (V. 22)
Ein gläubiger Mann bezeugte einst den Heiland vor dem Direktor einer chemischen Fabrik. »Nein«, sagte der Direktor, »ich habe eine unheilbar kranke Frau und zwei große Prozesse schweben, in denen für mich viel auf dem Spiel steht. Wenn Gott machen könnte, daß meine Frau gesund wird und daß ich die Prozesse gewinne, dann will ich an ihn glauben.«
Nach einiger Zeit traf der Mann den Direktor wieder. »Denken Sie nur«, sagte er, »meine Frau ist gar nicht unheilbar krank, wie sich jetzt herausgestellt hat, und den einen Prozeß habe ich auch gewonnen, seit wir uns sahen.« - »Nun«, antwortete der Gottesmann, »dann hat Gott ja getan, was Sie gefordert haben. Wollen Sie jetzt zu Jesus kommen?« - »Nein«, lautete die Antwort, »jetzt habe ich Wichtigeres zu tun!«
Gleichnis vom Senfkorn (Mt 13, 31. 32)
4 »Das kleinste unter allen Samenkörnern« (V. 32) Vor Jahren überredete eine unbemittelte Näherin. einen Jungen, zur Sonntagsschule zu gehen. Dieser Junge bekehrte sich. Seinem späteren Einfluß war es zuzuschreiben, daß die Mission unter den Telu-gus ins Leben gerufen wurde, durch deren Arbeit viele Tausende von Ungläubigen den Heiland gefunden haben.
Die arme, kranke Nähern, die bald darauf starb, und der kleine Junge, der ihrer Einladung zur Sonntagsschule folgte, waren ein Senfkom, aus dem jener große, früchtereiche Baum der vielen Heidenchristen heranwuchs.
5
Ein schwarzer Junge am Kongo, der eine gewisse Zeit auf einer Missionsstation gelebt hatte, fand dort zu Jesus Christus. Bald darauf wurde er von der
Schlafkrankheit befallen. Er wußte, daß dies seinen Tod bedeutete, und sagte deshalb zu dem Missionar: »Ich möchte wieder heim zu meiner Mutter.« So ging er nach Hause zu seiner unchristlichen Mutter und erzählte dieser in seinen letzten Lebenstagen von Jesus und seiner Liebe. Als der Missionar zwei Jahre später nach Bonginda, dem Heimatort des Jungen, kam, hörte er, daß seine Mutter seit dem Tod ihres Kindes täglich an den Muß gehe, in die Richtung blicke, wo der weiße Mann wohnte, und zu des weißen Mannes Gott betete. Dreiunddreißig Personen fanden sich bald zusammen, die, durch des Jungen Zeugnis veranlaßt, mehr vom Heiland hören wollten. An diesem Ort wurde dann bald eine Missionsstation eingerichtet.
6
Vor mehr als hundert Jahren sammelte eine junge Dame sich eine Sonntagsschulklasse aus armen, verwilderten Straßenkindern zusammen. Unter ihnen war einer namens Bob, der schlimmste von allen. Der Leiter der Sonntagsschule sagte diesen Jungen, sie sollten in der Woche einmal zu ihm kommen; dann wolle er ihnen allen einen neuen Anzug schenken. Sie kamen, Bob auch, und jeder erhielt den versprochenen Anzug.
Nach einigen Sonntagen jedoch fehlte Bob in der Sonntagsschule. Die Lehrerin machte ihn ausfindig und sah, daß seine neuen Kleider zerrissen und beschmutzt waren. Er ließ sich überreden, wiederzukommen, und der Leiter gab ihm einen neuen Anzug.
Doch nach einigen Sonntagen fehlte er erneut. Als die Lehrerin ihn auffand, war auch der zweite geschenkte Anzug zerrissen und gänzlich verdorben.
Bob schien unverbesserlich zu sein. Die Dame berichtete das dem Leiter der Sonntagsschule, doch dieser bat sie, es noch einmal mit ihm zu versuchen; er habe den Eindruck, es sei etwas Gutes an Bob. So sagte man ihm einen dritten neuen Anzug zu, falls er regelmäßig zur Sonntagsschule kommen wolle. Das versprach Bob und erhielt einen dritten neuen Anzug. Er kam wieder zur Sonntagsschule, kam bald gern, bekehrte sich, wurde in die Gemeinde aufgenommen, wurde Lehrer und studierte schließlich Theologie.
Aus diesem schmutzigen, zerrissenen Jungen wurde der große Chinamissionar Robert Morrison, der die Bibel in die chinesische Sprache übersetzte und so den Millionen Chinas das Evangelium in die Hand gegeben hat.
7 Gleichnis vom Sauerteig (Mt 13, 33)
»Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.«
Eine Missionarin war eben in Japan angekommen. Ihr Herz, so erzählte der Evangelist Kimura, brannte in Liebe und im Feuer des Heiligen Geistes. Die
Sprache kannte sie noch kaum, aber die Menschen liebte sie. So sammelte sie etwa 24 Jungen um sich, gab jedem von ihnen eine japanische Bibel in die Hand und ließ sie darin lesen, während sie selber ihre eigene Bibel vor sich hatte.
Eines Tages lasen sie die Geschichte der Kreuzigung Jesu. Dieser Bericht bewegte auch die Missionarin sehr stark und vertiefte ihre Hoffnung, daß die
Jungen Jesus als ihren Heiland erkennen möchten. Aus diesen Gedanken Wurde ein Gebet. Plötzlich
bemerkten die Jungen daß die Missionarin flehentlich zu Jesus betete, daß er doch die Jungen retten möchte. Das beeindrUC1 Sie so, daß sie jlij Herz dem Heiland gaben.
Von diesen Jungen sind einige tüchtige Männer geworden, und Kimura, ein Mami voll Glauben und Freude, ist einer von ihnen.
»Als ich«, erzählte er, »nach Hause kam und meinem Vater sagte, daß ich ein Christ sei, bekam
ich zunächst eine tüchtige Tracht Prügel; danach sollte ich umgebracht werden. Aber statt dessen bekehrten sich mehrere Glieder meiner Familie. Später kam ich nach ikazu Evangelist Moody, und nun durchziehe ich Japan und predige das Wort vom Kreuz.«
8 Der Schalksknecht (Mt 18, 21-35)
»Bezahle, was du mir schuldig bist!« (V. 18, 28) Ein Mann namens Samuel Holmes, der in Frank-fort/USA wegen eines Mordes im Zuchthaus eingekerkert lag, erhielt eines Tages Besuch von seinem alten Schulfreund Lucien Young. Dieser hatte vor Jahren durch tapfere Rettung einiger Menschenleben die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und als er sich nun an den Gouverneur Blackbum wandte, um seinem Schulfreund Begnadigung zu erwirken, da wurde ihm diese in Anbetracht seines Verdienstes gern gewährt.
Der Gouverneur unterzeichnete die Begnadigungsurkunde. Mit ihr in der Tasche eilte Young ins Zuchthaus zu seinem Freund. Doch ehe er ihm von seiner Begnadigung Mitteilung machte, fragte er ihn unter anderem auch, was er zu tun gedächte, falls er begnadigt würde.
»Was ich zu tun gedenke?« war die hastige Antwort. »Ich würde nach Lancaster gehen und den Richter Owsley samt dem Mann umbringen, der gegen mich gezeugt hat.«
Traurig, ohne ein weiteres Wort zu sagen, ging Young von ihm weg; draußen vor der Zellentür zerriß er die Begnadigungsurkunde in Stücke.
Weil Holmes selbst nicht vergeben wollte, konnte ihm keine Vergebung zuteil werden.
9 Gleichnis von der königlichen Hochzeit (Mt 22, 5. 12)
»Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft« (V.5)
Der Evangelist Moody erzählte folgendes: Einst wollte ich die Versammlung in unserer Kirche gerade schließen, als noch ein junger Mann aufstand und die Leute mit großem Ernst ermahnte, sich doch beizeiten ganz für Christus zu entscheiden.
Er sagte, er habe kürzlich eine erschütternde Szene erlebt. Einer seiner Kollegen hatte einen Vater, der ihn stets mahnte, sich Jesus zuzuwenden. Er sagte aber dauernd: »Erst wenn ich älter bin, das hat jetzt noch Zeit.« Da hatte er einen Unfall und kam ins Krankenhaus Sein Zustand verschlimmerte sich ständig. Eines Tages erhielt er einen Brief von seiner Schwester. Man las ihm den Brief vor, weil er ihn nicht mehr selbst lesen konnte. Es war ein ernster Brief! Aber der Kranke war bereits so schwach, daß er ihn nicht mehr recht zu verstehen schien, bis man zum letzten Satz kam, der lautete: »Mein lieber Bruder, willst du nicht den Heiland annehmen, wenn du diesen Brief erhältst?«
Der Sterbende richtete sich mühsam auf und fragte: »Was sagen Sie?« und dann, auf das Kissen zurückfallend, seufzte er: »Es ist zu spät, zu spät!«
10 »Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte« (V. 12)
Einst waren ein Negersklave und sein Herr Freunde des Evangeliums geworden. Der Sklave fand bald Vergebung und Frieden im Blut Jesu, der Besitzer aber nicht. Da kam er zu seinem Sklaven und sagte: »Wie kommt es, Sambo, daß du Frieden gefunden hast, während ich immer noch im Finstern bin?«
»Massa«, entgegnete der Sklave, »das verhält sich wohl so: Ein Mann kommt zu Sambo mit einem guten Rock und sagt: >Sambo, du mußt einen neuen Rock haben. Gib mir deinen alten und nimm diesen neuen!< Sambo sieht seinen Rock an und bemerkt, daß er viele Flecken hat und zu schlecht ist, als daß man ihn flicken könnte. Da sagt er: >Danke Ihnen, ich bin Ihnen sehr dankbar<, und zieht den neuen Rock an. Der Mann geht zu Massa und bietet ihm ebenfalls einen Rock an. Massa aber sieht den seinigen an und sagt: >Der ist noch nicht so schlecht. Er wird mir schon noch eine Zeitlang dienen. Ich behalte ihn lieber noch ein wenig.< Somit behält Massa seinen alten Rock, weil er noch nicht schlecht genug ist, weggeworfen zu werden; Sambo aber bekam einen neuen, weil sein alter ihm zu schlecht war.«
Gleichnis vom verlorenen Groschen (Luk. 15,8-10) -
„Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut" (V. 9)
Ein Sohn erzählt: Mein Vater war zur Zeit, aus der diese Erzählung stammt, als Lehrling bei seinem ältesten Bruder in Rendsburg angestellt, der ein großes Möbelgeschäft leitete; die verwitwete Mutter wohnte bei ihm und führte ihm den Haushalt.
Eines Tages nun gab der ältere Bruder meinem Vater den Auftrag, nach der Bank zu gehen und da einen Hunderttalerschein in kleines Geld umwechseln zu lassen, da er am andern Tag seine Arbeiter damit entlohnen wollte; dabei gab er ihm die strengsten Weisungen, ja recht vorsichtig-mit dem Geld zu sein, was natürlich auch fest versprochen wurde.
Der Weg zur Bank führte über die Eider. Dort, bei der Brücke, trifft der Junge andere an, die eifrig mit einem Spiel beschäftigt sind; er will an ihnen vorbei, aber sie versperren ihm den Weg und suchen ihn zu überreden, an ihrem Spiel teilzunehmen. Nach einigem Zögern gibt er nach und läßt sich überreden. Dabei legt er seine Mütze auf das breite Geländer der Brücke und unter die Mütze den Hunderttalerschein; er glaubte, ihn dort gut geborgen zu haben.
Und nun geht es an das Spiel, nicht besonders lange, und doch viel zu lange; denn während der Zeit war ein Windstoß gekommen und hatte die Mütze samt dem Hunderttalerschein in den Fluß geweht, so daß, als sein Eigentümer sich nun wieder auf den Weiterweg zur Bank machen wollte, er zu seinem größten Schrecken das Geländer leer und Mütze und Geld verschwunden fand.
Endlich, nach langem Suchen, gelang es ihm, die Mütze wiederzufinden, und zwar im Wasser schwimmend. Aber das Geld, das Geld, wo war das? Er wagte vorläufig gar nicht, nach Hause zurückzukehren, sondern schlich sich erst nach Verlauf einiger Zeit durch die Hintertür ins Haus hinein, traf da die Mutter in der Küche und bat sie, mit ihm in die Schlafstube zu kommen, er sei in großer Not und Angst und wisse nicht, was er tun soll.
Als nun die Mutter hinaufkam, da sah sie gleich an dem verstörten Gesicht ihres Jungen, daß ihm etwas besonders Schlimmes passiert sein müsse, und als er dann ein offenes Geständnis seiner Schuld abgelegt hatte, sagte sie in tiefem Mitleid mit dem armen, reumütigen Jungen: „Mein Kind, ich weiß dir keinen Rat zugeben, weiß auch niemand, der uns jetzt helfen könnte, doch - einen weiß ich, komm, wir wollen beten und den anrufen, der gesagt hat: ‚Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen."
„Dieses Gebet der Mutter", erzählte mein Vater, „war der Wendepunkt in meinem inneren Leben, das gab mir den ersten wirklich nachhaltigen Anstoß zu einem neuen Leben und wurde somit die erste Veranlassung, unter des Herrn wunderbarer Leitung später dem Ruf Folge zu leisten und in den Dienst der Brüdermission in Südafrika einzutreten." -
Doch zurück zu meiner Erzählung. Die Mutter sagte: „Ich will gleich mit dir gehen und dir noch einmal am Fluß suchen helfen; bei Gott ist nichts unmöglich, vielleicht läßt er uns das Geld doch wiederfinden." Und so gingen sie zum Fluß.
Dort suchen sie eine Zeitlang ganz vergeblich am Ufer entlang, in der Hoffnung, unter den angeschwemmten Blättern den verlorenen Geldschein wiederzufinden, bis sie zuletzt an eine Stelle kamen, wo der lange Zweig eines Strauches ins Wasser hinabhing und etwas Gras und Laub aufgefangen hatte. Mit einem langen Stock gelang es ihren, den Zweig herzubiegen, so daß sie denselben untersuchen konnten; und da, verborgen unter nassem Gras und Laub, fanden sie den verlorenen Hunderttalerschein! ganz durchnäßt, aber sonst noch ganz unversehrt!
@1995 VLM Verlag
Winterfeld-Platen Leontine von , Bonizetta von Are, Mittelalterliches Leben im Ahrtal,

Vielfarbig schimmernd fielen die letzten Streifen der scheidenden Sonne durch die schmalen, mit bunten Heiligenbildern bemalten Bogenfenster der alten Abtei-kirche zu Marienthal. Wie abschiednehmend berührten die zitternden Strahlen die geschnitzten Chorstühle der Nonnen, den samtgepolsterten Lehnsessel der Äbtissin und die Fange Stuhlreihe der Novizen und weltlichen Zöglinge. Und sie huschten tänzelnd weiter durch das ganze große Schiff, bis zum Hochaltar, von dem in Lebensgröße, von Meisterhand gemalt, die Mutter Gottes segnend niedersah. - Es war still und leer hier in der Kühle - die Zeit des Ave eben vorüber -‚ nur draußen vor der weitgeöffneten Tür summten die Bienen in den blühenden Linden.
Da knarrte ganz leise die schwere, eichene Eingangstür.
Ober die grauen Steinfliesen schritt langsam ein Mädchen. Wie flüssiges Gold flutete hinter ihm die Abendsonne durch die duftenden grünen Linden in das weit geöffnete Portal und umgab das Kind wie mit einem Glorienschein. Langsam ging es weiter bis zum Hochaltar, den Arm voll blühender, purpurroter Rosen.
Im Schreiten waren ihm einige entfallen, die lagen nun auf dem Estrich wie Blutstropfen. Tief beugte das Mädchen Knie und Haupt vor den Stufen des Hochaltars, Stirn und Brust mit dem heiligen Kreuz zeichnend. Dann hob es die großen dunkelblauen Augen zur segnenden Maria. Zu Füßen der Jungfrau ordnete es all die blühende, duftende Pracht in einen großen Krug. Die jungen Lippen bewegten sich im leisen Gebet. Von draußen durch die halboffene Tür klang noch immer das Summen der Bienen; ganz in der Ferne dengelte einer seine Sense. Süßer, schwerer Duft von frisch geschnittenem Heu mischte sich mit dem Hauch der Rosen. Da erhob sich das Mädchen von den Knien und ging langsam zwischen den hohen, geschnitzten Stühlen den Hauptgang wieder zurück, den es gekommen war.
- Den blühenden Lindenweg schritt es entlang, bis zum Klostergarten, über dessen hohe steinerne Mauer helles Jauchzen und Rufen klang. Hier lärmten die Zöglinge beim Blumenbegießen - lustig, ausgelassen, wie Kinder sind. Denn noch hatte die Glocke nicht zum Schlafengehen geläutet, und der Sommerabend war so wunderschön. Wie König Laurins Zauberreich dehnte sich hier blühend und duftend zur Seite der massigen Gebäude, sanft gebettet im geschützten Tal, der von Nonnenhand sorglich gepflegte Klostergarten von Ma-rienthal: Rosen, Rosen, wohin das Auge sah. Über die steinerne Einfriedung klommen sie in dichten, purpurnen Büschen, über die kiesbestreuten Wege spannten sie sich rankend in zierlichen Bogen. Durch die Säulen des Kreuzgangs hatten sie sich gezwängt und waren hinaufgeklettert bis zum moosigen Klosterdach, auf dem die Tauben gurrend saßen und sich Brust und. Flügel mit
den Schnäbeln putzten. Hinter dem Kloster, bis tief ins Tal hinein, vorne bis hart an die grüne, rauschende Ahr heran, erstreckten sich die Beete, der Stolz der frommen Frauen zu Marienthal. Und hier am Fluß, wo die Schwalben mit schrillem, jauchzendem Schrei pfeilgeschwind dicht übers Wasser glitten, wo die rotgesprenkelten Forellen sprangen, saßen zwei der Mädchen, eng aneinandergeschmiegt, auf der Steinmauer und schauten träumend hinaus in das dämmernde Land, Über die waldbewachsenen Berge jenseits der Ahr stieg schon der Abendstern. Jetzt kam den Garten herunter auf die Mauer zu auch die kleine Dunkle, die eben die Rosen vor den Altar gebracht hatte. Die beiden winkten ihr.
„Mechthild,- so lauf doch ein bißchen! Wo bleibst du nur? Die Sonne ist schon untergegangen, und wir müssen gleich hinein. Hattest du eine Pönitenz, daß du so spät kommst?«
Mechthild schüttelte das braunlockige Köpfchen und schwang sich neben die zwei auf die Mauer.
»Hab nur der Mutter des Hochgelobten noch Rosen gebracht. Weißt, Gathli, ich denke, sie hat sie gern.«
Die junge Novize, schon an der dunklen Tracht erkenntlich, nickte ernst, und in ihre Augen stiegen Tränen.
„Oh, du, Mechthild, liebst die Heiligen und ihren Dienst, und hast's doch nicht einmal so nötig wie ich, denn du bist nur ein weltlicher Zögling und fliegst bald wieder davon,- da oben hin auf die Landskron. Aber ich?" Sie grub die weiien Zähne tief in die Unterlippe und ballte die Faust.
„Nach Jahresfrist schneiden sie mir die Haare und ziehen mir Nonnenkleider an. Oh!”
Die andere, die bis dahin still neben ihr gesessen hatte, strich ihr begütigend leise über den Arm.
»Still, Gathli, still, daß Schwester Mathilde dich nicht hört! Sie hat's nimmer gern, wenn man so spricht."
Mechthild sah die Weinende sinnend an. „0 Gathli, wie gut wirst du's einmal haben! Immer, immer hier bei den frommen Frauen im Rosengarten, und dann alle die lieben Heiligen so in der Nähe."
Da tönte plötzlich eine schrille Stimme durch die Dämmerung. „Agathe, Agathe!"
Erschrocken sprang Gathli empor. „0 weh, das ist Schwester Mathilde. Ich habe meine Borte nicht fertig am Meßgewand, nun gibt's Pönitenz. Lebt wohl, Mechthild und Margret! Grüßt mir die Bonizetta!"
Damit war sie auch schon von der Mauer heruntergesprungen und der rufenden Stimme entgegengelaufen.
Die beiden blieben noch sitzen, etwas beklommen nach dem eben Gehörten.
„Du, Margret", flüsterte ein wenig scheu die kleine dunkle Mechthild und beugte sich vor, „du, sag einmal, warum wird denn die Agathe Nonne, wenn sie's nun einmal nicht will?"
Die dicke Margret zuckte die Achseln.
„Ja, weißt du, das ist nun einmal so. Sie hat keine Eltern mehr und keine Geschwister. Und weil ihr Oheim ihr Vermögen will, hat er sie halt ins Kloster gesteckt. Es ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ich werd' ja auch schon nächsten Neumond Novize und dann Nonne."
Mednhilds dunkelblaue Augen sahen traumverloren in die Ferne.
„Wie ich euch beneide, Margret! Bei uns droben auf der Landskron ist's auch schön, freilich ja! Aber da sind der Vater und die Buben, die trinken und raufen so viel. Die Mutter und die Armtrud denken nur allweil an Spiel, Tanz und Lustbarkeit. Und so viel Gäste sind immer oben bei uns, und fahrende Sänger und Gaukler und Narren. Ich mein schier, bei uns müßt' den Heiligen fast schwindelig werden, so toll geht's da her."
„So bleib doch bei uns, Mechthild, und tritt ein als Novize."
„Ich darf nicht, Margret. Der Vater hat mich schon als ganz kleines Kind dem Saffenburger Sohn versprochen. Nun muß ich doch dessen Ehweib werden."
Die andere nickte ernsthaft.
„Freilich mußt du's, das hilft dann nichts. Aber sag, Mechthild, was ich noch fragen wollt. Drüben bei uns in der Klosterkirche unter den schweren Steinplatten in der Gruft liegen doch auch so viele Ritter von Sinzig und Grafen von Landskron, sind die alle von deiner Sippschaft?"
Mechthild nickte. Und es schien fast, als käme jetzt ein wenig Leben in ihr weiches sechzehnjähriges Gesicht-dien.
„Freilich, das hat mir Vater oft genug erzählt. Die Ritter von Sinzig, wie wir früher hießen, haben dazumal die Landskron vom deutschen Kaiser zum Dank bekommen, weil mein Ahnherr Gerichwin von Sinzig dem Kaiser Philipp von Hohenstaufen treu gewesen ist."
„Sieh, sieh”, spottete Margret, „unsere sanfte Mechthild scheint sich doch ab und zu auch ganz gern mit weltlichen Dingen abzugeben. Ich meinte bis dahin, du wüßtest nur unter den Heiligen Bescheid."
Mechthild errötete.
„Warum? Was meines Vaters Stolz ist, ist auch der meinige. Drum lern ich ja jetzt Latein bei Schwester Erdmute, daß ich es später alles in der Chronik aufzeichnen kann. Wir haben unser Erbbegräbnis hier in der Klosterkirche durch hohe Schenkungen urkundlich erlangt. Da liegt auch Gerhard II., der eine Gräfin von Neuenar zur Frau hatte. Das sind meine Großeltern gewesen."
Margret legte den Kopf auf die Seite.
„Dann bist du also auch mit der Bonizetta versippt? Die ist doch auch eine von Neuenar?"
Die Kleine nickte.
„Freilich. Landskron und Neuenar stehen allzeit zusammen, heißt der Spruch.«
„Recht, Klein-Mechthild, du gelehrtes Klosterkind, das tun sie. Ihr Heiligen! Ist mir heiß! Ist noch Platz da oben?"
„Bonizetta!" jubelte Mechthild.
Und „Bonizetta ! « echote fröhlich die dicke Margret.
Von den jetzt schon im Halbdunkel liegenden Rosenbüschen des Gartens hatte sich eine hohe; schöngewach-sene Gestalt gelöst. Weißblond wie! reifer Flachs lagen ihr die dicken Zöpfe im Nacken. Das regelmäßige, herbe Antlitz war purpurn überhaucht. Den Rock hatte sie bis über die Knöchel geschürzt, die langen Armel bis zu den Ellbogen zurückgestreift, daß die schlanken Arme weiß im Dämmer schimmerten. Der rechte lag ihr voller Linnen, der linke hielt die schwere Gießkanne.
Sorgsam legte sie jetzt das Linnen auf die breite Steinbank unter der Linde und stellte die Kanne daneben. Dann setzte sie sich zu den beiden andern auf die Mauer und faltete die Hände um das linke Knie.
„Ihr habt's gut hier!" lachte sie. „Allweil Feierabend. Ich war noch auf der Bleiche, Linnen zu begießen."
Margret rümpfte die Nase.
„Warum, Bonizetta, 's ist ja nicht deine Arbeit? Mag sich doch Schwester Angela damit plagen, wenn sie heimkommt."
Da reckte Bonizetta sich tiefatmend.
„Wenn mir doch die Arbeit Freude macht!"
Und in ihren schönen graublauen Augen lag's dabei wie blitzender Sonnenschein.
Dann legte sie ihren Arm schützend um die kleine schmächtige Mechthild.
„Sag, Bäschen, wer hat dir etwas tun wollen, daß du's vorhin so laut hinausriefst in den Abend: Lands-kron und Neuenar stehen allezeit zusammen?"
Die Kleine schmiegte sich an sie.
„Niemand, Bonizetta. Ich sagte es bloß so. Wir sprachen grad von der Sippschaft und solchen Dingen, die Margret und ich."
Margret nickte.
„Ja, Bonizetta. Und ist das wahr, was sie hier alle erzählen, daß du einmal einen von den beiden letzten Grafen von Are ehelichen sollst?"
Bonizetta nickte sehr ruhig.
„Ja, aber das ist eine eigentümliche Geschichte. Ich dachte, ihr wüßtet sie alle längst.”
„Jeder redet so etwas, aber keiner weiß Genaues. Erzähle du es doch", schmeichelte Margret mit neugierigen Augen.
Bonizetta lehnte sich zurück und sah in die Sterne.
»Einmal werdet ihr's ja doch erfahren. Warum dann nicht heute abend? Komm, kleine Mechthild, sieh nicht gar so erwartungsvoll drein. Die Geschichte ist sehr einfach, ihr wißt, der alte Theoderich von Neuenar, der da oben so wild haust, hatte einen Bruder, der mit dem Kaiser nach Welschland zog. Das war mein Vater. Drunten in Welschland hat er geheiratet. Bonizetta hat meine Mutter geheißen, so wie ich. Als ich wenige Wochen alt war, starb sie."
Bonizetta hielt inne im Sprechen und sah wie verloren über das dunkle, gurgelnde Ahrwasser. Ihre Brust hob und senkte sich.
»Als meine Mutter gestorben war, hat mein Vater mich heimgebracht nach Deutschland zum Ohm auf den Neuenar. Dann ist der Vater wieder zurückgezogen nach Welschland und in einer Schlacht gefallen. Ich bin auf dem Neuenar geblieben und aufgezogen worden zusammen mit den beiden Buben vom Ohm, dem Kraffio und dem Will. Dazumal hat noch meine Muhme, die edle Frau Hadawig, gelebt. Die hat mich liebgehabt wie ihr eigenes Kind. Früh hat sie an einer Seuche sterben müssen, da ward ich siebenjährig hergebracht zu den frommen Frauen nach Marienthal, bloß zum Aufziehen, weil ich droben nicht sollte allein bleiben unter den Mannsleuten. - Nach Frau Hadawigs Tode wurde es bekannt, daß sie einst ein schweres Gelübde getan hatte, das sie, verbrieft und versiegelt, vom Erzstift zu Köln unterzeichnet, als heiliges Dokument in einem Schrein verwahren ließ, zu dem allein Graf Theoderich den Schlüssel besitzt, der aber an ihrem Sterbebett geschworen ha; ihn nicht eher zu öffnen, als bis die Buben einundzwanzig Jahre zählen. Nur das weiß man, daß der eine der Buben mich heiraten, der andere Domherr zu Köln werden soll. Aber niemand ahnt, wen's getroffen hat, den Kraffio oder den Will, selbst der eigene Vater nicht."
Margret schauderte.
»Die armen Buben! Ein so ungewisses Schicksal vor sich zu haben!"
Mechthild lächelte.
»Warum denn, Margret? So oder so, es ist beides schön. Und wie es dann kommt, so ist's der Wille der Heiligen."
Aber Margret gab sich noch nicht zufrieden.
»Was hat Frau Hadawig denn für einen • Grund gehabt, ein so schweres Gelübde zu tun?"
Bonizetta wiegte den Kopf.
»Man weiß es nicht recht. Sie soll in großer Not gewesen sein und habe eine Schuld sühnen wollen."
Mechthild hob jetzt den dunklen Kopf und sah der Blonden voll in das schöne Gesicht.
„Sag, Bonizetta, fürchtest du dich nicht, so allein einmal hinauf zu • müssen in das alte Raubnest, wo nur der alte Graf und die beiden wilden Buben hausen? Man erzählt drunten im Tal von den Letzten von Are da oben so viel Arges."
ISBN 3-87047-014-3 49. Tausend 1982 © 1964 Otto Bauer Verlag 7000 Stuttgart 75 Herstellung: Druckerei Bauer GmbH Winnenden Ptinted in Germany
Winterfeld-Platen Leontine von, Wanderer zum Licht,
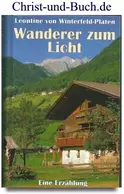
Haben die hohen, spitzen Dächer und der alte Kirchturm je so majestätisch ausgesehen wie an diesem Morgen? Als hätten sie von Gold und Purpur durchwirkte Gewänder an, die ein solches Glänzen schaffen, daß man die geblendeten Augen vor dieser Pracht sekundenlang schließen muß. Aber es ist weder ein Königsmantel noch ein Diadem, was die Giebel und Dachfirste so aufleuchten läßt, - es ist nur die Morgensonne, die ruhig den Nebelschwaden von der Wiesen steigt, die die Stadt rings umgeben. Heute ist Markttag, und da drängt und schiebt es sich vor dem verwitterten Rathaus, das schon seit Jahrhunderten Wache hält an dem großen Platz mit seinem groben Pflaster.
Zwischen den Budenreihen schieben sich die Käufer, und die Kinder, die mit ihrem Ranzen zur Schule traben, werfen begehrliche Blicke auf die roten Zuckerherzen und blinkenden Blechtrompeten. Aus dem Gedränge löst sich eine Frau, die einen Kinderwagen vor sich herschiebt. Darin sitzt ein Bübchen mit großen, hellen Augen, in den dicken Händchen eine anknabberte Brezel. Ein Netz mit Gemüse hängt der Frau am Arm, und auf den Füßen des Kindes liegt ein großes, in Papier gewickeltes Brot.
Die Frau mag so Ende der Deißig sein und hat noch einjunges Gesicht. Ihr lockiges, braunes Haar ist von keinem Hut oder Tuch bedeckt, aber auf ihrer Stirn steht eine Falte, und auch die Mundwinkel sind im Unmut zusammengezogen. Ihr ist warm geworden beim Schieben des Wagens auf dem holprigen Pflaster, und sie bleibt, als sie den, Marktplatz überquert hat, ein wenig seufzend an der nächsten Straßenecke stehen, um sich auszuruhen. Mit dem Taschentuch fährt sie sich über das erhitzte Gesicht und lehnt sich müde gegen eine Hauswand. Hier sind doch wenigstens nicht soviel Menschen, hier kann sie in Ruhe verschnaufen.
Da kommt von der anderen Straßenseite her ein junger Mann auf sie zu, der einen großen Pakken Bücher unter dem Arm trägt. Es ist Kaspar David, der im gleichen Haus wie die Frau wohnt, und ganz oben unter dem Dach ein kleines Zimmer hat.
„Guten Morgen, Frau Nebeling! Ist das nicht ein herrlicher Tag heute?"
Er streckt ihr die freie Rechte hin und schüttelt kräftig ihre Hand. Die Falte auf ihrer Stirn wird tiefer, und sie schüttelt den Kopf.
Was soll mir der schöne Tag, wenn ich ihn doch nicht genießen kann vor lauter Arbeit?"
Oh soviel Zeit haben Sie schon noch, um diesen Sonnenglanz auf allen Dächern zu bewundern! Wird einem das Herz da nicht weit, und möchte man nicht dahinfliegen mit den Schwalben?"
Sie setzt ihren Kinderwagen wieder in Bewegung und lacht gezwungen.
„Dann fliegen Sie doch los, Herr David! Ich muß nach Hause in die alte Tretmühle, weil Mann und Kinder warten und endlose Arbeit!"
Er beugt sich freundlich herab und nimmt ihr die Griffe des kleinen Wagens aus den Händen, nachdem er vorher seine Bücher neben das Brot gelegt [hat.
„Lassen Sie mich den Kinderwagen schieben, das Pflaster ist hier so uneben. Und das schwere Netz können Sie auch noch irgendwo anhängen, dann brauchen Sie es nicht zu schleppen."
Sie sieht erstaunt zu ihm auf, denn er ist fast einen Kopf größer. ja, aber ist es ihnen nicht peinlich, hier mitten in der Stadt mit dem Kinderwagen?"
„Warum?"
„Ihre Bekannten könnten Sie auslachen. Viele Studenten würden das als eine unerhörte Zumutung ansehen -
„Mögen sie doch! Warum soll ich nicht auch mal ein solch herziges Bübchen fahren? Und Sie sehen müde aus und haben noch einen ziemlich weiten Weg." Sie seufzt.
„Ja, eigentlich bin ich immer müde. Mein Mann muß früh heraus, sein Frühstück muß fertig
sein. Dann müssen die beiden anderen Kinder schnell zur Schule fertiggemacht werden! Und dann Reinmachen, - Einkaufen, - Mittagko-chen -”
Er schüttelt bekümmert den Kopf. Und sein Gesicht wird sehr nachdenklich.
„Ist das bei allen Hausfrauen so? Ich kann mich doch besinnen, daß meine Mutter immer
noch ein bißchen Zeit für andere Dinge übrig hatte. Sie sah auch nie so vergrämt und abgehetzt aus und hat uns immer auf alle Schönheiten in der weiten Gottesnatur aufmerksam gemacht."
„Sie hatte vielleicht viel Hilfe und nicht drei Kinder wie ich."
„Oh, wir waren fünf Geschwister. Vater war Lehrer und Mutter konnte sich kein Kindermäd-
chen leisten. Aber nun sind wir ja glücklich bei Ihnen angelangt, Frau Nebeling. Ich trag' Ihnen den Kleinen die drei Treppen hinauf. Der Wagen bleibt wohl unten?"
„Ich weiß nicht, Herr David, —wenn doch alle Menschen so hilfsbereit wären! Und kommen
Sie doch abends wieder zu uns, wenn Sie Zeit haben. Mein Mann freut sich, wenn er jemand zum Erzählen hat"
Als sie oben in ihrer Küche ist und sich die große, derbe Schürze vorbindet, muß sie sich erst erschöpft auf einen Stuhl setzen. Ach, warum ist sie nur immer so schlapp? Ist es die
Frühlingsluft, oder die ununterbrochene Tretmühle des langen, grauen Alltags? Sie weiß, irgend etwas fehlt in ihrem Leben, -etwas, das ihr Antrieb und Kraft geben könnte! Ihr Mann schüttelt oft den Kopf darüber und sagt:
„Du hast doch die Kinder!"
„Ja, und jedes Kind ist eine Sorge mehr!"
„Aber wir haben doch unser leidliches Auskommen und -"
„Das ist es ja gerade, was mich ständig bedrückt: Leidliches Auskommen! Das heißt, es reicht so gerade eben hin, aber man kann sich nie und niemals das Geringste leisten. Ich meine, so ein kleines Extra-Vergnügen. Hofers Lotte geht fast jeden Abend ins Kino, und Frau Kruse hat sich wieder ein neues Kleid machen lassen! Ich kann so etwas niemals tun! Immer das Alte wieder flicken, - immer nur sehen, daß die Kinder sauber und heil sind zur Schule! Für einen selbst bleibt auch nicht ein Pfennig übrig! Andere Beamte bekommen mal eine Gehaltszulage, - du niemals!"
Sie hatte es neulich in großem Ärger vorgestoßen und die Teller beim Abwaschen durcheinander geworfen, daß es nur so klirrte; Da hatte ihr Mann, der sonst immer fröhlich war, sie ganz bekümmert angesehen:
„Ich glaube, Lisbeth, es ist der Neid, der dich quält. Aber du mußt wirklich nicht immer auf die sehen, .die es besser haben. Sieh dir doch einmal die an, denen es viel schlechter geht als uns.
Zum Beispiel das Fräulein Griese gegenüber, oder den alten Karsten unten im Keller!"
Da hatte sie schrill aufgelacht.
„Ja, wenn du uns allerdings mit denen vergleichst! Kannst ja noch den Lumpensammler dazurechnen! Der hält uns natürlich für wohlhabend!"
„Na siehst du, das sind wir auch wirklich. Vor allem, wenn du unsere drei gesunden, herzigen Kinder ansiehst! ist das nicht ein Reichtum, der nicht mit Geld zu bezahlen ist?"
Da hatte sie sich unwirsch abgewandt. „Ach, du willst mich einfach nicht verstehen, Hans! Man könnte ebensogut tauben Ohren sein Leid klagen!".
Er war ihr mit der Hand über die braunen Haare gefahren.
„Versündige dich nicht, Lisbeth! Armut ist noch lange kein richtiges Leid. Und wir haben immer noch unser bescheidenes Auskommen gehabt. Was würde mir Reichtum nützen, wenn ich krank wäre, oder die Kinder stürben?"
Dabei war er leise kopfschüttelnd aus der Tür gegangen.
Das war noch gar nicht lange hergewesen. Aber statt über seine Worte nachzudenken, war sie ärgerlich auf ihn. Ach, die Männer verstanden einen ja doch nie!
Müde steht Frau Nebeling von ihrem Stuhl auf. Dann sieht sie sich suchend nach ihrem Jüngsten um, den Herr David vorhin so freundlich hier auf den Fußboden gesetzt hatte. Über ihr ungutes Grübeln hatte sie ihr Bübchen ganz vergessen. Das hatte sich schleunigst die seltene Freiheit zunutze gemacht und war rasch auf allen vieren ins Nebenzimmer gekrochen, denn laufen konnte es noch nicht. Und hier hatte es Vaters Papierkorb unter dem Schreibtisch entdeckt und umgekippt. Nun spielt es selig mit all den alten Umschlägen und Papierstückchen, die es rings umher auf dem Fußboden verstreut, und jauchzt und kräht dazu, daß es eine Lust ist
Sekundenlang bleibt die Mutter in der Tür stehen und sieht dem frohen Spiele zu. Dann bückt sie sich und hebt den Kleinen vom Boden hoch in ihre Arme. Fest, fest preßt sie das Kind an sich und geht mit ihm hinaus auf den angrenzenden Balkon. Frühlingsblumen wetteifern in den Holzkästen ringsum mit ihren leuchtend bunten Farben. Ein Schmetterling, der sich in die Stadt verirrte, gaukelt sonnentrunken von einer Blüte zur andern. Man hat von hier oben eine weite Sicht über die Gärten der Stadt Und fern bis zu den Wiesen hin, von denen die Nebel nun alle verschwunden sind. Und in all dem Morgensonnen-glanz wird die Seele der Frau allmählich ganz still. Als sie auf die Straße hinuntersieht, geht dort ein Blinder, von seinem treuen Hund geführt. Sie kennt den Mann mit der breiten Binde an seinem Arm, denn er kommt immer um dieselbe Zeit hier vorbei. Es gibt ihr einen Stich ins Herz, weil er ja all die Pracht ringsumher nicht mehr sehen kann. Und dann jagt ein Krankenwagen vorüber. Wen holt er ab? Vielleicht in allerletzter Minute?
Wieder preßt sie ihr Kind an sich, und es kommt wie Scham in ihre Seele. Ist sie nicht unermeßlich reich? Sie senkt den Kopf und geht still an ihre Arbeit.
Der lachende Tag ist vorüber und macht einem linden, dämmerigen Frühlingsabend Platz. Oben in seiner Studentenbude kramt und packt der junge Kaspar David. Er möchte das Licht noch nicht anschalten, denn diese Dämmerstunden sind ihm die liebsten des Tages. Da können die Gedanken ungehindert wandern, ohne daß hetzende Arbeit sie stört. Und obgleich es ziemlich wüst aussieht in seinem Zimmer, wo ein Teil Bücher verstreut auf der Erde liegt, und ein anderer Teil schon in die bereitstehenden Kisten verstaut ist, so hat er doch das große Bedürfnis, ein wenig beim Aufräumen innezuhalten und alles einfach so stehen und liegen zu lassen, um sich auf die breite, niedrige Fensterbank zu setzen und einige tiefe Atemzüge der reinen, herben Abendluft in Lunge und Seele fluten zu lassen. Sein verträumter Blick geht über die Dächer der Stadttief unter ihm und bleibt an dem wuchtigen, alten Kirchturm hängen, der seinem Zimmer oben im Dach-
geschoß so nahe ist, daß er das Moos auf den altersgrauen Steinen erkennen kann.
jetzt hebt der Student lauschend den Kopf: Poltert da nicht jemand seine steile Treppe herauf? Er wundert sich, denn er bekommt nicht oft Besuch, und hier oben unterm Dach wohnt weiter keiner als er.
Ohne anzuklopfen wird die Tür stürmisch aufgerissen, und eine etwas ärgerliche Stimme ruft:
„Aber Kaspar, bist du eigentlich hier oder nicht? Warum machst du kein Licht an?"
„Weil es so viel schöner ist, Ulrich. Und ganz dunkel ist es ja auch noch nicht. Aber falle nicht über meine Bücher da auf der Erde!":
Der andere hat allmählich die Fensterbank erreicht und setzt sich rittlings darauf, den einen Fuß draußen in der Dachrinne. Nun ist das Abendrot über den Wiesen stärker geworden und wirft einen purpurnen Widerschein in alle Fenster und auch auf die Turmspitze, daß sie leuchtet wie Gold. Am übrigen Himmel verblassen die Farben, nur einige rosenfarbene Wölkchen künden davon, daß die Sonne einmal dagewesen ist. Gedämpft klingt der Lärm der Gassen von unten herauf. Mit wuchtigen Schlägen holt die Turmuhr über ihnen zur ihrem stündlichen Mahnruf aus.
„Ein schönes Plätzchen, Kaspar, das du dir hier ausgesucht hast. Nur das laute Dröhnen der Uhr und der Glocken würde mich stören."
„Ich bin schon so daran gewöhnt, daß ich es
@ 1996 Otto Bauer Verlag
Wilson Dorothy C. Mutter Brand - Er brachte ihnen das Licht
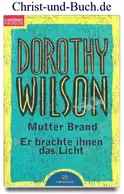
Erster Teil
Wie lieblich, sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen. .
Jes. 52,7
Obwohl sie das neunte von elf Kindern war - neun davon waren Mädchen -‚ war sie niemals nur »eine der Harristöditer«, sondern immer und völlig sie selbst, Evelyn Constance Harns, von ihrem älteren Bruder Charlie »Babs« und »Baby« und von der übrigen Familie gewöhnlich »Erle« genannt.
Evies Welt war klein, aber schön, und stillte alle Bedürfnisse. Sie bestand aus einem Haus und einem Garten, einer frommen Mutter, einem zärtlichen Vater, acht innig geliebten Schwestern und zwei lustigen Brüdern. Ihre Welt war voller Güte und Behagen, sie schenkte Frieden und Geborgenheit. Sie war reich an Duft und Farben; an süßen, saftigen Trauben, die in dem großen Treibhaus wuchsen; an dicken, goldenen Kürbissen in dem andern Gewächshaus, das sie »die Hölle« nannten; an Stachelbeeren und Johannisbeeren im Küchengarten; an grünen Farnen und Kletterpflanzen; an rosafarbenen, karmin- und korallenroten Begonien und Geranien. Selbst der schwarze Eisenzaun um den Garten war oft unter einer Fülle großer lilaer Fliederblüten begraben. Und da Evie mit den Augen und der Seele einer Künstlerin geboren war, stachen die Farben alle Süßigkeiten und Wohlgerüche aus.
Es war eine Welt von bunten Farben, ja, aber auch von Schwarz und Weiß. In den moralischen Anschauungen der Familie Harns gab es keine Grautöne. Sünde war schwarz, Tugend weiß, und die Trennlinie war klar gezogen. Zwischen den Kardinalsünden wie Diebstahl, Vergewaltigung, Mord und Gotteslästerung und den in den Augen strenger Baptisten nicht so schweren Vergehen wie Tanzen, Kartenspielen, Theaterbesuch, Sonntagsentheiligung gab es nur einen Unterschied im Grad, nicht in der Art. Das Rauchen war verboten. Aus Höflichkeit fühlte sich Vater Harns zwar verpflichtet, auf einem Aschenbecher
zwei Zigarren für Gäste vorrätig zu haben, stürzte aber, sobald der tibeltäterdas Haus verlassen hatte in sein Arbeitszimmer, um sämtliche Fenster aufzureißen. Alle Arbeit, sogar das Kochen war am Snn-tag verboten.
»Die Dienstboten müssen ebensoviel Gelegenheit haben, zum Gottesdienst zu gehen, wie wir«, sagte Vater Harns bestimmt Aber kaltes Fleisch und kalte Kitsch- oder Stachelbeertorten schmeckten ja auch' Und da immer ein paar Lehrer seiner geliebten Sonntagssdiule sowie zu Besuch weilende Missionare zum Tee eingeladen wurden, brachte der Tag mehr spannende Erlebnisse als Verzicht mit sich. Und weil Liebe und nicht Furcht die treibende Kraft des religiösen wie auch des häuslichen Lebens der Harns war, weitete sich Evies Welt von Jahr zu Jahr.
Selbstverständlich gab es außerhalb der Mauern noch mehr Welt! Zunächst einmal den St. Johns-Wald, an den dann eine unbestimmte Gegend, Londongenannt, angrenzte; und dahinter etwas noch Vageres, »die Welt«, die fast ganz in heidnische Dunkelheit getaucht war. Dank 1 der Missionare, die oft in der »Kapelle« sprachen, konnte sie sich unter Indien und Afrika mehr vorstellen als unter England, und die »Armen und Verlorenen« hatten mehr menschliche Wirklichkeit für sie als die
Queen. -
Evie konnte wenig für die »Verlorenen« tun, außer daß sie Pfennige in die Missionssammelbüchse warf. Aber für die Armen gab es eine• Geschenkkiste,in die zerbrochenes Spielzeug, abgelegte Kleider und was die Kinder sonst sucht mehr brauchten, wanderten Aber schon als Evie noch ganz klein war, kamen ihr Zweifel über diese Art von Wohltätigkeit. Dazu kam, daß Mutter oft Sachen weggab, die sie wirklich noch brauchte, und sie schien große Freude daran zu haben.
»Meine Liebe, ich kann meine Stiefel nicht finden«, sagte Vater einmal ratlos.
Mutter sah ihn mit strahlendem Lächeln an.
»0, das tut mir sehr leid. Ein armer Mann war an der Tür. Seine Schuhe waren voller Löcher. Ich hoffe, daß du das verstehst.«.
Vater verstand es. Hatte sie nicht einmal ihr eigenes Kleid ausgezogen, um es einer armen Kusine zu schenken?
Als Evie noch ein kleines Kind war, wurde ihre Welt durch eins Veränderung erschüttert. Die »Great Central Railway« beschlag-
nahmte ihr elterliches Haus und Grundstuck, um Versdnebebahnhofe zu bauen Die Familie zog in ein neues Heim in der Cavendish Road Nr. 3 Dieses Haus hieß genau wie das alte »Nethansa«, das heißt »Gabe Gottes«, und mit seinen hohen, grauen Ziegelwänden war
ein ebenso sicherer Zufluchtsort. Man lief über die alten bekannten Teppiche Der riesige Nußbnumschrank im Wohnzimmer enthielt die-
selben Schätze: die Nautilusmusdiel, die Krabbe aus Elfenbein, die grüne Wedgwood-Gruppe »Tanzende Mädchen«. An der Wand hing dieselbe Uhr mit dem Trompete blasenden Engel, und selbstverstand hei standen überall im Haus Einzelstucke von Vaters geliebter Martin-Keramik, die die drei Bruder Martin in einem kleinen Schuppen im selbstgebauten Brennofen herstellten
Seine Freude, wenn er eine gelungene Schöpfung der Bruder aus dem weißgluhenden Ofen herauskommen sah, war überschwenglich; und er empfand wirklich Schmerz über einen Riß oder wenn die sorgfältig aufgestapelten Werkstücke unter der starken Hitze zusammenfielen. Die Bruder waren Kunsthandwerker und nicht bereit, ihre sdiopferischeBegabung für Massenproduktionen zu opfern
»Sie sollten dieses Stuck nicht pflegte einer von ihnen listig zu Vater zu sagen Und da dieser wußte, daß es so ausgezeichnet war, daß sie sich nicht davon trennen wollten, nahm er es prompt in seine fl Sammlung auf.- .
Evie teilte Vaters Freude am Schönen; sie folgte mit dem Finger den feinen Linien an Krügen und Figürchen und brach in Ausrufe des Entzückens über die leuchtenden Blautone aus Ebenso begeistert war sie von Vaters anderem Hobby, seinem wertvollen Mikroskop, das die Wunder der Natur, wie zum Beispiel die unzähligen Facetten eines Insektenauges, enthüllte. Vater und Tochter malten auch leidenschaftlich gern, und Evie war außer sich vor Stolz, als eins von ihres Vaters Bildern in die »National Gallery« aufgenommen wurde
Wenn es Mangel in ihrer beinahe vollkommen schonen Kindheit gab, dann war ihr eigenes, selbstbewußtes kleines Ich daran schuld Sie hatte eineii ganz großen Kummer: Sie war eine der »Kleinen«. Nach ihren sieben älteren Schwestern -- Grace, Minnie,, Lily, Ross, -Eunice, Florence und Hope - war Chanhie gekommen, der erste Junge. Dann, nach einer kurzen Pause, waren sie, Stella und Bruder Bertie gefolgt Obwohl sie die älteste dieses Trios war und wie sie wußte, die klügste und reifste, wurde sie mit ihnen auf den gleichen Platz verwiesen Vielleicht übte sie sich deshalb so verbissen im Stelzenlaufen - sie konnte sogar Treppen mit Leichtigkeit hinauf- und hinuntersteigen -‚ weil sie zeigen wollte, wie erwachsen sie schon war.
»Schick die drei Kleinen ins Kinderzimmer'« hieß es oft nach dem Essen, wenn ernstere Dinge besprochen werden sollten, und dann wurde sie mit den beiden »Babys« ins Kinderzimmer abgeschoben.
Das war mehr als Demütigung. Das war Ablehnung. Aber sonntagsaben& gab es einen Ausgleich. Da versammelte Mutter die »drei Kleinen« um sich und erzählte ihnen Geschichten von Jesus. Zu den vielen Bibelsprüchen, die sie lernten, gehörten auch die Seligpreisungen.
»Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.«
Evie wiederholte diese Worte mit einem Gefühl plötzlicherBefreiung. Sie beschrieben ihren Zustand ganz genau. Wie Christ, der Pilger in den aufregenden Abenteuern der »Pilgerreise«, fühlte sie, wie eine Last von ihr abfiel. Von diesem Tag an dachte sie nicht mehr soviel über ihre eigenen Schmerzen und Enttäuschungen nach, sondern mehr darüber, wie sie andern helfen konnte.
»Zu jung!« meinten einige ihrer Schwestern, als sie darum bat, getauft zu werden.
Mutter dachte nicht so. Und als Evelyn Constance Harns im Alter von elf Jahren nach Art der Baptisten durch Untertauchen getauft wurde, war sie mit einer Leidenschaft und Hingabe dabei, die ihr ganzes Leben prägen sollte..
Vater Harns hatte sich zum Ziel gesetzt, seine Kinder für ihr ganzes Leben reichlich zu versorgen. Keins von ihnen sollte jemals gezwungen sein, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, und nichts wäre ihm lieber gewesen, als sie alle, besonders seine neun Töchter, zu seinen Lebzeiten und darüber hinaus zu Hause zu behalten.
»Wenn ich nicht vermittelt hätte«, pflegte Mutter Harns lachend zu sagen, »wären heiratsfähige junge Männer niemals bei uns willkommen gewesen.«
Als wohlhabender Kaufmann war Vater Harns durchaus in der Lage, sein ehrgeiziges Ziel finanziell zu verwirklichen. Ein Leben im Wohlstand, ja Reichtum war das Erbe seiner Kinder von beiden Seiten der Familie. Großvater Wilson, Mutters Vater, war Importkaufm941 für Eier und andere Waren aus Dänemark. Er und Vater Hirns blieben auch als Geschäftsleute ihrer religiösen tYberzeugung treu, und beide verbanden Sparsamkeit mit unerschütterlicher Ehrlichkeit. »Lieber hungern als borgen«, sagte Großvater mahnend. »Ich hätte lieber meine Uhr ins Leihhaus gebracht, um meine Rechnungen zu bezahlen, als Schulden zu machen.«
Es war das Viktorianische Zeitalter, wo junge Frauen aus wohlhabenden Familien in häuslicher Geborgenheit lebten. Dienstboten reinigten das Haus und kochten, Hausmädchen kümmerten sich um ihre persönlichen Bedürfnisse. Rechtlich hatte die Frau wenig zu sagen. Wirtschaftlich war sie völlig vom Ehemann, Vater oder Bruder abhängig. Nur wenige Berufe standen ihr offen: Erzieherin, Schneiderin, in seltenen Fällen Schriftstellerin - und die beiden ersten wurden stillschweigend für arme Adlige reserviert. Vater Harns' Wunsch, seinen Töchtern ein sorgenfreies Leben zu sichern, war also nichts Besonderes. Ungewöhnlich war nur, daß er sie nicht heiraten lassen mochte.
Ihre Erziehung entsprach den Gepflogenheiten jener Zeit und schloß außer Lesen, Schreiben und Rechnen wenig praktische Fächer ein.
Ein wenig Stichen, Malen, Musik und vielleicht ein bißchen Französisch ergänzten die Ausbildung. Da Vaters Vater eine Gouvernante der königlichen Hofhaltung in Paris geheiratet und er selbst einen Teil seiner Jugendzeit in Frankreich verbracht hatte, legte er auf Französisch großen Wert.
Rosa, die klügste von Evies Schwestern, wurde die Lehrerin der drei Kleinen. Für Evie war das sehr erfreulich, denn Rosa teilte nicht nur
ihre künstlerischen Neigungen, sondern auch ihre Liebe zur Natur, und
sie machten lange Spaziergänge im Park, wo sie die Namen vonBlumen und Bäumen lernte. Ein Internatsaufenthalt von Evie und Stella wurde
nach zwei unglücklichen Wochen abgebrochen, weil die beiden fast
krank vor Heimweh nach Hause kamen. In einer kleineren, weniger unpersönlichen Schule in Boscomb, dicht am Meer, hielten sie dann
aus. Trotzdem - Französisch war für Evie eine Qual. Sie fühlte sich
wie ein Tier im Käfig, wenn sie über ihren Schulaufgaben schwitzen und sich mit Konjugationen abmühen mußte, statt Felsen, Wellen und
Sonnenaufgang zu malen. Obwohl sie mit ihrer unbändigen Energie lernte und lernte, konnte sie Mademoiselle nur Töne den Mißbilligung entlocken. Einzig und allein der Gegenwart der sanften, -liebevollen Stella war es zu verdanken, daß sie durchhielt.
Die nächsten französischen Sprachstudien betrieben die beiden Schwestern in der Nähe von Paris. Sie verbrachten drei Monate als
zahlende Gäste im Hause von Pastor Saillen. Der Aufenthalt hier wurde auch geistlich ein Erlebnis. Zwei englische Jungen, ebenfalls Internatsschüler, waren vom Leben und der Lehre des Pastors so beeindruckt, daß sie sich taufen lassen wollten. Pastor Saillen zögerte.
»Erst müßt ihr euren Vater um Erlaubnis bitten.«
Ein Telegramm löste das Problem sehr schnell.
»Kommt sofort nach Hause!«
Der Grund für den schroffen Befehl stand im nachfolgenden Brief
»In England sind die Baptisten eine niedrige Gesellsdiaftsklasse un werden sehr verachtet. Ich will nicht, daß meine Söhne geringgesdiätr. werden Sie können ruhig fromm sein aber niemals Baptisten.«
Evie war verärgert und, was schlimmer war, ratlos. Hatten Väter das Recht, ihren Kindern vorzuschreiben, was sie glauben sollten>
Angenonmien, eines von Vaters Kindern wollte sich gern der »Church of England« anschließen oder - was das strenge hugenottische Erb& verhindern möge! - katholisch werden?! Sie war verunsichert...
Als sie Frankreich verließ, hatte sie Fortschritte im Lesen des Fränzö-sisdien gemacht und konnte es leidlich gut sprechen. Aber Sprachen, würden nie ihre Stärke sein.
Zu Hause trug sie sich in der Kunstschule von St. John's Wood ein. Da Malen zu den annehmbaren Betätigungen »höherer Töchter« gehörte und die Schule gerade um die Ecke lag, war Vater ganz damit einverstanden.
Evie besuchte Vorlesungen, wanderte durch Bildergalerien und bemalte Leinwand um Leinwand mit prachtvollen Sonnenuntergangsfarben. Sie stand früh auf, um den Sonnenaufgang über dem Nebel einzufangen, ein hoffnungsloser Versuch, Turners »Sonne, im Nebel aufgehend« nachzuahmen. Turner! Sie schwelgte in den karmesinroten und goldenen Farbtönen seines »Ulysses«, seines »Venedig«, »Stadt in Rosa und Weiß, aus dem smaragdgrünen Meer sich erhebend gegen einen saphirblauen Himmel«. Sie erhielt die Erlaubnis, in der Tate-Galerie zu kopieren, und als alle Schüler ein Ausstellungsstück vorlegen mußten, wurden ihr ein paar gute Noten verliehen
»Natürlich!« sagte einMitsdiüler geringschätzig.»Sie kopiertTurner in der Tat.«
Die Freude war ihr verdorben - das Vertrauen in die menschliche Natur war hin.
Aber Evie war nicht nur Künstlerin, sondern auch Modell. Ihre aristokratische Schönheit regte die schöpferische Phantasie der Studenten und Lehrer an. Einer der Lehrer war Bildhauer. Er überredete sie, ihm für eine Büste zu sitzen »Sie sehen so traurig aus«, sagte er einmal mit beruflichem Interesse. Ein paar andere Bemerkungen waren nicht so beruflich, und wenn ihr Vater die süßen Nichtigkeiten gehört hätte, die seinen Lippen entflohen, hätte er mit ihrer künstlerischen Ausbildung sofort Schluß gemacht. Doch seine Töchter. hatten Diskretion gelernt.
Unsicherheit und eine wachsendetJnruhe bemächtigten sichEvies. Die Farben auf der Leinwand erschienen ihr tot, während doch die Pracht eines Sonnenuntergangs zum Teil in seinen ständigen Verwandlungen lag, in seinen kaleidoskopischen Veränderungen, Mischungen, Kreseen-dos. Sie nahm Unterricht über Bewegungsdarstellung, trotzdem blieb alles flach, bewegungslos. Ob sie sich vielleicht lieber in Portraitmalerei hervortun sollte -wie Baker, eine ihrer Konr4litoninnen? Zumindest würde sie es dann mit Menschen zu tun haben!
Menschen . . . Mehr und mehr wurde sie sich ihrer bewußt, als sie sich von den engen Mauern der Kindheit und Jugend entfernte. Sie sah gequälte, bekümmerte Gesichter auf den Straßen, hoffnungslose Augen, die in den düstern Slums rund um die Kapelle aus den Fenstern blickten.
Menschen. . . Häufig kamen Missionare in die Gemeinde und danach mit nach Hause Zu ihnen gehörte auch Mrs Booth, die Frau eines Missionars in Indien, die von der großen Not der Frauen In Madras erzählte und damit Evies innere Unruhe nur noch vergrößerte. Als Mitglied eines Komitees half sie ein Frauenhilfswerk ins Leben rufen, dessen Ziel es war, eine Missionarin in die Zenanas auszusenden, jene abgeschlossenen Hofe der indischen Hauser, die kein Mann betreten durfte, der nicht zur Familie gehörte. Eine junge Frau, Olive Elliott, bewarb sich, und das Komitee stimmte ihrer Berufung zu Als Evie sie da stehen sah, jung, stark, voll froher Zuversicht, wurde ihr die Ungewißheit ihres eigenen Lebens fast unerträglich. Hätte nicht sie, Evie, gewählt werden sollen?
An ihre Staffelei zurückgekehrt, kamen ihr die Pinsel wie Spielzeug vor. Einmal wagte sie es, ihrer Freundin Baker gegenüber den kühnen Gedanken zu äußern.
»Hast du - hast du schon einmal daran gedacht, Missionarin werden zu wollen?« platzte sie heraus.
Baker schien gar nicht überrascht zu sein.
»Ja, ich habe das schon oft gedacht. Ich würde auch bestimmt eine werden wollen, wenn Gott mir nicht dieses Maltalent gegeben hatte Ich bin sicher, er will, daß ich es weiter ausbilde. Das braucht aber natürlich nicht auf dich zuzutreffen.«
Evie beneidete ihre Freundin. War sie deshalb so sicher, weil sie mehr Vertrauen in ihre Begabung hatte? Nein, das war es nicht. Das Leben ,goirde immer leichter sein für die Bakers in dieser Welt. Ihre Wünsche ließen sich leicht als Gottes Führung auslegen. Sie waren wie stille Ströme, die in klar begrenzten Betten bestimmten Zielen zuflossen.
Während die Evie -. Sie kam sidivorwie ein reißender Wildbach„„" der über Hindernisse, Klippen und Treibsand stürzte und erbarmungslos einem von Gott bestinunten Betätigungsfeld für ihre Energ: getrieben wurde, es aber niemals finden konnte.
Vater Harns hatte seine Töchter vergeblich abzuschirmen, versucht. Ein heiratsfältiger junger Mann nach dem anderen drang in die Burg ein und trug eine Braut davon. Es gehörte zum viktorianischen Brauch, daß die älteste Tochter zu Hause blieb und für ihre Eltern sorgte, bis sie heiratete. Als Grace die Frau eines wohlhabenden Farmers -wurde, übernahm Minnle die Sorge für den Haushalt. Als sie heiratete und nach Bristol zog, trat Lily an ihre Stelle. Als dann Lily einen Vetter heiratete, wurde die Ordnung unterbrochen. Rosa, die vierte und begabteste aller Mädchen, wurde die Frau des Farmers Ridiardkobbins, der die Farmer's Union gründete und schließlich unter Asquith und Lloyd George Staatsmann wurde.
Es war Eunice, die nun die Leitung des Haushalts übernahm. Und dabei blieb es. Das herlisdiöne Mädchen nahm keine der ihr gebotenen Gelegenheiten zum Heiraten wahr. Mit ihrer großen mathematischen Begabung, ihrem unglaublichen Gedächtnis und mit ihrem W'zssens-drang, mit dem sie sich in so verschiedenartige Fächer wie Astronomie und Archäologie vertiefte, würde sie es in späterer Zelt in einem Beruf weit gebracht haben. Aber ihr ein7iger Wunsch war, bis zum Tode ihrer Eltern für sie zu sorgen.
Ein Hauch von Romantik zog plötzlich ins Haus, als ein Onkel, der sich in Brisbane, Australien, niedergelassen hatte, zur Kolonialausstellung nach London kam Er brachte eine Sammlung von großen Opalen mit - und seinen Sohn, Charles Frazer. Vater Harns begann sofort, sein Sammelhobby auf Opale auszudehnen, und füllte einen ganzen Schrank damit Pur seine Tochter jedoch besaß Charles eine größere Anziehungskraft als Opale Er entschied sich für Florence Plorne Als er abreiste, versprach er ihr, wiederzukommen, sobald er im Geschäft eingearbeitet sei, und sie als seine Frau heimzuholen
Evie teilte die Qualen einer dreijährigen Wartezeit mit Florrie Das half ihr ein wenig über ihr eigenes Unbefriedigtsem hinweg Aber die drei Jahre vergingen, und Charles kam zurück, und dann war plötz-
lidi alles vorbei, und Florrie war gegangen. Charlie und Bertie hatten inzwischen geheiratet und zogen Kinder groß. E& waren nur noch vier Mädchen zu Hause, die tüchtige Eumce, die impulsive Hope, die ihre Schwestern manchmal dadurch schockierte daß sie rannte und pfiff, die sanfte Stella und Evie.
Florries Weggang hinterließ einen leeren Raum Die künstlerischen Studien kamen Evie mehr und mehr wie ein zweck- und zielloses Hobby vor. Nur eins konnte sie teilweise befriedigen die »Wohltätigkeit«. Wie Malen und Sticken wurde sie als angemessene Besi41~ftigung für »höhere Tochter« betrachtet So billigte auch Vater Harns die
Besuche seiner Töchter in den benachbarten Slums Er hatte sie sogar selbst oft auf solche Expeditionen mitgenommen, war mit ihnen durch
schmutzige Treppenhauser und dumpfe Korridore in Stuben gegangen,
die nach Armut, Alkohol und Krankheit rochen Mutter leitete neben ihrer Geschenkkisten-Aktion eine Gesellschaft zum Wohl »gefallener
Mädchen« Es wurden Babyausstattungen zusammengestellt und
jeweils für einen Monat an unglückliche Mutter verliehen, von denen erwartet wurde, daß sie die Sachen gewaschen zurückbrachten. Trotz
ihres Abscheus vor solcher Art von Freigebigkeit (schrecklich, alte
Sachen -wegzugeben!) flickte Evie zerrissene Kleidung, sammelte Spenden ein, ergänzte Ausrangiertes heimlich von ihrem Taschengeld und
suchte entschlossen Baracken, Mietskasernen und Armenhäuser auf. Für
solche Gänge zog sie sich genauso sorgfältig an wie für einen Fünfuhrtee. Sie dachte, es sähe gönnerhaft aus, wenn sie sich nicht in ihren
besten Sachen zeigte. Erst Jahre später wurde ihr klar, daß gerade die Rüschen, Spitzen, Seidenstoffe und großen Blumenhüte die verhaßteste
Form gönnerhaften Benehmens gewesen war. -
»Sie sieht so schön aus«, hörte sie einen kleinen Jungen sehnsüchtig sagen, »als ob sie gerade aus einem wunderhübschen Garten käme.«
Daneben hörte Evie die Berichte von Missionaren, die aus Afrika und Indien zurückkamen, und verschlang jedes Wort aus entsprechen-
den Veröffentlichungen. Eine davon, eine kleine Broschüre, die 1910 herauskam, trug den Titel: »Wie das -Evangelium in die >Berge des Todes< kam«, und ihr Autor war ein jünger Missionar mit Namen
Jesse Mann Brand. -
Evie las sie mit glühender Begeisterung Sie hatte schon früher einmal von dem jungen Brand gehört. Er war Mitglied der Guildford-Gemeinde und vor drei Jahren nach Indien gegangen. Nun berichtete er von der Reise die er mit Mr. Morling, einem anderen Missionar, -in die »Kolli Malai«, die Berge des Todes, gemacht hatte, eine Bergkette
in Südindien, wo es noch Zehntausende von Menschen gab, die noch nie das Evangelium gehört hatten
in Gedanken begleitete Evie die beiden Männer, besuchte mit ihnen ein Dorf nach dem andern, wo sie allmählich das Vertrauen der scheuen Einwohner gewannen, ihnen die Geschichte von dem großen, gutigen »Guru« erzählten, der die Sunde haßte, aber die Sunder liebte der Blinden das Augenlicht und Kranken die Gesundheit schenkte der kleine Kinder segnete, mit den Trauernden Weinte und schließlich den Tod überwand.
Die Leute hatten aufmerksam zugehört, schrieb der Junge Brand
»Wir glauben, daß dein >Yesu< der einzige wahre >Swami< ist«, hatten drei Männer zu ihm gesagt »Wenn du bei uns bleibst und uns unterrichtest oder wenn du andere Lehrer schickst, werden wir alle Christen werden.«
»Aber ehe sie diesen Schritt tun können« - Evie Augen hingen an den durch Kursivschrift hervorgehobenen Worten -‚ »mußt Ihr ihnen Priester und Lehrer senden «
Evies Herz pochte wie wild Wenn nur -I Aber das war natürlich unmöglich. Sie war schon dreißig Jahre alt Und außerdem wurde Vater es nie erlauben Die so liebevoll gewobenen seidenen Faden der Abhängigkeit waren zu einem starken Netz geworden, aus dem es kein Entrinnen gab.
In der Familie waren Krisen eingetreten. Rosa starb und ließ Richard Robbins mit zwei kleinen Kindern zurück. Mutter sah plötzlich schmal und alt aus, die Lodadien um ihre glatten Wangen wurden weiß Vaters Schritt wurde langsamer, seine Stimme schwacher, obwohl er sie bei den Famlienandachten und im Gottesdienst zu ebenso innigem Lob und Dank erhob Das Netz zog sich immer enger zusammen Dann kam Florrie aus Australien mit ihren Kindern, weil der zweijährige Ray wegen eines Muttermals behandelt werden mußte Die Reise war eine Qual für sie gewesen
»Du fährst am besten ing ihr zurück«, sagte Vater zu Evie »Sie braucht jemanden, der ihr die beiden kleinen Jungen betreuen hilft.«
Die Reise war eine Gnade Sechs Wochen für die Hin- und Ruchfahrt und sechs Wochen in Australien, das ergab drei Monate, in- denen ihr
22 - Leben aus dem schrecklichen Stillstand -herausgerissen wurde. Und irgendwie verwandelten die größere Nahe der dunklen Erdteile, die sie sich im Geist so oft vorgestellt hatte, der Anblick schwarzer, glänzender Körper, die zum Schiff beraussdiwamnien, und dunkelbärtiger Kulis, die mit Kohlenlasten auf dem Kopf über die Decks schwärmten, ihre Unrast in Hoffnung Wenn sie ihnen so nahe kommen konnte, wer weiß, was für ein Wunder geschah! -
»Ich danke dir, ich danke dir, Gott'« jubelte sie immer wieder.
Aber es war die Rückreise, die ihr Leben veränderte. Sie war einem frommen Ehepaar anvertraut worden, das sie mit einem jungen Missionar bekanntmachte, der in Afrika arbeitete. Er suchte sie immer wieder auf und schilderte ihr beredt und anschaulich, wie nötig er neue Mit-arbeitet in seiner Mission brauche, besonders Frauen, die Beziehungen zu ihren dunkelhäutigen Schwestern herstellen könnten.
»Frauen wie Sie!« sagte er eindringlich zu ihr. »Ich fühle Ihre große Liebe zur Mission. Sie würden sicher gern Ihr Leben für solch eine Aufgabe einsetzen.«
Unter seinem zwingenden Blick schien ihr Blut erst zu stocken und raste dann wild durfh ihren Körper.,
»Ja, o ja!« kam es von ihren Lippen. - -
In den folgenden! Tagen war sie voll bebender Erwartung. Begierig nahm sie alle Einzelheiten seines Lebens in der Mlssionsstation in sich -- auf und hoffte von einer Begegnung zur andern auf den Augenblick, der über ihre Zukunft entscheiden wurde. Sicher würde er ihr bald
- einen Heiratsantrag machen. Der Augenblick kam - und mit ihm ein -
unsanftes Erwachen. ! -
»Wenn wir erst in England -sind, haben Sie hoffentlich bald Gelegen-hei; -meine Frau kennenzulernen. Sie mußte schon eher in Urlaub fahren, wie Sie wahrscheinlich wissen. Wie wird sie sich freuen, zu hören, daß sie vielleicht eine Freundin und Mitarbeiterin auf dem Missionsfeld bekommt'«
Evie antwortete mit steifen Lippen. Sie war erstaunt, daß sie über-
haupt einen Ton herausbrachte. - - --
»Ich - ich will sie gern kennenlernen. Aber - - bitte, machen -Sie ihr keine Hoffnungen, ehe ich mir klar geworden bin. Es. gibt - viele
Schwierigkeiten -.« - -
Sobald sie konnte, -lief sie in ihre Kabine, warf sich auf das Bett und vergrub das Gesicht in den Kissen. Wie dumm! Was für eine alberne Närrin war sie gewesen!
@ 1976 R. Brockhaus
Wilts Harm, Familie nach Gottes Plan

2. Lamech und seine Familie (1. Mose 4,19-24)
Nach der Geschichte der ersten Familie finden wir in 1. Mose 4 und 5 zwei Geschlechtsregister. Das eine beschreibt die Linie Kains, das andere die Linie Seths. Beide schließen mit der kurzen Beschreibung einer Familie.
Die erste ist die Familie Lamechs: „Und Lamech nahm sich zwei Weiber; der Name der einen war Ada, und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal; dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal; dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubalkain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Und die Schwester Tubalkains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Weibern: Ada und Zilla, höret meine Stimme; Weiber Lamechs, horchet auf meine Rede! Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme! Wenn Kain siebenfältig gerächt wird, so La-mech siebenundsiebzigfältig' (1. Mo 4,19-24).
Diese kurze Beschreibung macht deutlich, daß Lamech alle Charakterzüge seines Stammvaters Kain besaß. Seine Worte und Taten bewiesen, daß er weiter von Gott und Seinem Wort abgewichen war als Kam. Kain hafte sich in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken eine Frau genommen. Auf die viel gestellte Frage, woher er diese Frau genommen habe, gibt es nur die eine eindeutige biblische Antwort: Adam zeugte Söhne und Töchter (1. Mo 5,4). Gott hat aus einem Blut (d.i. Adam) jede Nation der Menschen gemacht (Apg 17,26). Also: Kain hat seine Schwester geheiratet. Doch Lamech handelte ganz deutlich im Widerspruch zu Gottes Absicht, indem er sich zwei Frauen nahm. Polygamie ist im Widerspruch zu Gottes Schöpfungsordnung. Wer die Bibel kennt, weiß, daß Gott die Vielweiberei toleriert hat, aber nie gutgeheißen hat. An den Folgen sehen wir, daß dieses Böse sich immer wieder selbst straft. Mei ne persönlichen Beobachtungen in Afrika In allernächster Nähe bestätigen diese Regel. Ideale Ehen und Familien sind auf dieser unbiblischen Grundlage nicht zu erwarten.
Lamech handelte nicht in Unwissenheit. Aus 1. Mose 4,24 können wir ableiten, daß ihm die Aussprüche Gottes nicht unbekannt waren. Er hatte aber nicht das geringste Verlangen nach der Bewahrung, die Gott Kain verheißen hatte. lii seinem Gedicht voll hochmütiger Selbstverherrlichung gibt er zu erkennen, daß er sich sehr wohl für fähig erachtete, sich selbst zu verteidigen. Er würde selbst für sein Recht eintreten! Er hafte Gott in keiner Weise nötig. Eigenwille, Unabhängigkeit und Geltungsdrang waren dominierende Eigenschaften seines Charakters. Mit diesen Eigenschaften kann man es in einer sündigen Welt weit bringen.
Die kurze Beschreibung seiner Familie macht das deutlich. Seine drei Söhne zeigten die Eigenschaften ihres Vaters. Alle drei wurden Männer, die sich in der Welt ihrer Zeit einen Namen machten. Sie wurden Pioniere auf dem Gebiet ihrer besonderen Begabung und Tätigkeit. Jabal, ein Landwirt, wurde der Vater all derer genannt, die in Zelten wohnten und Viehzucht trieben. Jubal wurde der Vater derer, die Laute und Flöte spielten.
Er wurde der Pionier in der Welt der Kunst und Kultur, in der er tonangebend war. Tubalkain war der Vater der Schmiede, all derer, die Erz und Eisen bearbeiten. Mit Recht können wir ihn als den Pionier in der industriellen Welt seiner Zeit ansehen. Wir können uns vorstellen, daß die Zeitgenossen Lamechs mit Respekt und Neid zu ihm aufgeschaut haben. Welch eine erfolgreiche Familie hatte dieser Mann. Wie sollte
man darauf nicht neidisch werden? Drei Söhne, die jeder eine führende Stellung in der Gesellschaft einnahmen. Welche Eltern freuen sich nicht, wenn es ihren Kindern in dieser Welt
gut geht? Für ihre Erziehung scheuen sie keine finanziellen Opfer, opfern ihre Zeit und Energie. Sollten sie sich dann nicht
über deren Erfolg freuen und sogar ein wenig stolz darauf sein? So denken Väter heute, und bei Lamech wird es nicht anders gewesen sein. Doch war wohl alles so gut und schön, wie es aussah? Oder ließ sich Vater Lamech von dem schönen Schein blenden? Handeln seine Artgenossen heute nicht ebenso?
Lamech hatte einen Zeitgenossen namens Henoch. Dieser gehörte, genau wie Larriech, zu der siebten Generation nach Adam, doch in der Linie Seths, wo man den Namen des HERRN anrief. Henoch wandelte mit Gott. Das tat Lamech nicht, im Gegenteil.. Auch Henoch heiratete. Auch er zeugte Söhne und Töchter. Für die Welt seiner Zeit ist Henoch mit seiner Familie, soweit wir wissen, nicht von besonderer Bedeutung gewesen. Henoch lebte auch nicht für diese Welt. Nein, er wandelte mit Gott.
Wer mit Gott wandelt, hat andere Ideale als jemand, der nur für diese Welt lebt. Für ihn sind andere Dinge wertvoll. Henoch sah seine Aufgabe und seinen Platz in der Welt ganz
anders als Lamech.
Es gibt noch zwei andere Schriftstellen, die uns ergänzend zu 1. Mose etwas über sein Auftreten mitteilen: Der Wandel Henochs mit Gott war ein Wandel durch Glauben, der mit seiner Aufnahme in Herrlichkeit endete (Hebr 11,5.6). Durch diesen Glauben bekam er auch Einsicht in den Charakter der Gott feindlichen Welt seiner Zeit. Dadurch hat er auch verstanden, daß dieser Welt das Gericht eines heiligen Gottes bevorstand. Er weissagte über dieses kommende Gericht und warnte die Menschen seiner Zeit (Judas 14). Leider hat die damalige Welt die Warnung nicht zu Herzen genommen. Drei Generationen später, in den Tagen Noahs, brach das Gericht in Form der Sintflut herein.
Die Geschichte Lamechs und seiner . Familie enthält auch für uns und unsere Familien eine ernste Warnung. Man verstehe mich nicht falsch. Es ist keine Sünde, für die Kinder eine gute Ausbildung zu erstreben. Es ist keine Sünde, in dieser Welt einen Beruf auszuüben. Ob wir auf landwirtschaftlichem, kulturellem, industriellem oder irgendeinem anderen Gebiet arbeiten, ist nicht ausschlaggebend, solange wir unseren Beruf in Gemeinschaft mit Gott und zu Seiner Ehre ausüben können. Gläubige gehören nicht mehr zu dieser Welt. Gott hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes Seiner Liebe (Kol 1,13). Wir gehören durch Gnade zu denen, die der Vater aus dieser Welt Seinem Sohn gegeben hat. Aber wir sind noch. in der Welt. Und wir haben darin eine verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen.
Der Apostel Johannes schreibt: „Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe
des Vaters nicht in ihm, denn alles was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit" (1. Joh 2,15-17).
Um unserem Platz und unserer Verantwortung in dieser Welt zu entsprechen, haben wir den Glauben eines Henoch
nötig. Paulus sah die Gefahr, die Welt zu mißbrauchen, und warnte davor. Er sprach von der Möglichkeit, die Dinge der Welt in der rechten Weise zu gebrauchen und dadurch Gott zu verherrlichen (1. Kor 7,31). Gebrauch und Mißbrauch können eng beieinander liegen. Das erste kann in das zweite übergehen.
Um das zu verdeutlichen, will ich ein Beispiel nennen.
Schon sehr früh hat der Mensch Mittel erfunden, um seine Gedanken festzuhalten und sie anderen weiterzugeben. Bereits Hiob kannte die Schreib- und Gravierkunst (Hiob 19,23.24). Später wurde die Buchdruckerkunst erfunden, noch später kamen andere Medien dazu. Alle diese Erfindungen wurden Schritte zum Himmel oder zur Hölle, wie einmal jemand gesagt hat. Wir können feststellen, daß der Teufel zur Ausbreitung seines Reichs intensiv Gebrauch davon macht. Muß das nun ein Grund für Gläubige sein, die ganze Kultur abzulehnen, sich feindlich dagegen einzustellen und sich zu isolieren?
Buchdruckerkunst, Radio- und Fernsehtechnik haben einen Strom des Verderbens über diese Welt ausgegossen. Das ist der Mißbrauch. Aber durch nützlichen Gebrauch z.B. der Buchdruckerkunst wird jetzt die Bibel in die Hände von Millionen von Menschen gebracht. Und den Menschen, die nichtS lesen können, wird durch Radio und Kassetten die frohe Botschaft verkündigt. Gebrauche die Dinge der Welt, aber miß-
brauche sie nicht!
Der große Sprachgelehrte und Bibelkenner William Kelly
kam einmal in Kontakt mit einem Altphilologen.
Beide Gelehrten befanden sind bald in einer tiefgehenden Unterhaltung. Plötzlich stellte der Professor die Frage: „Was tun Sie eigentlich im Alltagsleben, Herr Kelly?" Seine Antwort war: ‚ich studiere die Bibel, schreibe darüber und halte Vorträge." Darauf sagte der Professor: „Wie schade, daß der Welt solch ein Talent verlorengeht." Kellys kurze Reaktion war: „Welcher Welt, mein Herr?" Die Frage regt zum Nachdenken an. Für Welche Welt leben und arbeiten wir? Für Welche Welt erziehen wir unsere Kinder? Ein weltlicher Mensch wie Lamech erzieht seine Kinder für die Welt - doch diese vergeht. „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte?" (Mt 16,26). Laßt uns mit Josua
sagen: „Ich aber und mein Haus, wir wollen dem HERRN dienen" (Jos 24,15).
Fragen zu Kapitel 2:
1. Welche Eigenschaften kennzeichneten Lamech und welche seine Söhne?
2. Aus welchen Bibelstellen ist ersichtlich, daß Gott die polygame Ehe wohl tolerierte, aber nicht guthieß?
3. Wo sehen wir die schlechten Folgen dieser Art von Ehen?
4. Weiche Gegensätze sehen wir zwischen Lamech und Henoch?
3. Noah und seine Familie
(1. Mose 6-9)
Groß war die Ungerechtigkeit und die Gewalttat der Menschen in den Tagen Noahs. Deshalb beschloß Gott, die Menschheit durch eine Wasserflut zu vertilgen. Aber Er tat das nicht, ohne die Menschen vorher ernstlich zu warnen. In Seiner Langmut gab Er noch 120 Jahre Zeit zu Reue und Umkehr. Petrus schreibt von der Langmut Gottes, die in den Tagen Noahs harrte (1. Petr 3,20). Leider änderte sich nichts.
Noah erwies sich in seinem Verhalten als große Ausnahme, verglichen mit seinen Zeitgenossen. Er war ein gerechter und untadeliger Mann; er wandelte mit Gott, geradeso wie Henoch vor ihm. Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Das Gnadenangebot Gottes richtete sich jedoch nicht nur an Noah. Es war auch für "sein Haus" bestimmt, für seine Frau und seine Kinder.,, Du und dein Haus" ist ein Ausdruck, den wir oft in der Bibel finden. Gott will nicht nur einzelne Personen retten, sondern Häuser und Familien. Als Gott zu Abrahams Zeit das Gericht über Sodom kommen ließ, beschloß Er, Lot zu retten. Als Engel kamen, um Sodom zu verderben, sagten sie zu Lot: „Wen du noch hier hast ...Dabei nannten sie sogar an erster Stelle die Schwiegersöhne. Und Lot ging hin, um sie mitzunehmen. Leider weigerten sie sich, sich retten zu lassen, und kamen um. Gott wollte die ganze Familie Lots retten.
Noah empfing einen göttlichen Ausspruch und hat in Ehrfurcht eine Arche zur Rettung seines Hauses bereitet. Als die
Arche fertig war, sagte der „Gehe in die Arche, du
und dein ganzes Haus" (7,1). Und Noah ging mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche. So wurden alle gerettet. Diese Söhne und Töchter waren alle erwachsene Menschen, sie waren annähernd hundert Jahre alt! Wie ganz anders war ihr Verhalten als das der Schwiegersöhne Lots!
In Apostelgeschichte 16 lesen wie die Begebenheit von dem
@1988 csv
Winkler Mechthild, Ich liebte Hasenheide - Man braucht das Schöne, um das Schwere zu tragen
KAPITEL 3
Mutter empfing mich in der Diele. „Ich habe eine Neuigkeit für dich", sagte sie bedrückt. ‚Keine sehr erfreuliche?" vermutete ich.
„Wie man's nimmt. Erika ist da."
„Und warum freut dich das nicht?"
„Ich denke an dein Fest morgen. Wie wird Dieter es aufnehmen? Sie hätte sich anmelden sollen."
»Als Tochter muß man doch unerwartet nach Hause kommen können!" nahm ich ihre Partei.
„Natürlich hast du recht", stimmte sie zu. „Aber Erika benimmt sich so seltsam. So undurchsichtig. Sie sagt einfach, sie hätte mal für ein paar Tage aus München verschwinden müssen, und dein Geburtstag sei ein guter Grund dafür."
„An meinem Geburtstag war sie ja gar nicht da! Und von meinem Fest morgen konnte sie nichts wissen", wunderte ich mich. „Oder hast du ihr davon geschrieben?"
„Nein. Und ich habe ihr vorhin vergeblich nahegelegt, morgen etwas anderes zu unternehmen oder wenigstens auf ihrem Zimmer zu bleiben. Sie behauptet, das mit dem Fest treffe sich prima, weil es alles viel unverdächtiger mache, aber sie will nicht mit der Sprache heraus, was sie damit meint."
„Ich werde selbst mit ihr reden", beschloß ich und wandte mich zur Tür.
„Du mußt dich gedulden. Vater hat sie ins Gebet genommen."
Es dauerte lange, bis die beiden aus Vaters Zimmer kamen und sich zu uns in die Küche setzten, wo Mutter und ich gerade mit dem Abwasch fertig waren. Erika sah verweint aus, und Vaters Blick war erschreckend ernst.
„Hör zu, Monika", sagte Vater. „Erika ist auf meinen Wunsch zu deinem Fest gekommen. Ich wollte dir eine Überraschung bereiten."
„Aber Vater!" protestierte ich. „Davon ist doch kein Wort wahr! Warum lügst du mich an?"
„Ich lüge dich nicht an, mein Kind. Was ich eben gesagt habe, ist die Version, die wir alle - hörst du, wir alle! - unbedingt aufrechterhalten müssen, und zwar jedermann gegenüber. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht erklären, aber ich verlasse mich auf euch. Also: Erika und ich haben die Überraschung ausgeheckt, und niemand außer uns, auch Mutter nicht, hat etwas davon gewußt. Ist das klar?"
„Es kann doch gar nicht gehen, Vater", widersprach ich. „Ich habe Dieter versichert, daß Erika in München ist. Willst du ihm die Peinlichkeit zumuten, sie trotzdem hier zu treffen, nachdem sie ihn in die Wüste geschickt hat?"
»Er mich!" rief Erika dazwischen. „Nicht ich habe ihn fortgeschickt, sondern er mich."
Eine Weile waren wir sprachlos.
»Warum?" fragte Mutter schließlich.
„Das kann sie dir später erzählen", griff Vater ein. „Jetzt ist vordringlich, daß wir uns wegen morgen einig werden." Er wandte mir sein besorgtes Gesicht zu. „Glaubst du mir, Monika, daß ich absolut zwingende Gründe für das habe, was ich von dir verlange?"
„Es fiele mir leichter, wenn ich die Gründe wüßte", trotzte ich.
»Monika hat recht", nahm Mutter meine Partei. „Wenn man jemand um Hilfe bittet, schuldet man ihm Information; und wenn man Vertrauen verlangt, sollte man es auch gewähren."
»Außerdem kann ich nicht gut lügen, und wenn ich über etwas im Dunkeln tappe, mache ich eher Fehler, als wenn ich Bescheid weiß", setzte ich hinzu.
»Das ist's ja, was ich meine", ergänzte Mutter. »Es kann nichts Gutes aus einer Sache herauskommen, die auf Unehrlichkeit aufgebaut wird."
Vater schaute von Mutter zu mir und schien unsre Einwände zu bedenken.
„Ihr macht es mir sehr schwer", seufzte er.
„Wir?" fragte ich und sah zu Erika hin.
Sie hob die Augen und erwiderte meinen Blick. Dann wandte sie sich an Vater: „Ich hätte es dir nicht erzählen sollen, wenn du auch noch so sehr gedrängt hast." Ihre Stimme klang belegt, als ob sie in großer innerer Aufregung wäre. „Ich hätte überhaupt nicht herkommen sollen. Aber das ist nun passiert, und ich finde, Mutter und Monika müssen Bescheid wissen."
AC
Sie heftete ihre Augen auf Mutters Gesicht und sagte kaum hörbar: „Ich habe in München Freunde, von denen einige bei der Gestapo denunziert wurden."
„Wer oder was ist Gestapo?" fragte ich verständnislos.
„0 Gott, du Baby!" Erika sah kurz zu mir hin. „Geheime Staatspolizei. Hitlers Schnüffler. Wer denen in die Fänge gerät, kann sein Testament schreiben, wenn er noch Zeit dazu hat."
„Mach's halb so theatralisch!" giftete ich sie an, ärgerlich über die Anrede Baby und gereizt von der gespannten Atmosphäre im Zimmer.
„Man kann es nicht ernst genug nehmen", wies Vater mich zurecht.
„Was habt ihr getan?" fragte Mutter mit weißem Gesicht und zitternden Lippen.
„Getan? Leider gar nichts. Aber geredet wurde halt, darüber, was alles falsch ist in unserm Land, und ob und wie man etwas ändern könnte. Einige von uns sind einem Spitzel aufgesessen. Meine Zimmernachbarin im Studentenheim ist abgeholt worden. Ihr Verlobter studiert hier an unsrer Uni; er mußte gewarnt werden, und weil es bei mir vielleicht nicht auffällt, wenn ich herfahre, habe ich das übernommen."
„Wäre es nicht einfacher gewesen, zu telefonieren oder ein Telegramm zu schicken?" fragte ich.
„Wirklich, Monika, soviel Naivität gehört verboten!" tadelte mich Erika. „Post und Telefon werden überwacht, wenn du erst mal auf der Liste bist. Hast du denn keine Ahnung, wie es in unserm Staat zugeht?"
„Stehst du auch unter Verdacht?" erkundigte sich Mutter.
„Ich weiß es nicht. Wir hoffen, daß die Geschnappten dicht halten."
„Es wäre eine bodenlose Gemeinheit, wenn sie's nicht täten!" warf ich ein.
„Könntest du für dich garantieren, unter Folter nicht auszusagen?" Erika sah mich zornig an.
„Folter! Wir leben doch nicht im Mittelalter!" protestierte ich.
„Aber du lebst hinter dem Mond!" entgegnete sie scharf. Sie wandte sich wieder zu Mutter: „Verstehst du, warum alles ganz natürlich und normal aussehen muß? Ich bin zu Monikas Fest gekommen, fahre nach dem Wochenende wieder nach München, studiere dort brav weiter und kehre zum nächsten Semester hierher zurück, um mein Examen zu machen. So habe ich es mit Vater besprochen."
„Ich bin traurig, daß ihr mich nicht in euer Vertrauen ziehen wolltet."
„Nur dir zuliebe, Mutter!" Erika liefen plötzlich die Tränen übers Gesicht. „Weil Mitwissen gefährlich ist. Man kann dadurch selbst in Bedrängnis geraten."
„Außerdem", sagte Vater hart, „stellt jeder Mitwisser ein Risiko dar. Die Gestapo weiß, wie man an Informationen kommt. Es muß nicht immer Folter sein. Es gibt andere Wege, Drohungen und Repressalien oder heimtückische Bespitzelungen, Belohnung von Denunziationen und was sonst noch alles."
Er sah mich unglücklich an. „Daß nun auch du noch da hineingeraten bist, beunruhigt mich schrecklich."
„Das ist ein Preis, den wir für unser Familienleben zahlen müssen." Mutter nickte mir zu, während sie es sagte, und wandte sich dann an Vater.
„Was würde es für Erika bedeuten, wenn sie verraten würde?"
„Schon die geringste Kritik kann als Wehrkraftzersetzung ausgelegt werden", antwortete Vater, „und Gespräche darüber, wie man etwas ändern könnte, gelten als Vorbereitung zum Hochverrat. Auf beides steht Todesstrafe."
„Durch Erhängen oder Enthaupten", fügte Erika bei.
„Kind, wie konntest du dich auf so etwas einlassen!" stöhnte Mutter.
„Und ihr ... Wie konntet ihr weiterleben, als ob nichts geschehen wäre, damals, als Bücher verboten und Künstler ins Exil gedrängt und jüdische Geschäfte zerstört wurden?! Wie konntet ihr zulassen, daß die Juden weggeholt und in Lager gesperrt wurden?! Und sagt bloß nicht, ihr wußtet nichts davon, denn ich selbst kann mich daran erinnern, wie die Synagoge gebrannt hat."
„Wir sind hineingeschlittert, Kind, ob du das verstehen kannst oder nicht", antwortete Vater. „Als alles anfing, damals, in der Weimarer Republik, waren wir des Parteiengezänks und der offensichtlichen Unfähigkeit der meisten Politiker so müde!
Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, alle auf den Markt kommenden politischen Programmschriften zu studieren. Wir hätten vielleicht etwas von dem wissen können, was mit Hitler auf uns zukam, etwas, nicht alles, und das Schlimmste sicherlich nicht. Wir hätten Hitlers Buch lesen können, aber diese Lektüre reizte mich nicht. Es gab so viele Parteiredner und Propagandaparolen, zuerst schien Hitler nur einer unter anderen, und als sich abzeichnete, daß er so etwas wie ein Hoffnungsträger für viele geworden war, neigten wir dazu, ihm eine Chance zu geben. Er versprach die Bildung einer handlungsfähigen Regierung und die Abschaffung der wirtschaftlichen Notlage. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, was das damals bedeutete. Man räumte ihm ein, daß er im Anfang mit scharfen Maßnahmen durchgreifen müsse, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Und er hatte Erfolge! Wie die zustande kamen, lag nicht auf der Hand - auch wir hatten keinen Durchblick—, und den allermeisten Menschen genügte es damals, daß endlich für Arbeit und Brot und Ruhe und Ordnung gesorgt war. Die demokratischen Politiker hatten sich mißliebig gemacht, die Liquidierung der Demokratie tat kaum jemand weh. Kurze Zeit nachher, als einigen so langsam die Augen aufgingen, war es schon zu spät. Ihr seht ja selbst, wie es denen geht, die Mißbilligung erkennen lassen. Was würde sich ändern im Land, wem würde es konkret nützen, wenn Erika und ihre Freunde sterben müßten?!" Tränen.
»Bisher dachte ich, ihr hättet es nicht soweit kommen lassen dürfen, aber wie Vater es erklärt, war ja von Anfang an alles verfahren."-
»Es würde wenigstens dokumentieren, daß nicht alle Deutschen die Verbrechen gutheißen, die bei uns geschehen!" sagte Erika heftig. „Es ist leicht, zu verurteilen, wenn man die Dinge ohne profundes Wissen der Zusammenhänge sieht", sagte Vater. „Aber wenn man mitten drin steckt, hilft das Urteil von außen gar nichts. Vielleicht werden Jahrzehnte vergehen müssen, bis man sachlich darüber reden kann, wie alltägliches Verhalten odgar ehrliche Überzeugung zum Schuldigwerden führten."
»Wer würde schon groß davon erfahren?" fragte Mutter, und ich hielt Erika vor: „Du versuchst ja selbst, jeden Verdacht von dir abzulenken." „Im Augenblick«, erklärte Mutter vehement, „geht es mir um nichts anderes als darum, unser Kind zu retten."
Ihre Schultern sackten nach vorn. »Ja", sagte sie leise, »ich habe Angst. Das scheint alles so sinnlos, sich quälen und umbringen zu lassen, wenn doch keiner davon aufgerüttelt wird." „Verdammt nochmal!" platzte ich heraus. „Ich komme mir immer noch vor wie in einem Alptraum! Das kann doch nicht wahr sein, daß hier bei uns zu Hause jederzeit ein Geheimpolizist schellen und Erika verhaften kann, nur weil sie meint, daß unsre Regierung Fehler macht!"
»Aufgerüttelt wären wir; wir sind es ja jetzt schon", sagte Mutter, »aber aufgerüttelt wozu?, frage ich dich. Wenn ein Aufgerüttelter seine Stimme erhebt, ist er am nächsten Tag selber mundtot. Was wirfst du uns also vor, Kind?" „Du wirst dich damit abfinden müssen", sagte Erika schluchzend. „Und wenn du dich nicht damit abfinden willst, kann es dir gehen wie meinen Freunden- und vielleicht auch mir", fügte sie leise bei.
„Ich weiß es bald auch nicht mehr." Wieder kamen Erika die „Und für einen solchen Staat kämpfen unsre Soldaten?" fragte ich fassungslos.
„Das kompliziert ja alles so furchtbar", stellte Vater fest. „Man müßte wünschen, daß wir den Krieg verlieren - aber kann man das wollen?"
„Meine Freunde denken, es wäre das kleinere Übel", bemerkte Erika.
Mutter wandte sich heftig zu ihr hin. „Sie haben keine Erfahrung mit einem verlorenen Krieg. Wir haben sie."
„Und diesmal würde alles noch hundertmal schlimmer", ergänzte Vater.
Im gleichen Augenblick schellte es an der Haustür. Wir fuhren alle erschrocken zusammen.
»Kurz vor elf!" sagte Vater, der die Uhr gezogen hatte. »Wer will jetzt etwas von uns, um diese Zeit?!"
Es war ein Nachbar, dem aufgefallen war, daß in einem unserer oberen Zimmer das Verdunklungsrollo nicht heruntergelassen war. Wir konnten froh sein, daß er es bemerkt hatte. Wenn
ISBN: 9783765516283
Format: 21 x 14 cm
Seiten: 400
Verlag: Brunnen
Erschienen: 1998
Einband: Hardcover
Wenn's auch nicht immer leicht war, Mutter! Elsbeth Walch
Mutters Kindheit im Pfarrhaus und im Töchter-Institut
Über die frühen Jahre meiner Mutter weiß ich viel, denn sie hat immer gern davon erzählt, hat ihren Kindern und Enkelkindern alles so lebendig vor Augen gestellt, daß wir uns fast einbilden kohnten, wir hätten es selbst miterlebt. Und ich muß auf der Hut sein, daß ich die Bilder nicht gar zu breit ausmale.
Ich sehe vor mir das Pfarrhaus in Ispringen bei Pforzheim mit großem Garten; ein hübsches, kleines Mädchen mit kastanienbraunen Locken, nach fünf Brüdern die Freude und das Glück ihrer nicht mehr ganz jungen Eltern. Ein hingebungsvolles Puppenmütterchen; wenn Papa nach Tisch ein kleines Nickerchen machen will, kann es geschehen, daß sein ganzes Sofa voller Puppen sitzt, eine neben der andern. Aber natürlich ist Anna sofort bereit, ihm Platz zu schaffen - sie ist fast unwahrscheinlich lieb und folgsam. Wilhelm allerdings, der jüngste der Brüder, findet, das sei keine Kunst, wenn man von jedermann verwöhnt und mit Samthandschuhen angefaßt wird. Er ist im Alter am nächsten und kommt noch einigermaßen als Spielgefährte in Frage, doch da geht es nicht ohne Reibereien ab.
»Mamaaa! Der Wilhelm streckt die Zunge gegen mich raus!« »Aber Bub, du sollst doch nett mit deinem Schwesterlein umgehen!«
»Aber hör mal, Mama - darf ich mir nichtmehr die Mundwinkel ablecken?!«
Und eifrig läßt er die Zungenspitze nach allen Richtungen aus dem Mund schnellen und blinzelt dabei unverschämt der entrüsteten kleinen Schwester zu. Er ist der Spaßvogel der Familie, und Anna hat manches von ihm auszustehen.
Aber einmal hat auch die kleine Anna etwas Schlimmes angestellt. Zuerst war es zwar, was man »ein gutes Werk« nennen könnte: Anna hat im Auftrag ihrer Mama eine alte Frau besucht, die von jedermann nur die »Witfrau« genannt wird; sie soll ihr zum Weihnachtsfest Gebäck, eine Tüte Kaffeebohnen und einen warmen Unterrock bringen, denn die Frau ist sehr arm. Anna macht solche Besuche gern, und bei der »Witfrau« noch lieber als sonstwo; denn in deren Häuschen starrt alles vor Schmutz— kaum daß die verkrusteten Fensterscheiben noch Licht einlassen.
Anna, die aus einem blitzsauberen Heim kommt und Reinlichkeit als Lebensnotwendigkeit empfindet, genießt gleichwohl den heimlichen Schauder, wenn sie mitten in dieser Küche steht, selbst frischgewaschen und nett gekleidet; mit großen Augen blickt sie um sich und nimmt alles in sich auf, während die »Witfrau« ihr Körbchen leert und Dankesworte brabbelt. Gleich wird sie wieder draußen stehen und die klare Winterluft tief einatmen. Aber da plötzlich hat die »Witfrau« eine Idee, ihr Runzelgesicht unter den zottigen Haarsträhnen verklärt sich. Sie lacht - Anna sieht die zwei schwarzen Zahnstümpfe:
»Ich hab was für dich, Annäle - ganz was Feines! Hab frisch Brot gebacken, es ist noch warm, und du kriegst das Beste davon, das Knäusle!« Ja, so ein Knäusle, das ist schon was Gutes, nur nicht von der Witfrau, nicht aus dieser klauenähnlichen Hand mit einem Netzwerk von eingefressenem Schmutz! Sehr zögernd greift Anna nach dem dargebotenen Brot und möchte jetzt gehen. Aber die »Witfrau« will sich den Anblick nicht entgehen lassen, wie dem Annäle das Knäusle so prächtig schmeckt, und vorher gibt sie auch den Korb nicht zurück. Das Kind steht wie gelähmt, keine Ausrede fällt ihm ein, aber es kann keinen Bissen zu sich nehmen. Dem Weiblein dauert die Sache zu lange, es geht für einen Augenblick in die Kammer nebenan, um die Gaben aus dem Pfarrhaus auf ihrem Bett auszubreiten. Hilfesuchend schaut sich Anna um. Dort in der Ecke steht das hölzerne Butterfaß, und hastig flüchtet sie dorthin, bricht das Knäusle in Stücke und wirft sie in das Faß.
Als die »Witfrau« wieder in die Küche tritt, wundert sie sich: das Kind steht hochrot mit leeren Händen, greift schnell nach seinem Korb und schießt davon. »Hat's dir geschmeckt, Annäle?« Darauf bekommt das Weiblein keine Antwort mehr. Doch am Abend kommt die »Witfrau« ins Pfarrhaus gehumpelt, lamentierend stellt sie ihren Henkelkorb auf den blanken Küchentisch und packt aus. Sie hat gebuttert, und nun ist die ganze Butter verdorben, all&s mit Brotkrumen vermischt. Wie soll sie das zum Markt bringen? Die Frau Pfarrer wird herbeigerufen, und Anna, die kleine Missetäterin, drückt sich mit zerknirschtem Gesicht auf die Seite. Aber
Mama macht kein Aufhebens. »Sie können die Butter hierlassen, Witfrau, wir werden sie auslassen und zum Kochen verwenden. Natürlich bekommen Sie den vollen Preis ... « Hochbefriedigt zieht das Weiblein ihres Weges, nun ist ihr sogar der Marktgang abgenommen. Anna aber schmiegt sich dankbar an die Frauengestalt, die selbst fast so zart und zerbrechlich ist wie ein Kind.
Auch der Papa liebt sein Nesthäkchen zärtlich, auch wenn er nicht viel Zeit übrig hat. Anna bekommt ihre ersten Klavierstunden, und von Zeit zu Zeit darf sie dem Papa vorspielen und ihre »Fortschritte« zeigen. Sie bringt es bis zum »Fröhlichen Landmain« er klingt mit der Zeit ganz annehmbar und schließlich geradezu flott. Aber wenn die Kleine sich mit was Neuem herumplagt, dann sagt Papa plötzlich mitten in das Geholper: »Weißt du was, Anna - jetzt spielst du mir noch den >Fröhlichen Landmann!« Dann blättert Anna erleichtert zurück und legt los - das geht schon wie von selbst. Sie bekommt ihr Lob, darf auf PapasSchoß klettern und den Schaum von seinem Bier abtrinken. Sie schüttelt, sich, Papa und Mama lachen, und alle sind sehr glücklich.
Nach der Grundschule muß Anna auswärts zur Schule, jeden Tag mit der Bahn nach Pforzheim. Sie fürchtet diese schrecklichen Waggons mit den Abteiltüren, die für Kinderhände so schwer zu öffnen sind. Bruder Wilhelm kann das Necken niemals lassen, er witscht gerade vor der Schwester ins Abteil und schlägt die Tür hinter sich zu. Was kann es ihr schaden, ein paar Augenblicke ängstlich und ratlos draußen auf dem Bahnsteig zustehen- erwird schon rechtzeitig wieder aufmachen. Aber dazu kommt, er nicht.
Da steht wie aus dem Boden gestampft ein Schulkamerad von Wilhelm: Theodor, der Lehrersbub. Und ehe das kleine Mädchen sich's versieht, hat er die Tür für sie geöffnet, er steht daneben ohne ein Wort, aber er wacht darüber, daß die Kleine ungehindert einsteigen kann Niemand wird es wagen, sie beiseite zu drücken oder ihr die Schultasche aus der Hand zu stoßen. Theodor ist immer zur Stelle, wenn Anna in irgendeine Bedrängnis gerät. Sie weiß es und verläßt sich unbekümmert darauf. Sie bedankt sich niemals, höchstens mit einem Lächeln. Aber er wartet nicht auf Dank, seine Beschützerrolle ist ihm eine Selbstverständlichkeit.
'In Annas Klasse sind zwei kleine Schwestern aus der Konditorei Katz, deren Mama ist mit Annas Mama befreundet. Und wenn immer sich Gelegenheit gibt, darf Anna die »Kätzchen« nach Haus begleiten, darf mit ihnen im Cafe auf roten Plüschpolstern
sitzen und bekommt Leckereien vorgesetzt - Mohrenköpfe oder Kremtörtchen, die etwa am Vortag übriggeblieben sind. Und früh entwickelt sich Anna selbst zu einem begeisterten Naschkätzchen!
Ja, die Meine Anna ist ein glückliches Kind, fast ungetrübt verlaufen die ersten Lebensjahre. Und Bruder Wilhelm hat so unrecht nicht: das Leben scheint sie ungebührlich zu verwöhnen. Aber es wird so nicht bleiben
Da kommt jener Sommertag, an dem das heitere Licht ihrer Kindheit jäh erlischt, ein Tag, dessen Schrecken sie lange begleiten wird. Es ist ein Ferientag. Der Papa ist schon tags zuvor mit Bruder Wilhelm zu einer Bergwanderung in die Vogesen aufgebrochen. Eine Base ist bei Anna zu Besuch, vergnügt spielen die kleinen Mädchen im Garten, kommen Hand in Hand schwatzend und lachend zum Pfarrhaus gelaufen. Da steht die Mama oben am offenen Wohnzimmerfenster, blickt ihnen entgegen und legt den Finger auf die Lippen. Erschrocken verstummen die Mädchen, und Anna weiß sofort: etwas Schreckliches muß geschehen sein. So hat sie ihre Mama noch nie gesehen.
Eine Depesche aus den Vogesen ist gekommen, von Wilhelm: »Papa ernstlich erkrankt.« Annas ältester Bruder Otto, zu dieser Zeit schon Vikar, wird nach Haus gerufen, um seine Mutter zu dem Berghotel zu begleiten. Sie reisen ab, sprechen kaum etwas auf dem Weg. Als sie das letzte Stück Weg zur Höhe zu Fuß zurücklegen, kommen ihnen fremde Menschen entgegen, die unterhalten sich lebhaft darüber, im Hotel liege ein Professor, den ein Herzschlag tödlich getroffen habe. Otto und seine Mutter bleiben stehen. »Ein Professor?« fragt Otto.
»Nein, ich glaube ein Pfarrer«, berichtigt ein anderer.
Da sinkt die Mutter bewußtlos in die Arme ihres Sohnes. Anna wird es nie vergessen: Gesund und fröhlich hatte der Papa Abschied genommen. In einem Zinksarg kehrte er zurück, im Güterwagen, von Bruder Otto begleitet. Gegen Mitternacht kommt der Zug nach Ispringen, Anna steht an Mamas Hand unter
der Tür des Pfarrhauses. Und alle Glocken fangen an zu läuten. Ein halbes Jahr später: Sie wohnen nicht mehr im Pfarrhaus, sondern in einer Mietwohnung in Duilach. Nur Anna mit Mama. Wilhelm steht vor dem Abitur und durfte bei einer befreundeten
Familie in Pforzheim bleiben. Anna sitzt am Bett ihrer Mutter, die mit Lungenentzündung darniederliegt. Eine liebe alte Dame, die im selben Haus wohnt, kümmert sich um die beiden, setzt sich zu ihnen ans Krankenbett. Und Mama erklärt in aller Ruhe, was geschehen soll, wenn sie nun bald nicht mehr da sein wird. Die Hausgenossin fragt - und Tränen zittern in ihrer Stimme: »Ist es nicht schrecklich für Sie, Frau Dörflinger, zu denken, daß Ihre kleine Anna allein zurückbleiben soll?«
»Nein«, gibt die Mama ruhig zur Antwort, »der Vater im Himmel wird besser für sie sorgen, als ich es selber tun könnte.« Auch dieses Wort wird Anna begleiten - unendlich schmerzlich und unendlich tröstlich.
Zwölf Jahre alt war Anna Dörflinger, als sie nach dem Wunsch ihrer Mutter in das Töchter-Institut nach Korntal kam. Innerhalb eines einzigen Jahres hatte sie beide Eltern verloren, hatte all die Tränen geweint, die ihr in den früheren Jahren erspart geblieben waren. Während der Ferien hielt sie ihren Einzug ins Heim, da fiel das Eingewöhnen leichter. Nur wenige Mädchen waren da, Mis-sionarskinder, die nicht nach Hause fahren konnten. Alle waren gut und liebevoll zu Anna, auch die Lehrerinnen und der Leiter, Rektor Decker, den sie bald wie die andern fürchtete und auch verehrte. Wie hätte man auch anders als gut sein können zu dem zarten, lockigen Mädchen, dem man ansah, daß sie nachts oft ins Kopfkissen weinte. Auch gab sich Anna die größte Mühe, mit Wohlverhalten die allgemeine Zuneigung zu gewinnen.
Immerhin - ein paar »Untaten«, die sie begangen, wußte sie später doch ihren Enkelkindern zu berichten, nicht ohne nachträgliche Beschämung, und sie erwartete, die Kinder würden darüber hell entsetzt sein. Da war einmal die Geschichte im gelben Schlafsaal: Jeden Abend kam eine Lehrerin, um mit. den Schülerinnen zu beten und ihnen gute Nacht zu wünschen. Einmal aber machten die mutwilligen jungen Dinger miteinander aus, der Lehrerin einen Streich zu spielen. Sie kommt also zur gewohnten Zeit in den Schlafsaal, ein bereits aufgeschlagenes Gesangbuch in der Hand.
Beim schwachen Schein eines Lämpchens liest sie einen Vers. Will dann von Bett zu Bett gehen und jedem gute Nacht sagen - aber alle Betten sind leer. Die Mädchen haben sich doch wahrhaf-
10
tig in Schränken oder unter Betten verkrochen, wo sie vor unterdrücktem Gelächter fast platzen. Der armen Anna allerdings' klopft das Herz jämmerlich - sie hat nur mit größter Überwindung sich an dem Unfug beteiligt. Die Lehrerin, vor Zorn außer sich, verkündet mit erhobener Stimme, die Sache werde ein Nachspiel haben. In fünf Minunten wolle sie wiederkommen, dann müsse alles in den Betten sein. Am nächsten Tag kam das Nachspiel: Alle Übeltäterinnen mußten zum Rektor kommen, es erfolgte eine sehr ernste Strafpredigt, und zum Schluß nahm der Herr mit bekümmerter Miene einen Rohrstab aus seinem Pult und verabfolgte jeder eine sogenannte »Tatze«, quer über die ausgestreckte Handfläche. »So, und nun geht, so kommt ihr noch recht zum Unterricht. Nur du, Anna Dörflinger, bleibst hier.« Anna blieb zurück, tief erschrocken. Hatte sie sich denn noch schlimmer vergangen als die andern, sollte noch eine besondere Strafe sie treffen? Doch als die Tür sich hinter den andern geschlossen hatte, da trat der Herr Rektor auf Anna zu, legte ihr, väterlich die Hand auf den Kopf und sagte mit ernster Stimme: »Mein Kind, wenn dich die bösen Mädchen locken, so folge ihnen nicht.« -
»Es war ein unvergeßlicher Augenblick in meinem Leben«, erzählte sie, »eindrucksvoll und feierlich wie eine Segnung. Aber hört mal, Kinder, was gibt es denn dabei zu lachen?«
Ein anderes Mal passierte es Anna, daß sie ihrer liebsten Lehrerin, Fräulein Paret, eine tiefe Kränkung zufügte. Die Klasse war spazierengegangen, nur Anna, die sich nicht wohl fühlte, hatte die Erlaubnis bekommen, zu Hause zu bleiben. Lesend saß sie in einer Laube im Garten. Nahe bei der Laube war ein Rondell mit Tulpen, die in bnter Pracht erblüht waren. Plötzlich hörte Anna lebhafte Stimmen und rasche Schritte durch den Garten näher kommen. Sie verbarg sich ein wenig und beobachtete, was da vor sich ging. Zwei junge Lehrerinnen hatten irgendeinen scherzhaften Streit, eine verfolgte die andere und versuchte sie zu haschen, lachend und kreischend hetzten sie um das Rondell. Bis die Ältere von ihnen japsend innehielt und rief: »Der Gescheiteste gibt nach!« Diese Redensart war auch Anna geläufig, und unwillkürlich fügte sie aus ihrer Verborgenheit keck die zweite Hälfte hinzu: »Und der Esel macht weiter!«
Die beiden Lehrerinnen erstarrten vor Verblüffung. Und ebenso erstarrte Anna vor Entsetzen über ihre eigene Unver schämtheit. Dann trat Fräulein Paret in die Laube, maß das Mädchen mit eisigem Blick. Anna saß wie gelähmt, brachte kein Wort hervor. »Dörflingerle - du?« fragte die Lehrerin nur. Holte aus und versetzte ihr eine schallende Ohrfeige. Gleich darauf war sie verschwunden. Anna aber blieb zurück wie vernichtet. Was hatte sie da angerichtet - sie, die doch sonst niemals frech war? Die Tränen liefen ihr stromweis über die Backen.
Und dann auf einmal stand Fräulein Paret wieder vor ihr, sie schien unsicher und bedrückt. Jetzt konnte Anna reden, sie bat unter Schluchzen um Verzeihung. Die Lehrerin aber setzte sich ohne ein Wort neben sie auf die Gartenbank, umschloß das weinende Kind mit beiden Armen und gab ihr einen Kuß. »Oh, wie erleichtert und glücklich war ich da«, erzählte die Großmutter später. »Wie hab-ich das Fräulein Paret geliebt - und nie wieder hat sich unser Verhältnis im geringsten getrübt. Aber ich möchte wirklich wissen, was ihr daran komisch findet.« Sie selbst hatte Tränen der Rührung in den Augen.
'Aber die Kinder kicherten nur sehr vergnügt.
»Ach Großmama, sei nicht böse - aber wenn du sehen könntest, wie es heute zwischen Lehrern und Schülern zugeht! Die Zeit der Schreckensherrschaft ist vorbei, sie muß schauderhaft gewesen sein!«
»Schauderhaft? Aber nein, ganz und gar nicht! Schauderhaft' finde ich, wie man jetzt in den Schulen miteinander umgeht - wenn eure Berichte wirklich stimmen. Wir haben unsere Erzieher geachtet und geliebt, und ich werde immer in Dankbarkeit an sie denken. Wir haben durch sie auch gelernt, in rechter Weise zum Vater im Himmel aufzusehen.« Die Kinder verstummten, ein bißchen nachdenklich. Vielleicht hatte das Vergangene, das so siegreich »überholt« war, doch auch sein Gutes gehabt
Nach der »Mittleren Reife« verließ Anna das Töchter-Institut.
Ein Bild aus dem Familienalbum 5
Von Vaters Kindheit und Jugendzeit 12
Mutters Kindheit im Pfarrhaus und im Töchter-Institut 15
Mutter macht Erfahrungen und findet einen Beruf 22
Begegnung. Eine altmodische Liebesgeschichte 35
Beginn des gemeinsamen Lebens 48
Die Familie wächst und entfaltet sich. 54
(Unsere Nürtinger Jahre)
Familienbande lösen sich. 78
(Unsere Heilbronner Jahre)
Vaters letzter Einsatz und Feierabend 97
Mutters Witwenzeit 107
CIP-Kurztitelaujnahme der Deutschen Bibliothek
Waich, Elsbeth:
Wenn's auch nicht immer leicht war, Mutter / Elsbeth Walch. - Lahr-Dinglingen:
Verlag der St.-Johannis-Druckerei C. Schweickhardt, 1982.
(Edition C: C; 62 Paperback)
NE: Edition C / C
ISBN 3501001150
Edition C-Paperback Nr. 55362 (C 62)
Umschlagfoto: Eigentum der Verfasserin
© 1982 by Verlag der St.-Johannis-Druckerei C. Schweickhardt
Lahr-Dinglingen
Gesamtherstellung:
St.-Johannis-Druckerei, 7630 Lahr-Dinglingen
Printed in Germany 7828/1982
An die Eltern meiner Enkelkinder, G.C. Willis
ALTES TESTAMENT
ADAM
Laßt uns mit der Geschichte Adams beginnen. Wir kennen die Ursache des Falles von Adams Erstgeborenem wohl. „Ihr werdet sein wie Gott" hatte der Versucher Eva versprochen, und Eva und ihr Mann waren beide gefallen. Und was war die Ursache ihres Falles? Der Ungehorsam. Der Ungehorsam gegenüber dem klaren Wort Gottes. Sie waren bewußt ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes, das sie gut kannten und durchaus verstanden. Auch wir dürfen sicher sein, daß Ungehorsam gegen dieses Wort, auch wenn er unseren Weg hier müheloser zu machen scheint, Leid bringen wird, nicht nur für uns selbst, sondern Leid - und vielleicht sogar Verderben - für unsere Kinder.
Vielleicht steht der Ungehorsam, die erste Ursache des Verderbens, die uns hier vor Augen geführt wird, noch immer an erster Stelle als der hauptsächlichste Grund für den Untergang christlicher Familien. Darf ich euch bitten, wenn ihr euren Meister liebhabt, wenn ihr eure Kinder liebhabt, dem Worte Gottes voll, von Herzen, mit Liebe und ohne Zögern gehorsam zu sein? Das ist der einzige sichere Weg hienieden. Was aber war die Ursache des Ungehorsams unserer ersten Eltern? Ich denke, die erste Ursache war der Zweifel, den 'die Schlange ausgestreut hatte: „Hat Gott wirklich gesagt"?
Möge der Herr Selbst in diesen Tagen, wo es als fortschrittlich gilt, Sein Wort zu bezweifeln, uns ein solch unerschütterliches Vertrauen zu Seinem Wort bewahren, daß nichts auch nur im geringsten unseren Glauben zu beunruhigen vermag.
Es gibt gewisse Dinge, die wir fliehen sollen: „ Die jugendlichen Lüste aber fliehe" (2. Tim z, 22). „Fliehet den Götzendienst" (i. Kor 10, 14). „Fliehet die Hurerei" (z. Kor 6, iS). „Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge" (i. Tim 6; ii). Soviel ich weiß, wird uns aber nirgends gesagt, daß wir vor dem Teufel fliehen sollen. Im Gegenteil, wir lesen:
„Widerstehet dem Teufel, und er wird von euch fliehen" (Jak 4,7). Ich glaube, daß es niemals einen Zweifel am Worte Gottes gegeben hat oder geben wird, dessen Urheber nicht der Teufel ist. Widerstehe ihm, und er wird von dir fliehen.
Wirsehen, daß Eva ein besonderes Lockmittel angeboten worden war, um sie ungehorsam zu machen. „Ihr werdet sein wie Gott". Der Versucher bietet Eva einen höheren Platz an als den, den Gott ihr gegeben hatte. Sehen wir nicht genau den gleichen Versuch überall um uns her bei Eltern? Suchen nicht die meisten Leute, sich „geiischaftli& zu verbessern"? Suchen nicht 'die meisten, einen höheren Platz in der Welt zu erlangen, und wenn schon nicht für sich selbst, so doch zumindest für ihre Kinder?
Es ist traurig, daß es gesagt werden muß: auch christliche Eltern sind nicht gefeit gegen diese List des Teufels, mit der er uns und unsere Familie bergab zu führen sucht. Wir sehen das allenthalben. Unsere Eltern waren zufrieden mit einem einfachen Häuschen. Wir müssen ein vornehmes, schönes Haus haben. Unsere Eltern waren damit zufrieden, zu Fuß zu gehen; wir müssen einen Wagenhaben. Unsere Eltern waren zufrieden mit rauhen Matten, wir müssen schöne und kostbare Teppiche haben. Ihr sagt, die Zeiten haben sich geändert. Wahrhaftig, das haben sie. „Es gab Riesen auf Erden" zur Zeit unserer Vorfahren, nämlich in den Dingen Gottes; heute aber - Schwächlinge.
Es ist dasselbe Übel, an dem Adam krankte. Selbst unsere Tageszeitungen bringen Karikaturen davon: Wer hat noch nachts vom „Schntthalten mit dem Nachbarn" gesehen oder gehört? Es belustigt uns vielleicht nur, wo es uns vielmehr eine Warnung hatte sein sollen, denn auch war sind oft in Versuchung, „Schritt zu halten mit unseren Nachbarn und Bekannten Wir kennen es nicht ertragen, daß man uns für anders hält; und doch hat Gott in Seiner Gnade einen Unterschied gemacht, wir sind anders Ich glaube, daß das Vergessen dieses Unterschiedes, diese Begierde der Eltern Kains, einen ..höheren Platz einzunehmen als den, auf den Gott sie gestellt hatte, eine der Ursachen für Kams Verderben und
Das Neue Testament gibt uns etwas mehr Licht in dieser Sache. „Weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht" (1.Joh 3, za). Er war eifersüchtig auf seinen Bruder, und „wer kann bestehen vor Eifersucht" (Spr 27, 4)? Mißgunst hat manchen Heiligen Gottes zu Fall gebracht. Es würde die Mühe lohnen, wenn ihr eure Bibel nehmet und eine gute Konkordanz und einmal nachsehet, was der Herr über Neid und Eifersucht zu sagen hat; aber begnügen wir uns jetzt mit dieser einen Stelle: „Denn wo Neid (Eifersucht) und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat" (Jak 3, 16). Ja, es war Neid, was Keins Mordtat zugrunde lag. Und es ist der Neid, der auch uns einen höheren Platz in der Welt suchen läßt als den, den Gott uns gegeben hat. Deshalb, meine lieben, achtet darauf, daß ihr allen Neid ablegt (1.Petr 2,1).
Wie wenig dachte Eva, als sie die verbotene Frucht pflückte, daran, was für eine unsagbar bittere Frucht sie sich selbst bereitete, - eine Frucht, die sie mit einem Schlag zweier Söhne beraubte. Und wie leichtfertig und unbekümmert mögen auch wir selbst • in irgendeine bewußte Sünde einwilligen, die uns und unseren Kindern Jahre des Kummers und des Leides einbringen mag. Seien wir auf der Hut!
Aber es wird uns noch ein weiterer Hinweis gegeben, daß In Adams Familie nicht alles so war, wie es hätte sein sollen. Aus 1. Mo 4, 1 ist zu entnehmen, daß es Eva war, die Kain seinen Namen gab. Dies mag so ziemlich mit der heutigen Praxis übereinstimmen, aber wir fürchten, es steht im Gegensatz zu Gottes Ordnung. Es ist wie ein Strohhalm, der uns sagt, von woher der Wand an Adams Haus wehte Ihr erinnert 'euch, daß Eva es war, die Adams Fall herbeiführte, und augenscheinlich behielt sie in jenem ersten Haushalt die Führung. Wenn wir zu Seth kommen in i. Mo 5, 3, so sehen wir, daß sich alle Dinge geändert haben. „Und Adam lebte hundertdreißig Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth". Adam und Eva hatten ihre Lektion gelernt, und wir finden Adam nun an seinem richtigen Platz
Und welcher Platz war das für ihn und für Eva? Ich denke, 1. Petr 3,4 5.6 diese-Frage beantwotet:
„der unverwesliche Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Denn also schmückten sich auch einst die heiligen Weiber, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren: wie San dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte". Und zum anderen seid ihr es, die jungen Gattinnen und Mütter, an die ich schreibe, die ‚.che Haushaltung fuhren" (i Tun 5,14)
Das griechische Wort, das hierfür gebraucht wird, ist besonders aufschlußreidi. Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, in der es vorkommt, und buchstäblich übersetzt würde ich wahrscheinlich lesen „die Hausherrin sein". Es ist ein einziges Wort, ein Verb. Das entsprechende Hauptwort ist zwölfmal (alle in den ersten drei Evangelien und stets in bezug auf den Vater) gebraucht und wird übersetzt mit „Meister des Hauses", „Herr des Hauses" (Hausherr) etc. Der Gedanke in dem Vers in Tun ist einmal wunderschön wie folgt umschrieben worden: „Es bedeutet eine königliche Souveränität, die diejenige des Hausherrn nicht antastet". Vielmehr regieren sie beide miteinander in dein kleinen Bereich, den Gott ihrer Obhut anvertraut hat.
lind vielleicht sehen wir etwas von dieser Einheit der Gesinnung und Handlung in Verbindung mit dem Neugeborenen Seth, denn in i. Mo 4, 25 scheint es zwar, als ob Eva wiederum die Führung bei der Namensgebung des Kindes ergriffen hätte, während jedoch in Kap. y, 3 dieselben Worte von Adam gebraucht werden.
Das Buch der Sprüche würde es verdienen, mehr als nur beiläufig angeführt zu werden, denn diese liebliche Harmonie zwischen Vater und Mutter ist dort vortrefflich dargestellt durch die Tatsache, daß von den vierzehn Malen, in welchen die Mutter erwähnt ist, es zwölfmal um Vater und Mutter zusammen geht
Anscheinend war diese liebliche Einheit in Adams Familie über lange Jahre hin nacht vorhanden, und der Gegensatz zwischen 1. Mo 4, i und g, 3 gibt uns eine ernste Belehrung. Eva „führte die Haushaltune wirklich, aber die ausgleichende Ermahnung von m. l'etr 3
finden wir bei ihr nicht beherzigt. Es ist erquickend zu sehen, daß die Lektion zuletzt schließlich doch gelernt worden war, und Seth, die Frucht und der Beweis dieser so mühsam gelernten Lektion, ist der erste in der langen Reihe des Samens des Weibes, die in jenem herrlichen Samen gipfelte, der den Kopf der Schlange zermalmte.
LAMECH
Der nächste Elternteil, der uns in der Schrift vorgestellt wird, ist Lamech, „der siebente von Adam", aber der siebente in .der Linie von Kam, nicht von Seth Beachte zunächst, daß Lamech der erste ist, von dem die Bibel erwähnt, daß er mehr als eine Frau hatte. Dieser Brauch hat also seinen Ursprung bei einem Nachkommen Kains, nicht Seths.
Von manchen Eltern hört man sagen: „Sie können wirklich stolz sein auf ihre Familie". Lamech, Ada und 7illa (seine zwei Frauen) waren solche Eltern. Die Jungen wurden anscheinend zu nützlichen, arbeitsamen Männern erzogen, und ihre Schwester Naama (,‚Lieblichkeit") vervollständigt dieses Bild einer Familie im Erdenglück. Adas beide fl Söhne Jabal und Jubal waren wohl die Väter derer, die in Zelten wohnen und Vieh halten, und derer, die mit der Laute und Flöte umgehen können, während Tubalkain (was so viel wie „Abkömmling von Kair" bedeutet - zur Erinnerung an seinen berühmten Vorfahren) der Vater des metallverarbeitenden Gewerbes war, eines großen und wichtigen Industriezweiges, der immer weiter an Bedeutung zunimmt. Ja, wenn Lamech den deutlichen Erfolg im Leben jedes seiner vier Kinder beobachtete, mochte er wohl (vom weltlichen Standpunkt aus) ein stolzer und glüdclicher Mann gewesen sein.
Aber der Schein trugt, denn Lamech hatte, ebenso wie sein Stammvater, dessen Namen er in einem seiner söhne fortleben lassen wollte, eine Sunde, die ihn verfolgt zu haben scheint, und Sünde nimmt die Freude aus jedem Leben Wie Kein war Lamech ein Mörder, und die Angst vor der Rache lastete offenbar schwer auf ihm und untergrub den Frieden und die Freude, die sonst sein Teil hatten sein können. -
Und was wurde aus seiner Familie? Was wurde aus jenen ersten Pionieren der Landwirtschaft, der Musik und des Metallgewerbes? Sie sind längst von diesem Schauplatz abgetreten. Wohin aber sind sie gegangen? Sie waren erzogen und ausgebildet für diese Erde, waren erfolgreich auf dieser Erde; es ist wohl nicht anzunehmen, daß sie je die breite Straße verließen, die schon so viele, die darauf wandelten, zum Verderben geführt hat; allen voran Kam, ihr geehrter Vorfahr, als ihr Führer.
Tausende von christlichen Eltern haben ihren Kindern einen guten Start auf dem breiten Weg gegeben, wo sie ihnen lediglich einen guten Start für dieses Leben zu geben meinten. Wieviel besser für eure lieben Kleinen, unbekannt und unbeachtet in diesem Leben zu sein, aber ihre Namen Im Himmel angeschrieben zu wissen, als daß sie hier auf den prächtigsten Ruhmestafein dieser Welt glänzen - ohne Christus!
HENOCH
Es ist eine Freude, sich vom „siebenten nach Man" in der Linie Kains zum ‚siebenten nach Adam" in Set.hs Linie zu wenden (jud 14). Habt ihr übrigens schon einmal darüber nachgedacht, warum der Heilige Geist in einem so kurzen Brief, wie es der des Judas ist, Sich die Mühe nimmt, uns aufzuzeigen, wieviel Generationen es von Adam bis Henoch sind? Henochs Geschichte kann allen christlichen Eltern von heute Trost bringen. Wir lesen: „Henoch lebte fünfundsechzig Jahre und zeugte Methusalalt. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah gezeugt hatte, dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter" (1.Mo 5,21. 22).
Beachtet wohl: es wird uns von Henoch nicht berichtet, daß er die funfundsechng Jahre vor der Geburt des Kindes Metltusa-lah mit Gott wandelte Es war offenbar erst dieses kleine Kind, das Henoch dazu brachte, niet Gott zu wandeln
Ihr habt vielleicht schon beobachtet, wie selbstsüchtig die meisten jungen Christen sind, ganz gleich, ob verheiratet oder unverheiratet Das Ich - das gute oder das schlechte Ich -
beansprucht im allgemeinen einen großen Raum in ihren Gedanken „Was mochte dz gern?"„Ich will das nicht tun wie oft hört man solche Ausdrücke! Wie oft haben wir sie selbst benutzt! Doch wenn Kinder kommen, beginnt für uns eine neue Art von Lektionen.
Das Baby schreit oft und will nicht schlafen; Die Mutter hat das Kleine schon den ganzen Tag gehabt, jetzt ist Vater an der Reihe So manche Stunde bin ich mit einem von euch auf dem Arm den Flur auf- und abgegangen, wenn ich viel lieber in meinem warmen, molligen Bett gelegen und geschlafen hätte. Glücklich die Eltern, die mit Gott Umgang haben, während sie so mit einem schreienden, unruhigen Kind den Flur auf- und abgehen. Sie werden erleben, wie sich diese gefürchteten Nachtwachen in Stunden himmlischer Gemeinschaft mit dem besten und liebsten Freund verwandeln. Das stille Haus, wenn alle anderen schlafen, ist gerade der Platz, wo du mit deinem Herrn ungestört Umgang haben kannst.
Und wenn dann das Kind (wie es bei euch abwechselnd der Fall war), an den Rand jenes kalten, dunklen Flusses kommt und das junge Leben, das dir teurer geworden ist als dein eigenes, dir zu entgleiten droht, dann lernst du eine der tiefsten Lektionen, die dieses Leben lehren kann - in Wahrheit zu sagen: „Dein Wille geschehe!"
Aber wahrscheinlich könnte jeder von uns ein Buch niederschreiben über die Lektionen, die wir von unseren kleinen Lieblingen lernen - von deren kleinen zarten Händchen uns die bloße Berührung immer mehr bedeutet und deren eigensinniger Wille sich unserer Autorität hartnäckig widersetzt.
Wir können hier nicht weiter auf Lese Lektion eingehen; nur wer selbst Kinder hat, kennt und versteht sie, und ich glaube, nur ein solcher kann die Geschichte Henodis verstehen. Sie scheint eigens für uns Eltern geschrieben zu sein Mochte doch jeder von uns erkennen wie Henoch erkannte, daß unsere lieben Kleinen uns dahinbnngen mit Gott zu wandeln Und in dieser wunderbaren Begleitung dürfen wir Starke und Trost für unseren Pfad als Eltern finden
Das kleine Kind, das das Mittel gewesen zu sein scheint, daß sein Vater mit Gott wandelte, wird diesen geliebten Väter Tag
@Verlag: Ernst Paulus Verlag 1968
Die härteste Versuchung Elke Werner
Die härteste Versuchung
Wer in Trübsal und Versuchung beständig und inbrünstig betet, der kämpft mit Jesu im Todeskampf wider den Teufel.Thomas von Kempen
Wissen Sie, wo ich immer wieder gute Anregungen für leckere Speisen bekomme? In einer Fastenklinik. Das mag auf den ersten Blick absurd klingen. Aber wer schon einmal in einer solchen Klinik war, weiß, dass jeder dort über das Essen spricht. Ich habe vor fast zwanzig Jahren damit begonnen, wenn möglich einmal im Jahr in diese wunderbare Fastenklinik in der Rhön zu fahren. Die ersten Jahre habe ich dort richtig gefastet, um die schädlichen Restbestände einer Chemotherapie loszuwerden und meinen Körper von den Giften zu reinigen. Mittlerweile genieße ich dort die guten Therapien und das leckere, vollwertige Essen. Doch gehöre ich zu den wenigen, die während ihres Aufenthalts Nahrung zu sich nehmen. Fast alle, die dort sind, fasten freiwillig und aus vollster Überzeugung.
Und doch wird bei jeder Mahlzeit - und das ist in der Klinik für die Fastenden morgens ein Glas Möhrensaft, mittags eine Gemüsebrühe und abends ein Tee mit einem Esslöffel Honig - mit wachsender Begeisterung über Essen gesprochen. Die besten Rezepte werden ausgetauscht, es wird an den Tischen in Erinnerungen an Lieblingsessen geschwelgt, über den letzten Braten, das letzte Stück Kuchen vor dem Fasten gesprochen, und es werden bereits Pläne gemacht, was man alles kochen wird, wenn man erst wieder zu
Hause ist. Bei meinen ersten Fastenzeiten kam ich jedes Mal mit mehreren neuen Koch- und Backbüchern bestückt nach Hause zurück, die ich mir während des Fastens genüsslich angeschaut hatte. Ich hatte von langer Hand geplant, welche neuen Rezepte ich bald schon ausprobieren würde.
Ich fahre immer noch begeistert in diese Klinik und bin überzeugt vom Fasten, auch wenn ich in den letzten Jahren das Angebot der Vollwertkost im Haus schätzen gelernt habe. Fasten kann guttun. Jesus hat vor Beginn seines öffentlichen Auftretens vierzig Tage lang gefastet. Vierzig Tage lang nichts essen? Warum tat Jesus das? Ich glaube nicht, dass Jesus versucht hat, durch vierzig Tage Fasten in der Wüste seine überflüssigen Pfunde loszuwerden. Es war ein Verzicht mit einem Ziel: ganz von Gott abhängig zu sein. Er hatte sicher nicht so große Polster wie wir gut genährten Menschen im reichen Westen. Er fastete aus geistlichen Gründen. Er wollte sich auf das Wesentliche konzentrieren, Kraft tanken für seinen schweren Auftrag, dessen Umsetzung ja noch vor ihm lag.
Jesus wird auf die Probe gestellt War Jesus stark oder schwach? Konnte er von seinen Plänen abgebracht werden, indem man ihn auf eine harte Probe stellte? Als Jesus versucht wurde, kam er direkt von seiner Taufe im Jordan, bei der der Vater im Himmel sich in aller Öffentlichkeit zu ihm gestellt hatte:
Als Jesus untergetaucht war und wieder aus dem Wasser hervorkam, war auf einmal der Himmel über ihm geöffnet.
Er sah, wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig war eine Stimme zu hören, die aus dem Himmel ertönte: „Dieser Mensch ist mein Sohn. Ihm gilt meine ganze Liebe. An ihm habe ich meine reine Freude!" (Matthäus 3,16).
Was für ein Mut machendes und erfreuliches Erlebnis muss das • gewesen sein: Es war die erste öffentliche Bestätigung - zunächst einmal für Jesus selbst, aber dann auch gleichzeitig für die Öffentlichkeit, die dieses Ereignis miterlebte: Der Vater im Himmel, der allmächtige Gott hatte ihn gesandt. Doch dann wurde er unmittelbar von dort weg in die Wüste geführt. Dor folgten drei Versuchungen des Teufels, der ihn von seinem Weg mit Gott abbringen wollte.
Als Hungernder angreifbar
Jesus war schwach. Er hatte seit vierzig Tagen nichts mehr gegessen. Der Hunger muss ihn gequält haben. Und genau an diesem Punkt setzte der Teufel an. Er schlug Jesus vor, doch aus den Steinen um ihn herum Brot zu machen. Nichts leichter als das! Eigentlich kein Problem für Jesus. Doch er tat es nicht. Jesus war zwar geschwächt und hungrig, aber er ging nicht auf die Versuchung ein. Er bewies Stärke, indem er am Wort Gottes und seinen Verheißungen festhielt: Doch Jesus gab ihm die Antwort: „Ein Mensch kann nicht allein von Nahrung leben. In Wirklichkeit ist er ganz abhängig davon, dass Gott sein lebendig machendes Wort ausspricht" (Lukas 4,4).
Diese Versuchung war damit überwunden. Doch es ging gleich weiter.
Als Sohn Gottes herausgefordert
Nun war es nicht mehr Gottes Geist, der Jesus führte, sondern der Teufel selbst versetzte Jesus mitten in die heilige Stadt, hoch hinauf auf den Tempel und versuchte ihn dort: „Wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürz dich doch hinunter, Denn schließlich steht im Buch Gottes: ‚Er wird seine Engel damit beauftragen, auf dich aufzupassen, Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du ja nicht mit deinem Fuß auf einen Stein aufstößt—(Matthäus 4,5-6).
Der Teufel versuchte, Jesus mit seinen eigenen Waffen, nämlich mit dem Wort Gottes zu schlagen. Hatte Jesus sich vorher noch erfolgreich mit der Heiligen Schrift gegen den ersten Angriff gewehrt, wurde er jetzt selbst mit Gottes Wort angegriffen.
Der Umgang des Teufels mit dem Wort Gottes zeigt uns zudem, wie gefährlich es sein kann, ein einzelnes Zitat aus der Bibel herauszunehmen und es zu einer absoluten Maxime für das eigene Handeln zu erheben. Ja, es stimmt, dass Gott auf jeden Fall auf Jesus hätte aufpassen können. Ja, er hätte Engel schicken können, keine Frage. Aber Jesus wusste, dass es nicht sein Auftrag war, in diesem Augenblick seinen ersten und sicher sehr öffentlichkeitswirksamen Auftritt vor allen Menschen im Tempel zu vollziehen. Er ließ sich weder den Zeitpunkt noch sein Handeln vom Teufel vorschreiben. Trotz der anhaltenden körperlichen' Schwäche war sein Geist ganz stark. Sein Vertrauen in seinen guten Vater im Himmel zeigte sich gerade darin, dass er Gott nicht herausforderte; Er entgegnete: Du sollst auf keinen Fall versuchen, den Herrn, der ja dein Gott ist, zu irgendetwas zu zwingen (Matthäus 4,7).
Als Armer mit Reichtum gelockt
Die dritte Versuchung folgte. Der Teufel entführte ihn und zeigte ihm alles, was in unserer Welt als Reichtum bekannt ist. Alle Güter der Welt und alle Herrschaft der Königreiche. Jesus sollte dem Teufel die Ehre geben, ihn anbeten - und alles würde ihm gehören. Doch Jesus reagierte sofort und sehr stark:
„Hau ab, du Satan! Denn in Gottes Buch steht: ‚Du sollst einzig und allein den Herrn, deinen Gott, anbeten; Ihm allein sollst du deine Verehrung zukommen lassen!" Danach ließ der Zerstörer endlich Jesus in Ruhe. Stattdessen kamen die himmlischen Gottesboten zu ihm und versorgten ihn (Matthäus 4,10-11).
Jesus ergriff trotz aller körperlicher Schwäche seine göttliche Autorität und gebot dem Satan, ihn zu verlassen. Und dieser musste folgen. Hier zeigt sich endgültig, wer wirklich schwach und wer stark war in dieser Situation. Jesus war die ganze Zeit über der Stärkere und behielt die Kontrolle über die Situation, obwohl er für eine Zeit den Teufel mit seinen Versuchungen gewähren ließ. Er tat das nicht aus Ohnmacht und Schwäche, sondern um zu zeigen, dass er sich seiner Autorität und seines Auftrages sicher war. Jesus hat nicht mit dem Teufel gekämpft, um zu siegen. Sein Sieg ist in seiner Autorität und in seiner Abhängigkeit vom Vater schon gegeben gewesen. Und diese Stärke von Jesus wurde durch die Begegnung mit dem Teufel öffentlich gemacht. Dadurch wurde der Vater umso mehr verherrlicht.
Sieg in Schwachheit Nur die Wahrheit trägt den Sieg davon der Sieg der Wahrheit ist die Liebe.
Augustinus Aurelius
Sehen wir uns ein drittes Beispiel von Stärke und Schwäche bei Jesus an - seinen Leidensweg. Er saß zum letzten Mal mit seinen Jüngern, seinen Freunden, beim. Passahfest zusammen. Er hatte alles organisiert. Ein Fremder hatte einen Raum für sie alle vorbereitet. Sie aßen und hatten Gemeinschaft. Dann erklärte Jesus ihnen noch einmal, dass er bald schon von ihnen getrennt werden würde und dass er den Weg in den Tod gehen müsse. Sie verstanden die Zeichen nicht, die er il-u-ien gab, die Hinweise, dass er auf dem Weg ans Kreuz war. Jesus entlarvte beim Essen Judas, der schon beschlossen hatte, Jesus zu verraten, der aber noch wie selbstverständlich mit allen Jüngern und Jesus am Tisch saß. Er durfte bei diesem letzten Mahl dabei sein. Als er Judas das Brot reichte, gab Jesus ihm eine letzte Chance, sich von seinem Vorhaben abzukehren. Doch Judas war fest entschlossen. Jesus trug ihm daher auf, so bald wie möglich umzusetzen, was er sich vorgenommen hatte.
Als Missionare einem Volk, das noch im Dschungel lebte, diese Begebenheit erzählten, lachten alle und freuten sich. Sie feierten Judas als Helden und sahen in Jesus einen Schwächling. Warum diese merkwürdige Reaktion? Weil in ihrer Kultur jemand als stark galt, der andere überlisten konnte. Und Judas war in ihren Augen der Held, der Jesus getäuscht hatte. Erst einige Zeit später gelang es den Missionaren, ein für dieses Volk vertrautes Bild zu nutzen, um ihnen zu erklären, was Jesus für die Menschheit getan hat: das: Friedenskind.
Wenn ein Stamm mit einem anderen Frieden schlie-, ßen wollte, wurde ein Kind von jedem Stammesältes-ten in die jeweilige andere Familie gegeben, um dort groß zu werden. Jesus ist das Friedenskind, das in diese Welt kam, um den Frieden zwischen Gott und uns zu erreichen.
Doch hätten sie bei der Geschichte mit Judas genau hingesehen, hätten sie festgestellt, dass Jesus gar nicht; getäuscht oder überrascht wurde. Dass nicht Judas der Starke war, der Jesus austricksen konnte. Sondern dass Jesus selbst Herr der Lage war und blieb. Er wusste alles, was Judas vorhatte. Und er hätte die Pläne des Judas jederzeit durchkreuzen können. Aber er tat es nicht.
Als Todgeweihter voller Angst
Danach nahm Jesus drei von seinen Jüngern mit in den Garten Gethsemane. Dort brauchte Jesus dringend die seelische und moralische Unterstützung von ein paar Freunden. Er wusste genau, was ihn erwartete. Was unumkehrbar auf ihn zukam: Verhaftung, Folter, Tod am Kreuz, Verlassenheit von Gott, ein Gang durch die Hölle. Etwas entfernt von den dreien ging er im Garten auf die Knie und betete. Er rang mit Gott und bat seinen Vater im Himmel, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergehen möge. Er schwitzte Blut und Wasser und hatte Angst. Todesangst.
Und ausgerechnet diese seine engsten Vertrauten versagten und ließen ihn allein mit der Angst kämp fen. Mehrmals weckte er seine Freunde auf und bat sie erneut um ihre Unterstützung.. Er war wirklich schwach, voller Angst und sah mit großem Schrecken dem entgegen, was auf ihn zukam:
Dann kam er zu seinen Schülern und fand sie schlafend vor. Er sagte zu Petrus: „Seid ihr nicht in der Lage, eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuchung hineingeratet! Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach!"
Noch ein zweites Mal ging er fort und betete: „Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, ohne dass ich ihn austrinke, dann still dein Wille geschehen!" (Matthäus 26,40-42).
Dennoch entschied Jesus sich dazu, Gott mehr zu gehorchen als seinen Gefühlen. Trotz allem wollte er den Weg gehen, den er vor sich sah: den Weg bis ans Kreuz. In dieser schwächsten Stunde seines Lebens, in der die Angst ihn im Griff hatte, war er ganz allein. Enttäuscht und verlassen von Menschen. Und dennoch stark genug, sich Gottes Willen anzuvertrauen. Im Ja zu seinem Weg ans Kreuz fand er die Kraft, diesen Weg auch zu gehen.
Quelle: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig Elke Werner
