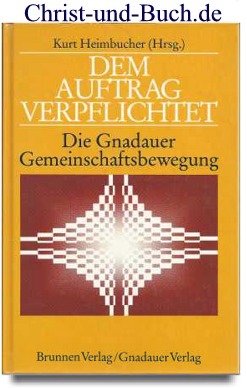Keine Bewertungen gefunden
Homepage/Autoren/Autoren H/Heimbucher, Kurt/Dem Auftrag verpflichtet - Die Gnadauer Gemeinschaftsbewegung, Kurt Heimbucher
Dem Auftrag verpflichtet - Die Gnadauer Gemeinschaftsbewegung, Kurt Heimbucher
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Verkäufer Details und Geschäftsbedingungen: » .ChristUndBuch.de «
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
gebraucht
Bestell-Nr.: BN7748
Autor/in: Kurt Heimbucher
Titel: Dem Auftrag verpflichtet - Die Gnadauer Gemeinschaftsbewegung
Preis: 3,90 €
ISBN: 9783765557439 (früher: 3765557439)
Format: 21 x 15 cm
Seiten: 440
Gewicht: 620 g
Verlag: Brunnen
Erschienen: 1988
Einband: Hardcover/gebunden
Sprache: Deutsch
Zustand: wie neu
Zur Einführung
Dieses Buch, das zum Gnadauer Jubiläum (1888-1988) erscheint, bedarf einiger einführender Erläuterungen.
Wie sich aus dem Inhaltsverzeichnis ersehen läßt, besteht dieser Band aus zwei Teilen.
Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Weg Gnadaus von der i. Pfingstkonferenz 1888 an bis in die jüngste Vergangenheit. Es konnte sich bei der Fülle des geschichtlichen Materials nur darum handeln, drei Epochen schwerpunktmäßig anzureißen. Es geht dabei um die Zeit von 1888-1933, VOfl 1933-1945, von 1945 bis heute. Wer sich eingehender mit der Geschichte der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung beschäftigen will, sei verwiesen auf
Hans von Sauberzweig, Er der Meister - wir die Brüder. Geschichte der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung;
Dieter Lange, Eine Bewegung bricht sich Bahn. Die deutschen Gemeinschaften im ausgehenden 19. und 2o.Jahrhundert und ihre Stellung zu Kirche, Theologie und Pfingstbewegung;
Jörg Ohlemacher, Das Reich Gottes in Deutschland bauen. Ein Beitrag zur Vorgeschichte und Theologie der deutschen Gemeinschaftsbewegung.
Eine ausführliche Geschichtsdarstellung der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung für die Zeit nach 1945 ist noch nicht geschrieben.
Es erschien dem Redaktionskreis wichtig, in einem Jubiläumsband wenigstens kurz auf die Geschichte einzugehen. Mit uns beginnt der Weg Gnadaus nicht. Wir haben ein reiches Erbe und eine bewegte Geschichte. Das darf nicht vergessen werden.
Der zweite Teil des Buches bringt in 16 Artikeln wesentliche Anliegen der Lehre und der Praxis der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung. Dieser Teil will nicht als eine Gnadauer »Dogmatik« oder »Ethik« verstanden werden. Bei der Vielfalt der theologischen Akzente und Prägungen in Gnadau wäre das auch gar nicht möglich. Vielmehr geht es im zweiten Teil darum, daß Themen angesprochen werden, die die Gemeinschaftsbewegung bis heute immer neu beschäftigen.
Manche Leser werden manche Themen vermissen. Da das Buch aber in seinem Umfang begrenzt werden mußte, war es nötig, sich im Blick auf die Themenwahl Beschränkungen aufzuerlegen. Das gilt auch vom Umfang der einzelnen Artikel. Den Verfassern der Artikel wurde die Seitenzahl vorgegeben - der eine hat sich mehr, der andere weniger daran gehalten. Ebenso war den Mitarbeitern die Vorgabe mitgegeben, die Artikel ohne Anmerkungen
abzufassen. Einige Autoren meinten jedoch, ohne Anmerkungen nicht auskommen zu können.
So vielfältig wie die Gemeinschaftsbewegung mit ihren zahlreichen Werken und Verbänden ist, so vielfältig sind auch die Beiträge dieses Buches. Es wurde in keiner Weise der Versuch unternommen zu harmonisieren, sondern die Artikel wurden - mit Ausnahme leichter redaktioneller Überarbeitungen - so übernommen, wie sie abgefaßt wurden.
Alle Autoren sind Glieder der Gemeinschaftsbewegung oder sind zumindest eng mit ihr verbunden. Unter den Verfassern sind Brüder aus der Bundesrepublik Deutschland und aus der DDR; es sind Brüder aus der praktischen Arbeit und theologische Lehrer dabei, ältere und jüngere; das kurze Autorenverzeichnis am Schluß gibt darüber Aufschluß.
Diese Hinweise zeigen, daß in dem Buch ein Spannungsbogen deutlich wird, der in Gnadau gegeben ist: Gnadau ist kein monolithischer Block; vielmehr stellt es sich dar in einer großen Vielfalt von Prägungen, theologischen Erkenntnissen und geistlichen Gaben.
Das alles will bei der Lektüre des Buches bedacht sein. Vielleicht wird dabei erkannt, welch ein Reichtum der Gnade in Gnadau geschenkt ist.
Freilich sind sich alle Autoren darin eins - und damit wird eine große Einheit in der großen Vielfalt in Gnadau deutlich: Wir bekennen gemeinsam: »In keinem andern ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden« (Apg 4,12). Wir stehen in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dem Offenbarungszeugnis der ganzen Heiligen Schrift.
Zur Anordnung des zweiten Teiles sei noch kurz vermerkt, daß zunächst zu Lehrfragen und dann zu praktischen Fragen Stellung genommen wird.
Weil die Bibel als das Wort Gottes und die Christologie in der Mitte des theologischen Nachdenkens der Gemeinschaftsbewegung stehen, wird mit ihnen bei den Lehrfragen der Anfang gemacht.
DIETER LANGE
Zur Geschichte der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung Aufbruch und Weg der Bewegung(i 888-1933)
Die Wurzeln der Gemeinschaftsbewegung in Deutschland
In der Mitte des 17. Jahrhunderts bildete sich auf Grund eines erstarrten evangelischen Kirchenwesens eine Reformbewegung, die man allgemein als Pietismus bezeichnete. Durch Erneuerung des christlichen Lebens wollte sie den Erstarrungsprozeß überwinden. Die neue Bewegung begann mit der Einführung privater Erbauungsstunden, den sogenannten »collegia pietatis«. Sie sammelte Laien zum gemeinsamen Gespräch über die Bibel und fand in Philipp Jakob Spener (1635-1705) ihren geistigen Führer.
Die altpietistischen Konventikel haben im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Aus der Erwekkungsbewegung des 19.Jahrhunderts waren sie erstarkt und mit neuem Missionsbewußtsein hervorgegangen. Die Folge davon war, daß es zur Bildung von zahlreichen Missionsvereinen kam, die die ersten Ansätze einer organisierten Evangelisations- und Gemeinschaftspflege erkennen lassen. Dem aufopferungsvollen Einsatz der Mitarbeiter der Christentumsgesellschaft und der der Herrnhuter Brüdergemeine ist es zu verdanken, daß das Gemeinschaftsleben in Deutschland bis zum Ende des 19.Jahrhunderts nicht zum Stillstand gekommen ist.
Die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland geht zurück auf die altpietistischen Konventikel. Sie bilden gewissermaßen die pietistische Grundlage, die die methodistischen Einflüsse und Anstöße der Oxfordbewegung von 1875 bereitwillig aufnahm. In den siebziger Jahren des 19.Jahrhunderts hatte sich durch die evangelistische Arbeit von Finney und Moody im nordamerikanischen und englischen Raum eine Heiligungsbewegung entwickelt, die breite Teile der Bevölkerung erreichte. Finney vertrat in seinen Ansprachen eine Heiligungslehre, wonach die Geistestaufe auf die Bekehrung und Wiedergeburt als höhere Stufe zu folgen habe. Nach seiner Auffassung ermöglicht die Geistestaufe den Gläubigen, in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott zu bleiben, wodurch schließlich seine sündige Natur ganz und gar ausgerottet wird. Hier liegt der Ansatzpunkt für die perfektionistische Irrlehre der amerikanischen Heiligungsbewegung, die