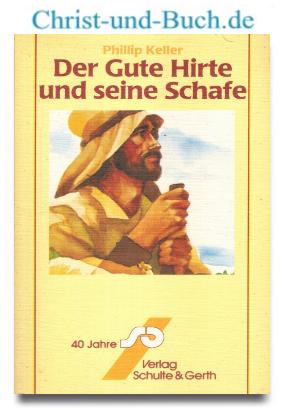Keine Bewertungen gefunden
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Ergänzung zu meinem früheren Werk Psalm 23 - Aus der Sicht eines Schafhirten. Gott hat es für viele Menschen auf der Welt zum Segen werden lassen. Wie "Psalm 23..." ist auch dieses Buch aus einer Reihe von Ansprachen entstanden, die ich in meiner Gemeinde gehalten habe..zu meiner Freude kamen dadurch etliche zum Glauben an den Guten Hirten: Jesus Christus. Das Wort Gottes kann aber auch in gedruckter Form für den einzelnen Menschen lebendig werden. Unser Guter Hirte sagt ausdrücklich: "Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben ..." (Johannes 6,63). So wie im Buch über den 23. Psalm wird auch hier die Heilige Schrift aus der Sicht eines Schafzüchters erklärt. Darüber hinaus hat der Verfasser die Fürsorge und Gegenwart des Guten Hirten, unseres Herrn Jesus Christus, viele Jahre lang persönlich erfahren. Ich bete darum, dass auch dieses Buch dem Leser klarmachen möge, was Gott, unser Vater, durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist für seine Nachfolger, die Schafe seiner Herde beabsichtigt.
DER GESCHICHTLICHE HINTERGRUND
Bevor wir uns dem Schriftabschnitt aus Johannes 10 direkt zuwenden, müssen wir den geschichtlichen Hintergrund betrachten, vor dem Jesus die drei Gleichnisse erzählt hat. Nur so können wir die Wahrheiten, die er lehrte, richtig erfassen.
Jesu Zeitgenossen waren über seine forte völlig verblüfft. Die Hörer waren so bestürzt, daß einige meinten, er wäre irrsinnig oder von einem bösen Geist beherrscht. Über Aussagen, wie Jesus sie machte, stand damals das Gerichtsurteil: „Tod durch Steinigung." Aber es gab auch Menschen, die gesehen hatten, wie Jesus dem Blindgeborenen das Augenlicht schenkte, und die nicht daran zweifelten, daß er die Wahrheit sagte. Wenn Jesus solche Wunder vollbringen konnte, maßte er der Messias sein.
An der Person Jesu Christi erhitzten sich die Gemüter und schieden sich die Geister. Einige sagten, er verdiene den Tod. Andere jubelten ihm als dem Heiland zu.
Seit diesem bedeutungsvollen Tag, an dem er sich als der Gute Hirte zu erkennen gab, hat man sich - durch die Jahrhunderte hindurch - nicht einigen können, was er wirklich meinte. Philosophen, Theologen, Naturwissenschaftler und Prediger haben diesen Schriftabschnitt ausgelegt. Und in Kommentaren und dicken Büchern wurden diese Gleichnisse behandelt. Wenn man die unterschiedlichen Ansichten und Erklärungen liest, ist man fast so verwirrt wie die Menschen zur Zeit Jesu.
Es ist also nicht einfach, über Johannes 10 ein Buch zu schreiben. Doch ich habe es in aller Demut versucht. Ich will nicht abwerten, was andere zu diesen Gleichnissen gesagt haben. Ihre Ansichten sind völlig berechtigt. Doch ich möchte gleich zu Anfang sagen, daß sich meine Auslegung von den anderen unterscheidet. Ihr liegt nicht die alttestamentliche Vorstellung von dem Volk Israel als der Herde Gottes zugrunde, auch nicht die neutestamentliche von der Gemeinde Jesu Christi als der kleinen Herde, sondern einfach die Tatsache, daß ich als Einzelmensch Jesu Eigentum bin.
Nur der Hintergrund, vor dem Jesus Christus diese Aussagen machte, ist für meine Auslegung entscheidend.
Das öffentliche Wirken Jesu sollte bald ein Ende finden. Die geistliche Elite seiner Zeit begegnete ihm zunehmend mit Feindseligkeit. Durch seine Popularität und seine Ausstrahlung auf das einfache Volk fühlten sich die religiösen Führer bedroht. Man jubelte ihm zu. Die Menschen wurden durch seine vollmächtige Verkündigung und durch seine Wunder angezogen.
Um die Person Jesu entwickelte sich ein hitziger Meinungsstreit. Den Schriftgelehrten, Sadduzäern und Pharisäern war jedes Mittel recht, ihn anzugreifen, sobald er in der Öffentlichkeit auftrat.
Nun kam Jesus nach Jerusalem. Er wollte das Laubhüttenfest feiern (Dieses Fest soll daran erinnern, daß der HERR auf der langen Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten für sein Volk gesorgt hat). Bei seinem öffentlichen Auftreten dort wurde Jesus sofort beschuldigt. In Johannes 7,1.2 lesen wir: „... die einen sagten: Er ist gut; andere meinten: Nein, er verführt das Volk." Seine Gegner hätten ihn getötet, wenn sie gekonnt hätten; aber die Stunde seiner Gefangennahme war noch nicht gekommen.
Am letzten Tag des Festes kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Einige behaupteten, er sei wahrhaftig der Christus, andere dagegen meinten, der Messias könne unmöglich aus Galiläa kommen. Man schickte Polizisten, die ihn festnehmen sollten, doch diese weigerten sich, den Befehl auszuführen, und bezeugten: „Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser." Deshalb konnte Jesus erneut dem Zugriff entgehen.
Als er am nächsten Tag wieder im Tempel war, schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie sollte gesteinigt werden. Um Jesus eine Falle zu stellen, brachte man sie zu ihm. Aber anstatt sie zu verurteilen, vergab er ihr mit dem Gebot, nicht mehr zu sündigen.
Die Ankläger der Frau waren wütend, und nachdem er behauptet hatte, er tue die Werke seines Vaters und sei ewig, wollten sie ihn steinigen. Aber er verbarg sich vor ihnen. Das alles wird in Johannes 8 beschrieben.
Später begegnete Jesus einem Blindgeborenen. Er berührte die Augen des Blinden, und als der sich auf Jesu Anweisung hin im Teich Siloa gewaschen hatte, konnte er sehen. Dankbar warf er sich später vor seinem Wohltäter nieder. Zuvor aber war er von den skeptischen religiösen Führern hart ins Kreuzverhör genommen worden.
Weil der Mann nun an Jesus als den Messias glaubte, wurde er aus der religiösen Gemeinschaft seines Volkes ausgestoßen.
Den Pharisäern sagte Jesus ins Gesicht, sie seien blind und lebten in Sünde und Selbstgerechtigkeit. Ihre ganze Frömmigkeit nütze ihnen vor Gott überhaupt nichts. Damit endet Johannes 9.
Ganz anders konnte Jesus Christus im Leben der Ehebrecherin und des blindgeborenen Mannes wirken. Er war zu ihnen gekommen und hatte ihnen ein erfülltes Leben in der Gemeinschaft mit ihm geschenkt