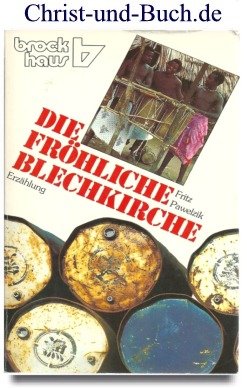Keine Bewertungen gefunden
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Einmal saß ein Mann neben mir in der Blechkirche, der ein lebendiges Huhn mitgebracht hatte. Unten hatte er der armen Kreatur die Beine zusammengebunden. Nicht gerade der richtige Anblick für den Tierschutzverein.
Ich wußte erst nicht, was er mit dem Tier wollte. Bei der Kollekte wandte er sich an Mercy, eine der Market Mammies, und bat sie: »Ich hab kein Geld, darum möchte ich das Huhn für die Kollekte versteigern lassen. Du kannst das besser als ich ...« O.k., Mercy versteigerte das Huhn, und ich kam dran. Alle steigerten mich hoch, und dann bekam ich das flatternde Tier für einen unerhörten Preis zugesprochen.
Karin, meine Frau, fuhr mich hinterher an: »Was willst du denn damit?« »Du kannst es uns ja braten«, schlug ich vor.
»Lebendig?« fragte sie zurück. »Nein, nein, du hast es ersteigert, du mußt es auch schlachten, ausnehmen und rupfen.« (aus dem Inhalt)
Fritz Pawelzik beschreibt das Leben in einer afrikanischen Gemeinde, die sich aus kleinen Anfängen entwickelt. Als der Versammlungsraum zu eng ist, wird aus weggeworfenen Kanistern ein Haus, die fröhliche Blechkirche.
Einleitung mit Karin und großer Liebe
Damals, Ende der vierziger Jahre, arbeitete ich als Kumpel unter Tage. Nach Feierabend, an dcii Wochenenden und in meinem Urlaub spielte ich Fußball. Oder sprang auf mein Motorrad und raste Europa und das, was noch von Deutschland übriggeblieben war, ab. Ich fuhr bis zum Nordkap hoch und durchquerte die Sahara.
Auf einer dieser Touren geriet ich nach Rom und in die Vatikanischen Museen. Dorthin hatte sich auch ein junges Mädchen verlaufen. Ich entdeckte sie, als sie vor einem Relief stand und das Bild vergeblich in einem Reiseführer suchte.
Ich tat so, als ob ich sie gar nicht bemerkte, sondern ganz in die Betrachtung des Kunstwerkes vertieft sei. Da sprach sie mich an: »Do you speak English?«
Worauf ich aufsprang und, nicht ganz meinen Kenntnissen dieser Sprache entsprechend, laut: »Yes!« antwortete.
Sie hätte gerne gewußt, was das für ein Bild sei. Ich konnte es daneben lesen und erklärte ihr dann die Schule von Athen, die vom Maler Raffael dort dargestellt war.
Dann zeigte ich ihr den Rest des Museums und Rom. Dabei versäumte sie den Zug, mit dem sie nach Kopenhagen hätte zurückfahren müssen. Ihre Fahrkarte galt nur in Verbindung mit einer Studentengruppe aus dem Norden, die schon abgefahren war.
Sie war Finnin und Medizinstudentin. Als ich mich als Kumpel vorstellte, war sie doch ein wenig verwundert. Und noch mehr, als ich ihr später, im Mondschein am Tiber, sagte: »1 love you!« Da heulte sie plötzlich los, weil sie dachte, daß ich ihr etwas antun würde. Da sie wie ich kein Geld hatte, wußte sie nicht, was sie tun sollte. Und das mit der Liebe war bei ihr auch nicht so sicher. Sie meinte: »Wir kennen uns doch erst ein paar Stunden!« Aber bei mir war alles klar.
Ich fuhr sie dann mit dem Motorrad bis nach Helsinki. Dort marschierte ich sofort zu ihrem Vater, der gerade in seiner Hals-Nasen-Ohrenpraxis beschäftigt war. Dem fiel vor Schreck der Ohrenspiegel herab, als ich um die Hand seiner Tochter bat. Aber er gab sie mir schließlich doch.
Karin hieß sie. Sie studierte weiter, machte ihr Examen als Zahnärztin. Dann heirateten wir, und sie kam zu mir ins Ruhrgebiet. Das war schon ein Wechsel für sie, von Helsinki nach Herne! Aber wir liebten uns sehr. Dadurch wurden auch meine wilden Ausflüge weniger. Mein Tempo verringerte sich, weil Karin nun hinten auf dem Sozius saß.
Vorher hatte ich in einem Bergarbeiterwohnheim gelebt, doch als Karin kam, zogen wir auf ein Zimmer in einer Arbeiterkolonie. Dort meldete sich bald unser erstes Kind an.
Sicher waren wir beide nicht gerade fromme Typen, doch wir waren unserem Schöpfer dankbar dafür, daß er uns zusammengebracht hatte, und ich arbeitete kräftig in einem christlichen Verein, dem CVJM, mit und versuchte, den Kumpels die frohe Botschaft ins Herz zu packen.
Da erreichte mich ein Brief von einer Missionsgesellschaft. Die fragte mich, ob ich als Missionar ins »dunkle« Afrika gehen würde, unter wildfremde Menschen, an einen Ort, der in Westafrika, in Ghana, am Meer liegen würde, Takoradi mit Namen.
Ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Karin auch nicht. Ich fragte sie: »Kommst du mit?«
Sie antwortete, fast wie Ruth in der Bibel: »Ich gehe überall mit, wohin du gehst. Das habe ich doch in der Kirche versprochen.«
Ich weiß nicht, warum die frommen Leute gerade mich ausgewählt hatten. Vielleicht darum, weil ich auch schwarz war, wenn ich aus der siebten Sohle hochkam, und weil sie wohl meinten, daß einer, der mit den Kumpels in Deutschland zurechtkam, auch vor den »wilden Negern« keine Angst haben würde. Aber sicher hatten sie daneben noch solidere Motive.
Aber dann waren sie sich doch nicht so sicher. Als ein Ghanaer auf Besuch nach Deutschland kam, meinten die von der Missionsgesellschaft zu ihm: »Sehen Sie sich doch noch einmal diesen Mann an, ob der zu Ihnen passen würde.«
Der Afrikaner kam an einem Sonntag in den Kohlenpott, als ich gerade mit meinem Verein auf der Steinhalde Fußball spielte. Der junge Mann aus fernem Land war von meinem Spiel sehr angetan. Hinterher kam er sofort auf mich zu und rief begeistert: »Du mußt zu uns als Fußballtrainer kommen!«
Damals kannte ich die Phantasie einiger Afrikaner noch nicht, obwohl ich selbst auch mit reichlich Phantasie begabt war. Ich wandte ein: »Ich bin doch gar kein technischer Spieler, sondern einer, der lieber seinen Körper einsetzt.«
Wenn es damals schon gelbe Karten gegeben hätte, hätte ich in diesem Augenblick zwei davon zu sehen gekriegt. Doch dann wischte mein »Fan« das alles weg: »Genau das brauchen wir. Unsere Jungens sind zu sehr in den Ball verliebt und vergessen das Toreschießen. Du mußt kommen und Takoradi trainieren. Die werden dann Bezirksmeister, Ghanameister, Afrikameister und vielleicht sogar Weltmeister ...«
Ich unterbrach ihn: »Aber die Deutschen wollen mich doch als Missionar hinausschicken.«
»Nein, nein«, blieb er bei seiner Meinung, »du kommst als Fußballtrainer.«
Verwirrt fragte ich Karin, was ich machen sollte. Sie wußte Rat, wie immer: »Mach doch beides«, sagte sie, »Fußballtrainer und Missionar.«
»O.k.«, antwortete ich, denn wir sprachen damals noch Englisch miteinander. Später, als die Kinderchen groß wurden, stellten wir uns auf Deutsch um, denn mein Eng-
lisch war nicht das beste in der Welt. Schon beim ersten Wort konnte man heraushören, daß ich aus dem Ruhrgebiet kam. Das sollte sich auch beim Twi und beim Pidgin-Englisch nicht ändern, das ich später lernte. Und Grammatik war schon immer meine schwache Seite.
Ich marschierte also zu meinem Trainer und konsultierte ihn. Das war ein gebildeter Mann. Er zitierte Goethe beim Training und brachte uns Kumpeljungen bei, manierlich mit Messer und Gabel zu essen. Zwecks Eßtraining mußten wir uns am Anfang immer ein Buch unter die Arme klemmen, damit wir mit unseren Ellenbogen nicht unsere Nebenmänner und -damen behinderten.
Der Trainer hatte auch schon Fußballbücher geschrieben; die schenkte er mir und hielt für mich Extrastunden ab, als Vorbereitung für Ghana. Später trainierte er sogar Bayern München. Er war also ein besonders guter Fußballtrainer.
Dann fuhren wir los nach Afrika, mit der Bibel und einem Fußball. Das Abenteuer begann.
Fußballtrainer in Takoradi
Mit meinem echten Lederfußball, von der FIFA geprüft und zugelassen, erreichte ich Takoradi, eine Hafenstadt im Westen Ghanas. Ich suchte nach einem geeigneten Platz und fand ihn zwischen Lehmhütten und Cassavabüschen. Der Platz glich in etwa dem Bolzplatz, auf dem ich als Junge Fußball gespielt hatte. Nur die Erde war etwas anders, dunkelrot, von der Sonne ausgedörrt und verbrannt, mit Buckeln und schroffen Rinnen versehen. Wenn die Sonne darauf schien, blitzten Salze und andere Kristalle auf.
Als ich ein bißchen mit dem Ball herumkickte, zog das sofort Dutzende von Jungen und Mädchen an. Viele von den Mädchen trugen ihre kleinen Geschwister auf dem Rücken und hopsten mit denen um den Ball herum.
Ich wollte so trainieren, wie mein Trainer in Deutschland es mir empfohlen hatte, doch das ging nicht. Zunächst einmal mußte ich mir meine neuen Fußballschuhe ausziehen. Darauf bestanden die Jungen; aus Solidarität mit ihnen, die alle barfuß waren, und weil Gleichheit herrschen sollte. Es fiel mir sehr schwer, barfuß über die harte Erde zu stolpern, ich riß mir die zarten, Schuh gewohnten Sohlen auf, aber langsam gewöhnten sich meine Füße an die rauhe Unterlage, und es bildete sich eine Hornhaut, wie damals, wenn ich als Junge über die Stoppelfelder lief.
Auch meine Mitspieler mußten Probleme überwinden. Sie waren es gewohnt, mit Bällen ihrer Machart zu spielen, zusammengerollten Knäueln aus Blechbüchsen und strohigen Bananenblättern. Aber wir einigten uns dann auf ein neues Spiel.
Leider ging es dabei nicht mit einem Spielchen Elf gegen Elf ab, da zu viele erschienen waren und Tränen flossen, wenn welche auf der Seite stehen und zugucken sollten.
Also gut, ich ließ sie alle mitspielen; es spielten fuffzig gegen fuffzig, und die Mädchen mit den Kindern auf dem Rücken stellte ich ins Tor.
Zuschauer strömten herbei und freuten sich. Sie beteiligten sich auch an unserm Spiel und griffen ein, wenn eine Mannschaft nicht vorankam. Geriet der Ball einmal unter die Jubelnden, dann wurde er dort weiter behandelt, und wir mußten sehen, daß wir ihn wieder auf das normale Spielfeld bekamen. Es war Fußball total, ohne Stars, dafür aber mit großer Freude.
Wurde eine Gruppe mit dem Spiel fertig oder so müde, daß sie nicht mehr weiterspielen konnte, strömten sofort die Zuschauer aufs Feld und bolzten weiter.
Auch andere Regeln wurden großzügiger ausgelegt als im normalen Match. Zunächst lief ich noch als Schieds-richter mit, doch dann zog mich das Spiel so in den Bann, daß ich meine Rolle vergaß und auch mitspielte, immer wieder meine Position wechselnd, immer dem Schwächeren aushelfend. Bald brauchten wir keinen Schiedsrichter mehr.
Während des Spiels wurde auch umgestellt. War eine Mannschaft zu schwach, gruppierten wir die beiden Teams um, und das Spiel lief gleichmäßiger weiter.
Aber verboten war es, daß ein Mädchen den Ball in die Arme nahm und damit davonlief.
Wer sich unfair benahm, wurde sofort vom Platz gestellt. Darin waren wir uns alle einig.
Wir spielten auch gegen andere Mannschaften, zum Beispiel gegen Seeleute aus dem Hafen. Die staunten zunächst über unsere Spielweise und wollten allen Ernstes dagegen protestieren. Aber dann fanden sie es bei uns nett und spielten so mit, daß es ihnen Freude machte.
Ein ganz tolles Spiel wurde es, als wir die Jugendlichen einer Blindenschule zu uns einluden. Meinen zweiten Ball hatte ich extra für sie konstruiert und innen mit einer Klingel versehen. Die läutete, wenn der Ball getreten wurde. Im Hellen waren die Blinden uns unterlegen, doch als es dunkel wurde, kamen wir nicht mehr mit. Ihr Gehör war schärfer als unseres, und so traten sie ihre Tore und glichen aus.
Während dieser Zeit erschien auch der Mann, der mich in Deutschland angeheuert hatte. Er hatte mir noch eine Postkarte nach Hause geschickt, auf der stand:
»Schick mir bitte ein Klavier und einen Volkswagen.« Nun kam er, um sich diese Kleinigkeiten abzuholen.
Er war nicht gerade erfreut, als ich ihm einen Spielzeug-VW und einen Schokoladenflügel überreichte, und unsere Mannschaft fand er nicht reif genug, um wenigstens den Ghanatitel zu erringen.
Enttäuscht zog er ab, aber ich freute mich jeden Tag auf das Fußballspiel la Takoradi.
gebraucht
Bestell-Nr.: BN5420
Autor/in: Fritz Pawelzik
Die fröhliche Blechkirche
ISBN: 9783417208146 (früher: 3417208149)
Format: 11 x 18 cm
Seiten: 160
Gewicht: 148 g
Verlag: R. Brockhaus
Erschienen: 1987
Einband: Taschenbuch
Sprache: Deutsch
Zustand: leichte Gebrauchsspuren
R. Brockhaus Taschenbuch Band 814