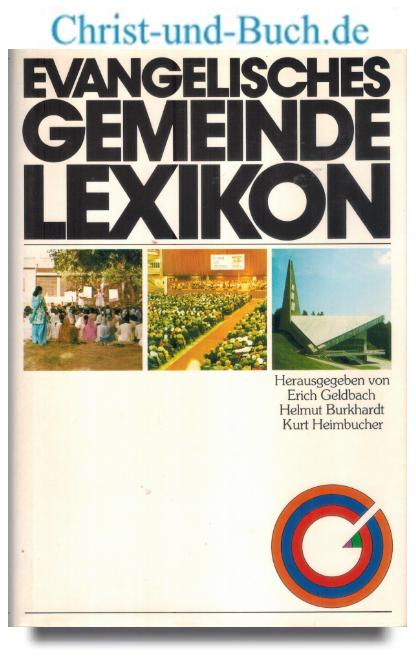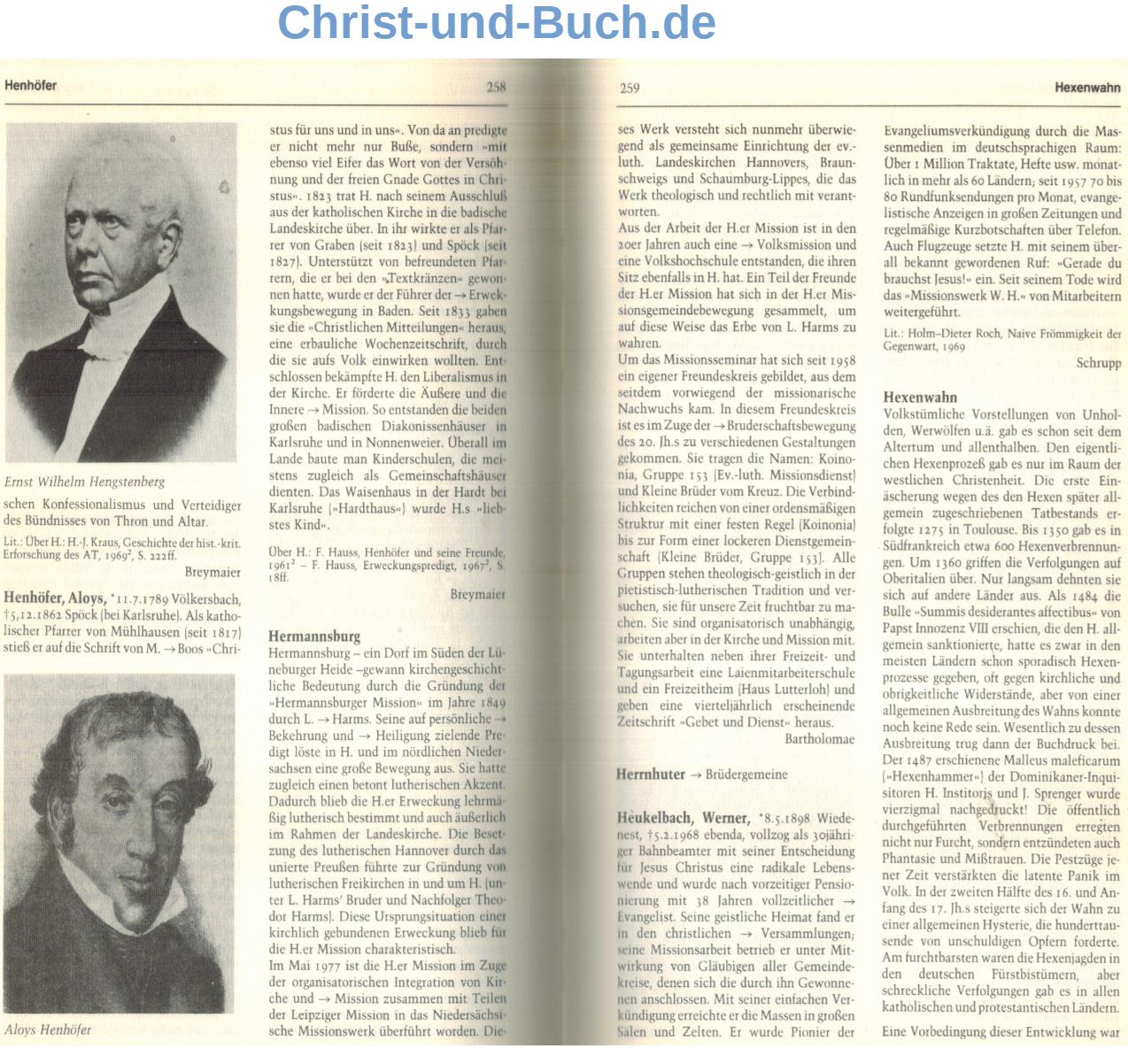Keine Bewertungen gefunden
Evangelisches Gemeindelexikon, Erich Geldbach, Helmut Burkhardt, Kurt Heimbucher #3
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Verkäufer Details und Geschäftsbedingungen: » .ChristUndBuch.de «
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
gebraucht
Bestell-Nr.: BV30037
Autor/in: Geldbach, Erich (Hrsg.)
Titel: Evangelisches Gemeindelexikon.
ISBN: 3417245664 (ISBN-13: 9783417245660)
Zustand: leichte Gebrauchsspuren
Verlag: Wuppertal : Brockhaus
Format: 16 x 22,5
Seiten: 557 S.
Gewicht: 900 g
Ort: Wuppertal
Erschienen: 1978
Einband: Hardcover/gebunden
Sprache: Deutsch
Beschreibung: Vorwort
Das Evangelische Gemeindelexikon will über christliche Bewegungen, Personen und Werke, sowie über biblische Begriffe und Zeitfragen allgemein-verständlich informieren. Insbesondere will es den Bereich christlichen Lebens und Denkens erschließen, der die Christenheit im deutschsprachigen Raum entscheidend geprägt hat, nanjlich die vom Pietisrnis; der Erwek-kungs- und Gemeinschaftsbewegung und den Freikirchen beeinflußten Personen, Gemeinden, Gemeinschaften und freien kirchlichen Werke. Es war das Anliegen der Herausgeber, diesen vielgestaltigen Bereich in Form von Personen- und Sachartikeln, Tabellen und Bildern betont in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei wollen die Sachartikel grundlegende biblische Erkenntnisse zur Sprache bringen und für das Denken der Gegenwart fruchtbar machen. Ober den Raum der christlichen Gemeinde hinaus sind Personen und geistige Strömungen aufgenommen worden, die den von uns umrissenen Raum beeinflußt haben oder zu Auseinandersetzungen herausfordern.
Um den Umfang des Lexikons nicht ausufern zu lassen, haben wir uns Fes-sein anlegen müssen, die oft sowohl von Autoren wie Herausgebern schmerzlich und störend empfunden wurden, aber aus mancherlei Gründen unerläßlich waren. So haben wir uns im wesentlichen geografisch auf den deutschen Sprachraum und zeitlich auf das i g. und 20. Jahrhundert beschränkt und - mit einer Ausnahme - auf Artikel über lebende Personen verzichtet.
Im übrigen haben wir durch größere Überblicksartikel versucht, den hier in den Mittelpunkt gerückten Stoff in den großen Ablauf der Kirchengeschichte einzugliedern. Als erstes sei auf den Artikel über den "Pietismus-. des Barock verwiesen, der den eigentlichen Queligrund für den hier zur Darstellung gebrachten Bereich bildet. Ferner sind der „Reformation«, dem «Mittelalter« und der «Alten Kirche« Überblicksartikel gewidmet. Auch die Artikel «Bibel« und «Bekenntnisse« sind als solche zu verstehen.
Die Querverweise wollen Hilfe für eine bessere Benutzung des Lexikons sein. Die unter den Artikeln genannten Literaturangaben wollen den Leser zu weiterem Studium anregen. Die Autoren haben sich bemüht, möglichst neueste Literaturangaben zu bieten, die dann ihrerseits weiterführende Bücher und Artikel nennen.
Es war das Ziel, wissenschaftlich fundierte und zugleich allgemeinverständ-liche Informationen zu vermitteln, um sowohl den hauptamtlichen Mitarbeitern wie auch den Nichttheologen ein Handbuch zu bieten, das zum Verständnis der heutigen kirchlichen Situation beitragen soll. Die Auswahl der Autoren, die für ihre Artikel verantwortlich zeichnen, erfolgte so, daß das Lexikon «aus der Gemeinde für die Gemeinde« geschrieben ist. Allen Autoren sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Dank gebührt auch dem Verlag und seinen Mitarbeitern, unter denen wir vor allem
Frau Esther Uber nennen möchten, die sich der nicht geringen Mühe unterzogen haben, dieses Werk herauszubringen.
Jesus Christus, der Herr, baut seine Gemeinde. Dazu benutzt er viele Menschen und mancherlei Formen und Bewegungen. Das wird auch durch dieses Buch deutlich. In diesem Sinne hoffen wir, daß das vorliegende Werk mit der Information zugleich auch Anstöße zum Nachdenken und Lernen für die eigene Arbeit geben wird. Es ist unsere Hoffnung, daß unser Herr Jesus Christus dieses Werk zum Bau seiner Gemeinde gebrauche.
Erich Geldbach
Helmut Burkhardt
Kurt Heimbucher
A
Abendmahl
L ZUM BEGRIFF
Das A. wird im deutschen Sprachbereich vorwiegend mit fünf Begriffen umschrieben. Obgleich diese Begriffe untereinander weitgehend austauschbar sind, kennzeichnet jeden von ihnen eine ganz bestimmte theologische Prägung.
1. ABENDMAHL: Der Begriff kam in der Reformationszeit auf und findet sich in Luthers deutscher Übersetzung des NTs seit 1522. Obwohl zeitlich gesehen der jüngste, ist er heute am weitesten verbreitet, nicht zuletzt deshalb, weil er als theologisch neutral empfunden wird. Er erinnert schlicht an die Aussage der Evangelien, daß die Gelegenheit, bei der Jesus am Vorabend seines Todes das A. stiftete, ein Abendessen war.
2. BROTERECHEN: In Apg 2,42 wird als zentraler Bestandteil urchristlichen Gemeindelebens das «Brechen des Brotes« genannt. Der Versuch, darin eine vom A. unterschiedene Form einer christlichen Mahlfeier zu sehen, etwa eine Agape, hat nicht überzeugt. Wenn Apg 2,46 davon spricht, daß sie «hin und her in den Häusern das Brot brachen«, dann ist damit eben kein Sättigungsmahl gemeint, sonst hätte man die Formulierung .'das Brot essen« gebraucht; vielmehr wird Bezug genommen auf den bedeutungsschweren Vollzug des Brechens des Brotes, der für das A. so charakteristisch ist. (Vgl. auch Apg 20,7; iKor 10,16). Das weitere Vorkommen des Begriffs in der Didache 14,1 (Kirchenordnung aus dem 2.Jh.) und im Brief des Ignatius an die Epheser 20,2 legt den Schluß nahe, daß Brotbrechen schon im Urchristentum eine geläufige Bezeichnung für das A. war. Konsequenterweise wird dieser Begriff heute vor allem in jenen Kirchen und Gemeinden gebraucht, die auf eine besondere Nähe zu Lehre und Ordnung des NTs Wert legen.
3. EUCHARISTIE: meint zunächst das Dankgebet bei Tisch, das im Judentum als Lobpreis Gott dargebracht wurde. So auch geschehen
14,22f.). In der frühen Kirche werden dann bald darunter auch die beiden Elemente Brot und Wein verstanden, für die gedankt wird, also das A. selbst. Zum Charakter des lobpreisenden Gebetes tritt nun noch der des Segnens und des Opfers, und wir haben damit die drei zentralen Aspekte, die bereits das frühchristliche A.-verständnis kennzeichnen und in der katholischen Kirche ihre weitere Entwicklung bis zur Ausgestaltung der römischen Messe erfahren haben.
4. HERRENMAHL: Nur in 1.Kor. kommt im NT dieser Ausdruck vor. Als sachlich dazugehörig kann noch die Bezeichnung -Tisch des Herrn« in 1.Kor 10,21 angesehen werden. Paulus macht mit diesem Begriff deutlich, daß Jesus Christus nicht nur der Stifter dieses Mahles ist, sondern als der auferstandene und erhöhte Herr lädt er die Gemeinde an seinen Tisch und macht sie aufs neue seines Heiles und seines Bundes gewiß. Von der Selbstverständlichkeit her, mit der Paulus vom »Mahl des Herrn« spricht, legt sich die Vermutung nahe, daß dieser Begriff, zumindest in den paulinischen Gemeinden, als Bezeichnung für das A. bekannt war. Im Blick auf seine starke biblische Füllung wird der Begriff heute von vielen allen anderen A.-bezeichnungen vorgezogen.
5.KOMMUNION: Religionsgeschichtlich gehört das A. zu den »sakralen Mahlzeiten«. Ström unterscheidet diesbezüglich zwischen einem "Konvivium-Typus« und einem »Komnunio-Typus« (TRE I,S.44ff.). Beim Konviviuni ißt man mit der Gottheit; bei der Kommunlo ißt man von der Gottheit. Beide Typen begegnen uns in der Umwelt des AT. Israel selbst kannte nur konvivische Mahifeiem; z.B. das Sabbat- und Passa-Mahl in der Familie, bei dem man sich bewußt in die besondere Gegenwart Gottes stellen ließ. In welchen Bereich das A. eingeordnet werden muß, ist eine offene Frage, je nach dem, ob man im A. mehr die Selbstmitteilung Jesu oder die Gegenwart des erhöhten Herrn und die Tischgemeinschaft mit ihm betont. Wo das A. als ein wirkliches Gerne-
Bestell-Nr.: BV30037
Autor/in: Geldbach, Erich (Hrsg.)
Titel: Evangelisches Gemeindelexikon.
ISBN: 3417245664 (ISBN-13: 9783417245660)
Zustand: leichte Gebrauchsspuren
Verlag: Wuppertal : Brockhaus
Format: 16 x 22,5
Seiten: 557 S.
Gewicht: 900 g
Ort: Wuppertal
Erschienen: 1978
Einband: Hardcover/gebunden
Sprache: Deutsch
Beschreibung: Vorwort
Das Evangelische Gemeindelexikon will über christliche Bewegungen, Personen und Werke, sowie über biblische Begriffe und Zeitfragen allgemein-verständlich informieren. Insbesondere will es den Bereich christlichen Lebens und Denkens erschließen, der die Christenheit im deutschsprachigen Raum entscheidend geprägt hat, nanjlich die vom Pietisrnis; der Erwek-kungs- und Gemeinschaftsbewegung und den Freikirchen beeinflußten Personen, Gemeinden, Gemeinschaften und freien kirchlichen Werke. Es war das Anliegen der Herausgeber, diesen vielgestaltigen Bereich in Form von Personen- und Sachartikeln, Tabellen und Bildern betont in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei wollen die Sachartikel grundlegende biblische Erkenntnisse zur Sprache bringen und für das Denken der Gegenwart fruchtbar machen. Ober den Raum der christlichen Gemeinde hinaus sind Personen und geistige Strömungen aufgenommen worden, die den von uns umrissenen Raum beeinflußt haben oder zu Auseinandersetzungen herausfordern.
Um den Umfang des Lexikons nicht ausufern zu lassen, haben wir uns Fes-sein anlegen müssen, die oft sowohl von Autoren wie Herausgebern schmerzlich und störend empfunden wurden, aber aus mancherlei Gründen unerläßlich waren. So haben wir uns im wesentlichen geografisch auf den deutschen Sprachraum und zeitlich auf das i g. und 20. Jahrhundert beschränkt und - mit einer Ausnahme - auf Artikel über lebende Personen verzichtet.
Im übrigen haben wir durch größere Überblicksartikel versucht, den hier in den Mittelpunkt gerückten Stoff in den großen Ablauf der Kirchengeschichte einzugliedern. Als erstes sei auf den Artikel über den "Pietismus-. des Barock verwiesen, der den eigentlichen Queligrund für den hier zur Darstellung gebrachten Bereich bildet. Ferner sind der „Reformation«, dem «Mittelalter« und der «Alten Kirche« Überblicksartikel gewidmet. Auch die Artikel «Bibel« und «Bekenntnisse« sind als solche zu verstehen.
Die Querverweise wollen Hilfe für eine bessere Benutzung des Lexikons sein. Die unter den Artikeln genannten Literaturangaben wollen den Leser zu weiterem Studium anregen. Die Autoren haben sich bemüht, möglichst neueste Literaturangaben zu bieten, die dann ihrerseits weiterführende Bücher und Artikel nennen.
Es war das Ziel, wissenschaftlich fundierte und zugleich allgemeinverständ-liche Informationen zu vermitteln, um sowohl den hauptamtlichen Mitarbeitern wie auch den Nichttheologen ein Handbuch zu bieten, das zum Verständnis der heutigen kirchlichen Situation beitragen soll. Die Auswahl der Autoren, die für ihre Artikel verantwortlich zeichnen, erfolgte so, daß das Lexikon «aus der Gemeinde für die Gemeinde« geschrieben ist. Allen Autoren sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Dank gebührt auch dem Verlag und seinen Mitarbeitern, unter denen wir vor allem
Frau Esther Uber nennen möchten, die sich der nicht geringen Mühe unterzogen haben, dieses Werk herauszubringen.
Jesus Christus, der Herr, baut seine Gemeinde. Dazu benutzt er viele Menschen und mancherlei Formen und Bewegungen. Das wird auch durch dieses Buch deutlich. In diesem Sinne hoffen wir, daß das vorliegende Werk mit der Information zugleich auch Anstöße zum Nachdenken und Lernen für die eigene Arbeit geben wird. Es ist unsere Hoffnung, daß unser Herr Jesus Christus dieses Werk zum Bau seiner Gemeinde gebrauche.
Erich Geldbach
Helmut Burkhardt
Kurt Heimbucher
A
Abendmahl
L ZUM BEGRIFF
Das A. wird im deutschen Sprachbereich vorwiegend mit fünf Begriffen umschrieben. Obgleich diese Begriffe untereinander weitgehend austauschbar sind, kennzeichnet jeden von ihnen eine ganz bestimmte theologische Prägung.
1. ABENDMAHL: Der Begriff kam in der Reformationszeit auf und findet sich in Luthers deutscher Übersetzung des NTs seit 1522. Obwohl zeitlich gesehen der jüngste, ist er heute am weitesten verbreitet, nicht zuletzt deshalb, weil er als theologisch neutral empfunden wird. Er erinnert schlicht an die Aussage der Evangelien, daß die Gelegenheit, bei der Jesus am Vorabend seines Todes das A. stiftete, ein Abendessen war.
2. BROTERECHEN: In Apg 2,42 wird als zentraler Bestandteil urchristlichen Gemeindelebens das «Brechen des Brotes« genannt. Der Versuch, darin eine vom A. unterschiedene Form einer christlichen Mahlfeier zu sehen, etwa eine Agape, hat nicht überzeugt. Wenn Apg 2,46 davon spricht, daß sie «hin und her in den Häusern das Brot brachen«, dann ist damit eben kein Sättigungsmahl gemeint, sonst hätte man die Formulierung .'das Brot essen« gebraucht; vielmehr wird Bezug genommen auf den bedeutungsschweren Vollzug des Brechens des Brotes, der für das A. so charakteristisch ist. (Vgl. auch Apg 20,7; iKor 10,16). Das weitere Vorkommen des Begriffs in der Didache 14,1 (Kirchenordnung aus dem 2.Jh.) und im Brief des Ignatius an die Epheser 20,2 legt den Schluß nahe, daß Brotbrechen schon im Urchristentum eine geläufige Bezeichnung für das A. war. Konsequenterweise wird dieser Begriff heute vor allem in jenen Kirchen und Gemeinden gebraucht, die auf eine besondere Nähe zu Lehre und Ordnung des NTs Wert legen.
3. EUCHARISTIE: meint zunächst das Dankgebet bei Tisch, das im Judentum als Lobpreis Gott dargebracht wurde. So auch geschehen
14,22f.). In der frühen Kirche werden dann bald darunter auch die beiden Elemente Brot und Wein verstanden, für die gedankt wird, also das A. selbst. Zum Charakter des lobpreisenden Gebetes tritt nun noch der des Segnens und des Opfers, und wir haben damit die drei zentralen Aspekte, die bereits das frühchristliche A.-verständnis kennzeichnen und in der katholischen Kirche ihre weitere Entwicklung bis zur Ausgestaltung der römischen Messe erfahren haben.
4. HERRENMAHL: Nur in 1.Kor. kommt im NT dieser Ausdruck vor. Als sachlich dazugehörig kann noch die Bezeichnung -Tisch des Herrn« in 1.Kor 10,21 angesehen werden. Paulus macht mit diesem Begriff deutlich, daß Jesus Christus nicht nur der Stifter dieses Mahles ist, sondern als der auferstandene und erhöhte Herr lädt er die Gemeinde an seinen Tisch und macht sie aufs neue seines Heiles und seines Bundes gewiß. Von der Selbstverständlichkeit her, mit der Paulus vom »Mahl des Herrn« spricht, legt sich die Vermutung nahe, daß dieser Begriff, zumindest in den paulinischen Gemeinden, als Bezeichnung für das A. bekannt war. Im Blick auf seine starke biblische Füllung wird der Begriff heute von vielen allen anderen A.-bezeichnungen vorgezogen.
5.KOMMUNION: Religionsgeschichtlich gehört das A. zu den »sakralen Mahlzeiten«. Ström unterscheidet diesbezüglich zwischen einem "Konvivium-Typus« und einem »Komnunio-Typus« (TRE I,S.44ff.). Beim Konviviuni ißt man mit der Gottheit; bei der Kommunlo ißt man von der Gottheit. Beide Typen begegnen uns in der Umwelt des AT. Israel selbst kannte nur konvivische Mahifeiem; z.B. das Sabbat- und Passa-Mahl in der Familie, bei dem man sich bewußt in die besondere Gegenwart Gottes stellen ließ. In welchen Bereich das A. eingeordnet werden muß, ist eine offene Frage, je nach dem, ob man im A. mehr die Selbstmitteilung Jesu oder die Gegenwart des erhöhten Herrn und die Tischgemeinschaft mit ihm betont. Wo das A. als ein wirkliches Gerne-
ISBN:
9783417245660
Ähnliche Bücher:
Mein Konto
Direkter Kontakt zu uns:
- Christ und Buch
- Günter Arhelger
- +49 2736 298277
- 9:00 Uhr — 18 Uhr
Montag - Freitag - [email protected]