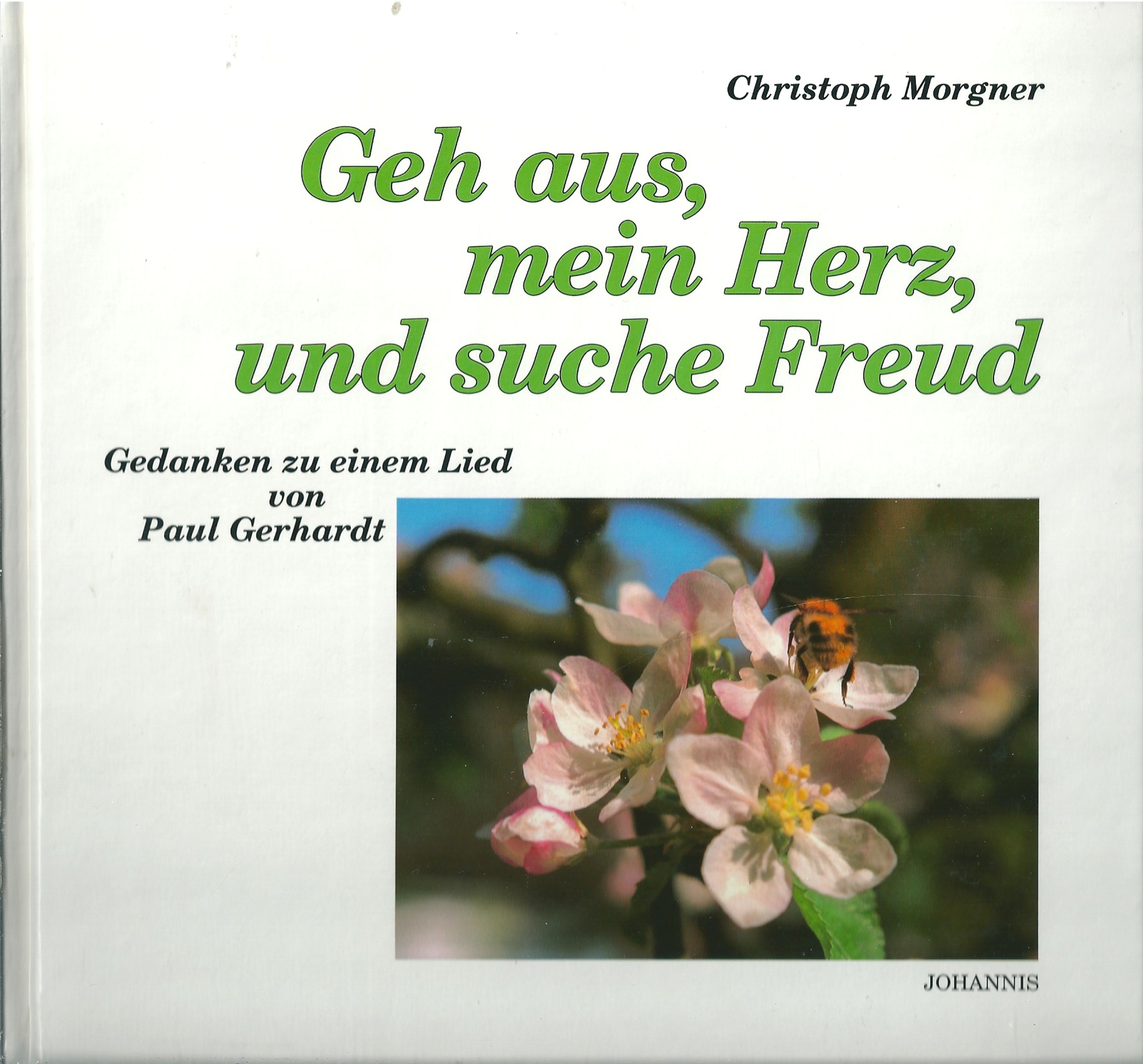Keine Bewertungen gefunden
Geh aus, mein Herz, und suche Freud - Gedanken zu einem Lied von Paul Gerhardt, Christoph Morgner
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
gebraucht
Bestell-Nr.: BN7943
Autor/in: Christoph Morgner
Titel: Geh aus, mein Herz, und suche Freud - Gedanken zu einem Lied von Paul Gerhardt
Preis: 5,20 €
ISBN: 9783501012819 (früher: 3501012810)
Format: 22 x 23 cm
Seiten: 36
Gewicht: 300 g
Verlag: Johannis
Erschienen: 1996
Einband: Hardcover
Sprache: Deutsch
Zustand: leichte Gebrauchsspuren
Paul Gerhardt - sein Leben und seine Lieder
Paul Gerhardt gehört zu den großen Dichtern der Christenheit. Er hat mehr als 130 Lieder geschrieben. Viele von ihnen haben Einzug in die Gesangbücher
gehalten.
In Gräfenhainichen, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt zwischen Wittenberg und Bitterfeld, wird Paul Gerhardt 1607 geboren. Hier verbringt er auch
seine frühe Kindheit. Der Vater ist neben seiner Landwirtschaft als Bürgermeister tätig. Doch diese geordneten Verhältnisse währen nur kurze Zeit. Innerhalb von zwei Jahren sterben die Eltern. Im Alter von 14 Jahren steht Paul Gerhardt mit seinen drei Geschwistern als Waise da.
Mit 15 Jahren wird er Schüler der Fürstenschule in Grimma - ein Elite-Gymnasium damaliger Zeit. Das jährlich zu entrichtende Kostgeld kann von Paul Gerhardt selbst aufgebracht werden, was auf einen gewissen Wohlstand
schließen läßt, den die Eltern ihren Kindern hinterlassen haben. Nach der Abschlußprüfung wendet er sich, mittlerweile 20 Jahre alt, dem Theologiestudium zu. Studienort ist Wittenberg, dessen Universität auch noch ein Jahrhundert nach der Reformation als Hochburg des lutherischen Bekenntnisses gilt, das von den dortigen Theologen eisern gehütet wird. Um sich Kost und Logis zu verdienen, wirkt Paul Gerhardt nebenbei als Hauslehrer bei einem Pfarrer der Stadtkirche, bei dem er wohl auch wohnt. Ansonsten liegen diese Jahre nahezu im dunkeln. Paul Gerhardt muß jedoch ein überdurchschnittlich fähiger Student gewesen sein, denn er wird, als er später seine erste Pfarrstelle antritt, sofort in ein leitendes Amt gerufen.
Nach seinem Studium arbeitet er zunächst in Berlin als Hauslehrer. Erst mit 44 Jahren bekommt er eine Pfarrstelle. Man überträgt ihm die Stelle eines Propstes (Dekan, Superintendent) in Miltenwalde, einem Ort im Spreewald. Dort hat er nicht nur sein Pfarramt zu verwalten, sondern ihm kommt auch die Aufsicht über einen Kirchenbezirk zu, der mehrere Pfarrstellen und Schulen umfaßt. Alles spielt sich unter dürftigen äußeren Verhältnissen ab. Den finanziellen Grundstock für die Versorgung bildet die eigene Landwirtschaft, die er selber zu bestellen hat.
1655 heiratet Paul Gerhardt. Seine Frau Anna Maria hat er in Berlin kennengelernt. Die Ehe wird nur 13 Jahre dauern. Von den vier Kindern, die den Eheleuten geschenkt werden, überlebt nur eins. Als seine Frau später stirbt, bleibt Paul Gerhardt mit dem sechsjährigen Paul Friedrich allein zurück.
Im Jahre 1657 kehrt Paul Gerhardt nach Berlin zurück und wird Pfarrer an der Hauptkirche St. Nikolai. Leider kommt es in Berlin zu heftigen Konflikten zwischen den reformierten und lutherischen Traditionen, die dort vertreten sind. Im »Berliner Kirchenstreit« weiß sich Paul Gerhardt unbedingt dem lutherischen Bekenntnis verpflichtet. Das Toleranzedikt, das der reformierte Fürst allen Pfarrern zu unterzeichnen befiehlt, um Religionsfrieden einkehren zu lassen, unterschreibt Paul Gerhardt nicht. 1 666 wird er seines Amtes enthoben.
Zwei Jahre später wird er auf die Pfarrstelle in Lübben im Spreewald berufen, seine letzte Lebensstation. 1676 stirbt
er und wird im Chorraurn der Lübhener Kirche bestattet, wo noch heute sein Grab und ein Ölbildnis an ihn erinnern.
Die Lebensstrecke von Paul Gerhardt überspannt den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Eine entsetzliche Zeit! Das Land wird verwüstet. Menschen werden entwurzelt. Das Elend, das dieser Krieg bringt, ist schier unermeßlich. Als er schließlich endet, hat Deutschland nur noch knapp zwei Drittel seiner Einwohner. In diesen schrecklichen Krieg wird auch Paul Gerhardt hineingerissen. Er muß erleben, wie Menschen leiden, Die Angst ist ständiger Begleiter. Hunger grassiert. In seinem Gefolge geht die Pest um und tut ihr grausiges Werk.
Mittenwalde hat unter dem Krieg besonders schwer gelitten. Hat es vor dem Krieg noch 245 Haushalte gegeben, so sind es danach nur noch 42. Einer der Amtsvorgänger von Paul Gerhardt wird im Jahre 1637 in seiner Kirche vor dem Altar von schwedischen Soldaten erschossen. Zum äußeren Elend dieser Jahrzehnte kommt die innere Verwüstung. Moral und Sitte sind weithin verfallen. Vielerorts droht der Rückfall ins Heidentum. In dieser schwierigen Zeit liegt Paul Gerhardt vor allem die innere Lage seiner Gemeinden am Herzen: Wie kann nach der bitteren Kriegszeit das Leben des Glaubens neu angezündet, gestärkt und vertieft werden?
Hier kommen den Liedern wesentliche Aufgaben zu. In ihrer Verbindung von Wort, Melodie und Rhythmus bringen sie die christliche Botschaft selbst zu solchen Menschen, die - aus welchen Gründen auch immer - des Lesens unkundig sind. Davon hat es damals sehr viele gegeben. Die Lieder singen die frohe Botschaft ins Herz. Sie helfen zum Besinnen und leiten zu einem verantwortungsbewußten Leben an. Ihre menschliche Wärme und seelsorgerliche Kraft ermutigen zum Vertrauen auf den lebendigen Gott.
Das Sommerlied »Geh aus, mein Herz« zählt zum Schönsten, was uns Paul Gerhardt hinterlassen hat. Wann es entstanden ist, wissen wir nicht genau. Es tritt 1653, als Paul Gerhardt Propst in Mittenwalde ist, erstmals - in einem Gesangbuch - ans Licht der Öffentlichkeit. In einer Zeit, in der Deutschland am Boden liegt, läßt sich Paul Gerhardt nicht vom Negativen gefangennehmen. Er setzt gegen alles Böse, das gewütet hat, die Kraft seines Gottes und Heilandes, der in diesen Jahren vielen fraglich geworden ist. Er lobt und rühmt. Er singt von ihm. Was Gott getan hat, noch tut und einmal tun wird, nimmt ihn in Beschlag und macht ihn mitten in allem Herzeleid froh und dankbar. Sein Glaube lebt nicht von glücklichen Umständen, sondern von der Nähe Gottes in Jesus Christus. Er rechnet mit dem lebendigen Gott, der ins Elend führen, aber zugleich aufrichten und heilen kann. So hat es Paul Gerhardt selbst erlebt. Davon künden seine zahlreichen Lieder, die bis heute ihre tröstende Kraft erwiesen haben. Die Melodie, nach der wir »Geh aus, mein Herz« gewöhnlich singen, ist erst mehr als hundert Jahre später vom Leipziger Musiker und Komponisten August Harder (1775-1813) geschaffen worden. Der Gütersloher Organist Friedrich H. Eickhoff (1807-1880) hat die ursprünglich für ein Frühlingslied bestimmte Weise dem Sommerlied Paul Gerhardts angepaßt. So ist unser Lied zu einem geistlichen Volkslied erster Größe geworden.
Ähnliche Bücher:
Mein Konto
Direkter Kontakt zu uns:
- Christ und Buch
- Günter Arhelger
- +49 2736 298277
- 9:00 Uhr — 18 Uhr
Montag - Freitag - [email protected]