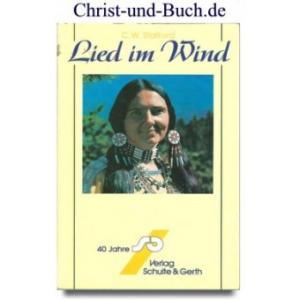Keine Bewertungen gefunden
etwas abgegriffen
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Verkäufer Details und Geschäftsbedingungen: » .ChristUndBuch.de «
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
„Was ist eigentlich aus Onkel Flint geworden?" fragten die Leute, die mein erstes Buch „Schrei im wind" gelesen hatten.
Das überwältigende Echo auf dieses Buch überraschte mich. Mein Telefon klingelte ununterbrochen, und eine Flut von Briefen traf ein, in denen sich die Leute nach dem weiteren Schicksal der in dem Buch erwähnten Personen erkundigten. Da wurde mir klar, daß ich meine Schreibmaschine abstauben und die Geschichte fertig erzählen mußte.
In „Schrei im wind" schrieb ich von dem Kampf meiner Familie. Wir sind Indianer und glaubten an die alten Indianergötter. Eines Tages aber kamen wir mit dem christlichen Glauben in Berührung. In meinem Buch versuchte ich, das Entsetzen und die Einsamkeit zu beschreiben, die uns packte, nachdem wir erkannt hatten, daß unsere Religion Götzendienst war und uns nicht helfen konnte.
Einige Begebenheiten habe ich verschwiegen, weil es mir zu peinlich war, darüber zu sprechen. Da aber so viele Menschen an den Einzelheiten meines Lebens interessiert waren und herzliche Anteilnahme zeigten, habe ich mich entschlossen, meine tiefsten Geheimnisse preiszugeben in der Hoffnung, auf Verständnis und Mitgefühl zu stoßen.
Ich habe oft Dinge gesagt oder getan, die ich später bereute. Um die Anonymität der Beteiligten zu wahren, habe ich die Namen einiger Personen und Ortschaften geändert. Ich möchte niemanden kritisieren oder in Verlegenheit bringen. Manchmal habe ich die Zeitangaben geändert, um die Geschichte interessanter zu gestalten. Die Ereignisse selbst jedoch sind so wiedergegeben, wie sie sich meinem Gedächtnis eingeprägt haben. Wenn Ihnen manches seltsam, unmöglich oder einfach lächerlich vorkommt, dann denken Sie bitte daran, daß ich mich als Neubekehrte ohne Bindung an eine Gemeinde nur sehr langsam entwickeln konnte.
Es war oft schwer, den richtigen Weg zu finden. Wie dem auch sei, alle in diesem Buch beschriebenen Ereignisse sind wahr und betreffen entweder mich selbst oder meine Familie.
Ich bin meinen Freunden und meinem geduldigen Mann sehr dankbar, daß sie mir geholfen haben, zu wachsen und meinen Platz in dieser Welt zu finden.
Leseprobe: Schrei im Wind
Schüsse krachten. Wo die Kugeln in das ausgetrocknete Erdreich einschlugen, wirbelte der Staub auf. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Eine einzige unvorsichtige Bewegung konnte mich das Leben kosten. Zwei weitere Schüsse böllerten durch das Tal, und wieder wirbelte der Staub um meine Füße.
Da - ein durchdringender Schrei: „Heute ist ein herrlicher Tag zum Sterben!" Ein junger Indianer preschte in halsbrecherischem Galopp heran und brachte sein Pferd einen knappen Meter von mir entfernt zum Stehen.
Der Indianer trug nur Blue jeans und Mokassins. Seine dunkle Brust war der Sonne ausgesetzt, und das lange, schwarze Haar fiel ihm wirr über die Schultern. Im Gürtel steckte ein Revolver, und in der rechten Hand hielt er seine Flinte. Er warf das rechte Bein über den Hals des Pferdes und ließ sich gewandt zu Boden gleiten. Das Tier begann zu grasen.
Mein Revolver lag kalt und schwer in meiner Hand, als ich ihn aus dem Halfter genommen hatte.
„Ist heute wirklich ein herrlicher Tag zum Sterben?" fragte ich.
Der Indianer lachte, bückte sich nach einer leeren Flasche und balancierte sie auf dem Kopf. Ich drückte den Abzug. Eine Kugel zerschmetterte die Flasche in tausend winzige Teilchen. Onkel Flint lachte und schüttelte sich die Glassplitter aus seinem dichten, schwarzen Haar.
„Gut getroffen, Schrei im Wind! Jetzt bin ich an der Reihe!"
Ich hob eine leere Konservendose auf und hielt sie in...
Zustandsbeschreibung:
etwas abgegriffen