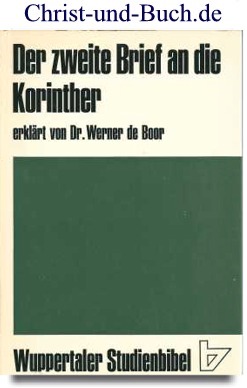Keine Bewertungen gefunden
Homepage/Bibelkommentare/Bibelauslegungen/Bibel NT/Korinther Briefe/Wuppertaler Studienbibel 2. Korinther, Werner de Boor
gebraucht, etwas abgegriffen
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Verkäufer Details und Geschäftsbedingungen: » .ChristUndBuch.de «
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
BEDROHLICHE SPANNUNGEN ZWISCHEN APOSTEL UND GEMEINDE Die Korinther waren sicher nicht bereit, auf die Anweisungen des Paulus zu hören. Paulus greift die Fragen des 1. Briefes nicht wieder auf. Jetzt musste erst einmal unterschieden werden, ob die Gemeinde Paulus grundsätzlich als ihren Apostel anerkennt und zu neuem Gehorsam gegen ihn bereit sein wird.
- Alter und Neuer Bund
- Bewährung des Aposteldienstes
- Abweisung von Missverständnissen
- Forderung ganzer Reinigung der Gemeinde
- Versöhnung
- Wirkung des Tränenbriefes
- Freude des Titus
- Freude des Titus
- erfreulicher Erfolg der Sammlung
- an Korinth gerichtete Erwartung
- Grund der Aussendung der Brüder
- zur Frage des Kollektierens
- Kampfansage des Apostels an seine Gegner
- berechtigtes Selbstbewusstsein
- falscher Ruhm der Gegner
- Gesichte und Offenbarungen
Der zweite Brief des Paulus an die Korinther (W.de Boor)
|11|
EINLEITUNG
1. Wenn wir vom 1. Korintherbrief herkommend unsern Brief lesen, spüren wir sofort den großen Unterschied zwischen den beiden Briefen. Im 1. Korintherbrief ging es um einzelne Sachfragen des Gemeindelebens, die nacheinander in ruhiger Darlegung behandelt werden. Im 2, Korintherbrief aber gibt es - abgesehen von dem Abschnitt über die Sammlung für Jerusalem - im Grund nur ein einziges Thema: die apostolische Autorität des Paulus. Die vielerlei Themen des 1. Briefes sind verschwunden. Vom rechten Verhalten bei Streitigkeiten unter Brüdern, von der Zucht im geschlechtlichen Leben, von der Ehe, vom Götzenopferfleisch, von der Feier des Herrenmahles, vom Verhalten der Frauen, von den Geistesgaben, von der Auferstehung hören wir nichts mehr.
Das wird nicht darin seinen Grund haben, daß alle diese Fragen inzwischen nach dem Wunsch des Apostels geregelt sind. Wir sehen aus dem 2. Brief, wie bedrohlich die Spannungen zwischen Apostel und Gemeinde geworden waren. In dieser Lage sind die Korinther sicher nicht bereit gewesen, auf die Anweisungen des Paulus zu hören! Paulus greift diese Fragen nicht wieder auf. Ihm geht es wie einem Architekten (1 Ko 3,10!), der nicht mehr über einzelne Fragen eines Baues verhandeln kann, wenn ihm die Vollmacht zur Durchführung des Baues überhaupt bestritten wird. Jetzt mußte erst einmal entschieden werden, ob die Gemeinde Paulus grundsätzlich als ihren Apostel anerkennt und zu neuem Gehorsam gegen ihn bereit sein wird.
Von daher wird verständlich, daß der 2. Korintherbrief der persönlichste Brief ist, den Paulus geschrieben hat. Notgedrungen muß er in ihm fort und fort von seiner eigenen Person und von seinem Tun und Leiden sprechen. Der ganze Brief klingt wie eine "Verteidigungsrede", auch wenn Paulus ihn nicht so aufgefaßt und gelesen haben will (Kap. 12,19). Paulus ist beim Schreiben in stärkstem Maße selbst beteiligt, auch wenn es ihm nicht um seine Person, sondern um Korinth und um die liegt, auch wenn es ihm nicht um seine Person, sondern um Korinth und um die Gemeinde dort geht. Für das Bestehen und Gedeihen dieser Gemeinde ist die Anerkennung seiner Vollmacht und Verkündigung von grundlegender Bedeutung.
Verständlich ist von daher auch der erregte Ton des Briefes und der auffallende Wechsel im Ton. Lesen wir nur einmal 7,8-16 und 12,20-13,4 nebeneinander. Für die Beurteilung der Einheitlichkeit unseres Briefes ist es von Wichtigkeit, daß wir diesen Wechsel im Ton begreifen. Vgl. die Darlegung unter 4.
2. Wir merken zunächst den tiefen Unterschied unseres Briefes gegenüber dem 1. Korintherbrief. Aber zugleich fällt vom 2. Brief ein klärendes Licht auf den 1. Brief zurück. Viele Sätze und Aussagen des 1. Briefes werden in diesem Licht schärfer und profilierter. Sie bekommen ein ganz anderes Gewicht. Dadurch rücken beide Briefe wieder näher aneinander; ihre Einheit und Zusammengehörigkeit tritt hervor.
Vom 2. Korintherbrief her sehen wir deutlicher, wie ernst die Spannung zwischen Apostel und Gemeinde bereits zur Zeit des 1. Briefes war. Es gab damals schon Männer in Korinth, die des Paulus erklärte Gegner waren, sein Apostelamt bestritten, |12| ihn aus der Gemeinde ganz hinausdrängen wollten und bereits triumphierend sagten, er werde gar nicht mehr nach Korinth zu kommen wagen (1 Ko 4,18). Gegen sie und gegen das Mißtrauen, das sie säten, mußte Paulus seine einzigartige Bedeutung für die Gemeinde in Korinth betonen: 1 Ko 1,1;3,10;4,15-17;9,1.2. Schon damals waren die ständigen Leiden des Paulus und sein wenig imponierendes Auftreten, einschließlich der Ablehnung einer Besoldung von seiten der Gemeinde, ein erheblicher Anstoß in Korinth. Sätze wie 1 Ko 2,1;3,17;4,8-13.18-21;9,1-12;9,19;14,37.38 lesen wir von den harten Auseinandersetzungen des 2. Briefes her ganz neu. Und auch die scharfen Urteile über die Gemeinde an einzelnen Stellen (1 Ko 3,1-4;4,8;4,21;5,2;8,12;11,30-32;15,33 f), verraten uns im Rückblick vom 2. Brief her eine bereits sehr tief gehende Sorge um die Gemeinde. Auch das kleine Sätzchen 1 Ko 16,22 mit seinem Anathema über alle, die den Herrn Jesus nicht liebhaben, erhält vom 2. Korintherbrief her ein ganz anderes Gewicht.
3. Wie aber ist es zum 2. Korintherbrief gekommen? Welche Ereignisse liegen zwischen den beiden Briefen? Die Sendung des Timotheus nach Korinth (1 Ko 4,17;16,10 f), vom Apostel nicht ohne Sorge unternommen, hatte offenbar keinen Erfolg gehabt. Die Lage in Korinth und die Auflehnung gegen Paulus zeigte sich noch bedrohlicher, als es der Apostel bei seinem Schreiben angenommen hatte. Timotheus brachte bei seiner Rückkehr aus Korinth so alarmierende Nachrichten mit, daß Paulus sich entschloß, die Arbeit in Ephesus für kurze Zeit zu unterbrechen und selber nach Korinth zu fahren. Er "kam in Traurigkeit" (2 Ko 2,1) zu diesem "Zwischenbesuch", den er in 13,1.2 ausdrücklich als "zweiten Besuch" zählt. Paulus konnte bei der Kürze der Zeit in Korinth die Nöte nicht beseitigen und die Schwierigkeiten nicht lösen. Darum gab er seinen früheren Reiseplan (1 Ko 16,5-8) auf und versprach den Korinthern einen besonders gründlichen Besuch. Er wollte direkt auf dem Seeweg von Ephesus zu den Korinthern kommen, bei ihnen verweilen und dann erst von Korinth aus den Besuch bei den makedonischen Gemeinden machen, um aus Makedonien nochmals nach Korinth zurückzukehren (2 Ko 1,15 f). Bei solch gründlichem Bemühen um die Gemeinde hoffte der Apostel wohl, sie wieder ganz in die Hand zu bekommen und alte Wunden zu heilen.
Paulus hat diesen Reiseplan nicht durchgeführt. Die Gründe nennt er uns in 1,23;2,1-4. In Korinth ist etwas geschehen, was den Apostel tief traf und sein Kommen nach Korinth sehr schwierig für die Gemeinde wie für ihn selbst gemacht hätte. Dieser notvolle Zwischenfall kann sich nicht während des "Zwischenbesuches" selbst ereignet haben; denn dann hätte Paulus den Korinthern nicht den großzügigen Doppelbesuch versprochen, bzw. ein in dieser Richtung gegebenes Versprechen sofort zurückgenommen. Der Aufschub des Besuches und die Änderung des Reiseplanes ist sichtlich erst nach der Rückkehr des Apostels nach Ephesus beschlossen worden. Was war in Korinth geschehen? Paulus spricht in unserm Brief von einem Mann in der Gemeinde, der "Betrübnis angerichtet" und "Unrecht getan" hat, und von einem andern, der "betrübt worden ist" und "dem Unrecht geschah" (2,5;7,12). Da sich dies nicht während des "Zwischenbesuches" ereignete, kann es nicht der Apostel |13| selber sein, der von einem Glied der Gemeinde beleidigt worden ist. Aber es wird sich um einen Mann gehandelt haben, der Paulus nahe stand, so daß der Apostel persönlich mitbetroffen war. Paulus gab seinen Besuch in Korinth vorerst auf und schrieb "aus großer Trübsal und Angst des Herzens mit viel Tränen" (2,4) einen harten Brief, in welchem er eine klare Entscheidung der Gemeinde und eine Bestrafung des "Übeltäters" forderte. Diesen Brief - zur Unterscheidung von den anderen Korintherbriefen der "Tränenbrief" genannt - ließ er durch Titus in Korinth überbringen. Er beendete seine Arbeit in Ephesus und wanderte über Troas zum Besuch der makedonischen Gemeinden. Er nahm damit seinen früheren Reiseplan (1 Ko 16,5-8) wieder auf, nur daß jetzt nicht mehr Korinth das klare Ziel seiner Wanderung war. Paulus mußte abwarten, was Titus in Korinth erreicht und was sein eigener Brief dort ausgerichtet hatte. Er hatte offenbar nicht an einen langen Aufenthalt des Titus in Korinth gedacht. Es ging nicht um Verhandlungen und Diskussionen, sondern um eine Entscheidung, die rasch gefällt werden konnte und mußte. Der Apostel hoffte, Titus auf dessen Rückweg von Korinth bereits in Troas zu treffen. Doch Titus kam nicht. Paulus brach in seinen tiefen Sorgen um Korinth eine hoffnungsvolle Evangelisation in Troas ab und reiste nach Makedonien weiter Titus entgegen (2,12 f). In Makedonien - wir wissen nicht in welcher Stadt, vielleicht schon in Philippi - traf Titus mit guten Nachrichten aus Korinth bei Paulus ein. Die Gemeinde hatte in ihrer Mehrheit eine Strafe gegen den Übeltäter verhängt; die Liebe zu dem Apostel Paulus, das Bewußtsein unlösbarer Zugehörigkeit zu ihm war ihnen neu aufgegangen. Paulus war voller Freude (7,5-16). Nun kann der 2. Korintherbrief geschrieben werden. Der Weg ist frei zu dem Besuch des Apostels in Korinth. Der Brief kündigt diesen 3. Besuch in der Gemeinde an (13,1-4) und bereitet ihn durch eine Besprechung der gegen Paulus erhobenen Vorwürfe und durch eine entschlossene Kampfansage an die Zerstörer der Gemeinde vor (Kap. 1-7 und 10-13). Titus wird, begleitet von zwei Brüdern, noch einmal nach Korinth kommen, diesen Brief übergeben und der Gemeinde bei der Durchführung der Sammlung für die Urgemeinde in Jerusalem helfen (8,16-24). Der eigene Besuch des Apostels wird dann folgen.
So können wir den Verlauf der Ereignisse, die von der Absendung des 1. Korintherbriefes bis zum Diktat des 2. Briefes und seiner Überbringung durch Titus führten, in großen Linien nachzeichnen. Wichtige Einzelheiten bleiben freilich offen. In einem Brief wird vielfach in Andeutungen geredet, die der Briefempfänger sofort versteht, die aber für einen späteren Leser des Briefes undeutlich bleiben. Es lag nahe, daß Paulus gerade von solchen Ereignissen, die für die Gemeinde schmerzlich und beschämend waren, jetzt nach der Aussöhnung mit ihr nur in solchen Andeutungen sprach.
4. Es würde das Verständnis der Vorgänge in Korinth und darum auch vieler Sätze und Anspielungen in unserem Brief sehr erleichtern, wenn wir die Gegner des Paulus dort genau kennen und ein klares Bild der Strömungen haben könnten, von denen die Gemeinde bewegt und innerlich zerklüftet war. |14| Wer waren die Männer, die zeitweise fast die ganze Gemeinde von Paulus loszumachen und unter ihren Einfluß zu bringen drohten? Wo kamen sie her? Was waren ihre Ziele? Es ist viel darüber nachgedacht und geschrieben worden. Aber die Hinweise und Andeutungen in unserm Brief, bzw. in beiden Korintherbriefen, sind so knapp, daß die Bemühungen der Ausleger nicht zu allgemein anerkannten Ergebnissen geführt haben.
a) Wir werden auch hier an den ersten Brief anzuknüpfen haben. Es ist bezeichnend, daß der Apostel dort nirgends eingehender eine "Irrlehre" darstellt, mit der er sich theologisch auseinandersetzt. Es geht um bestimmte Verhaltensweisen, die Paulus verurteilen muß und die er mit Erschrecken in der Gemeinde um sich greifen sieht. Man meint sehr viele "Freiheiten" zu haben, sogar die Freiheit zur Heirat mit der Stiefmutter (Kap. 5), die Freiheit zum Prozessieren mit Brüdern vor heidnischen Richtern (Kap. 6), Freiheit im sexuellen Leben (Kap. 6,12 ff), Freiheit zur Teilnahme an Tempelmahlzeiten (Kap. 8), Freiheit zum Aufgeben fraulicher Sitte (Kap. 11,2-16), Freiheit zum eigenen Genießen bei den Gemeindemahlzeiten (Kap. 11,17 ff). Was Paulus dabei besonders erschreckt, ist das Beiseitestellen der Liebe zugunsten der eigenen Freiheit und Größe. Man kümmert sich nicht um den Bruder (8,11-13)! Man verachtet die Gemeinde, den Leib des Christus (11,22)! Man fühlt sich als überlegener "Geistesmensch" mit großen "Gaben" und ist doch in Wahrheit "fleischlich" (Kap. 3,1-4). Man will sicher und überlegen leben (Kap. 4,8) und stößt sich an dem armen und von Leiden gezeichneten Weg des Apostels. Ist er überhaupt ein echter Apostel? Müßte ein Gesandter Gottes nicht ganz anders auftreten? (Kap. 4,9-13;9,1-23).
Offenbar ist die Gemeinde selbst von solcher Freiheitsschwärmerei bedroht und wird darum auch als ganzes angeredet. Immerhin zeigen Stellen wie Kap. 8,77 ff, daß diese "Freiheit" von einer Gruppe in der Gemeinde besonders in Anspruch genommen wird. Und in Kap. 15,12.34 erscheint das Stichwort "etliche", das Männer erkennen läßt, die hier tonangebend waren.
b) Hinter diesen "Freiheiten" in der Lebenspraxis stand eine bestimmte Anschauung vom Christentum, eine gefährliche "Lehre": "Alles ist erlaubt" für wahre Geistesmenschen. Der Apostel sieht in dem ganzen Denken dieser Kreise eine "Entleerung des Kreuzes Christi" zugunsten "hoher Weisheit", auf die man stolz ist (Kap. 1,17 ff;2,1). Es kommt hier zur Leugnung der Auferstehung und im Zusammenhang damit zur Abwendung von der biblischen Hoffnung (Kap. 15). Der Apostel muß "etlichen" geradezu "Unkenntnis Gottes" vorwerfen. So geht es freilich auch in Korinth um "Irrlehre", aber um eine solche, die mit einer Irreführung der Lebenspraxis völlig verwoben ist. "Leben" und "Lehre" liegen untrennbar ineinander.
c) Die führenden Männer dieser Bewegung in der Gemeinde müssen nicht erst nachträglich von außen gekommen sein. Sie können aus der Gemeinde selbst stammen, zumal sie deutlich "griechisch" empfinden und denken. Sie könnten sowohl Anschauungen des Apostels selbst oder auch des Apollos mißverstanden und gefährlich übersteigert haben. Wir werden sie in der vierten der aufgezählten "Gruppen" |15| in Kap. 1,12 zu suchen haben. Sie meinten offenbar in einer besonderen und unmittelbaren Weise "Christus zu gehören". Sie proklamierten ein freies, von menschlichen Autoritäten unabhängiges "Geistchristentum", "über die Schrift hinaus" (Kap. 4,6), ohne Unterstellung unter einen Apostel. Sie suchten darum die Gemeinde von Paulus loszumachen, der ihnen viel zu eng und geistig wie geistlich zu unbedeutend erschien. Sie wollten die Gemeinde in die eigene Hand bekommen, um sie erst wirklich auf die "Höhe" geistlichen Lebens zu führen.
d) Diese Gruppe ist auch im zweiten Brief deutlich zu erkennen. Die Losung "Ich gehöre Christus" erklingt immer noch (Kap. 10,7). In aller Offenheit wird geringschätzig von Paulus gesprochen, dessen Auftreten schwach und dessen Rede ohne Gewicht ist (Kap. 10,10). Jetzt wird auch seine ganze Lebenshaltung als "fleischlich" bezeichnet und vielleicht auch seine Christusbotschaft mit der zentralen Stellung des Kreuzes als ein "Kennen des Christus nach Fleischesart" abgelehnt (Kap. 10,2;5,16). Der Leidensweg des Apostels, einschließlich seiner Armut, erregt weiter Anstoß; Paulus muß immer wieder von der Notwendigkeit des Leidens sprechen (Kap. 4,7 ff;11,23-33).
Und die "Freiheit", gerade auch auf sexuellem Gebiet, wird von Männern dieser Gruppe so bewußt in Anspruch genommen, daß sie trotz der gründlichen Darlegung des Apostels in 1 Ko 6,12 ff eine Sinnesänderung ausdrücklich ablehnen und bei ihrem "Recht" auf uneingeschränktes Ausleben beharren (Kap. 12,12;13,2).
e) Wenn wir es im 2. Korintherbrief nur mit dieser einen Richtung zu tun hätten, wäre das Urteil über die Gegner des Apostels relativ einfach. Sie bildeten dann eine einheitliche Gruppe, an der wir leicht Züge dessen entdecken könnten, was später als Bewegung der "Gnosis"[ A ] die ganze Kirche erschütterte. Aber nun steht in unserem Brief das 3. Kapitel! Die Auseinandersetzung dieses Kapitels mit "Mose" und dem "Alten Bund" ist nicht zu verstehen, wenn nicht inzwischen "judenchristliche" Einflüsse in Korinth hervorgetreten sind, die die Herrlichkeit und bleibende Bedeutung des Mose als eine überragende dem Apostel entgegenstellten. Da im Anfang gerade dieses 3. Kapitels von "Empfehlungsbriefen" gesprochen wird, können sehr leicht nach dem Absenden des 1. Korintherbriefes (1 Ko 1,10) neue Lehrer mit Empfehlungen der Urgemeinde nach Korinth gekommen sein, die der Gruppe der "Petrus-Anhänger" nahestehen, wie sie auch in anderen Gemeinden (Apg 15,1), vor allem in Galatien, erschienen waren. Vielleicht gehörte gerade ihr Auftreten in Korinth zu jenen alarmierenden Nachrichten, die Timotheus mitbrachte und die den Apostel nach Korinth eilen ließen.
Diese Männer griffen Paulus in anderer Weise an als die Freiheitsschwärmer. Sie bestritten im Blick auf die "Zwölf" in Jerusalem die Echtheit des Apostolats des Paulus. Dazu paßt es dann gut, daß sie die Autorität der Urapostel gegen Paulus anriefen und durch einen Abgesandten aus Jerusalem, vielleicht durch Petrus selbst, den Frieden in der Gemeinde herstellen und alle Fragen entscheiden lassen wollten (vgl. die Auslegung von 11,4). Wir verstehen, daß Paulus ihnen gegenüber ironisch von den "ganz großen Aposteln" spricht und |16| nachdrücklich betont, in nichts hinter diesen zurückzustehen, ja in Arbeit und Leiden sie noch zu übertreffen (11,5;11,23). Wie diese beiden Gruppen zueinander standen, wie groß und wie einflußreich jede von ihnen war, können wir nicht mehr erkennen.
Es ist aber nicht schwer zu denken, daß sie sich in der gemeinsamen Gegnerschaft gegen Paulus zusammenfanden und unter Zurückstellung ihrer Gegensätze die Verdrängung des Apostels aus der Gemeinde in Korinth gemeinsam betrieben. Jedenfalls hatte Paulus gegen zwei ganz verschiedene Fronten zu gleicher Zeit zu kämpfen und gegen beide die Geltung seines Apostolats und seines Evangeliums zu verteidigen, um die Gemeinde auf dem "Grund" festzuhalten, den er einst als "weiser Baumeister" gelegt hatte (1 Ko 3,10). Dabei ging es Paulus nicht um sein persönliches Ansehen, sondern um die Wahrheit Gottes und um das Heil der ihm anvertrauten Gemeinde.
A) Vgl. dazu 1 Ko S. 218 Anmerkung 3, i. d. W. Stb.
f) Wir müssen also nicht entscheiden, ob wir die "Irrlehrer" in Korinth als "Freiheitsschwärmer" oder als "Judaisten" anzusehen haben. Beide Strömungen sind in Korinth am Werk gewesen. Wem galt der schärfste Angriff in Kapitel 11,12-15? Wer sind die "Lügenapostel", die in Wahrheit nicht Diener des Christus, sondern Diener des Satans sind? Sind es die gefährlichen Verfechter schrankenloser Freiheit? Aber wenn unsere Annahme richtig ist, daß die "Christuspartei" unter Ablehnung jeder menschlichen Autorität sich ein unmittelbar durch den Geist vermitteltes Verhältnis zu Christus zuschrieb, dann werden die Männer dieser Gruppe kaum Wert darauf gelegt haben, als "Apostel" aufzutreten. Dagegen lag es den "Judaisten" mit ihren Empfehlungsbriefen aus Jerusalem nahe, auf "apostolische Autorität" zu pochen.
Wir haben im 11. Kapitel überhaupt Ausführungen des Apostels vor uns, welche die "Zwölf" in Jerusalem und das Verhältnis des Paulus zu ihnen im Blick haben. So wird sich die schärfste Stelle des Briefes gegen die von außen in die Gemeinde eingedrungenen "Judaisten" richten. Die Parallele zu Phil 3,2.17-19 ist deutlich. Auch an Gal 6,12 f und Rö 16,17 f haben wir zu denken. Diese Stellen beweisen zugleich, daß es sich bei den Nöten in Korinth nicht um eine speziell "korinthische" Angelegenheit handelt, sondern um eine Bewegung, die durch die ganze Welt ging und vor der jede Gemeinde, die in Rom so gut wie die in Philippi, in Galatien wie in Griechenland, gewarnt werden muß.
g) Diese Bewegung konnte nur darum so bedrohlich werden, weil ihr starke Neigungen in der Gemeinde selbst entgegenkamen. Es waren z. T. allgemein menschliche Neigungen[ A ]. Dazu kamen in Korinth typisch "griechische" Züge. Der Grieche strebte nach "Erkenntnis" und war schnell von großartigem Auftreten und kunstvoller Rede bewegt. Um "Freiheit" war es ihm schon lange politisch und philosophisch gegangen. So fanden die neuen Männer in Korinth einen empfänglichen Boden. Die Botschaft und die Gemeindeleitung des Paulus aber richtete sich gegen das natürliche |17| Wesen des Menschen und das "fromme Ich". Wir können uns nicht wundern, daß eine ablehnende Haltung gegen den Apostel, in die Gemeinde tief hineingreift.
A) Der Mensch wird angelockt von "Höhen", die er erreichen kann. Gern hört er "Neues" und will gern "weiterkommen". Er ist stolz auf "Besonderheiten", die ihn vor andern auszeichnen, die "noch nicht so weit sind". Er wird mißtrauisch und ablehnend gegen den, der ihm so viel "vorenthalten" hat oder selber nicht in der Lage ist, auf diese "Höhen" zu führen.
5. Die Echtheit des 2. Korintherbriefes ist nicht zu bestreiten. So persönlich und so konkret auf Schwierigkeiten, Spannungen und Nöte in Korinth eingehen, konnte nur Paulus selbst. Dagegen ist die Einheitlichkeit des Briefes ernsthaft bestritten worden. Wir machten schon auf den Wechsel im Ton des Briefes aufmerksam (s. o. S. 11). Dieser Wechsel ist so stark, daß für das Urteil mancher Ausleger seine Einheit daran zerbricht. Die Kapitel 10-13 könnten unmöglich von Paulus nach den freudigen Sätzen in Kapitel 7 geschrieben worden sein. Sie müßten aus einem andern Brief des Apostels, vielleicht aus dem "Tränenbrief", stammen und später dem 2. Korintherbrief hinzugefügt worden sein.
Aber solche Urteile beobachten nicht scharf. Die Kapitel 10-12 setzen deutlich voraus, daß zwischen der Gemeinde als ganzer und dem Apostel der Friede wiederhergestellt ist. Nicht mit der Gemeinde oder um die Gemeinde als ganze wird Paulus kämpfen. Nicht mehr um die Entscheidung, ob die Gemeinde zu Paulus zurückkehrt, den Übeltäter bestraft und dem Apostel folgt, wird es bei diesem dritten Besuch gehen. Es sind nur einzelne Kreise und Gruppen in der Gemeinde, mit denen es vielleicht zum Kampf kommen wird und die nicht geschont werden dürfen (10,2.9 f;11,13-15;12,21;13,2). Aber solche Kreise und Gruppen sind auch tatsächlich noch in der Gemeinde vorhanden; mit ihrem Widerstand muß Paulus rechnen. Deshalb hat er seinen Besuch in militärischen Bildern (10,1-6) geschildert. Die harten Sätze der Kapitel 10-13 zielen auf diese Gegner. So wird es voll verständlich, daß der Apostel bei diesem Vorblick auf seinen kommenden Besuch in Korinth in einem ganz andern Ton schrieb und schreiben mußte, als bei seinem Eingehen auf die frohe und befreiende Nachricht von der Aussöhnung mit der Gemeinde als ganzer[ A ].
Weiteres zur Frage der Einheit des Briefes findet der Leser in der Auslegung zu Kapitel 10,1.
A) Ähnlich könnte ein Mensch, nach schwerer Operation aus dem Krankenhaus entlassen, in einem Brief zunächst voller Freude von seiner Rettung aus Todesgefahr und von seiner fortschreitenden Heilung erzählen, um dann doch im Blick auf die Zukunft in einem ganz andern Ton von seinen erheblichen Sorgen zu sprechen. Und doch ist es ein einheitlicher Brief.
Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß im Befund der Handschriften kein Anlaß vorliegt, Teile des Briefes als späteren Einschub oder Zusatz anzusehen. Alle Handschriften bieten uns den Brief so dar, wie er jetzt von Kapitel 1 bis Kapitel 13 vor uns liegt.
6. Fraglich ist die Datierung des Briefes. Ist der Apostel nach seinem früheren Plan kurz nach Pfingsten von Ephesus aufgebrochen? Reicht die Zeit bis dahin aus, um die Reise des Timotheus nach Korinth und seine Rückkehr, den Zwischenbesuch des Apostels in Korinth und die Sendung des Titus mit dem "Tränenbrief" darin unterzubringen? Oder hat sich die Abreise aus Ephesus durch diese unvorhergesehenen Ereignisse hinausgeschoben? |18|
Eine solche Verzögerung anzunehmen, scheint auch aus einem andern Grund nötig. Paulus hat nach Kap. 9,2 den Makedonen versichert, Griechenland sei "schon seit vorigem Jahr" zur Teilnahme an der Sammlung bereit gewesen. Wir dürfen annehmen, daß Paulus, dem damals üblichen Kalender folgend, das neue Jahr im Herbst, um die Zeit der Tag und Nachtgleiche, begann[ A ]. Er konnte nach dem 1. Oktober des Jahres im Rückblick auf seinen Brief aus dem Frühjahr den makedonischen Gemeinden mit Recht sagen, die Korinther seien schon "seit dem vorigen Jahr" zur Durchführung der Sammlung entschlossen. Aber er konnte es auch wirklich erst nach dem 1. Oktober tun! Ist er aber so spät erst nach Makedonien gekommen, wenn er kurz nach Pfingsten von Ephesus aufbrach? Ist er fast vier Monate, auf Titus wartend, in Troas geblieben?
Das ist sehr unwahrscheinlich. Bei einer Verlängerung des Aufenthaltes in Ephesus ist es viel leichter vorzustellen, daß Paulus tatsächlich erst am Anfang eines neuen Jahres, also im Oktober nach dem damaligen Kalender, bei den Makedonen war und ihnen ermunternd von der Bereitschaft Griechenlands "seit dem vorigen Jahr" sagte. Der Chronologie nach stehen wir, wenn Paulus im Sommer 50 nach Europa kam, mit dem Ende seiner Arbeit in Ephesus im Jahre 55 n. Chr. Die Apostelgeschichte berichtet uns in 20,1-6, daß Paulus in Makedonien zur gründlichen Stärkung der dortigen Gemeinden ("mit vielen Worten" ermahnte er sie) sich die Zeit genommen hat und dann seinen versprochenen dritten Besuch in "Griechenland", d. h. praktisch in Korinth durchführte. Lukas spricht von 3 Monaten seines Aufenthaltes dort. Es waren nach unserm Kalender die Wintermonate 55/56. Von Korinth aus ist er - um jüdischen Nachstellungen zu entgehen - wieder auf dem Landweg durch Makedonien zu seiner Reise nach Jerusalem zur Überbringung der großen Sammlung aufgebrochen.
A) Der jüdische Festkalender zählte freilich den Monat Abib oder Nisan (März/April) als ersten Monat. Das bürgerliche oder Wirtschaftsjahr aber nahm seinen Anfang im Herbst mit dem Monat Tischri (September/Oktober). Vgl. den Artikel "Jahr" im "Lexikon zur Bibel".
7. Welche Wirkung hat der 2. Korintherbrief gehabt, wie ist der Besuch des Apostels in Korinth ausgegangen? Unmittelbar wissen wir nichts darüber. Aber in Korinth hat Paulus den Römerbrief geschrieben. Er ist also wirklich nach Korinth gelangt und lebt inmitten der Gemeinde. Die Bedingung von 10,15 f ist erfüllt, der Apostel kann von Korinth aus seinen Reiseplan aufs neue aufnehmen: die Fahrt nach Jerusalem zur Ablieferung der großen Sammlung und dann die Reise nach Rom mit dem Blick nach Spanien. Die Prüfung des Glaubens (13,5) hat das rechte Ergebnis gehabt; Paulus ist der Gemeinde wieder sicher.
Ob die Gegner das Feld geräumt und Korinth verlassen haben oder ob sie blieben und eine eigene Gemeinde zu sammeln versuchten, wissen wir nicht. In dem Schreiben der römischen Gemeinde an die Gemeinde in Korinth, das unter dem Namen des 1. Klemensbriefes erhalten ist, wird eine solche konkurrierende Gemeinde in Korinth nicht sichtbar. An die Schwierigkeiten in Korinth erinnert aber die Tatsache, daß der 1. Klemensbrief durch eine Auflehnung jüngerer Gemeindeglieder gegen die Presbyter veranlaßt ist. |19|
Das Ringen des Apostels um seine Korinther ist nicht vergeblich gewesen. Paulus hat im Kampf mit seinen Gegnern gesiegt. Er hat offenbar durchführen können, was er in 10,1-6 und 13,1-4 angekündigt hat. Aber diese Feststellung können wir nur treffen, indem wir gleichzeitig sehen, wie schnell die eigentliche Botschaft des Paulus und sein Ziel beim Gemeindeaufbau in der Kirche vergessen worden ist. Schlatter sagt am Schluß der "Einleitung" in seinem großen Kommentar: "Paulus wurde einsam; er blieb der Apostel, aber unverstanden. Seine Briefe wurden heilige Schrift; aber über sie stellte sich die Theologie, und die Kirche sah in ihrer Erkenntnis ihr wesentliches Merkmal. Sie verbot die Ehe nicht, aber sah im Asketen den Heiligen und legte auf das geschlechtliche Verlangen die Schande der Sünde. Sie wurde über alles Herr, was an den Enthusiasmus erinnerte, und machte, daß nicht nur die Zunge, sondern auch die Prophetie verschwand; aber die Wirksamkeit des Christus im Geiste wurde für sie eine dunkle Rede. Damit verschwand die Gemeinde, die dem Leibe gleicht, dessen Glieder einander dienen. An die Stelle der Gemeinde trat die Hierarchie, die die Scharen einzelner regiert. Unaufhaltsam vollzog sich die Einordnung der Kirche in die Welt durch ihre Angleichung an den Staat." (A. Schlatter "Der Bote Jesu", S.55).
8. Worin liegt die Bedeutung des 2. Korintherbriefes für uns? Ist er mit Recht in das NT aufgenommen worden, um in jeder Generation neu zu der Gemeinde Jesu zu reden? Oder ist er eigentlich nur geschichtlich bedeutsam und als Quelle für die Geschichte der ersten Christenheit zu werten?
a) Zweifellos haben wir es besonders mit einem "Brief" zu tun, der zu ganz bestimmten Menschen in ihre Lage hinein spricht. Dieser Brief ist darum in vielen Teilen nicht ohne weiteres verständlich, sondern bedarf der geschichtlichen Auslegung. Wir können nicht jeden Satz einfach auf uns übertragen, sondern müssen erst einmal hören, was er den Korinthern damals zu sagen hatte. Der heutige Leser des Briefes muß schon ein Stück geschichtliches Interesse mitbringen und darf sich die Mühe nicht verdrießen lassen, sich in eine frühere Zeit und Welt hineinzuleben.
b) Wir erhalten dabei sofort einen sehr wesentlichen Gewinn. Der 2. Korintherbrief zerstört noch stärker als der 1. Brief ein unzutreffendes Idealbild, das wir uns von der ersten Christenheit gemacht haben. In einer urchristlichen Gemeinde konnte es wenige Jahre nach ihrer Gründung so aussehen, wie es unser Brief zeigt! Erstaunlich aber ist es, daß der Apostel eine solche Schar von Menschen, die derart versagt und ihm viel Not gemacht hat und bei seinem Besuch noch machen wird, dennoch als "Gemeinde Gottes" anredet und behandelt!
c) Das ist wichtig für uns. Es ist nicht so, daß erst wir Späteren untauglich sind und solche Nöte in den Gemeinden haben. Gemeinden Jesu sind von Anfang an nicht Versammlungen wunderbarer Menschen von fleckenloser Heiligkeit, sondern Vereinigungen erretteter Sünder, bei denen das alte, verdorbene Wesen noch sehr durchbrechen und das Zusammenleben bedrohen und entstellen kann. Sofort am Anfang der Christenheit gab es entsagungsvolle Arbeit und schmerzvollen Kampf um das rechte Bestehen und Leben der Gemeinde. Von Anfang an mußte auch mit verkehrten |20| und eigensüchtigen Männern gerechnet werden, die in der Gemeinde zur Geltung kommen wollen und die Gemeinde mit ihren neuen Lehren verwirren.
d) Es liegt für uns ein gewisser Trost darin, daß wir sehen: Nöte und Schwierigkeiten gab es von Anfang an in der Gemeinde. Aber das darf uns nicht zu einer falschen Beruhigung dienen.
Der 2. Korintherbrief zeigt uns auch, wie Paulus um die Gemeinden gerungen hat. Er hat sich in keiner Weise mit ihren Fehlern abgefunden. Mit unnachgiebiger, entschlossener Liebe hat er ihre Umkehr gefordert und sie durch seinen harten Brief zu der "göttlichen Traurigkeit" gebracht, aus der eine echte Sinnesänderung erwächst. Und er wird bei seinem dritten Besuch den Kampf rücksichtslos zu Ende führen und "jeden Gedanken gefangennehmen unter dem Gehorsam Christi" (10,5). Klare Scheidung von der Welt und volle Reinigung von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes bleibt sein Ziel für die Gemeinde (6,14-7,1). Wie aber ein solcher Kampf nicht in kühler Überlegenheit, sondern in den Schmerzen einer starken Liebe geführt wird, das lehrt uns gerade der 2. Korintherbrief. Er zeigt uns dabei auch, welchen unschätzbaren Dienst Mitarbeiter leisten können in diesem Ringen. Wäre die Gemeinde in Korinth zurechtgekommen ohne das Wirken des Titus? Der Apostel Paulus aber war einsichtig genug, einem solchen Mitarbeiter freien Raum zum Einsatz zu geben.
e) Unser Brief leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Frage der "Kirchenzucht". Schon in 1 Ko 5,1-5 trafen wir auf eine Handlung ernster Art. Aber dort war es ein besonderer Einzelfall. Jetzt aber wird deutlich, daß die Ausschließung aus der Gemeinde nicht nur bei denen geschehen muß, die als "Lügenapostel" entlarvt sind, sondern auch bei Gemeindegliedern, welche die Buße verweigern (13,1f). Eine solche Ausschließung war aber nicht eine bloß organisatorische Maßnahme. Denn die "Gemeinde" war für den Apostel nicht eine Organisation, sondern war der "Leib Christi". Die Entfernung aus der Gemeinde trennt also vom Leib des Christus und liefert an den "Gott dieser Welt" aus. Dazu aber war ein Handeln in geistlicher Vollmacht nötig. In der vom Apostel geübten Kirchenzucht wird die Gemeinde die Wirkungsmacht des in Paulus redenden Christus erfahren (13,3 f).
Es gibt aber auch eine von der Gemeinde selbst zu übende Zucht durch "Bestrafung" von Gemeindegliedern, die sich vergangen und Unrecht getan haben. Diese "Bestrafung" ist offensichtlich nicht Ausschluß aus der Gemeinde, wenn auch vielleicht der zeitweise Ausschluß von den Gemeindeversammlungen. Die "Strafe" dient hier der Umkehr. Ist diese Umkehr erreicht, dann kann und soll volle Vergebung gewährt und "der Beschluß auf Liebe" gefaßt werden (2,5-11).
Mit dem Satan wird auch hier mit Ernst gerechnet, doch in ganz anderer Weise als 1 Ko 5,1-5: das Vergeben verwehrt ihm sein böses Eindringen in die Gemeinde.
f) Beachtlich ist, daß der Apostel den inneren Nöten der Gemeinde gegenüber nicht von neuen "Geistesausgießungen" oder "Geistestaufen" die Hilfe erwartet. Von den Geistesgaben und dem Zungengebet ist in unserm Brief mit keinem Wort die Rede. Fällt uns schon in 1 Ko 3,1-3 auf, daß Paulus die korinthische Gemeinde trotz ihres "Reichtums an Gaben" doch unreif und fleischlich nennt, so ist auch jetzt |21| der weiteren Verstörung gegenüber eine ganz andere Wirkung des Geistes nötig: göttliche Traurigkeit, Buße, Reinigung, Frieden miteinander. Wir werden davon zu lernen haben.
g) Für den Apostel Paulus sind die großen Lehraussagen nie Sache eigener, theologisch-dogmatischer Bemühungen, sondern brechen überall aus der praktischen Sorge für das Gemeindeleben unvermutet hervor. So stoßen wir auch im 2. Korintherbrief mitten im Ringen um die Gemeinde auf grundsätzliche Ausführungen von großer Kraft und Klarheit. Paulus hat viel über "Gesetz und Evangelium" geschrieben; in Kap. 3 unseres Briefes tut er es in neuer, enthüllender Weise. Von der Bedeutung des Sterbens Jesu und der Versöhnungstat Gottes in diesem Sterben spricht Kap. 5, 14-21 in einzigartiger Tiefe. Der Apostel macht dabei deutlich, wie die Verkündigung dieser Tat Gottes in das Heilsgeschehen notwendig hineingehört.
Der Brief gibt uns aber auch wesentliche Beiträge zur "Praktischen Theologie". Wie der Verkündigungsdienst recht und vollmächtig geschehen kann, zeigt uns Kap. 2,12-17 ebenso wie Kap. 4,1-12 und Kap. 6,1-10. Dabei wird deutlich, warum das Leiden der Boten als Auswirkung des Sterbens Jesu zu einem wirksamen und lebenschaffenden Dienst unabdingbar mit dazu gehört.
Der Apostel entfaltet aber auch die große, lebendige Hoffnung der Glaubenden und zeigt, welche Kraft aus dieser Hoffnung für das Leben in der Gegenwart kommt (4,16 - 5,10). Die Anleitung zum rechten Geben und zur richtigen Durchführung von Sammlungen in der Gemeinde sind von bleibendem Wert auch für uns (Kap. 8 und 9).
h) Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß der 2. Korintherbrief wie kein anderes Buch des NT ein persönliches Bild des Apostels zeichnet. Es wäre eine lohnende Aufgabe, unsern Brief darauf hin zu lesen und durchzuarbeiten. Wir sehen, wie Paulus auf weite Kreise der Gemeinde und auf seine Kritiker an der Gemeinde gewirkt hat. Wir sehen aber auch ihm selber in seinem Ringen um Korinth tief ins Herz. "Wir verstehen, warum dieser Mann so viele Gegner gehabt und auf der andern Seite so viele Menschen und ganze Gemeinden immer wieder an sich zu fesseln vermocht hat.
Apostolische Autorität verband sich bei ihm mit brüderlich-seelsorgerlicher Anteilnahme, die ihm die Herzen der Bedrängten und Aufrichtigen gewinnen mußte. Intoleranz, wenn es um das Ev. und die Abwehr von Angriffen auf sein Amt ging, stand neben Aufgeschlossenheit und Weichheit, wenn eigene Nöte ihn Anschluß suchen ließen. Schneidende Ironie wechselte bei ihm mit bestrickender Liebenswürdigkeit. Immer aber war er bemüht, die Sache über die Person, auch über die eigene Person zu stellen." (Michaelis "Einleitung in das Neue Testament", S. 179.) "Paulus, der Bote Jesu", so hat Schlatter seine große Auslegung der beiden Korintherbriefe überschrieben. An Paulus können wir lernen, was es heißt, "ein Bote Jesu" zu sein.|23|
EINGANGSGRUSS 2. Korinther 1,1-2
1 Paulus, Apostel des Christus Jesus durch den Willensentschluß Gottes, und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth lebt, zusammen mit den Heiligen allen, die in ganz Achaja leben:
1 Ko 1,1; Phil 1,1
2 Gnade euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Rö 1,7; Gal 1,3
ISBN:
9783417003772
Zustand:
gebraucht
Zustandsbeschreibung:
etwas abgegriffen