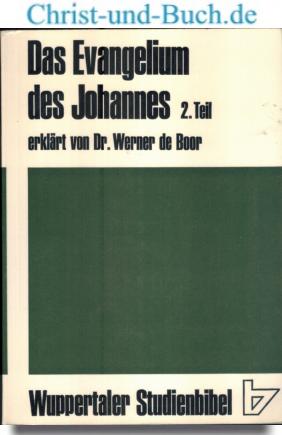Keine Bewertungen gefunden
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
eigentliche Einleitungsfragen zu unserem Evangelium sind in möglichster Kürze behandelt worden. Es wird aber gut sein, wenn die Leser die kirchengeschichtlichen Zeugnisse im Wortlaut vor Augen haben, auf die dort S. 18 hingewiesen worden ist.
In dem Brief des Irenäus an den Gnostiker Florinus (Euseb Kirchengeschichte V,20) heißt, es: "Ich kann nennen die Stelle, an der sitzend der selige Polykarp zu reden pflegte, sein Aus- und Eingehen, seine Lebenshaltung, seine körperliche Erscheinung, seine Reden, die er an die Gemeinde hielt, und wie er seinen Verkehr bezeugte mit Johannes und den übrigen, die den Herrn gesehen haben, und sich an ihre Worte erinnerte und was das war, was er über den Herrn von jenen gehört hatte und von seinen Wundern und von seiner Lehre; wie Polykarp alles bezeugte in Übereinstimmung mit den Schriften als einer, der es von den Augenzeugen des Lehrers des Wortes überkommen hatte. Das habe ich damals, da mir Gottes Erbarmen widerfahren war, eifrig gehört und meiner Erinnerung einverleibt, nicht auf Papier, sondern mit meinem Herzen, und durch Gottes käue ich es unverfälscht wieder."
Das Zitat aus dem Vorwort des Papias (Euseb Kirchengeschichte III, 39) lautet: "Wenn aber einer kam, der den Alten nachgefolgt war, erforschte ich die Worte der Alten, was Andreas oder was Petrus gesagt hat, oder was Philippus oder was Thomas oder Jakobus, oder was Johannes oder Matthäus oder ein anderer von den Jüngern des Herrn gesagt hat, und was Aristion und der Alte Johannes, des Herrn Jünger, sagen."
II.
Wir dürfen die Behandlung der "Einleitungsfragen" nach zwei Seiten hin ergänzen.
1. Wir stellen die Frage: Kann Johannes im hohen Alter noch zuverlässig über Jesus berichtet haben?
Diese Frage liegt nahe. Wir haben zu ihrer Beantwortung an drei Tatsachen zu denken.
Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß der alte Mensch zwar Erlebnisse der Gegenwart schnell vergißt, daß aber gerade die Erinnerung an die jüngeren Jahre im Alter besonders klar und anschaulich hervortritt. Weiter müssen wir bedenken, daß Johannes nicht erst im Alter von Jesus zu sprechen beginnt. Er hat als "Säule" der Urgemeinde (Gal 2,9) sogleich an "der Apostel Lehre" (Apg 2,42) teilgenommen und dabei |14| alles, was er mit Jesus erlebt und von Jesus gehört hatte, fort und fort der Gemeinde erzählt und bezeugt. So ist seine Schrift der Niederschlag jahrelanger Verkündigung. Vor allem aber weist uns Johannes selber in Kap. 14,26 auf die entscheidende Garantie zuverlässiger Erinnerung und rechten Verständnisses der Geschichte des Christus hin. Diese Garantie hat der Heilige Geist Gottes selber übernommen! "Aber der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, was ich euch gesagt habe" (14,26). Diese Tatsache sollten wir viel ernster nehmen, als wir es gewöhnlich tun. Der Geist der Wahrheit verbürgt uns die Wahrheit unseres Evangeliums.
2. Wir dürfen von da aus noch ein Wort zur Sprachgestalt unseres Evangeliums (1. Halbb. S. 23/24) sagen.
Wenn Johannes sein Buch nach Jahrzehnten mündlicher Verkündigung schrieb, wird es uns nicht verwundern, daß es in einer eigentümlich "johanneischen" Sprache geschieht. Damit ist nicht gesagt, daß Johannes die Reden Jesu frei komponiert hat! Johannes hat gewußt, daß es sein Auftrag war, ein "Zeuge" Jesu zu sein (Kap. 15,27). Ein "Zeuge" aber erfindet nicht, sondern sagt, was er tatsächlich gesehen und gehört hat. Die besondere Sprachform unseres Evangeliums muß auch nicht bedeuten, daß der Jünger seinem Meister die eigene Jüngersprache aufgeprägt hat. Wie unwahrscheinlich ist das nach alledem, was damals in Israel für das rechte Verhältnis zwischen Meister und Jünger galt (vgl. Kap. 13,16). Weit verständlicher ist es, daß der Jünger sofort die Reden seines Herrn in dessen eigentümlicher Sprache wiedergegeben hat uns so völlig in den Worten seines Herrn lebte, daß er schließlich in der Sprache des ewigen "Wortes" auch dann dachte, redete und schrieb, wenn er Miterlebtes erzählte oder in seinen Briefen seinerseits den Verkündigung übte. Die Redeweise Jesu bei den Synoptikern ist damit nicht entwertet. Es ist etwas anderes, ob Jesus in Galiläa das Volk lehrte oder ob er in Jerusalem (und auch in der Synagoge zu Kapernaum) Streitgespräche mit den Leitenden seines Volkes führte.
III.
Wir finden in den Kap. 11-21 besondere Bestätigungen der geschichtlichen Treue im Bericht des Johannes.
1. Johannes erlebte selber die Bedrohung der Gemeinde von der römischen Staatsmacht und von dem heidnischen Kaiserkult her. In der "Offenbarung", die Johannes in Gottes Auftrag schrieb, ist alles von diesem Blickpunkt her gesehen (vgl. die Einleitung zur W. Stb. Offenbarung 1. Halbb. S. 22 ff). Im Evangelium aber ist es ganz anders! Was dort in 15,22-25 und 16,1-4 über die kommende Verfolgung und Not der Jünger Jesu gesagt wird, bezieht sich ausschließlich auf jüdische Verhältnisse und berücksichtigt mit keinem Wort das, was Johannes z. Z. des Kaisers Domitian (81-96 n. Chr.) erlebt hat. Hätte ein Christ um 100 n. Chr. für die Erfordernisse seiner Zeit und Umwelt ein Christusbild frei gestaltet und Jesus Reden in den Mund gelegt, die auf Fragen der Gegenwart Antwort geben sollten, dann sähe die Voraussage in den |15| angeführten Stellen anders aus. Johannes aber gab in Treue das wieder, was Jesus bei seinem Abschied den Jüngern für die nächste Zukunft vor Augen stellte und was uns die Apostelgeschichte in den Kap. 4,5,7,8 als erfüllt schildert.
2. Johannes schreibt sein Evangelium in der Zeit, in der auch der 1. Clemensbrief, ein Schreiben der römischen Gemeinde an die Gemeinde in Korinth, entstanden sein dürfte. Deutlich zeigen sich in diesem Brief schon die Züge der werdenden Anstaltskirche. In den Briefen des Ignatius, wenige Jahre später, steht diese Kirche als festgefügte Organisation mit dem hohen Ansehen des Bischofsamtes vor uns. Wäre der Verfasser unseres Evangeliums ein freischaffender Künstler, der seinen Christus zu den Fragen der Gegenwart das Wort nehmen ließe, müßte dieser Christus sich gerade in den Abschiedsreden maßgebend zum Kirchenaufbau geäußert und von den notwendigen "Ämtern" gesprochen haben. Aber nichts davon ist in den letzten Anweisungen Jesu an seine Jünger zu finden. Jesus sieht seine Gemeinde als "Weinstock", bei dem jede Rebe unmittelbar mit dem Weinstock verbunden ist und ihre Frucht trägt (15,1-8). Maßgebend für das Leben der Jüngerschaft ist die Liebe untereinander und die ganze Bereitschaft, einander die Füße zu waschen (13,12-17;13,34 f). Wohl wird Petrus in 21,15-17 neu beauftragt, die Schafe und die Lämmer Jesu zu weiden. Aber irgendeine "amtliche" Stellung "über den andern Jüngern wird ihm nicht übertragen. Im Gegenteil. Als Petrus sich bei seinem Herrn erkundigt, was denn nun sein Mitjünger Johannes tun solle, wird er schroff zurückgewiesen: "Was geht es dich an! Folge du mir nach" (21,21 f).
So hat Johannes auch hier mit geschichtlicher Treue festgehalten, was Jesus seinen Jüngern tatsächlich gesagt hat, ohne es den Fragen und Problemen der Zeit entsprechend umzuformen oder gar frei zu gestalten.
3. In Ergänzung dessen, was im 1. Halbb. S. 15-17 ausgeführt ist, sei auf die wichtige Stelle 19,35 und ihre Auslegung in diesem Band S.222 hingewiesen. Wir haben hier ein Selbstzeugnis des Evangelisten von großer Bedeutung vor uns. Johannes versichert ausdrücklich, selber unter dem Kreuz seines Herrn gestanden und die Öffnung der Seite mit dem Speer der römischen Soldaten mit angesehen zu haben. Wir haben auch hier wieder nur die Wahl, dem Verfasser des Evangeliums zu glauben und in ihm dann notwendig den Augenzeugen der Vorgänge zu ehren, oder wir stünden vor einem fatalen Versuch, unter besonderer Versicherung der Wahrhaftigkeit den Leser zu täuschen.
IV.
Nach dem Studium des 2. Halbb. ist es an der Zeit, uns die Grundlinien in dem Werk des Johannes zu vergegenwärtigen und uns die Besonderheit des Evangeliums nicht nur nach seiner Form und Sprache, sondern auch nach seinem Inhalt zu verdeutlichen.
Darf es denn aber solche "Besonderheit" überhaupt geben? Haben wir es nicht gerade bei Johannes mit einem Augenzeugen zu tun, der einfach berichtet wie es gewesen |16| ist, was Jesus gesagt und getan hat? Johannes hat sehr betont, wie er aus der ganzen Fülle der Worte und Werke seines Herrn auswählen mußte. Die Art dieser Auswahl prägt bereits sein Buch. Er ist aber nicht nur "Berichterstatter". Er hat Jesus in besonderer Weise verstanden und an Jesus die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit gesehen (1,14). Nun will er auch uns an dieser seiner Schau Anteil geben, damit auch wir "glauben, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und daß wir durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen" (20,31). Dadurch hat sein Evangelium eigentümliche Grundlinien, die wir erfassen müssen.
1. Das "Evangelium nach Johannes" unterscheidet sich in seinem ganzen Aufbau wesentlich von den Synoptikern. Johannes sieht das ganze Wirken Jesu unter dem einen Gesichtspunkt: Jesus ringt um Israel, um das Bundesvolk Gottes, das den Messias erwartet und ihn nun bei seinem Kommen verkennt, ablehnt und haßt Die Kap. 1-3.5 u. 7-12 gehören der Schilderung dieses Ringens. Kap. 4 zeigt im Gegenbild, wie "Samariter" zu dem Glauben kommen, den die maßgebenden Kreise Israels verweigern. Kap. 6 läßt uns von Jesu Wirksamkeit in Galiläa so viel sehen, daß wir erkennen: dort ist nach falscher Begeisterung für Jesus die Ablehnung Jesu genau so da wie in Judäa. Weil Johannes uns dieses Ringen Jesu um Israel zeigen will, stellt er die Besuche Jesu in Jerusalem in den Mittelpunkt seiner Darstellung. In Jerusalem mußten die Entscheidungen fallen. Von daher verstehen wir auch die Eigenart der Reden Jesu im Johannesevangelium in neuer Weise. Sie sind nicht "Predigten" wie etwa die Bergpredigt. Sie sind Streitgespräche, harte und heiße Diskussionen, bei denen wir die Einwände und Angriffe der Gegner fort und fort mithören. Und es ist klar, wieviel Johannes fortlassen mußte, um Raum für sein großes Thema zu behalten. Er wußte dabei: dies andere alles fanden die Gemeinden in den Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas.
Nachdem die Entscheidung Israels zum Unglauben endgültig geworden ist, kann nur noch die Passions- und Ostergeschichte folgen (Kap.18-21). Johannes schiebt aber zwischen Kap. 12 und die Kap. 18-21 die "Abschiedsreden" ein. Es liegt ihm daran, ausdrücklich zu zeigen, wie Jesus seine Jünger für ihre Sendung zugerüstet hat. Versagt sich Israel seinem Herrn und Retter, so ist damit Gottes Plan nicht gescheitert. Im Gegenteil. Das Kreuz wird zur "Erhöhung Jesu", zur Verherrlichung des Vaters und des Sohnes, und öffnet den Weg zur Sammlung der weltweiten Gemeinde der Glaubenden.
2. Johannes legt großen Wert auf die "Werke" Jesu. Er schildert Jesus fort und fort als den in Wort und Werk Handelnden. Und doch hat bei Johannes die "Ontologie", die Lehre vom "Sein", vom "Wesen" Jesu, den Vorrang. Bei den Synoptikern finden wir selten eine Aussage über das, was Jesus "ist". Eine Stelle wie Mt 11,27 f ist darum immer als "johanneisch" aufgefallen. Johannes aber setzt in seinem Evangelium sofort mit dem mächtigen Aussagen ein, die Jesus als das ewige "Wort" des Vaters schildern. Und gerade bei den großen Taten Jesu hebt er hervor, wie Jesus dies alles nur darum "tut" und tun kann, weil er in seinem Wesen etwas Einzigartiges "ist". Darum beherrschen die "Ich-bin-Worte" unser Evangelium. Die |17| "Werke" sind nur "Zeichen" für das "Sein", das in Jesus zu uns "gekommen" ist. So ist das "Gekommensein" Jesu und das "Gesandtsein vom Vater" als eigentliches Geschehen der Offenbarung, aus dem alles einzelne Reden und Tun hervorgeht.
Der Höhepunkt dieser "Ich-bin" -Verkündigung in unserm Evangelium ist die Stelle 8,21-24. Die Erkenntnis des "Seins" Jesu ist allein die aus den Sünden errettende Erkenntnis. Ist Johannes hier noch einmütig mit der apostolischen Botschaft? Geht es in dieser Botschaft nicht um das Kreuz als unsere Rettung? Aber vergessen wir beim Reden vom "Kreuz" nicht die entscheidende Wahrheit: nicht das Kreuz als solches rettet uns, sondern der, der daran hängt. Wäre Jesus nicht dieser "Ich bin", dann könnte seine Kreuzigung uns nicht das Geringste helfen.
Das Johannesevangelium leitet uns an, nicht bei einzelnen Worten oder Taten Jesu stehen zu bleiben, sondern sein Wesen, seine Person zu erfassen, wenn auch umgekehrt sein Wesen nur in seinem Wort und in seinen "Werken" zu uns kommt.
3. Johannes sagt es uns selber, sein Buch sei geschrieben, "daß ihr glaubet, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen" (20,31). Im "Glauben" sieht Johannes den entscheidenden, uns das Leben schenkenden Vorgang. Dabei haben wir darauf zu achten, wie der "Glaube" sich gerade auf das bezieht, was wir eben im zweiten Abschnitt vor Augen hatten. Auch er ist "ontologisch" ausgerichtet und hat das "Sein" jesu zu erfassen. Eine Seinsaussage, "daß Jesus der Christus, der Sohn Gottes, ist" kennzeichnet den Inhalt des Glaubens. Das entspricht jener entscheidenden Stelle 8,21-24, die wir schon hervorhoben.
Im ganzen Evangelium geht es fort und fort um "Glaube" und "Unglaube". Moralische Urteile über Israel fehlen völlig. "Kinder des Teufels" sind die Israeliten nicht wegen sittlicher Vergehen, sondern wegen ihrer Unfähigkeit, Jesus wahrhaft zu erkennen, und wegen ihres Vernichtungswillens gegen den Sohn Gottes.
Dabei hat aber Johannes keine schematische Auffassung von dem, was "Glaube" ist. Er sieht den Glauben als eine lebendige Wirklichkeit, die darum auch wachsen und verschiedene Stadien durchlaufen kann. Darum finden wir bei Johannes Aussagen über den Glauben, die einander zu widersprechen scheinen. Johannes stellt beim Abschluß des Ringens Jesu um sein Volk fest: "Und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn" (12,37).
Dabei hat aber sofort am Anfang, bei dem ersten Passa, das Jesus in Jerusalem mitbegeht, Johannes versichert, daß "viele an seinen Namen glaubten, da sie die Zeichen sahen, die er tat" (2,23). Ist das nicht ein Widerspruch? Aber wo bleibt dann dieser "Glaube"? Jesus glaubt ihnen sogleich ihren Glauben nicht (2,24.25)! Hier geschieht in Menschen etwas, das man "Glaube" nennen muß und das doch nicht wirklicher Glaube ist. So schien Jesus auch bei den Galiläern einsatzbereiten Glauben gefunden zu haben. Sie wollen ihn zum König, zum Messias machen (6,14 f). Aber Jesus entzieht sich solchem "Glauben". Und am Ende steht die Abwendung von Jesus bis in die Reihen der Jünger hinein (6,66 f). Es ist bei Johannes scharf beobachtet, wie unser menschliches Geltungsstreben das Glauben hindert (5,44) oder zu jenem seltsamen "Glauben" führt, der "an Jesus glaubt" und doch den Todesbeschluß gegen Jesus widerspruchslos mitmacht |18| (12,42 f) und damit ohne eigentliche Wirklichkeit bleibt. Johannes weiß, daß es alle diese Formen und Arten des Glaubens gibt[ A ].
So ist auch bei einer Reihe von Juden ein "Glaube" an Jesus da, der doch erst Glaube werden wird, wenn sie nun an der Rede Jesu bleiben (8,31), wovon wir aber nichts mehr hören. Und auch das fragende "Glauben" kennt Johannes, das sich dem Eindruck Jesu nicht entziehen kann und doch nicht zu einem wirklichen, klaren Ja Jesus gegenüber gelangt (7,31.40-43).
A) Wie wichtig ist es auch für uns, daß wir das wissen und bei uns selbst und bei uns anvertrauten Menschen den "Glauben" kritisch zu prüfen verstehen. Vgl. 2 Ko 13,5.
Scheinbar "widersprüchlich" ist auch die Schilderung des Glaubens bei den Jüngern. In Wahrheit ist gerade damit das Glauben in seiner ganzen Lebendigkeit erfaßt. Schon gleich am Anfang 1,41;1,50 kommen Jünger zum bestimmten Glauben an Jesus als den Messias. In 2,11 wird ihnen erneut bezeugt, daß sie nach dem Weinwunder in Kana an Jesus glauben. Und doch scheint erst in 6,69 der Glaube in ihnen wirklich durchzubrechen. Beim Abschied Jesu aber zeigt sich, wie wenig die Jünger Jesus wirklich erkannt haben, wie wenig sie im eigentlichen Sinne "glauben" (14,8-11). Und ob wir 16,31 als Frage oder als Ausruf auffassen, auf jeden Fall hält der bisherige Glaube der Jünger der kommenden Anfechtung nicht stand (16,32). Dann erleben wir an Thomas mit, wie ein Jünger nun erst nach Ostern zum "Glauben" im eigentlichen und vollen Sinn kommt, zu dem Glauben, der in Jesus seinen Herrn und seinen Gott erkennt (20,28) und der nun wirklich "der Sieg ist, der die Welt überwunden hat" (1 Jo 5,4). Jesus aber sieht es voraus, wie solcher Glaube wunderbarerweise gerade bei Menschen entstehen wird, "die nicht sehen und doch glauben". Solche "Glaubenden" preist er selig (20,29).
4. Es ist für das ganze Neue Testament kennzeichnend, daß zwar die Liebe sachlich so im Mittelpunkt steht, wie es gerade Johannes in seinem 1. Brief in 3,14;4,7-12;4,16 aussagt, daß aber meist nur mit großer Zurückhaltung von der Liebe gesprochen wird. Paulus weiß, wie Gott seine Liebe gegen uns preist (Rö 5,5 ff). Aber er nennt am Anfang des Römerbriefes nicht die Offenbarung der rettenden Liebe Gottes als Inhalt des Evangeliums, sondern spricht von Gottes Gerechtigkeit. Im 1. Korintherbrief ist im 13. Kapitel die Liebe als das Entscheidende im Christenleben gekennzeichnet, ohne welches alles andere zu einem Nichts wird. Aber diese Liebe ist dennoch nicht das ausdrückliche Thema des Briefes von Anfang an. Sahen die biblischen Zeugen die Gefahr der Mißverständnisse, die mit dem Wort "Liebe" verbunden sind?
Auch in unserm Evangelium ist die Liebe Gottes in 3,16 als der Grund der ganzen Sendung Jesu genannt. Man hat diesen Vers "das Evangelium im Evangelium" genannt. Umso mehr muß uns auffallen, daß nun in den folgenden Kapiteln kein weiterer Gebrauch von dieser Aussage gemacht und nicht weiter von dieser Liebe Gottes gesprochen wird. Sie wird nicht zum Thema der Reden Jesu, nicht zum Motiv, mit dem er um sein Volk wirbt. |19|
Erst in den "Abschiedsreden", also im internen Kreis der Jünger, weist Jesus wieder ausdrücklich auf die Liebe hin, auf die Liebe des Vaters zum Sohn (15,9), auf seine eigene Liebe zu den Jüngern (15,10), aber auch auf die Liebe des Vaters zu den Glaubenden (16,27;17,23-26).
Mit Überraschung lesen wir in Kap. 13,1 von der Liebe, mit der Jesus die Seinen in der Welt geliebt hatte, um sie nun gerade auf dem Weg zum Kreuz bis zur Vollendung zu lieben. Es ist kein Zweifel, daß seine Liebe das ganze Verhältnis zu seinen Jüngern bestimmt hat. Aber nichts in der Schilderung des Umganges Jesu mit seinen Jüngern hat etwas von dieser Liebe anschaulich werden lassen. Und nirgends wird direkt spürbar, daß Jesus in "Liebe" um Menschen ringt. Gerade Johannes zeigt die "Härte" Jesu (8,41-45;9,39-41;10,8;11,6.21.32.33), hinter der die Liebe nicht leicht zu erkennen ist. Die Liebe Jesu zu kranken, verlorenen, entgleisten Menschen soll damit nicht etwa geleugnet werden! Wir wollen aber die Zurückhaltung und Verhaltenheit beachten, mit der die Liebe in unserem Evangelium behandelt wird.
Das Leben und Wirken Jesu, des Sohnes, ist ganz und gar von der Liebe zum Vater getragen. Was Jesus in 5,19.20 sagt, drückt diese Liebe zwischen Sohn und Vater sehr tief aus. Aber das Wort "Liebe" wird von Jesus für seine Stellung zum Vater nicht verwendet. Erst in 14,31 spricht Jesus ein einziges Mal direkt von seiner Liebe zum Vater, die seinen Weg zum Kreuz bestimmt.
Auch von der Liebe der Jünger zu Jesus wird erst in den Abschiedsreden gesprochen, ohne daß dabei ein Versuch gemacht wird, diese Liebe näher zu kennzeichnen und ihre Entstehung im Herzen der Jünger zu erklären. Sie wird wie selbstverständlich vorausgesetzt, um nun bestimmte Folgerungen aus ihr zu ziehen.
Ebenso erscheint das Liebesgebot in 13,34 unvermittelt. In den Reden war es bisher nirgends hervorgetreten.
Und doch ist es eindeutig: Wo im Johannesevangelium die "Liebe" erscheint (3,16; 13,1;13,34 f;14,15;14,31;15,9.10;16,27;17,23-26;21,15-17), da ist sie die entscheidende Wirklichkeit[ A ]. Die Liebe ist nicht ein "Nebenzug" in unserem Evangelium, sondern der verborgene Grundzug, der an einzelnen Stellen leuchtend sichtbar |20| bar wird. Wenn unter "Liebe" irgendetwas Weiches, Gefühlvolles verstanden wird, dann ist Johannes allerdings nicht "der Apostel der Liebe", wie man ihn gern genannt hat. Aber wenn "Liebe" bedeutet "das Sein für den Anderen, das die eigene Existenz völlig bestimmt[ B ]", dann hat Johannes an der Sendung, dem Wirken, dem Sterben und Auferstehen Jesu diese Liebe erkannt und ist darum in seinen Briefen in besonderer Weise ihr Apostel geworden. Die Liebe ist eine entscheidende Grundlinie im Evangelium nach Johannes, so zurückhaltend auch von ihr gesprochen wird.|21|
A) Es kennzeichnet Bultmanns Theologie, daß er sich in seiner Auslegung des Johannesevangeliums mit großem Ernst bemüht, nachzuweisen bzw. als Grundsatz der Exegese festzuhalten, daß es ein direktes Verhältnis zum Offenbarer und eine direkt auf Gott gerichtete Liebe nicht geben kann (a. a. O. besonders S. 404 und S. 473/74). Darum kann "die auf den Offenbarer gerichtete Liebe nichts anderes sein als der Glaube" (473/74), wobei aber offensichtlich auch dieser "Glaube" wieder nicht ein direktes, persönliches Verhältnis zu Jesus ist. Hier fällt eine tiefgreifende und umfassende Entscheidung über das Wesen des Christentums! Alle die Männer und Frauen, die in der Liebe zu Jesus und in der Liebe zu Gott gelebt und in dieser Liebe die Kraft zum Lieben, Dienen und Leiden gehabt haben, wären nach dieser Auffassung Bultmanns einem verhängnisvollen Mißverständnis erlegen und hätten das eigentliche Verhältnis zu Gott und zum Offenbarer verfehlt. Es ist kennzeichnend für Bultmanns Kommentar, daß er in seiner eindringlichen Auslegung von Kap. 5 doch den wichtigen V. 40 völlig übergeht, wie auch das für uns so entscheidende Wort von dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt (1,29), inhaltlich bei ihm unbeachtet bleibt.
B) So Bultmanns gute Definition a. a. O. S. 415/16. Ob das aber, wie Bultmann meint, den "persönlichen Affekt" ausschließen muß und ihn nicht vielmehr gerade einschließt? Oder gibt es ein kaltes, affektloses "Sein für den Anderen"?
I. DAS ENDE DES VERGEBLICHEN RINGENS JESU UM SEIN VOLK Johannes 11-12
DIE AUFERWECKUNG DES LAZARUS Johannes 11,1-44
1 Es lag aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und Marthas, ihrer Schwester. Jo 12,3;Lk 10,38f
2 Es war aber Maria, die den Herrn gesalbt hat mit Myrrhe und seine Füße abgewischt hat mit ihren Haaren; deren Bruder Lazarus war krank. Mt 26,7
3 Es sandten nun die Schwestern zu ihm und ließen sagen: Herr, sieh, der, den du liebhast, ist krank
4 Als es aber Jesus hörte, sprach er: Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient der Herrlichkeit Gottes, daß verherrlicht werde der Sohn Gottes durch sie. Jo 9,3; Mk 5,39
5 Es liebte aber Jesus Martha und ihre Schwester und den Lazarus.
5 Mo 33,3;2 Jo 1.2
6 Als er nun gehört hatte, daß er krank sei, da blieb er an dem Ort, wo er war, zwei Tage lang.
7 Dann erst sagt er den Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa ziehen.
8 Es sagen zu ihm die Jünger: Rabbi, eben erst suchten dich die Juden zu steinigen, und du begibst dich wieder dorthin?
Jo 8,59;10,31
9 Jesus antwortete: Gehören nicht zwölf Stunden zum Tage? Wenn einer am Tage wandert, stößt er sich nicht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Jo 9,4.5; Mt 6,22.23; 1 Jo 2,10
10 Wenn aber einer in der Nacht wandert, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Jo 12,35;1 Ko 15,20;1 Jo 2,11
11 Dieses sprach er, und dann sagt er ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen (D: "schläft"), aber ich gehe hin, daß ich ihn aufwecke. Mt 9,24
12 Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist (D: "schläft"), wird er geheilt werden.
13 Es hatte aber Jesus von seinem Tode gesprochen; sie aber meinten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf (wörtlich: vom Schlummer des Schlafes).
14 Da erst sprach Jesus offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben,
15 und ich freue mich um euretwillen, damit ihr glauben lernt, daß ich nicht dort war. Aber wir wollen zu ihm gehen
Jo 11,42
16 Da sprach Thomas, der den Namen Didymus ("Zwilling") hat, zu seinen Mitjüngern: Auch wir wollen gehen, um mit ihm zu sterben. Jo 20,24-29;21,2;Mk 10,32;14,31
17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegen. Jo 11,39
18 Es war aber Bethanien nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt.
19 Viele aber von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen des (K: "ihres") Bruders zu trösten.
20 Martha nun, wie sie hörte, daß Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Lk 10,39
21 Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Jo 11,3.32
22 Und auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, Gott wird es dir geben. Jo 9,31.33
23 Jesus sagt zu ihr: Auferstehen |22| wird dein Bruder.
24 Martha sagt zu ihm: Ich weiß, daß er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage.
Jo 5,15.29;6,40; Mt 22,23-33; Apg 24,15
25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;
Jo 3,36;5,24;6,40.54;8,51;14,6
26 und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ganz gewiß nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?
27 Sie sagt zu ihm: Ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen, daß du der Messias ("der Gesalbte") bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jo 1,49;6,69; Mt 16,16
28 Und als sie dies gesagt hatte, ging sie weg und rief Maria, ihre Schwester, und sagte ihr heimlich: Der Lehrer ist da und ruft dich.
29 Jene aber, wie sie es hörte, steht schnell auf und ging zu ihm. Jo 11,20
30 Denn Jesus war noch nicht in das Dort gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war.
31 Die Juden nun, die bei ihr im Hause waren und sie zu trösten suchten, sahen, daß Maria schnell aufstand und hinausging, und folgten ihr in der Meinung, sie gehe zum Grabe, um dort zu weinen.
32 Maria indessen, wie sie dort hinkam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel ihm zu den Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, wären mir der Bruder nicht gestorben. Jo 11,21
33 Als Jesus nun sah, wie sie weinte und wie die mit ihr gekommenen Juden weinten, ergrimmte er im Geist und erregte sich
Jo 13,21; Mk 3,5;9,19; Mt 26,37.38
34 und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh [es].
35 Jesus kamen die Tränen.Lk 19,14
36 Da sagten die Juden: Sieh, wie hat er ihn liebgehabt.Jo 9,6.7.32
37 Einige von ihnen aber sprachen: Konnte dieser, der die Augen des Blinden geöffnet hat, nicht machen, daß auch dieser nicht sterben mußte?
38 Jesus nun, erneut ergrimmt in seinem Innern, kommt zum Grabe. Es war aber eine [Grabes]-Höhle, und ein Stein lag vor ihr.
39 Jesus sagt: Hebt den Stein weg! Es sagt zu ihm die Schwester des Verstorbenen, Martha: Herr, er riecht schon, er ist ja schon vier Tage tot.
40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, du würdest, wenn du glaubst, die Herrlichkeit Gottes sehen?
Jo 2,11;11, 4.23. 25.26
41 Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen nach oben und sprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört hast.
Jo 17,1; 1 Kö 18,36f; Mt 14,19; Mk 7,34
42 Ich aber wußte, daß du mich allezeit erhörst. Aber um der umherstehenden Menge willen sprach ich [es aus], damit sie den Glauben gewinnen, daß du mich gesandt hast. Jo 11,15;12,30; 1 Jo 5,14
43 Und nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Apg 7,8
44 Da kam heraus der Verstorbene, gebunden an den Füßen und den Händen mit Binden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umwunden. Jesus sagt zu ihnen: Macht ihn frei und laßt ihn gehen. Jo 20,7; Mk 5,42.43; Lk 7,15
1 Das Ringen um Israel, von Kap. 2,13 bis Kap. 10,39 sich ständig steigernd, war von Jesus abgebrochen worden. Jesus hatte sich auf das Ostufer des Jordans zurückgezogen. Wie sollte sein Weg weitergehen? |23| Wie sollte es zu jener letzten Entscheidung kommen, die Jesus als "seine Stunde" schon lange (2,4!) vor sich sah? Johannes macht uns deutlich, wie Jesus selbst diese "Stunde" in keiner Weise herbeiführt; er hat keinen "Plan". Alles begibt sich wie von ungefähr und doch so, daß der Sohn Schritt für Schritt den Plan und den Willen des Vaters erkennt und diesem Willen folgt[ A ].
Darum beginnt das gewaltige 11. Kapitel, an dessen Ende der Todesbeschluß des Hohen Rates steht (V.46-53.57), mit einer fast belanglosen Mitteilung: "Es lag aber einer krank, Lazarus von Bethanien." Wenn Johannes hinzufügt: "Aus dem Dorf Marias und Marthas, ihrer Schwester", dann wird wieder sichtbar, wie selbstverständlich er bei seinen Lesern die Kenntnis der synoptischen Überlieferung voraussetzt. Er selber hat bisher von "Maria und Martha" nicht gesprochen, führt sie aber hier als bekannte Personen an. "Martha" heißt "Herrin"; sie scheint auch tatsächlich die älteste der Geschwister und die maßgebende Hausfrau gewesen zu sein. Aber wie in Lk 10,38-42 Maria innerlich die Bedeutsamere ist, so hebt auch Johannes sie hervor:
A) In genauer Entsprechung zeigt uns Lukas in der Apostelgeschichte, wie auch die Jünger Jesu keinen Plan zur Durchführung der Weltmission entwerfen. Der große Auftrag Jesu: "Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde" erfüllt sich in lauter Begebenheiten, die z. T. sogar wie Hindernisse aussehen und die doch die Jünger Schritt um Schritt dem Befehl ihres Herrn gemäß vorwärts treiben. Vgl. die Auslegung der Apg in der W. Stb. besonders S. 33,79,291/92
2 "Es war aber Maria, die den Herrn gesalbt hat mit Myrrhe und seine Füße abgewischt hat mit ihren Haaren." Johannes wird das erst in Kap. 12,1-8 erzählen, setzt es aber als bekannt voraus. Und nun erst erfahren wir, daß Lazarus[ A ] nicht nur aus dem gleichen Dorf stammt, sondern der Bruder der Maria (und Martha) ist. Jetzt klingt der Bericht schon gewichtiger: "deren Bruder Lazarus war krank."
A) "Lazarus; ist die griechische Form des hbr "Eleasar", d. h. "Gott hat geholfen". Es ist ein häufiger Name, den wir auch 2 Mo 6,23.25;2 Sam 23,9 f;1 Chro 23,21 f; Esr 8,33;10,25;Mt 1,15 finden und den Jesus in Lk 16,20 mit Bedacht verwendet.
3 Wir spüren, daß besonderes Band Jesus mit diesem Haus verbindet, und verstehen, wie Jesus in das Geschehen mit hineingezogen wird. Es ist hier anders als bei Jesu Eingreifen in Kap. 5,1 ff und Kap. 9,1 ff. "Es sandten nun die Schwestern zu ihm und ließen sagen: Herr, sieh, der, den du liebhast, ist krank." Den Kranken am Teich Bethesda und den Blindgeborenen kannte Jesus vorher nicht. Aber mit Lazarus war er verbunden und hatte ihn lieb. Es gab im irdischen Leben dessen, der aus der ewigen Herrlichkeit kam, menschliche Zuneigungen, die er sichtbar werde ließ. Auch hierin war Jesus "wahrer Mensch".
4 Näheres über die Art der Krankheit hören wir nicht. Eine medizinische Diagnose ist hier nicht wichtig. Jesu geistliche Diagnose dieses Krankheitsgeschehens ist entscheidend. "Als es aber Jesus hörte, |24| sprach er: Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern dient der Herrlichkeit Gottes, daß verherrlicht werde der Sohn Gottes durch sie." Jede Krankheit hat von Natur die Richtung auf den Tod. Kein Fortschritt der Medizin kann das grundsätzlich ändern. #
Jesus aber gibt der Krankheit ein neues Ziel. Er tut es so wesentlich und tief, daß er in scheinbarem Widerspruch zu seinem Wort die Krankheit des Lazarus im leiblichen Tode enden läßt und dieses Ende noch selber durch sein Fernbleiben vom Krankenbett des Freundes herbeiführen hilft. "Diese Krankheit führt nicht zum Tode", das ist keine bloße beruhigende Prognose. Es ist darin von vornherein ein herausfordernder Angriff auf den Tod von Jesus ins Auge gefaßt, der erst als solcher in vollem Sinn "der Herrlichkeit Gottes dient". Der Tod stellt auf die letzte Probe. Wohl hat Jesus schon viele große Dinge getan, aber immer konnte er mit seinem Helfen und Heilen an das Leben anknüpfen, das er vorfand. Hat er aber wirklich Macht auch über den Tod? Behauptet hat Jesus diese Macht schon in Kap. 8,51 und Kap. 10,18. Nun muß und wird er in der Begegnung mit der ganzen Wirklichkeit des Todes seine Macht erweisen[ A ]. Gottes Herrlichkeit leuchtet in dieser Überwindung des Todes auf. Zugleich aber ist es Jesus, der Sohn Gottes selbst, der im Gehorsam nach dem Willen des Vaters handelt und so durch diese Krankheit des Lazarus "verherrlicht" wird. Auch hier wieder (vgl. Kap. 5,17 ff) liegt die Herrlichkeit Gottes und die Verherrlichung Jesu völlig ineinander. Verherrlicht sich der Sohn durch eine ungeheure Tat, dann leuchtet die Herrlichkeit Gottes auf. Und die Größe und Macht des unsichtbaren Gottes kann nur in solchen Taten des Sohnes auf der Erde sichtbar werden[ B ].
A) Dies alles ist im Blick auf unser Evangelium gesagt. Nach dem Bericht der Synoptiker hat Jesus seine Macht über den Tod bereits bei der Tochter des Jairus und bei dem Jüngling von Nain erwiesen. Aber auch dann bleibt es dabei, daß Jesus am Grabe des Lazarus in der äußersten Weise nach seiner Vollmacht dem Tode gegenüber gefragt ist.
B) Jesu gibt mit seinem Wort auch unserer Stellung zur Krankheit die rechte Richtung., einerlei wie unser Kranksein äußerlich verläuft und endet. Es ist nicht wahr, daß Gläubige nicht krank werden dürfen. Aber jeder Glaubende darf das Wort Jesu auch für seine Krankheit gültig wissen: Sie dient der Herrlichkeit Gottes.
Freilich ist der Blick Jesu dabei in die Weite gerichtet. Wohl verherrlicht ihn das unerhörte Wunder, das wir miterleben werden. Aber gerade dieses Wunder wird ihm selbst endgültig den Tod bringen. Wo bleibt dann seine "Verherrlichung"? In 13,31 f wird er vor seinen Jüngern auf diese Frage antworten. Sein Tod ist seine eigentliche Verherrlichung (17,1)! Weil er der "Fürst des Lebens", "die Auferstehung und das Leben ist," wird seine "Erhöhung" an das Kreuz, sein Sterben am Fluchholz die Rettung der Verlorenen aus dem Tode in das ewige Leben (3,15). Jesus hört in der Erkrankung des Freundes den Schlag der "Stunde", die gerade dadurch kommt, daß Lazarus |25| sterben und auferweckt werden wird. Es ist die rettende Stunde für die ganze Welt. Nur in solchen großen Zusammenhängen verstehen wir unser Kapitel recht.
5 Nun versichert uns Johannes: "Es liebte aber Jesus Martha und ihre Schwester und den Lazarus."