R Schriftsteller
Die Gnade Gottes unterweist uns - Hilfe zum Studium des Brief an Titus, Henri Rossier
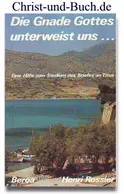
Einleitung
Mit Recht wurde schon darauf hingewiesen, dass der erste Brief an Timotheus, wie auch der Brief an Titus, jeder durch den Auftrag, womit der Apostel seine beiden Vertreter und Mitarbeiter im Werke betraut hat, seinen Charakter erhielt. Timotheus sollte über die gesunde Lehre wachen (1. Tim 1,3–4),
Titus über die Ordnung im Hause Gottes (Tit 1,5).
Wir wollen uns hier aber nicht mit dem beschäftigen, worin sich diese beiden Briefe unterscheiden –
andere haben dies schon getan – sondern uns im Laufe dieser Betrachtung auf ihre Berührungspunkte begrenzen, um so in unserem schwachen Masse zum Verständnis dieses wichtigen Gegenstandes beizutragen.
Der Brief an Titus, der wie der erste Timotheusbrief nachdrücklich auf der Lehre oder der Belehrung unter den Gläubigen [1,9; 2,1.3.7.10; 1. Tim 1,10; 2,7; 4,6.13.16; 5,17; 6,1.3 .] besteht, indem er sie der Unterweisung der falschen Lehrer gegenüberstellt, verweilt mehr bei den fundamentalen Wahrheiten des Christentums.
Er zeigt die Früchte dieser Wahrheiten, die aus dem praktischen Leben der Gläubigen hervorgehen sollen, damit eine schöne Ordnung das Haus Gottes kennzeichnen und
eine gute Harmonie zwischen allen Gliedern bestehen kann.
Die «gesunde Lehre» umfasst die göttlichen Grundsätze, die in den drei Hauptteilen dieses Briefes dargelegt werden.
1. in der ersten dieser Stellen (Kap. 1,1–4), die Lehre des Christentums, zusammengefasst in den grossen Wahrheiten, die es charakterisieren;
2. in der zweiten (Kap. 2,11–14), die Summe des Christentums, nicht mehr in ihren typischen
Wahrheiten, sondern in ihrer praktischen Verwirklichung in unserem Wandel und in unserem
Verhalten;
3. die dritte schliesslich (Kap. 3,4–7) unterweist uns über das Werk Gottes in uns und über die
Mittel, deren es sich bedient hat, um uns zu Ihm zu führen und uns das Heil zu erwerben.
Wir werden Gelegenheit haben, auf alle diese Stellen im einzelnen zurückzukommen und sie zu
erläutern. Aber bevor wir dazu übergehen, drängt sich eine Bemerkung auf: In den Tagen, durch
die wir gehen, ist es von allergrösster Wichtigkeit, auf dieser grossen Wahrheit zu bestehen: Die
Praxis des christlichen Lebens ist untrennbar von der gesunden Lehre.
Tatsächlich, man begegnet heute immer mehr der Meinung, man könne die Christen trotz ungesunder Lehren, welche die Wahrheiten, oft die fundamentalsten des Christentums, verändern oder verderben, gleichwohl dazu bringen, gottgemässe Früchte zu tragen. Damit wertet man die Heiligen Schriften ab, die einzige und unfehlbare Sammlung dieser Wahrheiten.
Indem aber dem christlichen Leben seine absolute Grundlage – das inspirierte Wort – entzogen wird, vergisst man, dass nicht ohne den Baum, der sie trägt, Früchte produziert werden können. Der gefallene Mensch kann aus sich selbst überhaupt keine Früchte für Gott hervorbringen, so wenig wie ein schlechter Baum gute Früchte tragen kann.
Indem man aus dem Worte Gottes einen Führer macht, der zwar mit einer höheren Moralität ausgestattet ist, aber unter dem Einuss der Irrtümer und Vorurteile seiner verschiedenen Schreiber verfasst wurde, vergisst man ferner, dass selbst ein guter Baum, durch die Verstümmelung seiner Rinde des ihn nährenden Saftes beraubt, unfähig ist, eine genügende Ernte oder überhaupt eine Ernte zu bringen.
Die enge Verbindung zwischen der Lehre und dem praktischen Leben ndet sich in der Schrift
auf Schritt und Tritt. Der 119. Psalm zeigt uns, dass der Pfad des Gerechten allein durch das Wort vorgezeichnet und erleuchtet wird. Der Gläubige bekennt, dass er ohne die Unterweisung der Schrift
«umherirrte wie ein Schaf». Die beiden Briefe an Timotheus sind voll von dieser Wahrheit. In
2. Timotheus 3,16 wird gesagt, dass es die von Gott inspirierten Schriften sind, die uns bezüglich der praktischen Gerechtigkeit in unserem ganzen Wandel belehren und unterweisen. Das zweite Kapitel unseres Briefes genügte schon allein, um uns von dieser wichtigen Wahrheit zu überzeugen und uns zu ersparen, weitere Beispiele anzuführen. Erinnern wir uns ferner daran, dass selbst der Christ, der ein völliges Vertrauen in die absolute Autorität des geschriebenen Wortes besitzt, immer wiedersehen wird, wie die Gesundheitseines praktischen Lebens von dem Masse abhängt, in welchem er sich von den Schriften nährt, mit ihnen in Kontakt bleibt und sich ihrer Unterweisung unterwirft.
«Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Honung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheissen hat vor den Zeiten der Zeitalter, zu seiner Zeit aber sein Wort geoenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach dem Befehl unseres Heiland-Gottes, – Titus meinem echten Kinde nach unserem gemeinschaftlichen Glauben: Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christo Jesu, unserem Heilande!» (V. 1–4).
Das ist die erste Hauptstelle in unserem Brief. Wie wir schon gesagt haben, wird in diesen vier
Versen in gedrängter Kürze das unerschöpiche Thema der grossen Wahrheiten des Christentums
zusammengefasst.
Wir lernen zuerst, dass die Quelle dieser Segnungen sich in Gott selbst bendet. Er wird uns in erster Linie in Seinem absoluten Charakter als Gott vorgestellt; dann als der wahre Gott, der nicht lügen kann; hierauf als der Heiland-Gott, dersich Verlorenen gegenüber alssolcher oenbart;schliesslich als Gott, der Vater, als Gott der Liebe.
Doch haben wir in Christo Jesu, unserem Heilande die Oenbarung alles dessen, was Gott für uns ist. Der Apostel Paulus ist das Werkzeug dieser Oenbarung. Er nennt sich Knecht Gottes. Diesem
Titel begegnen wir in den Briefen nur zweimal (hier und in Jakobus 1,1) und etliche Male in der
Oenbarung, während der Ausdruck Knecht Christi öfters vorkommt.
Ein Knecht Gottes zu sein, setzt eine völlige Abhängigkeit voraus, Furcht und Zittern in seinen Tätigkeiten, Achtung vor jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, tiefes Bewusstsein unserer Verantwortung.
Gleichzeitig wird der grosse Apostel der Nationen durch seine Eigenschaft als Knecht in die geringste und bescheidenste Stellung versetzt. Diese Haltung sollte Titus zum Beispiel sein, der soeben berufen
worden war, einen Ehrenplatz einzunehmen: Wenn der Apostel selbst eine so bescheidene und
abhängige Stellung einnahm, wieviel mehr sollte dies bei seinem Jünger der Fall sein!
Als Knecht oder Sklave Gottes gehörte sich Paulus nicht selber an. Was Gott von Seinem Knecht
erwartet, ist vorbehaltloser Gehorsam, eine gewissenhafte Treue in der Ausrichtung der Botschaft, die der Meister, dem er angehört, ihm anvertraut hat. Aber diese ernste Botschaft hat nichts Erschreckendes an sich und enthält keinerlei Drohung; denn der, welcher sie zu andern trägt, ist
Knecht des «Heiland-Gottes».
Daher nennt sich Paulus auch «Apostel Jesu Christi». Wenn Gott ihm die Wahrheit in die Hände
gegeben hat, so sendet ihn Christus aus, um sie bekanntzumachen und sie zu verbreiten. Dieser
Auftrag versetzt Paulus in eine besondere Beziehung zu Christo, als Sein Apostel, durch Ihn
ausgesandt, um der Welt die Wahrheiten zu bringen, die Gott von Ewigkeit her in Aussicht hatte,
Wahrheiten, die den Menschen als solche angeboten wurden, die ihr Teil sein würden, auf Grund
des Werkes Christi. Daher konnte Paulus sagen: «Christus Jesus, unser Heiland»; der Urheber des
Heils, das zu aller Zeit zum Ratschluss des Gottes der Liebe uns gegenüber gehörte. Von diesem Heil redet Paulus als ihm selbst angehörend. Er kann sagen: Christus ist nicht nur der Heiland, Er ist auch der meinige und aller derer, die an Ihn glauben: unser Heiland. Das Heil ist uns durch Jesum
Christum erworben worden. Er selbst ist Knecht Gottes geworden, um es uns zu erwerben, und uns zum Diener, um es auf uns anzuwenden, nachdem Er es vollbracht hat (Phil 2,6–8).
Kapitel 1,1–4
Betrachten wir jetzt, worin der Dienst des Apostels bestand:
1. Sein Apostelamt hat mit den Grundsätzen des Judentums nichts gemein. Es ist völlig unabhängig vom Gesetz. Es ist «nach dem Glauben der Auserwählten Gottes». Es richtet sich weder an das Fleisch, noch an den Willen des Menschen, sondern an den Glauben, im Gegensatz zum Gesetz. Ferner schliesst es den jüdischen Grundsatz eines Volkes, das auf eine eischliche Herkunft gegründet ist, gänzlich aus. Gewiss, diese Abstammung war ursprünglich von dem Glauben des einen Abraham abgeleitet, indem sie aber die Beziehungen nach dem Fleische zu dem aus ihm hervorgegangenen Volke bestehen liess. Aber dieses Volk nach dem Fleische, berufen, sich dem Gesetz zu unterwerfen, hat durch seinen Ungehorsam jedes Recht verloren, als das Volk Gottes anerkannt zu werden.
Es wird später diesen Anspruch – gleichwie wir – nur auf dem Boden des Glaubens der Auserwählten wiedernden. Das Apostelamt des Paulus richtet sich an den individuellen Glauben und nicht an ein bevorzugtes Volk, hervorgegangen aus einer irdischen Abstammung. Die diesen Glauben empngen, waren Auserwählte Gottes, die Er von Ewigkeit her auserkoren hatte, Ihm anzugehören, und die, durch Glauben errettet, fortan durch ihre Vereinigung ein himmlisches Volk bildeten.
Diese beiden Dinge, der Glaube und die Auserwählung, kennzeichnen das Christentum in einer
absoluten Weise, im Gegensatz zum Judentum. Das eine wie das andere ist ausschliesslich von der Gnade und nicht vom Gesetz abhängig.
2. Der zweite Gegenstand des Apostelamtes des Paulus war «die Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist». Es war die Wahrheit, die ganze Wahrheit, die er bekannt machte, nichts weniger als das! Was ist denn Wahrheit? Sie ist die volle Oenbarung dessen, was Gott ist (Seine Natur), was Er sagt (Sein Wort) und was Er denkt (Sein Geist); mit andern Worten: die Oenbarung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Was Gott ist, wurde uns in Christo geoenbart, in welchem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
wohnt (Kol 2,9). In Christo erkennen wir Gott als Den, der Licht ist und der Liebe ist.
Wahrheit ist sodann auch, was Gott sagt, also Sein Wort. Jesus sagt: «Dein Wort ist Wahrheit»
(Joh 17,17). Dieses Wort ist uns durch Christum gebracht worden. Er ist also gleichzeitig das, was Gott ist und was Gott sagt. Im Evangelium Johannes, das Ihn als «Sohn Gottes» vorstellt, sagt Er immer wieder: «Ich bin». Wenn die Juden Ihn fragen: «Wer bist du?», antwortet Er ihnen: «Durchaus das, was ich auch zu euch rede» (Joh 8,25). Die absolute Vereinigung dieser beiden Seiten der Wahrheit in Christo – was Gott ist und was Er sagt, Seine Natur und Sein Wort – wird uns in dieser Stelle vorgestellt.
In Christo («im Sohne») hat Gott zu uns geredet, im Gegensatz zu der bruchstückhaften Weise, in der Er einst durch die Propheten geredet hatte (Heb 1,1), indem Er durch jene gewisse Seiten der Wahrheit vorstellte, während Gott sie jetzt in Christo, welcher das Wort ist, in ihrer Fülle bekanntmacht. Das Christentum ist der erhabene und einzig vollständige Ausdruck der Wahrheit, weil die Wahrheit darin «im Sohne» zu uns redet. Sie ist durch Ihn geworden, nicht durch Mose, weil sie in einer Person gekommen ist, welche die Wahrheit selbst ist, so wie das Wort sie uns enthüllt.
Die Wahrheit ist schliesslich der Gedanke Gottes über alle Dinge. Dieser Gedanke ist in Christo, und der Geist gibt Zeugnis davon, denn «der Geist ist die Wahrheit» (1. Joh 5,6). Er gibt Zeugnis davon,
dass das ewige Leben in Christo ist und uns durch Sein Opfer erworben wurde.
Die Wahrheit ndet also in Christo ihren vollkommenen Ausdruck, denn Er selbst ist die Wahrheit:
«Ich bin die Wahrheit», sagt Er (Joh 14,6).
Unter der Herrschaft des Gesetzes oenbarte Gott keineswegs Seinen ganzen Gedanken über
irgend etwas. Er liess sich nicht als der Gott der Liebe erkennen: Die Oenbarung Seiner selbst,
die Jehova unter dem Gesetz gab, war höchstens von der Ausrufung Seiner Barmherzigkeit begleitet
(2. Mose 34,6).
Unter dem Gesetz oenbarte Gott auch nicht, dass der Mensch verloren ist, denn das Gesetz setzte für den Menschen die Möglichkeit voraus, durch Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes das Leben zu erlangen. Jehova oenbarte darin auch nicht Seinen Gedanken über die Welt, denn unter
Gesetz wurde die Welt noch nicht dargestellt, als endgültig Satan unterworfen und gerichtet. Es
bezeugte auch nicht Gottes Gedanken über den Himmel; denn da der Mensch ein Sünder war, blieb
ihm der Himmel verschlossen, und das Gesetz konnte ihm nur eine irdische Segnung verheissen.
Auch Gott selbst war unter dem Gesetz nicht geoenbart; Er blieb hinter dem Vorhang in tiefer
Dunkelheit verborgen. Unter dem Gesetz war auch die Frage eines Opfers ungeklärt, das die Sünden
hinwegzunehmen und den Sünder ein für allemal mit Gott versöhnen konnte.
Kurz, die Erkenntnis der Wahrheit blieb unter dem Gesetz unbekannt, oder sie war nur stückweise
erkennbar. Diese Erkenntnis ist in ihrer Fülle ausschliesslich dem Christentum eigen.
Aber beachten wir hier einen zweiten Punkt: diese Erkenntnis der Wahrheit ist «nach der Gottseligkeit».
Die Gottseligkeit ist die Aufrechterhaltung der innigen Beziehungen zwischen unserer Seele und
Gott, welche aus der Erkenntnis der Wahrheit hervorgeht. Das «Geheimnis der Gottseligkeit» in
1. Timotheus 3,16 ist nichts anderes; es ist das Geheimnis, wodurch Gottseligkeit hervorgebracht
wurde, mittels welcher die Seele dazu geführt wird, ihre Beziehungen mit Gott zu geniessen und darin
zu bleiben. Die ganze Wahrheit ist, wie wir gesehen haben, in einer einzigen Person zusammengefasst, in Jesus, Gott geoenbart im Fleische. Er allein hat uns Gott erkennen lassen und bringt uns in Beziehung zu Ihm. Darum ist das grosse «Geheimnis der Gottseligkeit» in der Erkenntnis Christi
allein zusammengefasst: «Gott ist geoenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen
von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit»
(1. Tim 3,16). Die Erkenntnis der Wahrheit, wenn sie nicht die Gottseligkeit zum Ergebnis hat, würde den Menschen zu seiner ewigen Verdammung führen, denn sie vermöchte ihn nie in Beziehung zu Gott zu bringen. Statt die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, zu haben, kann man sie «in Ungerechtigkeit besitzen» (Röm 1,18), und der Mensch, der sie in dieser Weise besitzt, ist ein Gegenstand des Zornes Gottes, statt ein Gegenstand Seiner Gunst.
3. Das dem Paulus anvertraute Apostelamt hatte «die Honung des ewigen Lebens» zur Grundlage.
Diese Honung ist eine Gewissheit, die nichts Unbestimmtes, Unsicheres an sich hat, wie die
menschliche Honung, denn sie gehört dem Glauben an. Das ewige Leben ist von Gott selbst
verheissen worden, vor ewigen Zeiten, und wie hätte Gott gegenüber Seiner eigenen Verheissung der
Ewigkeit lügen können? Hatte Er nicht gesagt: «Ich bin Gott, und gar keiner wie ich; der ich von
Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist; der ich spreche: Mein
Ratschluss soll zustande kommen»? (Jes 46,9.10). Die «Auserwählten Gottes» besitzen dieses Leben
jetzt schon, durch den Glauben an einen gestorbenen Christus (Joh 6,54). «Er ist der wahrhaftige Gott
und das ewige Leben.» Wer an Ihn glaubt, hat dieses Leben, nicht ein menschliches, vergängliches
Leben, sondern ein geistliches Leben ohne Ende, das Leben Gottes selbst, ein Leben, fähig, Gott zu erkennen, Ihn zu geniessen, Gemeinschaft mit Ihm, dem Vater, und mit Seinem Sohne Jesus Christus
zu haben. Solcherart ist «das ewige Leben». Solange der Christ hienieden ist, wird der Genuss dieses Lebens ohne Zweifel unvollkommen sein. Aber bald werden wir den ganzen Wert dieses Lebens in der Herrlichkeit verwirklichen; wenn wir Ihn, unser Leben, sehen und Ihm gleich sein werden; wenn
wir erkennen werden, wie wir erkannt worden sind; wenn wir die unaussprechliche Wonne einer vollkommenen und ununterbrochenen Gemeinschaft mit Ihm, dem Gegenstand unserer Honung, geniessen.
Das ist die christliche Lehre, das eigentliche Wesen des Christentums. Gewiss, wir können mit dem Apostel ausrufen: «O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes!»
Ja, welch unermesslicher Reichtum! Welch einen Gegenstand gibt uns das Christentum! Welche
Sicherheit! Welchen gegenwärtigen Genuss! Welche Glückseligkeit und welchen Frieden in unseren
Beziehungen mit Gott! Welch völlige Freude in Seiner Gemeinschaft! Welche Gewissheit für die
Zukunft! Gibt es eine Erkenntnis, die mit der verglichen werden kann, die das Evangelium uns bringt?
«Zu seiner Zeit aber (hat es) sein Wort geoenbart.» Im Gegensatz zu den «ewigen Zeiten» gibt es
ein «seiner Zeit». In dieser Zeit sind wir jetzt; es ist der heutige Tag, an welchem Gott den ganzen
Ratschluss Seiner Gnade, von welchem wir reden, völlig geoenbart hat. Dieses «seiner Zeit», das
Gott zum voraus festgesetzt hatte, ist jetzt erschienen. Diese Zeit ist durch eine in der Geschichte
einzigartige Tatsache eingeführt worden, deren Auswirkung ebensowenig ein Ende hat, wie die
Ewigkeit selbst: das Kreuz Christi und die Auferstehung des Sohnes Gottes aus den Toten. Da war es,
wo der Ratschluss Gottes in Bezug auf uns völlig geoenbart worden ist. Der Vorhang, der uns von
Gott trennte, ist zerrissen, der Zugang zu Ihm in dem vollen Licht aufgetan, die Beziehung zu Ihm, als unserem Vater, auf immerdar festgemacht, das Erbteil, als unser Teil mit Christo in der Herrlichkeit,
testamentiert – und alles das durch Ihn und in Ihm.
Nichts von all dem war vordem angekündigt und bekannt gewesen. Das Wort des Gottes, der
nicht lügen kann, ist jetzt geoenbart. Die ewigen Gedanken Gottes bestanden bis dahin in dem
Verborgenen Seiner Ratschlüsse, jetzt aber sind sie bekannt, und die Predigt dieses Wortes ist Paulus
anvertraut worden. Welch ungeheure Bedeutung hatte also sein Apostelamt! Seitdem ist das Wort
der Wahrheit vollendet (Kol 1,25). Seine Predigt war ein Gebot, und wir wissen, wie der Apostel
ihm gehorcht hat. Aber dieses Gebot hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem Gesetz, denn es war nicht
Jehova, der Gott vom Sinai, sondern der Heiland-Gott, der sich zu gegebener Zeit durch das Wort
oenbarte, dessen Predigt dem Apostel anvertraut war.
Paulus richtete seinen Brief an Titus (V. 4). Dieser war das echte Kind des Apostels. Er war nach
der Wahrheit gezeugt worden und hatte sie auf dem gleichen Boden empfangen wie sein geistlicher
Vater: auf dem Boden des Glaubens. Dieser Glaube war also Paulus und Titus, dem Juden und dem
Heiden, gemeinsam, aber Paulus war das Werkzeug gewesen, um ihn dem Titus mitzuteilen.
Gott, der Vater, und Christus Jesus, unser Heiland, die göttliche Liebe und die göttliche Gnade
vereinigen sich, um Titus eine frohe Botschaft der Gunst und des Friedens als gegenwärtige Segnungen
zu überbringen, die sein Teil waren, wie auch das des Apostels, welcher denselben Heiland hatte wie
sein Jünger.
«Deswegen liess ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte: Wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann,
der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind.
Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern
gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf dass er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen» (Kap. 1,5–9).
Wir haben gesehen, welches die Grundlagen des Christentums sind: Der Glaube der Auserwählten, die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, das ewige Leben, das Wort Gottes, und schliesslich die Predigt, welche diese Dinge aus dem Worte schöpft. Alle diese Gegenstände sind in dem enthalten, was als «die gesunde Lehre» bezeichnet wird.
Die soeben angeführten Verse 5–9 befassen sich mit der guten Ordnung in der Versammlung, und
diese gute Ordnung kann nicht Platz greifen ohne die gesunde Lehre und die Unterweisung, die sie den Gläubigen vorstellt. Darauf haben wir schon am Anfang dieser Betrachtung hingewiesen.
Diese Unterweisung ist allen denen anvertraut, welchen Gott in der Versammlung eine besondere Verantwortung gegeben hat: zuerst Titus (2,1), den Ältesten (1,9), den alten Frauen, wenn auch in einem sehr begrenzten Masse (2,3), den Jünglingen (2,7).
Schliesslich hat die Unterweisung ihr vollkommenes Vorbild in der Unterweisung der Gnade, die in Jesu erschienen ist (2,12). Die Titus anvertraute Verwaltung bestand darin, die gute Ordnung in den Versammlungen Gottes in Kreta festzulegen, zu regeln und aufrecht zu halten, während die Timotheus anvertraute Verwaltung in der Versammlung zu Ephesus darin bestand, in besonderer Weise über die Lehre zu wachen, damit sie nicht verfälscht würde.
Die Verwaltung, die dem Apostel Paulus übergeben wurde, war viel weiter ausgedehnt, als die seiner Delegierten: er hatte die Verwaltung des Geheimnisses des Christus in dieser Welt (Eph 3,2.9; 1,10; 1. Kor 9,17), des Geheimnisses, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen, jetzt aber durch den Geist geoenbart war. Dieses Geheimnis war die Vereinigung der Versammlung mit Christo zu einem Leibe. Paulus sollte diese ihre Stellung
und ihre Berufung bekanntmachen, und die Verwaltung dieses Geheimnisses war verbunden mit
einem unaufhörlichen Wirken und einer beständigen Überwachung, denn der Apostel wünschte,
dem Christus Seine Braut als «eine keusche Jungfrau» darzustellen.
Was Titus anbelangt, handelte es sich mehr, wenn auch nicht ausschliesslich darum, die äussere
Ordnung in den persönlichen Beziehungen der Christen untereinander aufrechtzuhalten. In dieser Beziehung blieben verschiedene Dinge zu regeln, unter anderem die Einsetzung von Ältesten.
Die Frage der Ältesten, die so oft von denen erhoben wird, die in den protestantischen Kirchen den Klerus verteidigen, ist im Lichte des Wortes geklärt und ist für jeden geregelt, der sich der Autorität der Schriften unterwirft, so dass es unnütz erscheint, hier näher darauf einzugehen. Wir beschränken uns darauf, sie zusammenzufassen.
Die Ältesten, ein Name, der identisch ist mit Bischöfen oder Aufsehern, werden sorgfältig
unterschieden von den Gaben des Geistes oder den Gaben, die der verherrlichte Christus Seiner
Versammlung gegeben hat. Die Identikation dieser Gaben mit den Ämtern der Bischöfe (oder
Aufseher) und der Diakone (oder Diener) ist ein Kennzeichen des Verfalls der Kirche und hat diese nach dem Verlassen der ersten Liebe sehr bald charakterisiert. Die Ältesten, wie auch die Diakone, sind lokale Ämter, das heisst, sie überschreiten die Abgrenzung einer lokalen Versammlung nicht.
Diese Ämter bestanden, zwar nicht öentlich, aber ebenso wirklich in den aus dem Judentum
hervorgegangenen Versammlungen, während sie in den Versammlungen der Nationen durch den
Apostel oder durch seine Beauftragten eingesetzt wurden. Es könnte noch andere gegeben haben, aber nur zwei dieser Beauftragten, Timotheus und Titus, werden in den Briefen als Gesandte des Apostels Paulus erwähnt. Auf alle Fälle sind wir nur ermächtigt, diese, die im Wort erwähnt sind, anzuerkennen. Titus ist der Beauftragte, mit dem unser Brief uns beschäftigt.
Die Gaben werden bis zum Ende bestehen (Eph 4,11–14). Von den Ämtern wird das nie gesagt. Ihr gegenwärtiges Fehlen (denn wir können die in oenem Widerspruch zum Worte Gottes eingesetzten Ältesten in keiner Weise anerkennen), ist ein ebenso greifbarer Beweis des Verfalls der Kirche, wie ihre Einsetzung ohne die Sanktion der Schriften. Tatsächlich, wo bendet sich heute die Autorität, um sie einzusetzen? Gewiss gibt es der Herr den Seinen ins Herz, da wo sie nach dem Worte versammelt sind, sich der Notwendigkeit der Aufsicht, die inmitten der Versammlungen vorhanden ist, zu unterziehen, aber jede Einsetzung oder Weihe von Ältesten, die auf eine andere Weise als in der geschieht, die das Wort lehrt, ist im Widerspruch zum Gedanken des Geistes Gottes.
Die Christen, die dem Worte unterworfen sind, werden sich strikte an seine Unterweisungen halten, sowohl in diesem wie auch in jedem anderen Punkt.
Die Gabe und das lokale Amt können bei der gleichen Person vorhanden sein, aber in der Schrift
werden sie nie miteinander vermischt. Ob so oder so, waren die Ältesten alle dazu bestimmt die
Herde zu weiden, aber es gab Älteste, die nicht am Worte dienten. Ausser ihren Funktionen, die darin bestanden, die Herde zu überwachen und zu pegen, sollten die Ältesten fähig sein, zu unterweisen, dem Worte anzuhangen nach der Lehre, damit zu ermahnen und die Widersprechenden zu überführen, aber mit dem Wort in dem Werke zu arbeiten und zu lehren war nicht unerlässlich für ihr Amt. Siehe
1. Timotheus 5,17, wo gesagt wird: «sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre».
Wir nden also in den Versen 6–9 die von den Ältesten geforderten Eigenschaften, damit Titus sie
einsetzen konnte. Es handelt sich in erster Linie um Eigenschaften äusserlicher Art (V. 6), weil sie von allen festgestellt werden können. Sie zeigen sich beim Ältesten im Verhalten seines Hauses und im Leben seiner Familie. Der Älteste musste in dieser Beziehung untadelig sein. Wie hätte er andere zurechtweisen können, wenn er selber der Zurechtweisungen bedurfte? Er sollte verheiratet sein und konnte nicht zwei Frauen haben, was nicht gemäss der göttlichen Ordnung war, eingesetzt bei der Schöpfung, aber gebräuchlich unter den Nationen und üblich bei den Juden, die eine Frau entliessen, die ihnen nicht geel, um eine andere zu nehmen.
Der Älteste sollte seiner eigenen Familie gottgemäss vorstehen (um Ältester zu sein, war es nötig, dass er Kinder hatte), wenn nicht, wie konnte ihm da die Aufsicht über die Versammlung anvertraut werden? Seine Kinder sollten gläubig sein.
Das setzte bei ihnen Bekehrung, Glauben, Gottseligkeit voraus. Es ging nicht an, dass seine Kinder der Ausschweifung angeklagt werden mussten, das heisst, der Unbeherrschtheit und des schlechten Lebenswandels. So war es einst bei den Söhnen Elis. Diese dienten ihrem Vater zum Fall, weil er nicht streng gegen sie war und seine Söhne mehr ehrte als Jehova. Daher hatten ihre Ausschweifungen über sie und ihren Vater ein schreckliches Gericht herabgezogen. Die Kinder der Ältesten sollten
nicht den Vorwurf der Zügellosigkeit auf sich laden, indem sie die Autorität ihres Vaters über sich missachteten. An diesen Wesenszügen konnte die Welt erkennen, dass in der Familie des Ältesten eine Gott gemässe Ordnung aufrechterhalten wurde.
Der 7. Vers stellt uns den Ältesten selbst bezüglich seiner inneren und persönlichen Eigenschaften vor. Wenn er in seinem Familienleben untadelig sein musste, so sollte er es auch als Verwalter Gottes sein. Er war weder gegenüber dem Apostel verantwortlich, der seine Einsetzung angeordnet, noch gegenüber Titus, der ihn angestellt hatte, sondern Gott gegenüber, der ihm die Verwaltung Seines
Hauses anvertraute. Wir nden hier also drei Grade in der Verwaltung: zuerst den Apostel, dann
Titus, sein Abgeordneter, dann den Ältesten, aber ihrer aller Verantwortlichkeit war gegenüber Gott
allein. Wie wichtig ist es, dies festzuhalten! Welches auch immer die Aufgabe sein mag, die Gott
uns anvertraut hat, wir sollen sie im Blick auf Ihn verrichten. Wie wir gesehen haben, sind die
Verwaltungen sehr verschiedenartig; ein Ältester konnte nicht übergreifen auf die Aufgabe des Titus,
noch ein Titus auf die des Apostels. Ein solches Handeln des einen oder des andern hätte verweriche
Selbstgefälligkeit und Unabhängigkeit bewiesen, die in diesen verschiedenen Verwaltungen zu einer
völligen Unordnung geführt hätte. Aber es blieb dabei nicht weniger wahr, dass die Verantwortung eines jeden – hier des Ältesten – vollständig und keineswegs abgeschwächt war gegenüber Gott, weil
er sich in einer untergeordneten Stellung befand. Hier war diese Verwaltung zweifellos äusserlich,
aber es gibt nichts Nebensächliches, wenn es sich um das Haus Gottes handelt.
Kapitel 1, Vers 7
Bezüglich der erforderlichen persönlichen Eigenschaften des Ältesten weist der Apostel zunächst auf
fünf negative Eigenschaften hin.
1. Er soll «nicht eigenmächtig» sein. Das Vorhandensein dieser ersten negativen Eigenschaft
ist leider nur zu häug unter den Kindern Gottes. Gewisse Geister kann man nie von ihrer
eigenen Meinung abbringen. Diesem Verhalten liegt viel Selbstzufriedenheit, Eigensinn und
eigentlich viel Selbstsucht und Hochmut zu Grunde, mit einem Eigenwillen, der sich den
Gedanken anderer nicht unterwerfen will, vergessend, dass gesagt ist: «Einander unterwürg
in der Furcht Christi» (Eph 5,21). Dieser Fehler allein schon macht einen Christen unfähig,
ein Aufseher zu sein, das heisst, das Haus Gottes weise zu verwalten; daher ist er in der Liste
der Dinge, die einen Bruder zum Ältesten ungeeignet machen, an erster Stelle. Eine gute
Verwaltung ist unmöglich ohne Selbstverleugnung.
2. Nicht zornmütig.» Ein jähzorniger Mann hat nicht die weise und ruhige Selbstbeherrschung.
Wie sollte er da andere leiten können?
3. «Nicht dem Wein ergeben.» Hier geht es nicht um einen Trunkenbold, von dem gesagt ist, dass
er das Reich Gottes nicht ererben werde, sondern um eine Gewohnheit der Unenthaltsamkeit,
verbunden mit Zorn, welche oft dessen Ursache ist.
4. «Nicht ein Schläger.» Schlagen ist die Folge von Zorn.
5. «Nicht schändlichem Gewinn nachgehend.»
1 Auch von den Diakonen oder Dienern wird in
1. Timotheus 3,8 gesagt: «nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend».
Der gleiche Ausdruck wird in 1. Petrus 5,2 auf die Ältesten angewandt: «Aufsicht nicht aus
Zwang, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig.» Es
ist schändlich, sein Amt als Aufseher im Blick darauf auszuüben, einen nanziellen Gewinn
daraus zu ziehen. Geld um des Geldes willen zu lieben, ist eine schreckliche Schlinge und
verleitet, es überall und mit allen Mitteln zu suchen.
Im achten Vers nden wir sieben positive Eigenschaften des Ältesten. Bevor ich sie aufzähle sei
darauf hingewiesen, dass nach 1. Timotheus 3,2–4 vierzehn Eigenschaften den Ältesten zieren sollen,
freilich mit negativen Eigenschaften vermischt. Dort ist die Liste also vollständiger als hier (sozusagen
zweimal vollkommen). Die Zahl 7 spielt im Worte Gottes im moralischen Sinn eine grosse Rolle und
sogar auch, wie einige bemerkt haben, in der rein äusserlichen Struktur der Heiligen Schrift. Sieben
ist die Zahl der Vollkommenheit in Verbindung mit der göttlichen Verwaltung. Im Timotheusbrief
ist das Amt der Ältesten durch die Zahl 14 gehoben, gegenüber den Funktionen der Diener und
Dienerinnen, von denen nur 7 Eigenschaften angeführt sind.
Treten wir jetzt auf die positiven Eigenschaften des Ältesten ein, die in Titus 1 aufgezählt sind.
1. «Gastfrei». Gastfreundschaft lässt sich nicht mit Gewinnsucht und Geiz vereinbaren. In
Hebräer 13,1.2 wird diese Gastfreundschaft allen Heiligen anempfohlen; sie habe oft dazu geführt,
göttliche Boten als Träger besonderer Segnungen zu beherbergen. Hier soll der Aufseher weder seine
Bequemlichkeit suchen, noch sich vor der Störung seiner Gewohnheiten fürchten. Sein Haus soll
allen oen stehen; es soll einladend sein in dem kleinen Kreise, der ein Bild ist von dem grossen
Bereich des Hauses Gottes, das die Ältesten örtlich verwalten.
2. «Das Gute liebend.» Das ist mehr als «das Böse hassen». Im letzteren Fall beschäftigt das Böse
die Gedanken, im Blick darauf, sich davon abzusondern; im ersten Fall aber sind sie mit dem Guten
beschäftigt, um es zu geniessen. Die unmittelbare Folge ist die, dass man sich mit den Menschen des
Guten verbindet und mit ihnen Gemeinschaft hat.
3. und 4. «Besonnen, gerecht.» Ein besonnener und gerechter Mann ist umsichtig, ausgeglichen, er
lässt sich nicht vom ersten Eindruck bestimmen und bewegen und weis die Umstände, in denen sich
die andern benden, gerecht abzuwägen.
1 Hier besteht die Schande nicht eigentlich in der Liebe zum Geld, die nach 1. Tim 3,3 beim Ältesten nicht sein darf,
sondern in der Liebe zum Gewinn, zu der die Geldliebe führt. Diese Gewinnsucht wird mit Recht als schändlich
bezeichnet, weil dabei heilige Funktionen, die kein anderes Motiv haben sollten als selbstlose Hingabe für das Haus
Gottes, zur Befriedigung niederer Begierden missbraucht und ausgenützt werden.
5. «Fromm» (heilig). Fromm sein heisst: heilig sein in seinem Wandel und Gott wohlgefällig in seinen
Wegen, ein Leben führen, worin Gott Mittelpunkt ist, ein durch Gott genährtes und geregeltes Leben.
6. «Enthaltsam.» So haben die eischlichen Leidenschaften keine Gelegenheit, sich zu oenbaren,
und die natürlichen Begierden sind unterdrückt.
7. «Anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre.» Die Aufgabe des Ältesten war, dem Worte
unerschütterlich anzuhangen und es aufrechtzuhalten. Es war das zuverlässige Wort, nach der Lehre
der Apostel, das nicht täuscht, auf das man sich unbedingt stützen kann, weil es das Wort des
treuen Gottes ist. Aber der Älteste konnte nicht im Ursprung der sein, «der da lehrt»; er war selber
unterwiesen worden durch die den Aposteln anvertraute Lehre, durch die gesunden Worte, die sie
mitzuteilen beauftragt waren, und diese Worte waren nichts anderes als die «von Gott eingegebene
Schrift», in den Mund der Apostel gelegt, und der Älteste musste sie daher festhalten. Die Lehre
war also nichts anderes als die volle Anerkennung des Wortes, denn sie war eins mit ihm. Das Wort,
vorgestellt durch schriftgetreue Unterweisung, gilt es festzuhalten, nicht eine Lehre, die man daraus
entwickelt.
Dieses Festhalten am Wort machte den Ältesten fähig, (die Treuen) mit der gesunden Lehre zu
ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen (die sich der christlichen Lehre widersetzen).
Die durch die Liebe zum Worte Gottes erworbene Fähigkeit war eines der Dinge, die der Älteste nötig
hatte. Wenn es darum geht, die Ordnung im Hause Gottes aufrechtzuhalten, genügen die sittlichen
Eigenschaften und der persönliche Wandel nicht. Zweifellos, wenn sie nicht vorhanden waren, so
bestand keinerlei moralische Autorität für die Verwaltung, aber es ist tatsächlich keine Verwaltung
möglich, wenn sie nicht das Wort zur Grundlage und zur Richtschnur hat.
Diese Dinge wurden von den Dienern, in 1. Timotheus 3,8–10, nicht verlangt, ausgenommen dieses,
dass sie «das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren» sollten. In diesem gleichen
Kapitel nden sich zwei Geheimnisse, das des Glaubens und das der Gottseligkeit «Das Geheimnis
des Glaubens» ist die Gesamtheit der Wahrheiten, die jetzt geoenbart, dem Glauben angehören. Es
brauchte für den einfachen Dienst eines Diakonen eine Vertrautheit mit den grossen Linien des Wortes,
die das Gewissen erreicht haben mussten, um darin bewahrt zu werden. Das gab dem bescheidensten
Dienst, wie dem die Tische bedienen, einen besonderen Wohlgeruch, aber es bereitete den Diener zu,
«voll Gnade und Kraft» zu sein, wie Stephanus, der dann berufen wurde, ein öentliches Zeugnis vor
der Welt abzulegen.
Die Verantwortung des Ältesten ist viel weitgehender als die der Diener, die übrigens im Titusbrief
nicht erwähnt sind, was leicht erklärlich ist: es war die Versammlung, welche die Diener wählte.
Jene Diener in Apostelgeschichte 6,3–5 wurden erst nachher durch die Apostel zu einem besonderen
Dienst eingesetzt. Um die Ordnung zu beaufsichtigen oder aufrechtzuhalten muss man oft ermahnen
oder die Widersprechenden überführen. Die Grundlage der Ermahnung selbst ist die gesunde Lehre,
und wir haben hier Gelegenheit festzustellen, was wir am Anfang sagten, dass praktische Heiligkeit
und ein gerader und gottseliger Wandel von der gesunden Lehre unzertrennlich sind und ohne diese
nicht bestehen können, was die Menschen auch immer sagen mögen. Durch diese allein auch können
die Widersprechenden zum Schweigen gebracht und gehindert werden, durch Widerstand gegen die
Wahrheit die Versammlung anzustecken.
Man sieht also, welche Wichtigkeit der Funktion des Aufsehers beigemessen wird, wenn auch die
Sphäre seines Dienstes auf die örtliche Versammlung begrenzt ist. Dieses Amt muss folglich den
lokalen Umständen der Versammlung angepasst sein, in welcher es ausgeübt wird. So war es, wie
wir noch sehen werden, in den Versammlungen in Kreta. Darum waren auch die erforderlichen
Eigenschaften der Ältesten hier nicht unbedingt die gleichen, wie in der ersten Epistel an Timotheus,
wo es sich um die Versammlung in Ephesus handelte.
Die Ältesten waren nicht Gaben des Heiligen Geistes, gekennzeichnet durch Allgemeinheit
(Universalität) ihrer Wirksamkeit, sondern ihre gewohnte Tätigkeit war das praktische Ergebnis eines
heiligen, gottseligen hingebenden Lebens, das am Worte festhielt. Aber das Amt des Ältesten schloss
die Gabe nicht aus, so wenig wie dies beim Amt des Dieners der Fall war. Das sehen wir aus der
wunderbaren Predigt des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Das nden wir auch in 1. Timotheus 5,17.
Aus dieser Stelle geht hervor, dass nicht alle Ältesten «in Wort und Lehre arbeiteten». Ihre Tätigkeit
auf diesem Gebiet wird als vortreiche Ausnahme bezeichnet, in bezug auf die Hilfe doppelter Ehre
würdig, in welcher Art ihnen diese auch immer geleistet werden sollte.
Kapitel 1, ab Vers 10
«Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen
man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes
willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt:,Kreter
sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.‘ Dieses Zeugnis ist wahr; um dieser Ursache
willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische
Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein;
den Beeckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern beeckt ist sowohl ihre Gesinnung als
auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind
greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werke unbewährt» (V. 10–16).
Die Verse 10–11 beschreiben die Widersprechenden in Vers 9, eine wahre Plage der Versammlungen
von Kreta. Sie haben drei Kennzeichen: 1. Auehnung. Indem sie keine über sie eingesetzte
Autorität dulden, lehnen sie sich dagegen auf und erheben sich gegen jede Aufsicht, die Gott zur
Aufrechterhaltung der Ordnung in Seinem Hause gegeben hat. 2. Zügellose Schwätzer. Oft genügt
eine gewisse Redegewandtheit, hinter welcher sich die geistliche und moralische Nichtigkeit dieser
Menschen verbirgt, um Christen anzuziehen, die unwissend, oberächlich oder weltlich sind, und
deshalb unfähig, die Absicht dieser Schwätzer zu erkennen. 3. Betrüger. Sie sind in Wirklichkeit
Instrumente Satans, dem Lügner im wahrsten Sinne des Wortes, um das Werk Gottes zu schädigen
und zu zerstören. Diese Werkzeuge fanden sich besonders unter denen aus der Beschneidung.
Es gibt nichts, was die religiöse Welt mehr verführt, als ein gesetzliches System, das sich auf die
vermeintliche Fähigkeit des Menschen stützt, Gutes zu tun. Die Lehre der absoluten Unfähigkeit des
sündigen Menschen ist diesen Gegnern zuwider. Man muss ihnen den Mund stopfen und nicht dulden,
dass sie die Lehre der Gnade und des Glaubens in der Versammlung angreifen und zerstören. Ihre
Tätigkeit kehrt ganze Häuser um. Man weiß, wie gefährlich die Autorität des Hauptes der Familie
ist, wenn er sich selbst mitreissen lässt und den falschen Lehrern und Verführern nachgibt, statt
zu widerstehen. Man hat sehen können, wie ganze Familien gesamthaft die gesunde Lehre der
Versammlung Gottes aufgaben, um zur gesetzlichen Belehrung zurückzukehren und dadurch neue
Werkzeuge des Zerfalls wurden, anstatt zur Auferbauung des Leibes Christi beizutragen.
Diese Leute lehrten, was sich nicht geziemt, im Widerspruch zur «gesunden Lehre» der Ältesten und
des Titus selbst, welcher ermahnt wurde (2,1), zu reden, was der gesunden Lehre geziemt. «Was sich
nicht geziemt», war das, was der moralischen Gesundheit der Christen unweigerlich schadete und
sie von Christo und der Wahrheit abzog. Man brauchte nur ihre Motive zu erkennen: sie lehrten um
schändlichen Gewinnes willen. Deshalb war es so wichtig, ihnen Älteste entgegen zu stellen, die Gott
gemäss ausgewählt wurden und nicht «schändlichem Gewinn nachgingen» (V. 7). Diese Männer
wussten, dass ihre verfälschte Ware dem Geschmack etlicher entsprach; sie machten sich das zunutze,
um irgendwie zu dem Geld zu kommen, das sie begehrten. Abraham hätte einen schändlichen Gewinn
gemacht, wenn er die Gaben des Königs von Sodom angenommen hätte; ebenso Petrus, wenn er das
Geld von Simon, der Zauberei trieb, genommen hätte.
Verse 12–14. Diese Schwätzer, und unter ihnen Angehörige des jüdischen Volkes, waren ursprünglich
von Kreta. Auch die Kreter hatten wie andereNationen ihre eigenen Propheten, Poeten und Moralisten,
die in ihren Werken ihre tiefe Verachtung für ihre Mitbürger zeigten. Zu diesem Urteil gelangen
die meisten klarsehenden Moralisten in der Welt, wenn sie sich zur Aufgabe stellen, die Menschen
zu erkennen. Sie schätzen sie schliesslich sehr gering ein, gehen aber nie so weit, sich selbst zu
verachten, weil sie sich nie vor Gott gesehen haben, um wie Hiob zu sagen: «Ich verabscheue mich.»
So hat Epimenides, Philosoph und Staatsmann, ihr eigener Prophet, in dem einzigen Bruchstück,
das uns, wenn ich nicht irre, von ihm geblieben ist, seine Mitbürger 600 Jahre vor Christo wie folgt
beurteilt: «Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.» Lüge, bestialische Bosheit
und Völlerei, Begierden, die sich ohne Arbeit und Mühe befriedigen wollen, das war der Charakter
der Kreter; so sind sie vielleicht noch heute. Dieses Zeugnis ist wahr, sagt der Apostel. Was die
Beurteilung seiner Mitbürger betrit, hatte jener Mann Gott gemäss gesprochen; er «besass die
Wahrheit» (Röm 1,18); er war ein von Gott anerkannter Zeuge der Verderbtheit der Kreter. Was
war im Hinblick auf diese Menschen zu tun? «Weise sie streng zurecht», sagt der Apostel zu seinem
treuen Beauftragten. In 2. Kor 13,10 nden wir den gleichen griechischen Ausdruck, wo Paulus davon
spricht, «Strenge zu gebrauchen nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat zur Auferbauung und
nicht zur Zerstörung». Es handelte sich somit darum, gegen die «Verführer» Strenge zu gebrauchen,
mit Gewalt, einer Funktion, die nicht den Ältesten anvertraut wurde, sondern Titus, bezeichnet durch
den Apostel, welcher selbst diese Autorität direkt vom Herrn empfangen hatte. Diese Strenge hatte
auch Paulus mehr als einmal gebraucht, selbst hinsichtlich des Petrus, wie er ein Apostel, als der
Glaube auf dem Spiel stand und die gesunde Lehre in Gefahr war. Aber der Tadel selbst, der sich an
diese zügellosen Schwätzer und Betrüger richtete, hatte die Liebe als Motiv. Sein Ziel war nicht, diese
störenden und gefährlichen Menschen zu verwerfen, sondern sie dazu zu führen, gesund im Glauben
zu sein. Diese Entfaltung geistlicher Autorität war notwendig, um sie zur Erkenntnis der durch den
Glauben empfangenen Wahrheiten zurückzuführen.2 Selbstverständlich wurde diese Autorität durch
den Gebrauch des Wortes Gottes in der Kraft des Geistes ausgeübt.
2 Das ist hier, wie in vielen anderen Stellen, der genaue Sinn des Wortes Glauben, während es sonst häuger gebraucht
wird, wie in Kap. 1,1, um den Zustand des Herzens zu bezeichnen.
Vers 14. «Nicht achten auf jüdische Fabeln.» Die «Fabeln» sind im ersten Brief an Timotheus (1,4)
erwähnt, wo sie von den «endlosen Geschlechtsregistern» unterschieden, aber doch damit verbunden
werden. Diese «Geschlechtsregister» haben keine Beziehung zu den Geschlechtsregistern im Alten
Testament, wie man geneigt wäre zu denken, sondern sind eine Mischung von jüdisch-spiritistischen
und philosophischen Spekulationen mit dem Christentum, hernach bei seinem Verfall durch das
Heidentum übernommen. Die jüdischen Fabeln, in 1. Tim 4,7 als «ungöttliche Fabeln» und AltweiberGeschichten bezeichnet,sind das Produkt orientalischer Einbildung, die sich auf die Schriften auswirkt
und unter dem Vorwand, die Wahrheit zu zieren, sie entstellt und sogar zunichte macht. Der Apostel
Petrus nennt sie «künstlich erdichtete Fabeln» (2. Petrus 1,16).3
In unserem Abschnitt wird zwischen jüdischen Fabeln und «Geboten von Menschen» unterschieden,
obwohl die einen wie die andern von «denen aus der Beschneidung» kamen. Die Gebote, von denen
hier die Rede ist, sind nicht die Gebote des Gesetzes, die Gott gegeben hatte, sondern durch Menschen
erfundene und zur Tradition erhobene gesetzliche Vorschriften, deren es im Judentum eine Fülle gibt.
Man begegnet ihnen häug in den Evangelien, wie beispielsweise dem Waschen der Becher und
Krüge und «vielen andern ähnlichen Dingen». Durch diese Dinge wandten sich solche Menschen von
der Wahrheit ab. Sie waren im krassen Gegensatz zum Apostelamt des Paulus, das auf der «Erkenntnis
der Wahrheit» beruhte (1.1).
Vers 15. «Den Reinen ist alles rein.» Der Christ ist rein, nicht in sich selbst, aber vor Gott, auf Grund
des Werkes Christi und unter der Wirkung des Heiligen Geistes(1. Kor 6,11). Alssolcher kann er durch
Schmutz nicht beeckt werden, und genau das war es, was diese Anhänger der jüdischen Lehren
durch ihre «Gebote von Menschen» verneinten, während das Wort Gottes den neuen Menschen
auordert, in den Fussstapfen Jesu zu wandeln. Nie konnte der Herr beeckt werden, weder durch den
Schmutz des Aussatzes noch durch irgend eine andere Unreinheit. Eine Sünderin, eine Ehebrecherin
konnten durch Ihn gereinigt werden, aber Er wurde durch sie nicht beeckt. Im Gegenteil, «die
Beeckten und die Ungläubigen» werden durch keine Reinheit beeinusst, denn es ist das Innere,
d. h. «ihre Gesinnung und ihr Gewissen», die beeckt sind.
In Vers 16 wird uns der Charakter dieser beeckten Menschen beschrieben: dem Bekenntnis nach
kennen sie Gott, während ihre Werke das Gegenteil zeigen; durch diese verleugnen sie Gott. Ihre Werke
lassen uns erkennen, ob sie Gott wirklich kennen, wie sie behaupten; und wenn ihre Werke böse
sind, können wir in dieser Frage sicher sein. Man kann von ihnen kein gutes Werk erwarten. Sie sind
«unbewährt», in dieser Hinsicht gänzlich von Gott verworfen; sie sind» greulich und ungehorsam».
Das führt uns dazu, den Charakter der guten Werke zu betrachten. Sie werden in diesem kurzen Brief
sechsmal erwähnt (1,16; 2,7.14; 3,1.8.14).
Eine Lehre, die nicht zu guten Werken führt, ist nicht die «gesunde Lehre», und es ist äusserst
wichtig, diesen Punkt zu beachten. Gott ist keine praktische Tätigkeit wohlgefällig, wenn sie nicht
3 Die endlosen Geschlechtsregister sind erdichtete Vorstellungen über den Ursprung und die Anfänge der geistigen
Wesen. Sie sind das Produkt jüdischen Aberglaubens, verbunden mit der heidnischen Philosophie. Diese Kabale oder
jüdische Überlieferung über die Auslegung des Alten Testaments enthält viele märchenhafte Bestätigungen bezüglich
dieser «Anfänge». Gemäss der Kabale gibt es zehn «Sephiroth» oder Anfänge, die von Gott herrühren sollen. Sie
scheinen die Äonen der Gnostiker veranlasst zu haben. Auf diese Theorie wurde ein System der Magie gepfropft, das
vor allem im Gebrauch von Wörtern der Schrift bestand, um übernatürliche Wirkungen zu erzeugen.
die «gesunde Lehre» des Wortes als Grundlage hat. Der erste Brief an Timotheus, der uns von der
Aufrechterhaltung der «gesunden Lehre» im Hause Gottes spricht, erwähnt die guten Werke ebenso
oft (2,10; 3,1; 5,10.25; 6,18). In einem wichtigen Abschnitt des zweiten Briefes an Timotheus (2,21)
wird uns gezeigt, dass man sich «zu jedem guten Werke zubereitet», wenn man sich vom Bösen im
Hause Gottes reinigt, d. h. absondert. Nun wird aber diese Wahrheit von den lieben Kindern Gottes
wenig verstanden. Sie sprechen bei jeder Gelegenheit von guten Werken, ohne je das getan zu haben,
was allein sie dazu vorbereiten kann: sich von den Gefässen zur Unehre reinigen. Die guten Werke
haben als Merkmal, dass sie das Ergebnis der Heiligkeit und der Liebe sind. Jesus, der «heilige Knecht
Gottes», der mit «heiligem Geiste gesalbt» worden war, ging wohltuend von Ort zu Ort (Apg 10,38).
Es gab nicht eines der «guten Werke, die Er den Menschen von Seinem Vater zeigte», das nicht ein
Werk der Liebe gewesen wäre. So war es auch bei Seinen Jüngern. Dorkas war «voll dieser guten
Werke». Die Liebe war die innere Triebkraft all ihrer Tätigkeit. In Heb 10,24 kommen die guten
Werke aus der Liebe hervor; sie sind nicht davon zu trennen. So ist es auch mit jenen der heiligen
Witwen in 1. Tim 5,10.
Nach Epheser 2,10 ist der Christ geschaen in Christo Jesu zu guten Werken, aber nicht, um sie nach
seinem Gutdünken zu wählen; denn Gott selbst hat sie «zuvor bereitet», und wir haben nur darin zu
wandeln. Gemäss Heb 13,21 haben sie zum Ziel, Seinen Willen zu tun und ihm wohlgefällig zu sein.
Diese guten Werke, von Gott vorbereitet – nicht durch uns, was ihnen den ganzen Wert nehmen
würde –, haben das Merkmal, dasssie im Namen Jesu Christi getan werden (Apg 4,9–10). Sie geschehen
an Jesus (Markus 14,6), an den Heiligen (Apg 9,36) und an allen Menschen (Gal 6,10), aber sollen immer
für Christum getan werden.
Die Welt kann nichts verstehen von den guten Werken, die für Christus getan werden, denn nicht
nur kennt sie den Herrn nicht, sondern sie ist Sein Feind. Die Salbe der Maria ist Torheit in ihren
Augen; die göttliche Liebe, die das Herz des Gläubigen einerseits zu den Heiligen und anderseits zu
den Verlorenen in der Welt treibt, ist für den natürlichen Menschen toter Buchstabe.
Im Gegensatz zu den guten Werken haben die bösen Werke das Böse als Ursprung und zum Ziel.
Ein Christ, selbst der vorzüglichste, ist in dieser Hinsicht in Gefahr und hat nötig, von jedem bösen
Werke bewahrt zu bleiben (2. Tim 4,18). Die bösen Werke kennzeichnen gewöhnlich die Feinde Gottes
(Kol 1,21).
Die toten Werke sind das Gegenteil der lebendigen Werke. Sie haben nicht das göttliche Leben zum
Ursprung. Sie werden nicht «böse Werke» genannt, aber sie haben keinen Wert für Gott, und da
sie die sündige Natur als Ausgangspunkt haben, ist es notwendig, von ihnen gereinigt zu werden
(Heb 6,1; 9,14). So gut wie die bösen Werke werden sie Gegenstand der Verurteilung sein, die vor
dem grossen weissen Thron über die Menschen ausgesprochen wird.
Wenn es sich um die gute Ordnung im Hause Gottes handelt, so erkennt man sie an den guten
Werken derer, die zu diesem Haus gehören, und nicht an ihrem Bekenntnis. Das Bekenntnis hindert
die Personen, die im 16. Vers unseres Kapitels erwähnt werden, nicht, «greulich und ungehorsam»
zu sein. Gott nahm nicht nur ihr Bekenntnis nicht an, sondern verwarf auch sie selbst.
Kapitel 2
«Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt: dass die alten Männer nüchtern seien, würdig,
besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren; die alten Frauen desgleichen in ihrem
Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem
Wein, Lehrerinnen des Guten; auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre
Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern
unterwürg zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen
ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst;
in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der
von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte
ermahne, ihren eigenen Herren unterwürg zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht
widerprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, auf dass sie die Lehre, die
unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem» (V. 1–10).
«Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt.» Wie wir bereits darauf aufmerksam gemacht haben, ist
jede Ordnung im Hause Gottes, alle christlichen Beziehungen der Glieder dieses Hauses untereinander,
auf die «gesunde Lehre» gegründet, die in der Versammlung gelehrt und festgehalten wird, und
ohne diese gibt es nur Verwirrung und Unordnung. Erklärt dies nicht zu einem grossen Teil die
Abweichungen der Christenheit in den Dingen, womit sich der Titusbrief besonders auseinandersetzt:
bezüglich der Gaben und Ämter, der Rolle der alten Männer und des Platzes der Frauen, alt oder jung,
der Beziehungen der Knechte zu ihren Herren?
Es gibt Dinge, die der gesunden Lehre nicht geziemen, und diese Dinge könnten im Worte Gottes nie
Unterstützung nden. Eine Lehre, wie erhaben sie auch in den Augen der Menschen sein mag, wäre
nicht gesund, wenn sie die Christen nicht anspornen würde zu einem Leben der Heiligkeit und der
praktischen Gerechtigkeit, das den Herrn ehrt. Diese Lehre betrit alle Klassen der Familie Gottes,
aber wir müssen sie vor allem auf uns selbst anwenden, in unserem Leben, unserem Wandel und
unserer Honung.
Die Gesundheit des Körpers ist immer mit dem Gleichgewicht seiner verschiedenen Teile verbunden;
so betreen auch die Dinge, die Titus lehren musste, alle Klassen derer, die zum Leib des Christus
und zum Hause Gottes gehören.
Wie es sich gehört, beginnt der Apostel bei den alten Männern, die eine ehrwürdige Stellung
einnehmen, und deshalb besonders verantwortlich sind, in der Familie Gottes ein Beispiel zu
geben: «dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im
Ausharren» (V. 2). Nüchtern (nephalios) hat gewöhnlich eine Beziehung zu Getränken oder anderen
Nahrungsmitteln. So mangelte es bei Isaak in seinen alten Tagen an Nüchternheit, was, zusätzlich zu
den Gebrechen seines Alters, seine geistliche Sicht trübte. Hier jedoch, wie im 1. Timotheus-Brief,
geht es mehr um Nüchternheit im bildlichen Sinn, um einen Geist, der sich nicht durch Leidenschaft
berauschen lässt, weil er sich der Gegenwart Gottes bewusst ist. Gesund im Glauben: Ihre moralische
Gesundheit sollte sich im verständnisvollen Erfassen der Gegenstände des Glaubens zeigen, die
eine gesunde Lehre ihnen vorgestellt hatte, denn mit Glauben ist hier nicht die Aufnahme des
göttlichen Zeugnisses in der Seele, sondern die Wahrheiten, welche das Wort Gottes dem Glauben
vorstellt, gemeint. Wie wir bereits gesagt haben, setzt die Gesundheit ein gutes Gleichgewicht in
allen Dingen voraus. Der erfahrene Christ muss Sorge tragen, dass er in der Belehrung nicht auf
gewisse Dinge, unter denen die den Glauben ausmachen, ein unverhältnismässiges Gewicht legt.
Um nur die wichtigsten Dinge zu nennen, könnte man zum Beispiel den ganzen Akzent auf die
himmlische Stellung des Christen legen, ohne auf seinem Wandel und seinem Betragen zu bestehen,
oder umgekehrt.
Gesund in der Liebe. Das gleiche geistliche Gleichgewicht muss sich in der Bruderliebe zeigen.
Unterschiede zu machen, oder gewissen Gliedern des Hauses Gottes gegenüber andern den Vorzug zu
geben (es handelt sich hier nicht um die Liebe für Christum, die selbstverständlich keine Abmessung
erlaubt), das ist nicht gesund sein in der Liebe.
Gesund im Ausharren. Hier könnte sich der Mangel an Gesundheit in einer gewissen Gleichgültigkeit
in der Prüfung zeigen was bei alten Männern oft der Fall ist – oder in einer gewissen Abstumpfung
gegenüber dem nahen Kommen des Herrn.
All das, zusammen mit Würde und Besonnenheit [Der Ausdruck besonnen in den Versen 2,5,6 und 12
könnte übersetzt werden roh: sich selbst mässigen und in der Gewalt haben.] gibt den Eindruck von
grosser Ausgeglichenheit im praktischen Leben der alten Männer und könnte nicht verwirklicht
werden ohne die Nüchternheit, welche die Grundlage ihres ganzen Betragens bilden muss. Auf diese
Weise werden sie zu erfahrenen Männern, bei denen man Rat holt, und die zum Wohlbenden und
zur guten Ordnung der ganzen Familie Gottes beitragen.
«Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt.»
Sie müssen in allen Dingen, in ihrem Wesen, ihrer Erscheinung, ihrem Äusseren, eine passende
Haltung einnehmen, der besondere Schmuck der Frau; aber diese Haltung muss den Charakter
innerer Heiligkeit widerspiegeln. Diese Ermahnung ist in Übereinstimmung mit dem, was uns in
1. Tim 2,9–10 und 1. Pet 3,2–5 von der christlichen Frau gesagt wird. Das Fehlen jeglichen weltlichen
Einusses soll sie in erster Linie charakterisieren.
Nicht verleumderisch. Sie müssen ihre Zunge im Zaum halten, übles Nachreden über den Nächsten
vermeiden – eine besonders gefährliche Falle für ihr Geschlecht.
Nicht Sklavinnen von vielem Wein. Das ist eine Gefahr für alte Frauen, welche im Hinblick auf ihre
abnehmende Gesundheit zu diesem Mittel Zuucht nehmen, Wenn sie nicht genügend achtgeben auf
sich selbst, verfallen sie in diese Sklaverei, deren der Feind sich zu ihrem moralischen Schaden bedient
und um sie daran zu hindern, einen heilsamen Einuss auf ihre Umgebung auszuüben. Eine solche
Gebundenheit ist um so gefährlicher für die Frau, als ihr Gewissen ihr zeigen wird, wie unpassend
solche Gewohnheiten sind und sie deshalb versuchen wird, diese zu verbergen. So verfällt sie in
Heuchelei.
Es besteht ein kleiner Unterschied zwischen Sklavinnen sein und dem Wein ergeben sein, wie uns
von den Aufsehern und Dienern in 1. Tim 3,3.8 gesagt wird. Ergeben bezeichnet vielleicht eine
Neigung, die man nicht zu verbergen sucht, etwas ganz anderes, als sich berauschen (Eph 5,18), was
eine Entwürdigung ist. In 1. Tim 3,8 ist das kleine Wort «vielem», das bei den Aufsehern in V. 3 fehlt,
bei den Dienern hinzugefügt. Dieses kleine Wort lehrt uns folgendes: je wichtiger die Funktionen im
Hause Gottes, um so grösser die Verantwortung, alles zu meiden, was einer gesunden Einschätzung
alles dessen, was die Verwaltung des Hauses Gottes betrit, hinderlich sein könnte.
Lehrerinnen des Guten; auf dass sie die jungen Frauen unterweisen. . . Hier sind es die alten Frauen, die
lehren sollen. Sie lehren in dem einzigen Bereich, worin die Frau es tun soll: im Hause. Sie müssen das
Gute lehren, was sich geziemt, aber nie Männer unterweisen. Ihr Tätigkeitsbereich im Hause ist viel
mannigfaltiger als das Lehren, denn er kann sich auf alle beziehen, auf Männer, alte Leute, Frauen
und Kinder, Kranke, Arme, Ausgestossene; aber wenn es sich um das Lehren handelt, ist es auf die
Frauen beschränkt. «Ich erlaube aber einem Weibe nicht, zu lehren», sagt der Apostel, «noch über
den Mann zu herrschen, sondern still zu sein» (1. Tim 2,12). Das Lehren der alten Frauen hat zum
Ziel, dass die jungen Frauen in ihrem Leben ein vollständiges Zeugnis von der Belehrung des Wortes
darstellen. Mit dem Wort «vollständig» spielen wir an auf die nachfolgenden sieben Ermahnungen
an die jungen Frauen.
Die Zahl sieben kommt immer wieder vor in diesem Brief, und wir haben schon davon gesprochen.
Sie bedeutet im Worte immer etwas Vollständiges, sei es gut oder böse, auf geistlichem Gebiet.
Kapitel 2, ab Vers 4
Die jungen Frauen sollen also unterwiesen werden, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,
besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürg zu sein,
auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Belehrung an die jungen Frauen empehlt in erster
Linie «zu lieben», vorab Liebe zu üben im engsten Familienkreis. Der Ehemann hat den ersten Platz
in der rechtmässigen Zuneigung der Frau. Es kann in der christlichen Familie vorkommen, dass die
Liebe der Frau zu ihren Kindern den Vorrang hat, was dann die Liebe, die sie ihrem Mann schuldig
ist, unterdrückt. Die gesunde Unterweisung stellt alles an seinen Platz.
Besonnen sein. Dieses Wort bedeutet Mässigung, Bescheidenheit, Zurückhaltung, Selbstbeherrschung.
Mangel an Zurückhaltung, selbst in den rechtmässigsten Zuneigungen, könnte in der Tat vorkommen,
und das könnte den Gott gemässen Charakter der Zuneigungen in der Familie gefährden. Keusch. Die
Keuschheit ist die notwendige Begleitung und die Folge der Zurückhaltung; denn es handelt sich hier
um die Beziehungen der jungen Frau im intimsten Kreis. Die eischliche Leidenschaft gegenüber
ihrem Mann hat darin keinen Platz; und gegenüber den Kindern ist eine strenge Überwachung
notwendig, damit keine unreine Neigung geduldet wird.
Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Das Haus ist, wie wir gesagt haben, der Bereich, welcher der
Frau zugeteilt ist. Dieser Bereich ist unendlich mannigfaltig, aber untersagt der christlichen Frau
absolut, in den öentlichen Bereich einzugreifen. Sie würde dadurch (und wie oft ist das leider
heutzutage der Fall!) ihren eigentlichen Charakter, nach den Grundsätzen der Regierung Gottes,
verlieren. Überall da, wo es sich um das Haus handelt, und zwar im weitesten Sinn dieses Wortes, hat
die Frau somit ihren Platz: zeitliche und geistliche Fürsorge, Gebet, Lesen des Wortes, Ermahnung,
Evangelisation, sogar Belehrung, (z. B. Apg 18,26), wenn sie dabei nicht über ihre Grenzen hinausgeht,
geistige und materielle Ordnung, Wohltätigkeit, Sorge um alte Leute, Kinder, Kranke und noch
vieles andere, all das gehört zum Wirkungsbereich der Frau. In unserem Abschnitt handelt es sich
für die jungen Frauen vor allem um die Fürsorge in ihrem eigenen Haus. Ihr Wirkungskreis wird
sich mit zunehmendem Alter erweitern, ebenso wie der Kreis des jungen Mannes. Wir haben darin
ein Beispiel in den heiligen Frauen, die dem Herrn nachfolgten und ihm dienten mit ihrer Habe
(Lukas 8,1–3). Die «häuslichen Arbeiten» beziehen sich hier auf materielle Fürsorge, und wir haben
eben gesehen, dass diese nicht vor allen andern den Vorrang haben; aber vom christlichen Standpunkt
aus gesehen, sind sie keineswegs unwichtig. Die Ordnung im Hause Gottes lässt keine Unordnung im
Hause Seiner Kinder zu. Es gibt eine Gott gemässe Ordnung, welcher sich Kinder und Dienstboten,
unter der Leitung der Frau, unterwerfen müssen; in diesem verkleinerten Bereich des Hauses Gottes
gilt es Ordnung zu halten, auszuteilen, Kleider auszubessern. für Nahrung und die verschiedenen
Bedürfnisse aller besorgt zu sein. In allen diesen Dingen ist uns das wackere Weib der Sprüche als
Vorbild gegeben (Sprüche 31,10–31).
Gütig. Die Güte erweist sich in Mitleid, Aufopferung und Hilfsbereitschaft für andere und wird hier
angeführt als Mittel gegen den Egoismus, der durch die Sorge um das eigene Haus hervorgebracht
werden könnte. Die Güte wendet sich in der Tat an alle, ohne Unterschied, und ist bemüht ihnen zu
helfen. Den eigenen Männern unterwürg. Die Unterwerfung kommt an letzter Stelle, sozusagen als
Krönung der Eigenschaften der jungen Frau. Diese schöne Ausgeglichenheit in allen Dingen kann
nicht bestehen ohne Selbstverleugnung und Abhängigkeit von der Autorität, welcher die Frau von
seiten Gottes unterstellt ist. Das heisst für sie, sozusagen, durch Vermittlung des Mannes, welcher
das Haupt der Frau ist, Gott unterwürg sein, welchem er selbst unterworfen ist.
Alle diese Dinge zusammengefügt verhindern, dass die Frau eine dieser Eigenschaften überbetont,
zum Nachteil des christlichen Lebens, wie im Fall von Martha, die «besorgt um viele Dinge» im
Hause, die Gemeinschaft mit dem Herrn und Seinem Wort vernachlässigte. In einem Wort, diese
Zusammenfügung ist es, was der Frau die Kraft gibt, das Gleichgewicht in allen Teilen ihres Zeugnisses
zu bewahren.
Auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Wie wir hier sehen, gehört diese ganze Ordnung,
selbst die materielle, zum christlichen Zeugnis. Die Welt, die sie sieht, ndet so keinen Anlass, wegen
Unordnung im christlichen Haus das Wort Gottes zu verlästern, indem sie dieses für das Böse
verantwortlich macht. Die Autorität des Wortes kann nicht in Frage gezogen werden, wenn man
dessen Früchte sieht. So sehen wir in diesem Kapitel die grosse Wahrheit immer wiederkehren, dass
die gesunde Lehre die Basis der ganzen Praxis des christlichen Lebens bildet.
Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein. Die Jünglinge zu ermahnen ist keinesfalls die
Aufgabe der alten Frauen, sondern ist Titus anvertraut. Die einzige Ermahnung, die den Jünglingen
gegeben wird (im Gegensatz zu den sieben Ermahnungen an die jungen Frauen) ist Besonnenheit,
d. h. gesunder Sinn, Selbstzucht (siehe Fussnote zu 2. Tim 1,7), denn, wie wir sehen werden, hatten sie
in allen Dingen Titus und seinen Wandel in ihrer Mitte zum Vorbild. Deshalb wird von ihm gesagt:
indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Nichts durfte fehlen, und das wollte
viel heissen, im praktischen Leben des Abgeordneten des Paulus. Wir haben uns schon weitgehend
damit befasst, was «die guten Werke» bedeuten. Sie sind die sichtbaren Kennzeichen des Glaubens
und der Liebe, wie wir es in 1. Thess. 1,3 sehen. Die Ermahnungen des Titus, der selbst jung war,
an die Jünglinge mussten von seinem eigenen Beispiel begleitet sein; ohne dieses wären sie wertlos
gewesen. Aber nebst diesem Beispiel war er dazu berufen zu lehren:
In der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der
Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat.
Die Lehre des Titus musste drei Merkmale haben:
1. Unverderbtheit in der Lehre. Es ist wichtig, dass die Lehre nicht mit zweifelhaften und fremden
Elementen vermischt wird, Diese schlechten Zusätze könnten die Hörer dazu führen, die
gesunden Teile der Lehre zu verwerfen, oder das Ganze ohne Unterscheidungsvermögen
anzunehmen und selbst zu Verbreitern des Irrtums zu werden. Je weniger die Autorität dessen,
der die Lehre bringt, bestritten ist, um so ernster ist die zuletzt erwähnte Gefahr.
2. Würdiger Ernst in der Lehre. Diese Eigenschaft fehlt heute oft in der Predigt, in der man, um die
Aufmerksamkeit anzuziehen, versucht, Eindruck zu erzeugen, die Einbildung anzusprechen,
die Neugier zu wecken. Solche Gewohnheiten, derart leichtfertige oder unpassende Worte,
zerstören die heilsame Wirkung der Wahrheit und nehmen ihr den göttlichen Charakter. Sie
machen den Redner ungeeignet, und er verliert so das Recht, ein «Ausspruch Gottes» für die
Hörer zu sein.
3. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Wer lehrt, wird immer Kritiker haben, und zwar häug in
den Reihen treuer Brüder, die seine Worte genau überprüfen, um Unrichtiges als Widerspruch
zur gesunden Lehre zu verurteilen. Der «Lehrer» soll keinen Anlass zum Widerspruch geben.
Worte, die zu wenig abgewogen und nicht wohlbegründet sind, kommen oft aus dem Wunsch,
Neuheiten zu bringen, die den Redner hervorheben. Derartige Aussprüche werden zu einer
Wae in der Hand Übelgesinnter, um den, der lehrt, anzugreifen und blosszustellen. Wenn sein
Wort «gesund» ist, so hat es Kraft in sich; man verurteilt kein Heilmittel, das denen, die es
nehmen, Gesundheit bringt. Wer unser Reden angreift, ist dann gezwungen, sich beschämt
zurückzuziehen, ohne einen annehmbaren Vorwand zum Widerspruch gefunden zu haben.
Die Gnade Gottes unterweist uns. . .
Henri Rossier
Die Gnade Gottes unterweist uns. . . (H.R.) Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kapitel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kapitel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bibelstellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Roy Kristina, Die zweite Frau

Die zweite Frau Kristina Roy :
Die Erzählung „Die zweite Frau“ wurde bereits vor einiger Zeit geschrieben, als das slowakische Volk noch unter ungarischer Herrschaft sich nach einem freien Vaterland sehnte. Wenn auch das in den von der Kultur weniger berührten Gegenden und in den abgelegenen Bergtälern dahinlebende schlichte Volk seine Sprache und die angestammten Sitten bewahrte, so war es für die slowakischen Patrioten eine bittere Tragik, dass die aufstrebende Jugend und die slowakische Intelligenz fast ganz dem heimatlichen Brauchtum entfremdet wurde, ja, ihm zum großen Teil für immer verloren ging. Aber dass auch die Erlangung der nationalen Befreiung einem seit Jahrhunderten unter fremdem Druck gestandenen Volk noch lange nicht das ersehnte Lebensglück bringt, dass selbst neben kulturellem und wirtschaftlichem Wiederaufstieg doch in erster Linie die sittlich-religiöse Erneuerung des Einzelnen und dann aller erst ein Volk wahrhaft frei und froh machen kann, diese Wahrheit immer wieder zu bezeugen, hat K. Roy sich als Lebensaufgabe gestellt.
In der vorliegenden Erzählung zeigt die Verfasserin, wie ein lieber junger Mensch, die zweite Frau des verbitterten Bauern, in seine verwahrloste Familie Sonnenschein und neues Leben hineinträgt, wie es ihr durch Umsicht und Fleiß gelingt, das verschuldete Anwesen wieder hochzubringen, und wie die junge Frau dann selber die frohe Botschaft von dem neuen Leben aus Gott vernimmt und sich ihr aufschließt, und daraufhin ihrer Familie und ihrer Umgebung eine Segensbringerin werden darf. Wäre nicht auch bei uns so mancherlei offene und geheime Not im Familienleben und auf wirtschaftlichem Gebiet, und hätten wir es heute nicht mehr nötig, die Botschaft von der suchenden, vergebenden und ein verfehltes Leben erneuernden Gottesgnade immer wieder zu hören, dann hätte diese schlichte Erzählung uns vielleicht nicht viel zu sagen. So aber hoffen die Herausgeber, dass das Buch auch bei uns den Dienst tun darf, den es in seiner slowakischen Heimat ausrichten durfte: mitzuhelfen, den Einzelnen und die Familie zu frohen und fruchtbaren Segensträgern zu machen.
„Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Das musste auch Martin Mras erfahren. Als er nach dem Tode seiner Frau nicht gleich wieder geheiratet hatte, da waren alle Muhmen und Basen sehr besorgt um ihn gewesen, was aus seinen unversorgten Kindern werden sollte, wenn er ihnen nicht alsbald eine neue Mutter und dem Hof eine Bäuerin zuführen wollte. Allerdings hatte eine jede von ihnen hinzugefügt, dass sie ihm wahrlich nicht ihre Tochter zur Frau geben würde, denn seine Kinder wären die ungezogensten des ganzen Dorfes, von dem ältesten, fünfzehnjährigen Schlingel bis zu dem kleinsten Schreihals. Ja, sagten sie, auch Betka Mras hätte noch gar nicht sterben müssen, wenn nicht erst die Schwiegermutter und dann der Mann sie so gequält hätten. Andere meinten zwar, dass auch er genug zu tragen gehabt hätte, und namentlich die Männer, die ihn verteidigten, behaupteten, er hätte sich die ewige Seligkeit verdient, weil er es sechzehn Jahre mit einer solchen Frau ausgehalten habe. Als aber an den letzten drei Sonntagen der Herr Pfarrer Martin Mras mit einer gewissen Ilenka Ozorovska aus Malotin aufgeboten hatte, da war es in der Kirche mäuschenstill gewesen; sogar die Frauen, die sonst meistens die Hälfte der Predigt verschliefen, brauchten plötzlich keine Riechsträußchen mehr, so sehr war ihnen alle Schläfrigkeit vergangen. Wer konnte das nur sein? Eine Fremde brachte er her – als ob es nicht genug Witwen und ältere Mädchen in Zaluschanie gäbe!
Aber freilich, ob sich unter ihnen wohl eine gefunden hätte, die ihn genommen hätte? Er war eben schlau, er ging hübsch weit über Land, wo ihn die Leute nicht kannten und wo niemand seiner Erwählten erzählen konnte, dass er seit jenem Brand bis über die Ohren in Schulden steckte und dass er zudem ein unleidlicher Mensch war, der mit seiner ganzen Verwandtschaft in Unfrieden lebte.
„Ich beneide sie nicht“, erklärte die Müllerin. „Aber es wird doch wohl jemand kommen, um die Wirtschaft zu besehen, in die sie hineingerät.“ Allein es kam niemand, und am Dienstag nach dem letzten Aufgebot erwartete die alte Tante Katuscha, die seit dem Tod der ersten Frau den Haushalt führte, den Bauern und die neue Bäuerin. „Arme Katuscha!“, bedauerten sie die Frauen. „Nachdem ihr euch jahrelang in diesem Haus gequält habt, wird es euch auf eure alten Tage schwer fallen, einer Fremden zu gehorchen. Die selige Bäuerin hat euch wie eine Mutter gehalten, jetzt werdet ihr nur noch eine Dienstmagd sein.“ Aber Tante Katuscha erklärte, dass der Bauer sich sehr irre, wenn er glaube, dass er ihr das bieten dürfe.
Er habe ihr nicht einmal gesagt, wen er da nehme, noch wann die neue Bäuerin ankomme. Aber sie wollte es ihm zeigen; sie wollte weder die Kinder noch das Hauswesen in Ordnung bringen, und wenn ihr das Vieh nicht Leid täte, dann würde sie heute noch gehen. So müsse sie eben die Ankunft der neuen Bäuerin abwarten, aber sowie dieselbe die Schwelle des Hauses betrete, würde sie dasselbe verlassen. Das war etwas für die schadenfrohen Weiber. Die Alte ließ wirklich alles, wie es lag und stand. Den Kindern hatte sie eine gute Suppe gekocht, damit sie doch auch wüssten, dass ihr Vater Hochzeit hätte.
Dabei erzählte sie ihnen, was sie bei der Stiefmutter würden zu erwarten haben. Sie verstand es, in den Kinderherzen Zorn und Hass gegen die Fremde zu erwecken, die heute ins Haus kommen sollte. Sie gedachten auch an die Worte ihres Vaters: „Ich will mich nicht länger mit euch ungezogenen Kindern ärgern. Ich bringe euch einen Zuchtmeister! Wehe dem, der nicht gehorcht!“ Palko Mras hatte sich schon damals vorgenommen, sich lieber von seinem Vater erschlagen zu lassen, als der Stiefmutter zu gehorchen – und wenn diese es wagen würde, ihn zu schlagen, dann wollte er ihr einen Denkzettel geben. Annitschka Mras versicherte, Tante Zaluschanska habe ihr gesagt, sie möge nur zu ihr kommen, wenn die Stiefmutter sie schlagen wolle. Joschko drohte, er würde sie beißen, und zwar feste! Die kleine sechsjährige Betka nahm sich vor, sie wollte, wenn man sie nur mit einem Finger anrührte, ein Geschrei erheben, dass alle Nachbarn zusammenlaufen sollten. Nun war nur noch der kleine dreijährige Andrischko übrig. Der sagte zwar nichts, aber in seinem kleinen Herzen war so viel Angst, die aus den großen tief liegenden Augen blickte.
„Ei, die wird auf Rosen gebettet sein“, lachten die boshaften Weiber. Sie gönnten es dem fremden Eindringling von Herzen; denn wenn auch keine von ihnen den finster blickenden Mras gemocht hätte, so wurmte es sie doch, dass er keine von ihnen begehrt, dass er sie verachtet hatte. Ja, den Leuten kann man es nicht recht machen.
Es war ein finsterer Oktoberabend. Der Wind brach die mit Früchten beladenen Äste von den Obstbäumen, als in Mrasens Hof der Wagen hielt. Der Bauer stieg ab und reichte wortlos der Frau die Hand, die mit solchen Hass- und Angstgefühlen erwartet wurde. Beim Schein der Laterne sah Tante Katuscha, wie sich in dem Wagen eine hohe, schlanke Gestalt aufrichtete, die leichtfüßig von dem hohen Leiterwagen herabsprang. „Geben Sie das Licht näher!“, befahl Mras.„Solch eine Junge bringt er daher“, dachte die mürrische Alte. „Die könnte seine Tochter sein.“ Ach, es war ein trauriger Empfang für die junge Frau. Kein Mensch hieß sie willkommen.
Die Kinder kamen zwar herbei, als der Vater nach ihnen rief. Joschko spannte die Pferde aus, Palko half die Truhe, Annchen die Körbe abladen, Betka nahm die Tücher, aber keines sagte ein Wort des Grußes. Da Mras seine Frau den Kindern nicht vorstellte, konnte auch sie sich ihnen nicht gut nähern. Etwas später waren alle in der ungefegten, unordentlichen Küche beisammen. Jetzt, wo auch alles, was man vom Wagen abgeladen, darin herumlag und herumstand, sah es aus wie in einem Stall. Die junge Frau hatte Tuch und Jacke abgelegt und stand im Schein der trüben Lampe inmitten dieser Unordnung. Ihre schönen, dunkelblauen Augen blickten umher und hafteten auf den schmutzigen Kindergesichtern, dann blickte sie fragend in das finstere Antlitz des Mannes.
„Also“, sagte der Bauer, „das sind meine Kinder. Ich gebe sie in deine Macht. Wehe dem, das dir nicht gehorcht. Ich brauche keine Frau; ich hatte an der einen genug, aber sie brauchen jemanden, der sie in Ordnung hält. Auch im Haus ist es ohne Hausfrau schlecht gegangen. Katuscha, helft mit den Kindern Ordnung schaffen und gebt uns das Abendbrot. Ich muss zu den Pferden.“ „Ich habe nicht wissen können, wann Sie kommen“, brummte die Alte. „Wir haben schon gegessen. Und“, fügte sie ärgerlich hinzu, „ich habe meine Sachen schon hier im Bündel und es ist spät; ich gehe fort, irgendeiner Fremden werde ich nicht dienen.“ Auf der Stirn des Bauern schwollen die Zornesadern; seine schwarzen Augen blitzten, aber er bezwang sich.
„Ihr könnt gehen“, sagte er kurz. „Wartet auf mich, ich komme gleich“, wandte er sich in freundlicherem Ton an seine Frau. Die Kinder blieben mit der neuen Mutter allein, nachdem der Vater und Tante Katuscha die Stube verlassen hatten. Unwillkürlich sahen sie sie an. So hatten sie sich die Stiefmutter nicht vorgestellt. Sie war hübsch und jung, schlank gewachsen wie eine Tanne.
„Liebe Kinder“, sprach sie endlich, ihre Stimme klang wie das Rauschen der Föhren im Walde, „ich bin so fremd hier, ich weiß mir nicht zu raten, helft mir doch! Euer Vater hat mich gebeten, zu euch zu kommen, weil ihr seit drei Jahren keine Mutter mehr habt. Ihr habt mir Leid getan, denn ich war auch noch klein, als meine Mutter starb, und dann ist es mir und meinem Brüderchen sehr schlecht ergangen; das hieß auch Palko. Ich will euch lieb haben, habt mich auch lieb! Ihr habt niemanden – ich auch nicht.“ „Und dein Bruder?“, wandte Palko ein. „Er starb, als er so groß war wie du.“ „Hast du keinen Vater mehr?“, fragte Betka schüchtern. „Er starb im letzten Jahr.“ „Und andere Geschwister?“, fragte Annitschka. „Ich habe sonst keine eigenen Geschwister.“ „Bei wem warst du denn, wenn du niemanden hast?“, forschte Joschko, näher tretend. „Bei der Tante meines Vaters. Also wollt ihr mich aufnehmen?
Ich will nicht, dass ihr mich ‚Mutter‘ nennt. Ich bin jung und ihr kennt mich nicht; nennt mich ‚Tante Ilenka‘, und wir wollen gute Kameraden sein. Du, Palko, wirst mir meinen Palko ersetzen; willst du das?“ Sie reichte dem Knaben herzlich die Hand. Zögernd legte er seine schmutzige Hand in die ihrige. „Warum willst du nicht, dass wir dich ‚Mutter‘ nennen?“, meldete sich Annitschka. „Wisst ihr, Kinder, als mein Vater sich wieder verheiratete, brachte er uns eine fremde Frau ins Haus. Wir mussten sie ‚Mutter‘ nennen. Das war uns zuwider, denn sie war böse zu uns. Auch euch wäre das zuwider. Später, wenn ihr euch an mich gewöhnt habt und wir uns lieb haben, könnt ihr mich so nennen, wenn ihr wollt, aber diesen Namen muss ich mir erst verdienen. Doch jetzt helft mir, damit es hier nicht aussieht wie in einer Räuberhöhle.“
Die Kinder lachten herzlich und halfen fröhlich, alles in die Stube und in die Kammer zu tragen. „Den Korb lass hier, Palko. Du, Annitschka, mach Feuer an. Joschko soll Holz bringen; gelt, wir wollen uns ein gutes Abendbrot machen?“ Eine halbe Stunde später, als der Bauer in die Küche eintrat, erschien ihm diese ganz verwandelt. Im Herd prasselte ein freundliches Feuer, das angenehme Wärme verbreitete. Betuschka gab auf die Milch Acht und Annitschka putzte die Lampe. Als diese sauber war, beleuchtete sie freundlich die Küche. Joschko räumte den Tisch ab. Die junge Hausfrau breitete ein hübsches Tischtuch darauf, verteilte neue Teller und Löffel und goss warme Milch in eine Schüssel. Palko brachte aus der Kammer einen Laib Brot und Stühle aus der Wohnstube herbei.
Mras blieb in der Tür stehen und blickte auf seine junge Frau und die Kinder. Betka brachte soeben den kleinen Andrej herbei. Das Kind wollte weinen, aber es hatte keine Zeit, die neue Tante steckte ihm ein Stück Kuchen in die Hand. Sie nahm es nicht auf den Arm, um es nicht zu erschrecken. Dann sagte sie den Kindern, dass die Teller und Löffel ihnen gehören sollten. Sie waren mit bunten Bildern bemalt, und die Kinder freuten sich sehr über das Geschenk. Palko wusch sich als Erster die Hände, um seinen schönen Teller nicht zu beschmutzen, und die Übrigen folgten seinem Beispiel. Ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit stahl sich in das harte Herz des Mannes. Als ihn seine Frau so freundlich zu Tisch rief, erheiterte sich unwillkürlich sein finsteres Gesicht und machte ihn um fünf Jahre jünger. Unterdessen erzählte die alte Katuscha bei der Müllerin schon zum fünften Mal, wie die junge Mras das Haus vorgefunden und wie sie ihr die Hölle heiß gemacht hatte. Und die Frauen knüpften allerlei Prophezeiungen daran, wie es wohl dieser dummen Person ergehen würde, die in dies Haus hineingeheiratet hatte, ohne sich vorher zu erkundigen. „Ja, ja, so geht es, wenn man die Katze im Sack kauft“, meinten sie. Während sich das Dorf so mit ihr beschäftigte, saß die Familie Mras beim Abendbrot, als wäre sie schon seit vielen Jahren so beisammen. Dann führten die...
@1991 Francke-Buchhandlung
Roy Kristina, Die Verlorenen

1. Kapitel
Es war Frühling, ein herrlicher Frühling. Die Nachtigallen sangen voller Lebensfreude, und Tausende von Blumen bedeckten die Wiesen, und Blüten zierten die Bäume. Die Erde sah aus wie eine ihren Bräutigam sehnsüchtig erwartende Braut. Überall war es schön, aber die Umgebung von Zaradskys Mühle glich dem Paradies, das einst für zwei heilige Leute geschaffen war, dann aber von den Wogen der Sintflut vernichtet wurde. Hinter der Mühle lag ein gtünbe-wachsener Bergabhang. Ihm zu Füßen floß ein tiefer kristallheller Bach. Man hätte sich in ihm den Strom des Lebens vorstellen können, der vorn Thron des Lammes fließt. Jenseits des Baches breiteten sich Wiesen aus, und an diese grenzten grüne Wälder, die die weitere Aussicht verdeckten. Die Mühle war alt, aber vergrößert und erneuert.
Die alte Frau Zaradsky führte, obwohl sie die Mühle ihrem einzigen Sohn bereits übergeben hatte, trotzdem dort noch immer das Regiment. Sie gehörte zu jenen Menschen, die meinen, ihre Tage auf Erden nähmen kein Ende. Sie war eine rechtschaffene und gute Hausfrau, so fleißig, daß sie sich selbst kaum ein Stündchen Ruhe gönnte, aber auch niemanden ruhen ließ
Dabei war sie auch fromm; jeden Sonntag sah man sie in der Kirche und hörte beim Gesang ihre laute Stimme. Die Predigt hindurch schlief sie zwar immer, aber das ließ sich wohl durch die Anstrengungen der Woche entschuldigen. Sie kannte auch viele Sprüche der Heiligen Schrift; doch was und wie sie glaubte, danach fragte niemand.
Jung verwitwet, hatte sie sich, obwohl viele Freier kamen, nicht mehr binden wollen, sondern erzog ihre zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, wie sie selbst sagte, in Gottesfurcht. Die Tochter verheiratete sie noch jung in ein großes
Bauerngut. Zwar hatte das Mädchen sich geweigert, weil
sein Herz einem armen Müllerburschen gehörte, der früher bei der Mutter gearbeitet hatte. Sie gebrauchte Zwang, und die Ehe wurde geschlossen. Als der Sohn vom Militär heimkam, suchte sie auch für ihn im Nachbardorf eine Braut. Die Mühle benötigte dringend eine Reparatur, so daß eine reiche Schwiegertochter ins Haus mußte. Sie suchte und wählte lange, bis sie endlich eine reiche Waise fand; und wie sie früher die Tochter gezwungen hatte, so zwang sie nun auch den Sohn. Sie wußte sehr gut, wie sie das machen mußte. Sie drohte ihm, fortzugehen und ihr Teil mitzunehmen. Wie hätte der junge Müller einen solchen Verlust ertragen können! Dann malte sie ihm aus, was er mit dem Vermögen seiner Frau alles ausrichten könne; und so überredete sie ihn endlich.
Es wurde eine rauschende Hochzeit gefeiert, die, wie üblich, eine ganze Woche dauerte, und dann folgte das neue Leben. Aber was für ein Leben!
Thomas Zaradsky verheimlichte nicht, daß seine Frau ihm nur eine Last sei, und daß er aus der ganzen Bibel am besten die Worte kannte: „Er soll dein Herr sein", wahrscheinlich deshalb, weil sie in der Bibel ziemlich am Anfang stehen. Bis jetzt hatte er ja niemals Zeit gehabt, in das alte große Buch hineinzuschauen, das sich vom Großvater auf Sohn und Enkel vererbt hatte. Es war so sauber, als ob es die vielen Jahre in einer Buchhandlung gelegen hätte.
Der sechzehnjährigen Eva ging es wie tausend anderen um ihrer Mitgift willen geheirateten Frauen. Anfangs überwand sie ihre Schüchternheit und bemühte sich, ihrem Mann und der Schwiegermutter alles recht zu machen. Diese lobte sie sogar vor ihrem Sohn und vor anderen Leuten. Da ihr Mann aber immer gleich unfreundlich blieb, verließ sie der Mut und die körperliche und seelische Kraft. Man verlangte von ihr die Arbeit von zwei Mägden.
Das Grasbündel, das sie vom Feld heimbrachte, war der Schwiegermutter nie groß genug, obgleich die arme Eva oft dachte, in ihrem Innern müsse etwas zerreißen. Wenn ihr Mann ihr auftrug, schwere Säcke zu heben, machte sie es ihm nie schnell und geschickt genug; nie hörte sie ein Wort der Ermunterung oder Anerkennung. Durch nichts konnte sie die Liebe ihres Mannes und der Schwiegermutter erringen.
Aber das hatte seinen besonderen Grund. Es stellte sich nämlich heraus, daß ihre Mitgift nicht so groß wie versprochen war, ja, daß ihre Mutter die Müllerin betrogen hatte. Thomas stritt sich deswegen mit seiner Mutter öfter und sie mit ihm. Auch zwischen ordentlichen und ehrbaren Leuten entsteht ja oft Zank und Streit, daß das Haus erzittert! Eva mußte für die Tat ihrer Mutter von ihrem Mann und von ihrer Schwiegermutter viel erleiden. Hatte ihr Mann ihr schon früher kein gutes Wort gegönnt, und sie oft, wenn sie in der Mühle zusammen arbeiteten, grob angefahren, so schritt er jetzt, aufgestachelt durch den Zorn der Mutter, zu noch grausamerer Behandlung. Mehr als einmal hörte man in dem lieblichen Tal Schmerzensschreie, die bewiesen, daß hier das Paradies nicht war. Unter solchen Verhältnissen kam der wundervolle Frühling.
Es war Sonntag morgen. Die Müllerin war mit ihrem Sohn in die Kirche gegangen. Die Mühle stand, nicht etwa, weil es Sonntag war, sondern weil das Rad beschädigt war, und der Steilmacher es gestern nicht hatte wieder herstellen können.
Der Kuhhirte trieb das Vieh auf die Weide, der Lehrling
war zum Wassergegangen, um Meine Fische zu fangen, und über dem Wehr, die Hände in den Schoß gelegt, saß eine junge Frau.
Hätte jemand eine verwelkte Blume malen wollen, in ihr hätte er das Modell gefunden. Aus einem marmorweißen Gesicht schauten große schwarze Augen starr in das Wasser.
Sie schauten und schauten - und es war ein sonderbarer Blick! In der einen Hand hielt die junge Frau krampfhaft an die Brust gedrückt ein Stück Kinderwäsche. Die bleichen Lippen waren schmerzhaft verzogen. Von dem ungeordneten Haar hing das Tuch ab, die Kleider waren schmutzig und nachlässig umgeworfen - alles zeugte davon, daß die Seele dieses Wesens nicht in Ordnung war, und daß in ihrem Innersten ihr Herz vor Schmerz erstarrt war. Kein Wunder! Hatten sie doch gestern ihr Meines schwaches Kindlein in der dunklen Erde begraben, und mit ihm ihre ganze Hoffnung und Freude.
Sie bedauerte es nicht, daß man die kleine Eva begraben hatte; dort war ihr wohl, ganz wohl! Niemals würde ihr Mann sie schlagen, niemals würde die Schwiegermutter sie quälen und ihr vorwerfen, sie verdiene das Essen nicht, wenn sie nicht arbeiten könnte. Dem süßen Kind war dort wohl; aber was sollte jetzt aus ihr werden, wo sollte sie hingehen mit ihrem Kummer, da sie hier niemanden hatte, dem sie ihr Leid Magen konnte?
„Sei nur froh, daß das Kind gestorben ist, du hättest was zu pflegen gehabt; denn es war so krank! Du hast keinen Grund zum Weinen," hatte die Schwiegermutter leichthin gesagt; „es war ja gar nicht tauglich für die Welt!" Niemand hatte Mitleid mit ihr; kein Mensch war da, der ihr Liebe erwiesen hätte.
- Weißt du, warum die Blumen zwischen Felsen und Disteln verwelken? Sie haben keine Sonne. Wie aber soll ein Mensch, den Gott erschaffen hat, um lieben zu können und geliebt zu werden, ohne Liebe leben? ‚Wozu soll ich noch leben", dachte Eva, „da mir das, was ich liebe, und was auch mich geliebt hätte, gestorben ist?" Sie drückte das kleine Häubchen, das vor dem Tod das Meine kostbare Köpfchen bedeckt hatte, an ihre Lippen und Wangen. Ach, wieviel Nachte hatte sie durchwacht um heimlich die Kinderwäsche nahen zu können, da man ihr am Tag kerne Zeit dazu gelassen hatte - und nun war alles umsonst! Die Meine Eva nahm nur ein Kleidchen mit sich, und das wurde ihr für immer genügen.
„Mir wäre auch wohl, wenn ich sterben könnte; was soll ich noch im Leben?" Sie schaute verzweifelt in das Wasser.
Plötzlich kam ihr in ihrer Verlassenheit ein finsterer Gedanke. „Und warum sollte ich nicht sterben? Das Wasser hier ist so tief; wenn ich hineinspringe, wird es mich fortreißen, es fließt so wild, es wird mich weit davontragen, dem Evehen nach! Vielleicht finden sie mich und werden mich neben es betten; sie wissen es ja nicht, daß ich es absichtlich getan habe."
Wie oft, wenn sie erst spät in der Nacht schlafen ging und schon um drei Uhr wieder aufstehen mußte, hatte sie sich gewünscht, nur einmal richtig ausschlafen zu können. Dort würde sie sich ausruhen können! 0, wird das gut tun! - Der Hahnenschrei schreckte die junge Frau auf und erinnerte sie an ihre -Pflicht. „Ich werde alles besorgen," dachte sie mit einer wilden Sehnsucht nach Freiheit, „und dann werde ich mich freimachen."
„Ach, Mutter, Mutter, welch einen schweren Stein hast du mir um den Hals gehängt, so schwer, daß er mich in die Tiefe hinabzieht," sprach sie und stand auf. Dabei erblickte sie ihr Bild im Wasser. „Ach, wie schaue ich aus! Als man meine 'Schwester in den Sarg legen wollte, wusch man sie vorher und zog ihr reine Kleider an; auch ich muß mich ankleiden!"
Die Hoffnung auf baldige Befreiung flößte der jungen Frau neue Kraft ein.
Im Hof versorgte sie die Hühner, schaffte Ordnung im Zimmer und in der Küche. Sie ging bis auf den Boden; überall räumte sie auf. Sie öffnete die Truhe, glättete ihr schönes blondes Haar und wand es in zwei Flechten um ihren Kopf, nahm ihre Sonntagskleider und verschloß die Truhe wieder. Dann ging sie hinunter, wusch sich, kleidete sich sonntäglich an und eilte zum Wehr. Aber als sie über dem Wasser stand, durchfuhr sie ein eigentümliches Gefühl. Es war ihr, als rief eine Stimme- »Eva, was machst du?"
Erschreckt blickte sie auf - aber nirgends war ein Mensch zu sehen. Sie fühlte plötzlich, daß das, was sie tun wollte, Sünde sei. Sie wußte nur wenig von Gott;nur zwei Winter war sie in die Schule gegangen, und zwar zu einem betrunkenen Bauern, der sie zwar gut lesen und etwas schreiben lehrte, aber von Gott selber wenig wußte und nie an ihn dachte.
Als sie zwölf Jahre alt wurde, besuchte sie den Konfirman-denunterricht. Doch hier konnte sie nie etwas auswendig lernen, da sie nichts verstand. Weil die Zahl der Schüler groß war, schrieb man es ihrer Schüchternheit zu.
Später war sie in die Kirche gegangen, wo sie, gerade so, wie hundert andere, von der Predigt nichts verstand. Dann hatte sie geheiratet.
Ein trauriges Leben hatte begonnen, und es war niemand da, der, der armen Seele das Licht gezeigt hätte. Aber eins
wußte sie doch, nämlich das, was auch die Heiden fühlten:
Es gab einen Gott.
In diesem schrecklichen Augenblick fühlte sie plötzlich seine Gegenwart, daher der Schrecken. Gestern hatte sie singen hören: „Selig sind die Kinder, die nach Gottes Willen gelebt haben und dann in dem Herrn sterben!" Evchen hatte gelebt, solange es Gott gewollt hatte, dann war sie gestorben. ‚Wenn ich mich ertränke, wird das auch nach Gottes Willen sein?" erwog sie bei sich. „Aber ich kann nicht leben, ich kann nicht! Thomas wird heute abend wieder betrunken heimkommen, er wird mich schlagen, und ich bin so elend. Die Müllerin wird mich zur Arbeit treiben, und ich kann nicht. Ach, warum sollte es Gott nicht wollen, daß ich mich ertränke? Ist denn Gott so hart? Aber wohin werde ich dann kommen?"
Ratlos irrten ihre dunklen Augen über das Wasser, über die Wälder und über den Himmel.
„Evchen ist dort, und ich, ich werde nach dem Tod nicht hinkommen, ich werde sie nicht finden. Ich möchte selbst in die Hölle fliehen, denn schlechter als hier kann es auch dort nicht sein, aber Evchen ist nicht in der Hölle; solche kleinen Kinder nimmt Gott zu sich. 0, wenn ich es nur wüßte! Wüßte ich nur, ob es ihr gut geht!"
Von dem Augenblick an, wo Eva zu der Überzeugung gekommen war, daß Gott ihr Kind zu sich genommen hatte und es, von aller Not erlöst, bei ihm war, stand ihr Gott näher. Eine tiefe Sehnsucht ergriff sie nach einem Menschen, mit dem sie über Gott sprechen könnte.
In ihrem Gedanken wurde sie durch nahende Schritte gestört. Der Kuhhirte kam mit dem Vieh und suchte die Hausfrau. Er war ein schöngewachsener Bursche, aber mit einem ungewöhnlich häßlichen, narbigen Gesicht; dazu war
Die Verlorenen/Kristina Roy. - Marburg an der Lahn:
Francke, 1993
(Edition C: Ii, Heimatlicht; Nr. 64)
ISBN 3-86122-059-8
NE: Edition C/H
Alle Rechte vorbehalten
© 1993 by Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH
3550 Marburg an der Lahn
Umschlaggestaltung: Gudrun Dresbach
Satz: Druckerei Schröder, 3552 Wetter/Hessen
Druck: St.-Johannis-Dnckerei, Lahr 28783/1993
Roy Kristina, Glück
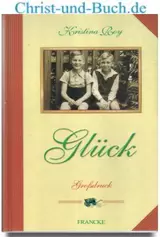
1. Unter dem Murtin
„Man könnte durch die ganze Welt gehen", so sagten die Leute, „und man würde keine zwei solchen Brüder wie Pavel und Andrej Murtin finden, die so einträchtig miteinander lebten und sich so lieb hätten wie diese beiden!
Ihr Vater war gestorben, als sie noch nicht 14 Jahre alt waren, und seitdem hatten sie der Mutter geholfen, die kleine Wirtschaft zu besorgen, die er ihnen hinterlassen hatte; als auch die Mutter starb, wirtschafteten sie allein, so gut sie es eben verstanden.
Sie wohnten in den entlegensten Kopanitzen, die zum Städtchen Z. gehörten, am Fuße des Berges. Ihr Stück Land, eine Wiese und ein hübscher Obstgarten umgaben das Häuschen. Weil auch der Feldrain der Gemeinde, von üppigem Grün bewachsen, in der Nähe war, konnten sie ihn für geringes Geld pachten und leicht zwei gute Kühe und manches Stück Jungvieh halten; jedes Jahr pflegten sie etwas davon zu verkaufen. Zur Mühle hatten sie es nicht weit, sie liefen nur den Hügel hinab ins Tal zum Müller Lehotsky.
Es machte keine große Mühe, Wasser für das Vieh zu holen, denn in der Nähe ihres Hauses floss ein kristallklarer Bach vorbei, dort tränkten sie ihr Vieh. Sie hielten auch einige Schafe, besonders der Wolle wegen; was sie den Winter über spannen, das ließen sie alle zwei Jahre weben und entweder Mäntel oder Hosen und Jacken daraus arbeiten.
Als sie bereits zu jungen Männern herangewachsen waren, gingen sie stets sehr gut gekleidet. So wie die Bäume im Wald der Sonne entgegenstreben und von keiner Hand gestützt, an keinen Pfahl gebunden, gerade emporwachsen, so wuchsen auch sie gerade auf, ohne Turnunterricht, denn in der kleinen Dorfschule, welche sie fleißig besuchten, wurde dieses Fach noch nicht gelehrt. Ja, sie wuchsen gerade und stark auf, mit breiten Schultern und schön. gewölbter Brust. Jeder der beiden hätte mit Leichtigkeit einen schwachen Städter auf den Gipfel des Murtins - so hieß der Berg, unter dem ihre Hütte lag -‚ getragen und wäre dabei selbst nicht außer Atem gekommen.
Andrej Martin liebte sehr ihr Hüttchen, er kannte nichts Schöneres auf der Welt. Nicht, als ob er noch keine großen, hohen Häuser gesehen hätte - er ging ja mitunter auf Viehmärkte -‚ aber er hätte für keines seine Hütte tauschen mögen. In den Städten standen die Häuser dicht nebeneinander, Stein auf Stein, und die Leute sahen aus ihren Fenstern nichts anderes als den Schmutz der Straße. Stets schien es dem Jungen und später dem Mann, als müsse er dort ersticken und als hätten die Leute keine Freiheit. Es ist wahr, sie hatten in ihrer Hütte kleine Fenster; aber wenn er hinausblickte, dann jubelte das Herz über die schöne Gotteswelt, die er sah, sei es im Frühling, wo der Obstgarten einem Paradies glich, oder im Sommer, wo das Obst an den Bäumen reifte, oder im Herbst, wo die Apfel- und Pflaumenbäume unter der Last ihrer Früchte zu brechen drohten.
In der Stadt musste man alles kaufen und sie hatten hier alles in Hülle und Fülle. Vom Frühling bis zum Winter lebten sie größtenteils nur von Obst, Milch und Pilzen, die sie nicht weit zu suchen brauchten. Fleisch aßen sie nur, wenn sie einen Hammel oder ein Kaninchen schlachteten. Solange die Mutter lebte, hatten sie wirklich genug Geflügel gehabt, aber das hatten sie dann in die Stadt verkauft und dafür allerlei Notwendiges für das Haus angeschafft.
Pavel Murtin war nicht immer mit allem zufrieden, er meinte, dass es nötig sei, die Hütte zu vergrößern. Häufig machte er Pläne und besah sich andere Gebäude. Gerade als sie sich ans Werk machen wollten, traf es sie wie ein Schlag aus heiterem Himmel Sie mussten beide zur Musterung, denn
sie waren Zwillinge, und was niemand gedacht hät te: Pavel musste zu den Soldaten!
Hätte man wenigstens alle beide genommen— aber sie so zu trennen! Manches Mal hatten sie sich ge
sagt: „Wenn wir zu den Soldaten müssen, dann werden wir auch dort beisammen sein und es gemeinsam ertragen." Aber sie hatten sich dennoch der Hoffnung hingegeben, dass das Los sie verschonen würde, aber dass der eine gehen . und der andere zurückbleiben müsste, das war ihnen nie in den Sinn gekommen Was wussten die Herren von der Kommission . - die Andrej auslachten, als er sie zu bitten begann, ihn doch nun auch als Soldat zu nehmen,
da Pavel Soldat sein musste -‚ was wussten jene Herren davon, wie es den .beiden Jünglingen zumute war, Pavel, weil er ohne, Andrej gehen musste, und Andrej, weil er allein bleiben sollte!
Beiden wurde es dunkel vor den Augen; hätte nicht das übermütige junge Volk um sie her getobt, sie hätten am liebsten geweint.
„Warum bin ich nur als Kind gefallen und habe mir einen Schaden geholt; ich könnte heute Soldat
sein", jammerte Andrej. „Oder warum ist nicht auch Pavel gefallen, dann müssten sie uns in Frieden lassen! Sehr betrübt kehrten sie heim.
„Fürchte dich nicht", sprach Pavel, als der erste Schmerz ein wenig nachgelassen hatte, „es kann sich noch alles zum Guten wenden; hätten sie uns beide genommen, dann wäre uns die Hütte ganz verwildert; und wenn wir sie vermietet hätten, wäre sie uns nicht so instand gehalten worden, wie du es nun tun wirst. Und was ich dort lernen werde, das wird so sein, als ob du es auch wüsstest. Bis Gott gibt, dass ich wiederkomme, werden wir wieder so leben, ja noch besser als zuvor."
‚ja", sprach Andrej, etwas getröstet; „ich will in den drei Jahren alles so besorgen, was wir • zusammen ausführen wollten."
„So viel wirst du nicht fertig bringen, das wäre zu viel für dich",: erwog Pavel, „und allein kannst du auch nicht bleiben. Ich denke, du könntest Tante Zvara zu dir nehmen, die Arme hat nichts zum Leben, weil der unglückliche Onkel alles durchgebracht hat, und nun ist auch ihr zweiter Mann gestorben."
„Da hast du Recht, sie ist eine gute Frau, sie hat nur ein Kind von dem Onkel. Nun, wie Gott will, wenn es nicht anders ist, müssen wir uns damit abfinden, du dort, ich hier, so gut es eben geht."
So trösteten sich die Brüder. Und weil Pavel nicht sofort gehen musste, erschien es ihnen endlich wie ein böser Traum.
Aber Woche um Woche verging und der Traum wurde Wirklichkeit.
Als Andrej den Bruder ausgerüstet hatte und als sie nun wortlos miteinander vor dem Haus standen und er ihm in das blasse Gesicht blickte, da war es Andrej, als habe er ihn lebend für das Grab ausgerüstet. Es schien ihm, als stürbe in diesen Augenblicken ihr schönes brüderliches Glück. Er nahm den Bruder um den Hals und weinte und Pavel schmiegte sich an ihn und weinte gleichfalls, auch ihm war es, als würde er nie mehr wiederkehren. - Wer weiß, wie lange sie noch geweint hätten, wenn nicht einige Freunde, die gekommen waren, um sich von Pavel zu verabschieden, sie gestört hätten.
Andrej begleitete den Bruder bis zur Bahn, weiter konnte er nicht mit ihm gehen, aber eines tröstete ihn: „Es gehen so viele junge Männer, die ebenso dran sind wie Pavel, die werden ihn wohl aufheitern." An sich dachte er nicht.
Er begab sich gleich zur Tante Zvara und half ihr, die wenigen Sachen umzuräumen, das Übrige wollte er mit dem Wagen holen. Es war ihm lieb, dass er nicht allein heimkehren musste. Frau Zvara segnete den Neffen in ihrem Herzen, dass er sie zu sich nahm Sie hatte als Witwe einen Witwer geheiratet, der
Mann war gestorben und seine Kinder aus der ersten Ehe hatten die Stiefmutter, und besonders deren Tochter, sehr schlecht behandelt. Die kleine Ilenka Zvara - die ifir ihre 14 Jahre sehr zurückgeblieben war, atmete beim Verlassen des Hauses auf wie ein in die Freiheit versetzter Vogel.
Sie war ein blasses, zartes Kind, aus dessen magerem, eingefallenem Gesicht zwei große, blaue Augen traurig und scheu in die Welt blickten. Man sah es dem Kind an, dass es schon viel Böses erlebt hatte. Der Mutter gab es, sooft sie es anblickte, einen Stich ins Herz, denn sie musste sich sagen, dass sie durch ihre unbesonnene zweite Heirat ihr Kind ins Unglück gebracht hatte. Doch nun waren sie beide glücklich.
Als sie im Haus unter dem Murtin heimisch geworden waren, lief das Mädchen hinter dem guten Vetter - der sie weder schlug noch schalt -‚ her wie ein Hund, der in seiner Verlassenheit einen gütigen Herrn gefunden hatte. Es dauerte lange genug, bevor sich die Seele des Kindes an die schöne Freiheit und an das große, unverhoffie Glück gewöhnt harte. Aber die veränderte Umgebung und Lebensweise wirkte so auf diesen zarten Menschen, wie wenn man eine im Schatten verkümmerte Pflanze ins volle Sonnenlicht versetzte - o, wie rasch holt sie das Versäumte nach!
12 13
Auch begann das Mädchen zu wachsen und kräftiger zu werden; die Wangen wurden rosig und rund. Da es nichts zu fürchten gab, verloren die Augen ihren scheuen Ausdruck; ein Lächeln umspielte den Meinen Mund, der inmitten des Gesanges der Vögel gleichfalls zu singen begann. Sie ging der Mutter und dem Vetter emsig zur Hand und ihre Dankbarkeit erfüllte die Hüfte mit hellem Glanz.
„Ach, Tantchen", meinte Andrej, „ich habe gar nicht gewusst, wie ich es überleben würde, ohne Pavel zu bleiben, es schien mir, als würde mir ein Tag wie ein Jahr werden, und sieh, nun ist bald ein Jahr um, so hat Gott uns geholfen."
„Das kommt daher, mein Sohn, weil du uns so wohl getan hast", seufzte die dankbare Frau.
Große Freude bereiteten in der Hütte immer Pavels Briefe. Anfangs waren es nur Grüße, und er schrieb, wie bange ihm sei, aber dann schrieb Pavel je länger je mehr, und Andrej bewunderte ihn nicht wenig, dass er die Sätze zusammenstellen konnte, als läse man sie aus einem Buch. Unwillkürlich schrieb auch er ausführlich, wie sie lebten und was sie machten.
„Ihr werdet sehen, Tante", sprach er, „unser Pavel wird dort viel lernen, und es wird noch gut sein, dass er gehen musste." Er selbst hatte gleich im ersten Winter begonnen, Ilenka im Lesen und Schreiben zu unterrichten; sie war auch darin sehr zurück, während die Brüder Murtin in der Schule stets die Ersten gewesen waren. Indem er mit ihr durchnahm, was er selbst einst in der Schule gelernt hatte, prägte es sich ihm aufs Neue und besser in sein Gedächtnis ein. Frau Zvara holte eine Bibel von ihrem Vater her, daraus lasen sie sich nun vor und wunderten sich über so manches.. Es waren schöne, aber auch ernste Geschichten darin.
Sie gingen gern zur Kirche, und obwohl sie gute zwei Stunden Weg dahin hatten, gingen sie im Sommer ziemlich häufig, und sie freuten sich, wenn. der Herr Pfarrex irgendeinen Text vorlas, den sie schon daheim in dem heiligen Buch gefunden hatten. Zwar verstanden sie von der Predigt ebenso wenig wie von dem Gelesenen, aber es verstand sicherlich keiner von den übrigen Zuhörern mehr davon, und es ging ja den Menschen auch so gut auf der Welt, und was nach dem Tod mit ihnen werden würde - das wusste Gott allein.
Sie waren unter dem Murtin anständige und rechtschaffene Leute, kein Mensch konnte ihnen etwas Böses nachsagen. Sie beteten ihre auswendig gelernten Gebete und sangen ihre Gesangbuchlieder. Drei-bis viermal im Jahr gingen sie zur . Beichte. An diesen Tagen fühlten sie sich stets sehr bedrückt, und sie waren froh, wenn sie diese christliche Pflicht wieder erfüllt hatten. Dabei dachten sie so wie ihre übrigen Nachbarn, etwas sehr Gutes, Gott Wohlgefälliges getan zu haben, wofür sie vielleicht einmal in den Himmel kommen würden
**
Und was tat Pavel? Nun, er trug eben alle die Beschwerden, wie sie der Soldatenstand mit sich bringt. Oft kam er sich vor wie ein Gefangener; oft beneidete er die Reitpferde, wie wurden sie gepflegt! Und während die Offiziere die hübschen Tiere streichelten und ihnen schöne Namen gaben, waren den Soldaten gegenüber die gemeinsten Schimpfworte nicht zu schlecht, sie mochten schuldig sein oder nicht. - Der in der freien Bergeinsamkeit aufgewachsene junge Mann litt unter dem gemeinsamen Wohnen in den Kasernen, unter der harten, strengen Zucht, unter der fremden Sprache, die er lernen musste, unter der oft rohen, aller menschlichen Würde widersprechenden Behandlung, wie sie ihm zuteil wurde - vor allem aber darunter, dass sie ihn aus seinem Heimatböden gerissen und hierher verpflanzt hatten, wo er nie Wurzeln schlagen konnte. Ja, er litt sehr, mehr als er sagen, mehr als er ermessen konnte, er litt an Seele und Leib, Gemüt und Geist.
Er hörte hier Worte und Redensarten, über die er am Anfang errötete. Manchmal überstiegen die Pflichten seine Kräfte und dann wieder hatte er sehr viel Zeit zum Mflßiggang. Die ungewohnte, hauptsächlich aus Fleisch bestehende Nahrung bekam ihm nicht, und in seinen müßigen Stunden kamen ihm Gedanken in diesen dumpfen Zellen, wo im Sommer die Hitze drückte, Gedanken und Vorstellungen, von denen er unter dem Murtin bei seiner freien, harten Arbeit keine Ahnung gehabt hatte.
Später dachte er, dass er sich eingewöhnt, dass er sich abgefunden habe, und er wusste nicht, dass er sich gewöhnte, weil er - starb. Sein ganzes urwüchsiges, unverdorbenes Wesen starb und es wurde ein ganz gewöhnlicher, roher Soldat aus ihm
Und doch war etwas in ihm, was sich gegen jenes Ersterben sträubte, und dieses Etwas trieb ihn zu lernen, so viel er nur konnte, hatte er es doch Andrej versprochen. Jahr für Jahr verging, und er hatte immer nur den einen heißen Wunsch, zurück, zurück zu Andrej. Es schien ihm mitunter, als würde er dann wieder jener Pavel sein, der er war, ehe er die Heimat verließ, als würde er mit dem Soldatenrock auch jenes fremde Wesen ablegen, das von ihm Besitz ergriffen hatte.
Sie hatten ihn zur Militärkapelle gegeben; es zeigte sich, dass er von Gott große Gaben erhalten hatte. Er lernte leicht, so dass manche ihn beneideten seine Lehrer lobten ihn. Dabei rückte er auf, bis er alle Dienstgrade erlangt hatte, die ein Soldat erreichen kann.
Im zweiten Jahr war er eine Zeit lang an der Grenze, dann in Bosnien, und im dritten Jahr hielt er sich in der Großstadt auf, wo er die Möglichkeit hatte, mit den anderen alle öffentlichen, dem Militär zugänglichen Lokale zu besuchen.
Er erfuhr, dass er sich für wenig Geld Bücher leihen könne, Zeit hatte er genug, auch an Mitteln fehlte es ihm nicht, so lieh er sich und las. Die Welt begann sich vor ihm aufzutun und sich ihm in einem neuen Licht zu zeigen. Und weil er nun wusste, wie man mit den Rekruten und Reservisten aus dem Bauernstand umging und wie man am allerwenigsten einen slowakischen achtete, kam er zu der Überzeugung, dass es gut sein würde, Rock und Lebensweise zu ändern. „Auch ich will ein Herr sein", sagte er sich, und „Andrej soll auch einer werden, warum sollten wir uns vor jemandem bücken? Wir werden uns unsere Wirtschaft in der Weise vergrößern, wie ich es an anderen Orten gesehen habe. Wir werden uns Bücher und Zeitschriften halten, ja, wir werden Herren sein wie alle anderen, es soll nicht jeder mit uns umspringen dürfen wie mit gewöhnlichen Bauern."
Und Pavel begann auf einen Herrenanzug zu spa- ren, was ihm umso leichter fiel, als er in den Dienst eines hohen Offiziers getreten war, bei dem er einige Monate über die vorgeschriebene Dienstzeit blieb.
„Wenn ich erst Herrenkleider habe, dann muss ich es lernen, so zu gehen und so zu sprechen wie ein Herr", grübelte er weiter und bemühte sich, seinen Offizier nachzuahmen Sie waren etwa gleich groß, gleich schlank; in kurzer Zeit hatte Pavel gelernt, sich zu verneigen, sich zu setzen, sich die Zigarre anzuzünden, mit denselben Worten zu sprechen wie sein Herr, und sehr mit sich selbst zufrieden, sah er seiner Heimkehr unter dem Murtin entgegen.
„Wie sie alle auf mich sehen werden", dachte er voll Stolz. „Ich will nicht, dass mich je wieder einer ‚PaIo Murtinov' nenne!"
@2000 Francke-Buchhandlung
Remmers Arend, Das Neue Testament im Überblick
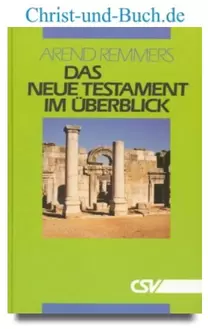
Der vorliegende Band bietet zu jedem der 27 Bücher des NT eine knappe Einleitung mit den wesentlichen Informationen über den Verfasser, die Entstehungszeit und den Zweck des jeweiligen Buches sowie eine gegliederte Inhaltsangabe, um den Zugang zum Verständnis der Botschaft zu erleichtern.
Weitere Hilfen bieten eine vergleichende Übersicht über die vier Evangelien, Aufstellungen über alttestamentliche Zitate im NT, ein Stichwortverzeichnis s0wie Karten und Abbildungen.
18 Markus 19
Das Evangelium nach Markus
16 Kapitel
1. Verfasser und Entstehungszeit
Nur ein Mann im NT trägt den Namen Markus, und ihm wird bereits seit dem Anfang des 2. Jh. das gleichnamige Evangelium zugeschrieben. Dieser Markus, der eigentlich Johannes hieß, war der Sohn einer Maria, die in Jerusalem ein Haus besaß (Apg 12,12). Dorthin ging Petrus, als er aus dem Gefängnis befreit worden war. Johannes-Markus war auch ein Neffe (oder Vetter) des Barnabas, der zeitweilig ein Begleiter des Apostels Paulus war (Kol 4,10), und er wurde von diesen beiden als Diener mit auf ihre erste Missonsreise genommen (Apg 12,25; 13,5). Aber in Perge verließ der wohl noch junge Mann Markus sie und ging nach Jerusalem zurück (Apg 13,13). Als Bamabas seinen Verwandten auch auf die zweite Reise mitnehmen wollte, verweigerte Paulus seine Zustimmung, so daß eine Trennung erfolgte (Apg 15,3739). Erst ca. 12 Jahre später tauchte der Name des inzwischen wohl gereifteren Markus in den Briefen an die Kolosser und an Philemon wieder auf (Kol 4,10; PhIm 24). Er befindet sich jetzt in Rom bei dem gefangenen Paulus. Im zweiten Brief an Timotheus bittet der Apostel kurz vor seinem Tode, diesen jetzt nützlichen Diener mitzubringen (2. Tim 4,11). Zum letzten Mal wird Mai kus in 1. Petrus 5,13 erwähnt. Hier nennt Petrus ihn seinen Sohn, wohl um das innige geistliche Verhältnis zu Markus anzudeuten.
Nicht nur Paulus, sondern auch Petrus besaß also eine besonders enge Beziehung zu Markus. Nach sehr alten Überlieferungen soll Markus das nach ihm genannte Evangelium auf der Grundlage von Predigten und Mitteilungen des Petrus in Rom für die Gläubigen dort geschrieben haben. Die Benutzung verschiedener lateinischer Worte, die Gewohnheit, jüdische Begriffe zu erklären, das seltene Vorkommen alttestamentlicher Zitate und der prägnante, lebendige Stil werden teilweise bis heute als Beweismaterial für diese These angeführt. Für das rechte Verständnis des
Evangeliums ist die Kenntnis dieser Überlieferungen jedoch nicht erforderlich. Dafür ist die eingehende Beschäftigung mit Inhalt und Aufbau dieses vom Heiligen Geist inspirierten Bibel-
buches maßgeblich. .
Über die Zeit der Abfassung läßt sich nichts Genaues sagen. Die Meinungen der Forscher schwanken zwischen den Jahren 55 und 70 n. Chr.
2. Thema und Zweck der Niederschrift
Das Evangelium nach Markus ist das kürzeste und in der Art der Darstellung das gedrängteste. Markus gibt nicht so sehr die Lehren, sondern die Taten des Herrn wieder. Oft gebraucht Markus in seinen Berichten das Präsens statt einer Vergangenheitsform. Besonders auffällig ist das über vierzigmal vorkommende Wort eutheös (alsbald, sogleich). Weder der Stammbaum noch die Geburt Jesu wird erwähnt. Bereits im ersten Kapitel beginnt Markus seinen Bericht über den Dienst des Herrn.
Viel häufiger als in den anderen Evangelien zieht der Herr Jesus sich in die Stille zurück (Mk 1,12.35; 6,31.46; 7,17.24; 9,2; 11,19). Besonders oft erwähnt Markus, daß Er nicht wollte, daß Seine Taten bekannt wurden (Mk 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9,9.30).
Kein einziges Mai nennen die Jünger Jesus „IIerr' und nur siebenmal wird Er „Christus" (Gesalbter) genannt.
Alle diese Eigenarten zeigen uns, daß das Thema dieses Evangeliums die Darstellung Christi als Knecht Gottes ist. Er war nicht nur der verheißene König Israels, wie im Evangelium nach Matthäus, sondern auch der wahre Knecht des HERRN (vgl. Jes 42,1-9; 49,1-6; 52,13-15; Sach 3,8). Nach Seinen eigenen Worten ist Er nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele (Mk 10,45).
Der Herr Jesus wird im Evangelium nach Markus jedoch auch als der wahre Prophet vorgestellt (vgl. 5. Mo 18,15). Als solcher verkündigte Er die gute Botschaft Gottes, das Evangelium. Dieses Kernwort kommt bei Markus achtmal vor, bei Matthäus viermal, bei Lukas (außer in dem griechischen Verb „evangelisieren") und Johannes überhaupt nicht. Seinen Dienst als Prophet, der das Wort Gottes mit Autorität verkündet, umschreibt der Herr in Markus 1,38 mit den Worten: „Laßt uns anderswohin in die nächsten Flecken gehen, auf daß ich auch daselbst predige; denn dazu bin ich ausgegangen".
Der Knecht Gottes ist auch der leidende Knecht. Im Verhältnis zur Länge des Evangeliums nimmt der Bericht über das Leiden und Sterben des Herrn bei Markus einen verhältnismäßig großen Raum ein. Viermal kündigt der Herr den Jüngern Sein bevorstehendes Leiden an: Markus 8,31; 9,12.31; 10,32-34.
Aus der Übersicht „Vergleich der vier Evangelien" (5. 39) ist zu entnehmen, daß Markus im Unterschied zu den beiden anderen Synoptikern die Ereignisse mehr in ihrer chronologischen Reihenfolge wiedergibt.
3. Besonderheiten
a) Eigenstücke des Markusevangeliums
Obwohl Markus das kürzeste aller Evangelien schrieb, berichtet er verschiedene Tatsachen, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Dabei sind besonders zu nennen
zwei Wunder:
- der Taubstumme in Dekapolis (Mk 7,31-37) - der Blinde in Bethsaida (Mk 8,22-26)
zwei Gleichnisse:
- die von selbst wachsende Saat (Mk 4,26-29) - Aufruf zur Wachsamkeit (Mk 13,34-37).
b) Die Person des Markus
Markus war in seiner Jugend ein untreuer Diener. Gerade er wurde vom Herrn beauftragt, Sein Leben als der treue Diener Gottes aufzuzeichnen
Nur Markus berichtet in Kapitel 14,51-52 die Episode von einem Jüngling, der dem Herrn Jesus bei dessen Gefangennahme folgte und, als die Männer auch ihn ergreifen wollten, nackt vor ihnen floh. Eine alte Überlieferung will in diesem jungen Mann Markus selbst sehen.
c) Der Schluß des Markusevangeliums
Über die letzten Verse des Markusevangeliums (Kap. 16,9-20) ist viel diskutiert worden. Er fehlt nämlich in einigen der alten griechischen Handschriften des NT (Cod. Sinaiticus und Vaticanus). Andere Handschriften wiederum enthalten einen kürzeren Schluß. Trotz aller Kritik haben auch die Herausgeber der wissenschaftlichen Ausgabe des griechischen NT, Nestle-Aland26, die Verse 9-20 - wenn auch in doppelten Klammern (d. h. von ihnen zwar als sehr alt, aber nicht als ursprünglich betrachtet) - im Text stehen. Da dieser Abschnitt in den meisten griechischen Handschriften und alten Übersetzungen jedoch enthalten ist, besteht wohl kein Zweifel daran, daß er seinen jetzigen Platz bereits hatte, bevor die Handschriften, die ihn auslassen oder in Frage stellen, entstanden sind. Von den verschiedenen Forschern, die diesen Abschnitt dennoch als nicht ursprünglich ansehen, werden auch inhaltliche und stilistische Gründe für ihre Auffassung geltend gemacht. Diese sind jedoch im vergangenen Jahrhundert u. a. von H. Olshausen, J. P. Lange, J. W Burgon, C. E Keil und W Kelly und in jüngster Zeit von W R. Farmer und J. van Brng-gen m. E. hinreichend widerlegt worden.
4. Inhaltsübersicht
L Markus 1,1-13, Einleitung: Das Kommen des Knechtes Gottes IL Markus 1,14 - 3,6: Der Anfang Seines Dienstes in Galiläa
Kapitel 1,14-45 Taufe Jesu, Berufung der ersten Jünger und erste Taten
Kapitel 2,1-3,6 Heilungen und Fragen der Pharisäer
III. Markus. 3,7 - 10,52, Hauptteil: Der Dienst des Knechtes und Propheten Gottes
Markus 23
Kapitel 15 Verurteilung, Kreuzigung und Tod Christi
V Markus 16,1-20, Schluß: Die Vollendung des Knechtes Gottes
Kapitel 16 Auferstehung, Sendungsbefehl und Himmel-
fahrt Christi
Kapitel 3,7-35 Kapitel 4 Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7 Kapitel 8
Heilungen und Reden
Verschiedene Gleichnisse; Stillung des Sturms Heilung des Besessenen und der blutflüssigen Frau; Auferweckung der Tochter des Jairus Aussendung der Zwölf; Tod Johannes' des Täufers; Speisung der Fünftausend; Jesus auf dem See
Jesus tadelt die Pharisäer, heilt die Tochter der Syro-Phörli7ierin und den Taubstummen Speisung der Viertausend; Warnung vor dem Sauerteig; der Blinde in Bethsaida; das Bekenntnis des Petrus und erste Leidensankündigung Jesu Verherrlichung; die Ohnmacht der Jünger; Rede über Demut und Vergebung Über die Ehescheidung; der reiche Jüngling; Bartimäus
Kapitel 9 Kapitel 10
IV Markus 11,1 - 15,47: Ende Seines Dienstes in Jerusalem
Kapitel 11 Einzug in Jerusalem und Tempelreinigung; der unfruchtbare Feigenbaum
Kapitel 12 Die bösen Weingärtner; die Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten
Kapitel 13 Jesu Endzeitrede auf dem Ölberg
Kapitel 14 Jesu Salbung in Bethanien, das letzte Passahmahl, Gethsemane und Gefangennahme
@1990 csv
Roy Kristina, In der Verbannung
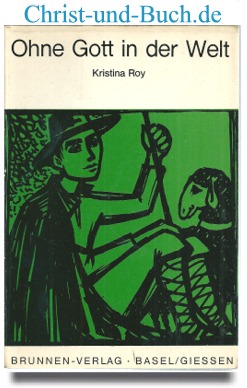
In der Verbannung - Kristina Roy
Die Erzählungen der slowakischen Verfasserin
Kristina Roy
Kristina Roys Erzählung: «Drei Kameraden» gibt mir Veranlassung, mich über die Kristina Royschen Schriften, die ich sehr liebe, auszusprechen und sie den deutschen Lesern dringend zu empfehlen. Ich darf wohl sagen, daß mein Leben durch das Lesen dieser Erzählungen bereichert worden ist.
Zuerst sei hervorgehoben, daß die Erzählungen in wahrhaft christlichem Geiste geschrieben sind, man kann sie getrost und ruhig jedem in die Hand geben. Sie enthalten auch keine versteckte, sozusagen christlich gefirnißte oder überzuckerte Sinnlichkeit, wie es bei sogenannten christlichen Romanen wohl oftmals der Fall ist. Ein weltlich gesinntes junges Mädchen äußerte einmal: «Ich lese ganz gerne diese christlichen Romane; sie sind so interessant; das ‚Christliche' nehme ich mit in Kauf.» Das Christliche in den Kristina Royschen Schriften kann man nicht so einfach liegen lassen, es dringt in das Gewissen und zieht hinauf.
Und doch sind diese Erzählungen keine Traktate. Sie dürfen es ja auch nicht sein, wenn sie Anspruch darauf erheben wollen, ein künstlerisches Gebilde zu sein. Der Traktat predigt, zeugt, appelliert an das Gewissen, will zur Bekehrung erwecken, zum Glauben führen, im Glauben fördern, und das in schlichter, gerader Rede. Die christliche Kunst, also auch die christliche Erzählungs-Kunst, will indirekt dasselbe erreichen, aber auf anderem Wege, auf dem Wege des Schönen. Sie will zeigen, daß wenn der Herr Jesus der Schönste unter den Menschenkindern und «aller Schönheit Meister» ist, so auch die Welt, in welche er uns hineinführt, die Welt der Harmonie ist, mit anderen Worten, daß das Leben, zu dem er uns führt, ein glückliches, im tiefsten Sinne des Wortes ein schönes ist. -
Man muß wohl eingestehen, daß die Helden der Kristina Royschen Erzählungen stark idealisiert sind. Aber warum auch nicht? Man läßt sich, wenn die Schilderung sympathisch ist, auch gern von einem Engel des Lichts in menschlicher Gestalt erbauen und aufwärts heben. -
Kristina Roy hat ein sehr offenes Auge für die Schönheit der Natur; feine, intime Stimmungsbilder erwachsen unter ihren Händen in natürlicher Weise aus der Situation heraus. Wer also empfänglich ist für Natur-Romantik oder, besser gesagt, für die Schönheit der von dem Herrn, unserem Gott, geschaffenen Welt, der wird bei Kristina Roy auf seine Kosten kommen.
lind wie hat die Verfasserin ihr Land und Volk, das so gering geschätzte Slowakenvolk, so lieb! Fast liegt das Land für den Leser als eine Art Märchenland da! Wie Selma Lagerlöf besonders durch ihr Buch «Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen» einen duftigen Kranz um ihre schwedische Heimat geschlungen hat, so hat Kristina Roy durch ihre Erzählungen ihr Siowakeriland bekränzt und verherrlicht.
In meinen Augen sind die Erzählungen: «Ohne Gott in der Welt», «Der Knecht», «Glückliche Menschen», die besten. Sie sind im Aufbau die einfachsten, aber darum auch die natürlichsten.
Wer ein kindliches Gemüt hat, und das kann man auch im Alter noch haben, und wer mit einem kindlichen Gemüt sich gern in eine schöne, ideale Welt hineinführen' lassen will, der wird es einem danken, wenn man ihn auf die Kristina Royschen Schriften aufmerksam gemacht bat.
Flensburg in Schleswig.
Pastor ein. Nie. Nielsen.
Erstes Kapitel
Zaroie *) war, wenn auch kein großes, so doch ein ansehnliches Dorf. Zwischen Wäldern und Hügeln eingebettet, hatte es mehrere Bäche und Mühlen, in die man von weit und breit her das Korn zum Mahlen brachte. Die Bevölkerung war fleißig; die Männer trieben neben Landwirtschaft auch Wagnerei; sie bauten Hanf und Flachs an, und die Frauen webten daraus sehr geschickt Leinwand. Die Gemeinde war wohlhabend, aber sie hatte eine große Sorge mit der Oberen Mühle. Diese war nämlich vor längerer Zeit auf Gemeindekosten gekauft worden, und nun konnte man keinen Pächter für sie finden. Nicht, daß es an Wasser gefehlt hätte - nein, es rauschte Sommer und Winter an der Mühle vorbei, aber - es ging dort um, und jeder Pächter entfloh schon nach kurzer Zeit.
Wie groß war also die Freude der Gemeinde, als unerwartet ein Fremder kam, der die Mühle nach kurzer Besichtigung kaufte. Am ersten Tage seiner Anwesenheit brach im Orte ein großes Feuer aus, dem wohl das halbe Dorf zum Opfer gefallen wäre, wenn nicht der neue Müller mit seinem guten Rat und mit tatkräftiger Hilfe eingesprungen wäre.
Mit dieser Tat hatte der Fremdling die Herzen der Bevölkerung gewonnen. Sie überschüttete ihn förmlich mit Korn zum Mahlen, um so mehr, als gerade die übrigen Mühlen wegen Wassermangels stillstanden. Kaum konnte er die
*) Sprich: Saroschje.
Arbeit bewältigen, obwohl er einen Gesellen mitgebracht und auch gleich zwei Lehrlinge angenommen hatte.
Der Müllerbursche war ein hübscher, junger Mann, aber er war stumm; reden ließ sich also nicht mit ihm. Daß er seinen Meister aber sehr verehrte und ihm alles zuliebe tat, das konnte jedermann bald merken. Der Müller mochte etwa vierzig Jahre alt sein, hatte einen leichten Schritt und fast soldatische Haltung. Haar und Bart trug er auch nach Soldatenart, und das grobe Müllergewand paßte seiner starkgebauten Gestalt wie angegossen. Viel Redens war nicht mit ihm, dagegen hatte er eine eigene Art des Zuhörens. Sie zwang die Leute förmlich, ihm alle ihre Nöte und Schwierigkeiten anzuvertrauen. Sein Rat war immer gut. Er nannte sich Kozima (lies Kosima), und der Geselle hieß Onclrej (Andreas).
Am unteren Ende des Dorfes wohnte eine alte Frau, die Witwe des ehemaligen Hilfslehrers *) Somora. Dieser bot Kozirna in seiner Mühle die Stelle der Wirtschafterin an. In jungen Jahren hatte Frau Somora in der Stadt gedient, verstand also gründlich das Kochen und Haushalten. Da ihre Kinder bereits verheiratet oder schon verstorben waren und sie ganz allein wohnte, kam ihr das Anerbieten Kozimas ganz gelegen. Nur die Spukgeschichte beunruhigte sie. Allein Wochen vergingen, ohne daß die Geister etwas von sich hören ließen.
Bei Kozima befand sich die alte Frau sehr wohl, und sie war mit allem zufrieden. Eins schien ihr allerdings sonderbar, nämlich, daß der Müller mit seinem Gesellen wie mit einem Sohne umging. Die beiden bewohnten gemeinsam ein Zim-
*) Die Stellen der Hufs- oder sogenannten Notlehrer haben in Ungarn bis zur neuesten Zeit hin immer nur intelligentere Bauern eingenommen. mer, hatten dort aber jeder seinen eigenen Schrank. Oft sah Frau Somora, wie sie sich durch die Fingersprache unterhielten; doch konnte sie das leider nicht verstehen.
Der stumme Ondrej tat ihr recht leid, denn er war ein tüchtiger und fleißiger Arbeiter. Wenn es aber keine Arbeit gab, konnte er oft stundenlang auf den Felsen oberhalb der Mühle sitzen, wo er in das brausende Wehr hinab starrte oder auch in einem Buche las. Es war aber weder ein Gebetbuch noch eine Postille; so etwas gab es bei Kozima nicht. Trotzdem konnte Frau Somora nicht sagen, daß Kozima ein gottloser Mensch gewesen wäre. Nie hörte man ein böses Wort von seinen Lippen, und wo es nur möglich war, da half er überall und jedermann.
Im Hintergebäude der Mühle war eine dunkle Kammer, die ließ Kozima reinigen, und Ondrej zimmerte Dielen und ein Fenster herein. Man stellte ein Bett mit frischem Stroh auf, bedeckte es mit reinem Leinen und einer grobwollenen Soldatendecke, dazu kam noch ein Tisch und Stuhl; und wenn ein Wanderer oder Bettler um Obdach bat, so ließ man ihn dort schlafen.
•Einst kam ein kranker Bettler und lag fast über eine Woche in der Kammer. Ondrej kochte ihm verschiedene Kräuter und pflegte den Mann gesund. Der Arme konnte, als er fortging, kaum Worte finden, um für alle erfahrene Liebe zu danken.
Bald nach seiner Ankunft baute Kozima ein Häuschen und stellte in diesem eine Leinwandmangel auf. Dann machte er bekannt, daß die Frauen ihre Leinwand nicht mehr soweit fortzutragen brauchten. Die Bewohner von Zaroie freuten sich sehr darüber. Bei Kozima bezahlten sie weniger als anderswo, und man hatte sie ganz nahe bei der Hand.
Eines Abends, Anfang Herbst, saßen Meister und Geselle lange Zeit beisammen und besprachen sich. Die Folge davon war, daß der Müller am anderen Tage Leuten, die Korn brachten, mitteilte, er wolle einen Ofen zum Obstdörren
bauen. Sie hätten ja hier reichlich Obst und auch Holz. Es wäre besser, wenn man das Obst trocknete, als es halb umsonst vom Baume zu verkaufen. Die wohlhabenden Besitzer wunderten sich, daß ihnen dieser gute Gedanke nie von selbst gekommen war. Sie riefen einen tüchtigen Hafner, halfen fleißig beim Bauen mit und lobten Kozimas Gesellen, hatte der doch beim Bau alles genau ausgemessen gerade wie ein ausgebildeter Ingenieur.
Der Bau war fertig. Man war gerade mitten beim Pflaumendörren, da bekam Frau Somora von ihrer in H. verheirateten Tochter einen Brief. Sie ließ ihn abends Kozima lesen. Er lautete:
«Meine vielgeliebte Mutter! Wir wünschen Euch gute Gesundheit und schicken hundert schöne Grüße. Es ginge uns sonst recht gut, auch gesund wären wir, gottlob, nur die Anna macht uns große Not. Meine liebe Mutter, denkt Euch, ein neuer Glaube ist in unserem Dorfe aufgetaucht. Die Leute kommen zum Wort Gottes zusammen. Nun, ich bin auch ein paarmal dort gewesen und muß zugeben, daß sie eigentlich nichts Schlechtes tun. Mir gefällt nur nicht, daß jeder, der länger hingeht, gleich über seine Sünden weint, und dann sagen sie, Jesus Christus habe ihnen diese Sünden vergeben, und sie seien zu Gott zurückgekehrt. Ich kann das von mir wirklich nicht sagen, obwohl ich von jeher fromm und gut gewesen bin. Ihr kennt mich ja. Nur der Pharisäer konnte sich derart vor Gott loben. Schließlich können ja die Leute reden, was sie wollen, aber sie haben auch unsere Anna verführt. Der Vater ist darüber sehr böse. Zweimal hat er sie deswegen geschlagen, doch sie will und will nicht ablassen. Es hätte sich ihr schon eine gute Heirat geboten, da sagte sie, einem gottlosen Manne könne sie ihre Hand nicht reichen. - Ach, liebes Mütterchen, ich bitte Euch schön, nehmt die Anna wenigstens für ein halbes Jahr zu Euch. Ihr seid eine fromme, schriftkundige Frau, werdet ihr gut zureden können, und sie wird den neuen Glauben vergessen. Wir wollen Euch ja alle Unkosten erstatten, und Anna kann Euch bei der Arbeit helfen.»
Mit etlichen Grüßen schloß der Brief.
«Was sagen Sie dazu, Herr Müller?» fragte die alte Frau verzweifelt. - «Meine Tochter weiß ja noch gar nicht, daß ich bei Ihnen in Stellung bin, und sie will mir das Mädchen schicken. Was soll ich Ärmste ihr antworten? Sie haben die Anna von Kind auf städtisch gehalten, weil sie in der Schule gut gelernt hat. Alle feine Arbeit ließ man sie lernen. Oft sagte ich ihnen: Kleidet die Anna nicht städtisch, sie wird nur verhätschelt - und jetzt dieses.»
Kozima legte den Brief, den er nochmals durchgelesen hatte, zur Seite «Was ich dazu sage? Nun, daß Eure Kinder töricht sind, wenn sie meinen, man könne einen Menschen mit Strafen auf den rechten Weg bringen. Was er einmal mit Kopf und Herz aufgenommen hat, das sitzt fest, ob gut oder böse, das geht auch nicht so leicht wieder hinaus. Schreibt Eurer Enkelin, sie möge nur kommen. Wenn sie in feiner Arbeit bewandert ist, so gibt's bei uns genug zum Nähen, und auch im Dorfe findet sich schon Arbeit, sie kann sich ihr Brot verdienen. In Eurer früheren Wohnung habt Ihr noch ein Bett stehen, das laßt herüberschaffen und dort neben dem Euren aufstellen. Platz ist genug.»
«Sie sind ein sehr guter Mann, Herr Kozima», dankte die Alte erfreut. «Aber, wenn Anna hier ein Ärgernis anstiftet? Sie ist zwar meine Enkelin, aber der neue Glaube?»
«Bah! » Der Müller schüttelte den Kopf. «Wir lassen sie glauben, was sie will. Wenn sie vergessen kann, vergißt sie; wenn nicht - die Welt ist ja doch groß genug. Da können auch Leute, die sich nicht verstehen, nebeneinander leben. So oder so weiß ja nur Gott, was gut und böse ist.»
Frau Somora schrieb nun der Tochter, beruhigte sie und ließ die Enkelin kommen. Dann aber wartete sie mit einer Angst, die ihr fast den Schlaf raubte, auf das ungeratene Kind und dachte: Was werde ich nur mit ihr anfangen?
Zweites Kapitel
Ein Herbstabend senkte sich über die Erde nieder. Leichte Nebel umhüllten Berg und Tal. Von den Bäumen fiel langsam das Laub. Das melancholische Sausen der Tannenbäume mischte sich mit dem Rauschen des Baches, der sich um Kozimas Mühle schlängelte und dann, die Wiesen durchschneidend, durch das Dorf weiterfloß.
Es war Sonntag. In der Dorfschenke unten spielte die Musik zum Tanz. Dieselbe Jugend, die vormittags in der Kirche gewesen war und hier den ernsten Text vom letzten Gericht gehört hatte, tanzte dort. Wer von ihnen dachte jetzt an das Weltgericht? Der Tag war ja noch in veiter, weiter Ferne. Und überhaupt, wer kam denn vom Jenseits, um zu sagen, wann und ob das überhaupt jemals sein werde?
Über dem Wehr bei der Mühle saß nach seiner Gewohnheit Ondrej im Schatten der Tannen und las. Plötzlich fiel ein Schatten auf sein Buch. Er blickte auf, und es dauerte eine gute Weile, bis er die Augen wieder abwandte. Auf der ins Dorf führenden Holzbrücke stand das unerwartete Hindernis in der Gestalt eines jungen Mädchens.
Es war eine unbekannte Erscheinung und, wie es schien, ganz fremd hier. So hübsch, wie etliche dort unten, die die Herzen der jungen Leute höher schlagen ließen, war das Mädchen nicht, aber es hatte seinen eigenen Liebreiz der Jugend und der Güte. Der Ausdruck ihres Gesichts schien zu bezeugen: «Ich bin sehr glücklich.» Die einfache städtische Kleidung stand ihr gut, wenn diese sie auch nicht so schmückte, wie die gestickte Nationaltracht der Dorfmädchen ihre Eigentümerinnen.
Die Fremde schaute zum Dorf hinunter. Plötzlich legte sich ein Schatten der Trauer über das liebliche Gesicht. Die großen Augen blickten zum Himmel, als wollten sie dort etwas fragen oder sich etwas erbitten. Der junge Mann wandte seinen Blick erst von ihr ab, als sie sich umwandte und grüßte. Ihre Stimme war geradeso anmutig wie die ganze Erscheinung. Onclrej verneigte sich tief, fast wie ein Herr, doch ohne einen Laut von sich zu geben. «Bitte, ist das die Mühle von Herrn Kozima?» Die Wangen des Angeredeten bedeckte ein Rot, als er wieder stumm nickte. Damit sie ihn aber verstehe, legte er sich die Finger an die Lippen und schüttelte mit dem Kopf. «Soll ich nicht hingehen?» fragte die Fremde verständnislos. «Ich bin Anna Somora, meine Großmutter wohnt bei Herrn Kozima, und ich komme zu ihr.» Da nahm der Jüngling ein kleines Notizbuch aus der Tasche, schrieb hinein: «Man erwartet Sie» und gab es ihr.
«Können Sie nicht sprechen?» fragte das junge Mädchen mitleidig. Er nickte. «0 seien Sie nicht traurig, der Herr Jesus bat alles wohlgemacht, die Tauben ließ er hören und die Stummen reden. Wenn wir ihn bitten werden, kann er auch Sie gesund machen.» Man sah, daß ihn ihre Worte sehr ergriffen, aber ihre Unterhaltung wurde abgebrochen, denn vor der Mühle erschien Frau Somora, und Anna eilte auf sie zu. Die alte Frau hatte Kozima versprochen, der Enkelin wegen ihres Glaubens gar nichts zu sagen. Sie sollte unbehelligt bleiben, solange sie sich in der Fremde nicht eingelebt hätte. Freilich betrachtete sie das Kind ihrer Tochter recht aufmerksam, fand aber nichts Außergewöhnliches an ihm.
Es zeigte sich, daß Blut kein Wasser ist. *) Das alte Herz
*) Slowakische Redensart.
taute in der Umarmung der Jugend auf. Anna richtete die Grüße ihrer Eltern aus, dann gingen beide hinein.
Im Hofe begegnete ihnen der Müller. Er grüßte die neue Bewohnerin seines Hauses mit ernster Freundlichkeit. Sie bekam gleich ein Nachtessen, das sie sich wohl schmecken ließ, war sie doch von früh bis jetzt gewandert.
So kam Anna Somora nach Zaroie. Wie wtirde es sein, wenn sie einmal wieder fortging? Würde man dann auch so wenig Notiz von ihr nehmen, nur die Wälder und das Was-. ser, die sie jetzt begrüßten? -
Drittes Kapitel
Die Tage und Wochen des Lebens gleichen dem Wasser; niemand kann seinen Lauf hemmen. ins Meer rauschen die Wellen. Ja, ins Meer der Ewigkeit fliehen die Wochen hin. Nur das, was sie mitbrachten, Gutes oder Böses, bleibt.
Auch in Zaroie vergingen vier 'Sonntage seit jenem, wo Anna Somora auf der Holzbrücke erschien; und die Menschen erlebten in dieser Zeit mancherlei. Man hatte Obst und• Kartoffeln geerntet. Die Frauen fingen an, sich mit Hanf und'. Flachs zu beschäftigen, während die Männer Holz für den Winter einfuhren; jeder hatte alle Hände voll zu tun.
Auch bei Kozima gab es viel Arbeit, nur schritt sie diesmal wunderbar gut voran - ja, wie früher nie. Man spürte nur zu gut, daß es in der Mühle zwei junge fleißige Hände mehr gab.. Frau Somora konnte sich nicht genug verwundern, was denn ihre Tochter eigentlich gegen Anna haben' könne. Das Mädchen war flink wie ein Reh, dabei lieb und' fröhlich, und was sie auch immer anfaßte, alles gelang ihr. Daß sie morgens und abends länger betete und in der Bibel las, das schadete doch niemandem. Die Großmutter merkte, daß sie die Enkelin nicht zu belehren habe, las ihr diese doch selber das Evangelium vor, 'und es war eine Freude anzuhören, wie sie die Sache verstand.
Frau Somora hielt ihr Versprechen und sprach mit der Enkelin nie über ihre Glaubensverirrungen. Sie würde ja gewiß das alles hier vergessen; denn da war niemand, der sie an diese Dinge erinnerte, so dachte sie und beruhigte sich dabei.
Obwohl Anna in jeder Arbeit bewandert war, verstand sie doch am besten, mit der Nadel umzugehen. Sie nähte alles, was für die Mühle nötig war. Kozima entlieh von der Jüdin Kohn im Dorfe eine Nähmaschine für sie. Die Jüdin war schon lange krank und schuldete ihm Geld; es war ihr ganz angenehm, auf diese Weise etwas von der Schuld abtragen u können.
Die Männer kümmerten sich nicht viel um Anna. Kozima sprach wenig, Ondrej gar nichts; doch lebten sie friedlich und einträchtig beieinander. Wenn das junge Mädchen irgend eine nötige Frage an sie richtete, wurde diese freundlich beuntwortet, und was der Großmutter nicht möglich gewesen war, das erlernte die Enkelin sehr bald, nämlich die Finger-und Zeichensprache. *
Das Laub war schon gefallen, und in der Natur herrschte eine Traurigkeit, ähnlich der, die ein vereinsamtes Herz, dem alle Lieben weggestorben sind, empfindet, als Kozima mit Anna durch den Wald ging. Sie kamen von einem Begräbnis Im Nachbardorfe. Einer von den Kunden des Müllers war gestorben, und so ging dieser ihn nach dortiger Sitte heimbegleiten; und weil Frau Somora schlecht gehen konnte, hatte sie die Enkelin geschickt.
Die beiden gingen ganz still. Vorher hatten sie über die verlassene Familie des Verstorbenen geredet. Anna, tief in Gedanken versunken, bemerkte gar nicht, daß die ernsten Augen des Müllers schon lange auf ihrem Antlitz ruhten,
@1993 Francke Buchhandlung
Hedwig von Redern 1866-1935
Hedwig von Redern
Geb. 23.4. 1866 in Berlin als Tochter eines preußischen Offiziers. Wechselnde, durch den Beruf des Vaters bedingte Wohnorte. Nach dem • Abschied des Vaters vom militärischen Dienst 1873-1887 auf dem landwirtschaftlichen Familiengut in Wans-dorf/Mark. Nach dem Toddes Vaters wieder in Berlin. Dort das Leben prägende Begegnung mit der werdenden Gemeinschaftsbewegung und ihren führenden Vertretern (vor allem Bernstorff und Pückler). Zunehmende Mitarbeit in mancherlei Aufgaben, besonders literarischer Art.
des Vaters bedingte Wohnorte. Nach dem • Abschied des Vaters vom militärischen Dienst 1873-1887 auf dem landwirtschaftlichen Familiengut in Wans-dorf/Mark. Nach dem Toddes Vaters wieder in Berlin. Dort das Leben prägende Begegnung mit der werdenden Gemeinschaftsbewegung und ihren führenden Vertretern (vor allem Bernstorff und Pückler). Zunehmende Mitarbeit in mancherlei Aufgaben, besonders literarischer Art.
Entscheidende Dienstberufuiig auf der Blankenburger Allianzkonferenz 1897. Um die Jahrhundertwende Mitbegründerin des Deutschen Frauen-Missions- Gebetsbundes. Viel Reisedienst. Dichterin vieler Lieder. Jahre der Wanderschaft 1920-1935 in Wiesbaden, Gumbinnen (Ostpreußen) und Potsdam. Dort gest. 22. 5.1935.
»Der Meister ist da und ruft dich!«
Die schönsten und sorglosesten Jahre ihrer Kindheit und Jugend hat Hedwig von Redern auf dem väterlichen Stammsitz Wansdorf in der Mark Brandenburg verbracht. Dieser war seit fünfhundert Jahren im Besitz der Familie. Hedwigs erstes nachhaltiges religiöses Erlebnis war ihre Konfirmation, beider sie den Denkspruch erhielt: »Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt; darum fürchte dich nicht!« Bei aller inneren Offenheit war sie aber von dem Glauben als der persönlichen Bindung des Vertrauens zu Jesus noch weit entfernt.
Unter den Konfirmationsgeschenken war eins, das sie ganz besonders entzückte: ihr erster Schreibtisch. Dort entfaltete ihre dichterische Gabe zum ersten Mal die Schwingen. Aber es war noch ein weiter Weg von den ersten gefühlvollen Jungmädchenversen bis zu der Klarheit der Lieder, die dem Ruhm des himmlischen Königs geweiht waren.
Mit dem plötzlichen Tod des heißgeliebten Vaters brach der erste große Schmerz in Hedwigs Leben ein. Wenig später zerstörte ein Brand den größten Teil des väterlichen Gutes. Die wirtschaftliche Lage erlaubte keinen Wiederaufbau. Die Familie mußte eine Mietwohnung in Berlin beziehen. Aus dem äußeren Verlust wurde aber reicher innerer Gewinn. In der damaligen Reichshauptstadt regte sich ein geistlicher Frühling. Bei einer Evangelisation durch den vollmächtigen Elias Schrenk blieb auch Hedwigs Herz nicht unberührt. Sie wurde mit jenen Hausversammlungen in adligen Kreisen bekannt, in denen Grafen, Generäle und andere samt ihren Frauen die Bibel miteinander lasen und sich praktisch - erfahrungsmäßig über das Wort Gottes austauschten Wiedergeburt, Bekehrung, Heiligung waren beliebte Themen. Vor allem machten ihr das lebendige, tätige Christentum der beiden Grafen Andreas von Bernstorff und Eduard von Pückler einen starken Eindruck. Der erstere wurde ihr väterlicher Freund. über ihre eigene Hinwendung zu Jesus hat sie folgendermaßen geurteilt: »Langsam öffnet sich das Herz und läßt den selbstsüchtig gehegten Schmerz fahren. Es ist nicht die plötzliche Bekehrung mit der Uhr in der Hand, es ist das langsame Erschließen einer Pflanze, die der Sonne zugewandt ist.«
Bernstorff, Pückler und ihre Freunde - wie der Forstmeister Eduard von Rothkirch, einer der Väter des Christlichen Vereins junger Männer, und Curt von Knobelsdorff, der Pionier des Blauen Kreuzes in Deutschland - bekannten sich zur innerkirchlichen Gemeinschaftsbewegung, die sich damals in fröhlichem Aufschwung befand, als ihrer geistlichen Heimat. Auch Hedwig von Redern fand dort ganz ihr Zuhause. »Bekehrt, zu dienen dem lebendigen Gott« - dieses biblische Losungswort wurde von Adligen wie von vielen schlichten Leuten glaubensfroh praktiziert. Hedwig von Re-dern begann ihre Mitarbeit als Helferin in der Sonntagschule des Grafen Bernstorff. Köstlich waren ihr schondie Stunden der Vorbereitung, wenn der Graf die biblischen Geschichten erzählte und kindertumlich auslegte Toni von Blücher, eine von den eifrigen neuen »Stadtmissionarinnen«, nahm sie mit in Versammlungen von Postboten, Straßenbahnern, Droschkenkutschern und Polizisten und bei Besuchen in deren Familien.
In diese Anfänge ihrer Reichgottesarbeit fiel für Hedwig von Re-dern die gesegnete Blankenburger Allianzkonferenz des Jahres 1897. Dort griff ein Vers an ihr Herz, den sie zum erstenmal singen hörte und der fortan ihrem Leben für immer die Richtung wies:
»Nur Gefäße, heil'ger Meister;
doch gefüllt mit deiner Kraft,
laß von dir und durch uns strömen
Liebesmacht und Lebenssaft«
Was sich schon mannigfach bei ihr anbahnte, nun stand es für Hedwig von Redern unverlierbar fest: »Der Meister ist da und ruft dich!« Mit bereitem Herzen ging sie auf den Gebetswunsch eines der Konferenzredner ein: »Der Herr wolle uns alle zu Kanälen machen, durch die lebendige Ströme fließen, damit wir nicht mehr versuchen, für Gott zu arbeiten, sondern ihn durch uns wirken lassen!« Sie schreibt von jenem Erleben (in der dritten Person): »Blankenburg hat ihr im Jahre 1897 die große Gewißheit gebracht, daß Gott sie für seinen Dienst gebrauchen will, so untüchtig sie von sich aus sei, daß er ihr aber für diesen Dienst die Gabe des Heiligen Geistes schenkt und sie dadurch tüchtig macht.«
Was folgte auf die Erfahrung von Blankenburg? Hören wir Alfred Roth, Hedwig von Rederns Biographen: »Nun wird ihr Leben auf die Höhe eines selten vielseitigen und ungewöhnlich fruchtbaren Dienstes gehoben. Sie dient als Dichterin, als Schriftstellerin, als Schriftleiterin (von Blättern), als soziale Helferin, als Stadtmissionarin, als Organisatorin christlicher und humanitärer Werke. Die Fülle dieser Arbeiten könnte den Zuschauer fast verwirren, aber sie selbst geht fest und unbeirrt in dem allen durch Jahrzehnte ihren Weg. Sie weiß gar nicht, was sie alles schafft; ihr gesamtes Arbeiten geht in einer ergreifenden Schlichtheit des Sinnes dahin. «
Am Schreibtisch und im Strom des Lebens
Hedwig von Redern hat den Berufswunsch für ihr Leben einmal in die Worte gefaßt: »Ich möchte eine Feder sein in meines Gottes Hand.« Und das ist sie wirklich geworden nach der Platzanweisung ihres Herrn! Im Jahre 1894 gab sie eine erste kleine Sammlung von Gedichten heraus unter dem Titel: »Schlichte Lieder für schlichte Leute«. Weitere Bändchen folgten in rascher Aufeinanderfolge, es wurden insgesamt ein Dutzend. - Die erste kleine Erzählung stand in dem Blatt »Die Friedenshalle« des Grafen Bernstorff. Sie hieß »Fäden in Gottes Hand« und gab eigenes Erleben aus Hedwig von Rederns Dienst in Krankenhäusern wieder. Sie geriet so gut, daß sie um weitere Beiträge gebeten wurde. Für die Sonntagschularbeit gab sie 36 Jahre hindurch das Kinderblatt »Wehr und Waffe« heraus.
Es war erstaunlich, wie kindertiimlich sie schreiben konnte. Und noch bei weiteren Blättern war sie Schriftleiterin oder Mitarbeiterin. Die
Polizeibeamten lasen die Erzeugnisse ihrer Feder in ihrem Standes-blatt »Allzeit bereit«.
Doch nicht nur auf Blätter und Blättlein beschränkte sich ihre eifrige literarische Tätigkeit. Sie schrieb auch viele Bücher, am liebsten Biographien. Dabei wandte sich ihre Liebe auch Mystikern und katholischen Gläubigen der vorreformatorischen Zeit und anderer Jahrhunderte zu. Genannt seien ihre Darstellungen von Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi, dem schweizer Nationalheiligen Nikolaus von der Flüe und dem französischen Erzbischof Franois F&neion. Zu diesen und anderen Büchern waren umfangreiche Studien nötig. Hedwig von Redern wagte sich an die Lektüre der vielbändigen Kirchengeschichte von Johann August Wilhelm Neander, vor der sogar Fachgelehrte ein gelindes Grausen verspürten.
Wir müssen heute urteilen, daß sie in ihrer Vorliebe für die Mystiker - wie sie ähnlich Gerhard Tersteegen geteilt hat— Gefahren übersah, in welche die Mystik fallen und denen sie erliegen kann. Mystik kann sich in den seelischen Erlebnistiefen des Menschen verlieren und den Abstand aufheben wollen, der zwischen dem ewigen, heiligen Gott und dem sündigen Menschen klafft. Nur die im Glauben erfaßte Versöhnung durch Christus stiftet zwischen Gott und Mensch echte Gemeinschaft.
Hedwig von Redern hat sich mit einer verhältnismäßig einfachen Wesensbestimmung der Mystik begnügt und diese einfach »Erfahrungstheologie« genannt.
Bei den vorbereitenden Studien für ihre Bücher und beim Schreiben derselben »wurde ihr das gemeinsame Band so köstlich, welches die Glaubenszeugen aller Zeiten, aller Länder und aller Stände verbindet, ja welches die streitende und die triumphierende Gemeinde einander so naherückt, als könnte man sich fast die Hände reichen mit denen, die vor uns und gleich uns am Reiche Gottes bauten, Seelen retten halfen und den Namen Jesu zu verherrlichen trachteten.
Unsere Gegenwart wurzelt ja in der Vergangenheit, wir bauen auf dem Grunde, den andere vor uns mit vielen Kämpfen und großem Glaubensmut, mit Drangabe ihres Lebens und Seins legten.«
Aus der evangelischen Glaubenswelt seien Hedwig von Rederns Bücher über Gerhard Tersteegen und die beiden Väter der deutschen Gemeinschaftsbewegung Bernstorff und Pückler genannt.
Durch die beiden letzteren - wir hörten es schon - ist ihr eigener Glaubens- und Dienstweg entscheidend mitgeprägt und beeinflußt worden. - Alfred Roth urteilt hinsichtlich der erstaunlichen Personen - und Themenvielfalt im literarischen Schaffen von Hedwig von Redern: »Sie gehörte in ihrer geistlichen Einfalt zu den beneidenswerten Naturen, die wie eine Biene aus allen Blumen Honig saugen können.«
So sehr sich für Hedwig von Redern die Aufgaben am Schreibtisch häuften, so wenig zog sie sich dadurch vom Strom des um sie her flutenden Lebens zurück. Sie wollte immer nahe an den Menschen bleiben und ja nicht deren gegenwärtige Fragen und Nöte übersehen. Dabei lag es ihrem Wesen sehr fern, sich vorzudrängen und sich selber die Aufgaben zu suchen.
Es war ihr am liebsten, wenn sie von Älteren und Erfahreneren an Lese herangeführt wurde. Mitarbeiterin wollte sie sein, und dabei machte es ihr nichts aus, wenn ihr die schwierige, verborgene, wichtige, aber nicht sonderlich begehrte Partie der »zweiten Geige« zufiel. Sie war eine »personifizierte Nothilfe« und ließ sich überall Dienste zuweisen.
Eine bedeutungsvolle Auswirkung hatte Hedwig von Redens Freundschaft mit Margarete von Oertzen. 1888 lernten die beiden geistesverwandten Frauen einander kennen. Im März 1893 begannen sie ihre erste gemeinsame Arbeit an den Kranken im Moabiter Krankenhaus. Was sie aber vor allem verband - wobei Fräulein Jeanne Wasserzug aus der Bibelschule Malche die Dritte im Bunde wurde -‚ war die Liebe zum weltweiten Missionsdienst.
Der Deutsche Frauen-Missions-Gebetsbund wurde um die Jahrhundertwende gegründet. Margarete von Oertzen wurde nach einiger Zeit die erste und Hedwig von Reden die zweite Vorsitzende. (Für beide bürgerten sich die Namensabkürzungen M. v. 0. und H. v. R. ein). Die letztere überwand bei Konferenzen des Bundes immer mehr ihre Scheu und Befangenheit im öffentlichen Sprechen und kehrte auch in vielen der einzelnen Kreise ein, die hin und her im Lande entstanden.
In aller nach außen hin sichtbar werdenden Arbeit blieb Hedwig von Rederns wichtigste innere Erkenntnis und Erfahrung: Sie wußte, welche Arbeit sie mit ihren Sünden ihrem Gott machte, und wie die Erlösung vom Ich schwerer ist als die Erlösung von der Welt.
Die Liebe Christi konnte nur ganz allmählich durchbrechen, und es gab manche innere Kämpfe durchzukämpfen. Gott aber hat sein Kind sehr geduldig und freundlich geführt.« Loskommen vom Ich, von der eigenen Große und Ehre - dieses Thema hat Hedwig von Reden oft in ihren Liedern anklingen lassen. Dafür ein Beispiel:
»Er muß wachsen, ich muß sterben,
er muß groß sein und ich klein,
soll zu seinem Kind und Erben
ich erwählt, bereitet sein.
Und ich küsse seine Hände,
wenn sie es an mir vollbracht,
hat mein Ich doch bis zum Ende
mir nur Herzeleid gebracht.«
» Wir dürfen nicht ankern hienieden«
So lautet ein Satz aus einem der Verse Hedwig von Rederns. Das hat sich wahrlich in ihrem eigenen Leben erfüllt. Seitdem ihr das Jugendparadies Wansdorf genommen worden war, ist ihr Leben eine stete Fahrt, ein immerwährendes Wandern gewesen. Zwar hat sie in Berlin viele Jahre hindurch mit der geliebten Mutter eine Wohnung geteilt. Aber ihre vielen Reichgottesaufgaben erforderten es immer wieder, daß sie »getrost ihr Wandergerät nahm« und in ganz Deutschland - vor allem im Dienst des Frauen-Missions-Gebetsbundes - umherreiste. Von 1919 an, dem Todesjahr der Mutter, wurde dieser Wandercharakter ihres Lebens noch verstärkt. Auch zwei ihrer Brüder wurden innerhalb kurzer Zeit in die Ewigkeit abberufen.
Hedwig von Redern folgte nun der Bitte ihres ältesten Bruders, eines hohen Staatsbeamten, ihn an seine wechselnden Dienstorte Wiesbaden und Gumbinnen in Ostpreußen zu begleiten.
Der letztere Ort führte sie weit weg von ihren vielen Freunden im weiten deutschen Reich an dessen östliche Grenze. Sie widmete sich vor allem den Frauen-Missions-Gebetskreisen in Ostpreußen. Diese wuchsen unter ihrer Leitung nach außen und innen.
Aber auch zur »Bundesmutter« in Rostock, Margarete von Oertzen, zu den Freunden in Berlin und anderswo hörten die Kontakte nicht auf. Als der Bruder in den Ruhestand trat, begann in Potsdam Hedwig von Rederns letzte irdische Lebensstation. Sie reiste mehr als je in ihrem ganzen, vielbewegten Leben.
Schon 1920 war sie nicht ungefährlich operiert worden. Im Oktober 1933 mußte sie zum zweitenmal unter das Messer der Ärzte. Bis dahin hatte sie immer wieder - trotz vieler körperlicher Schwäche und Müdigkeit— zu ihrem »Wandergerät« gegriffen.
Heilung wurde ihr nicht mehr zuteil. Fortan sorgte auch eine lange, mit viel Schmerzen und leiblichen Demütigungen verbundene Krankheit dafür, daß sie »hienieden« immer weniger vor Anker lag.
Die Nähe ihres Gottes blieb ihr dabei in allem gewiß. An die 14000 Empfänger des Rundbriefes des Frauen-Missions-Gebetsbundes schrieb sie: »Stunde um Stunde vergeht; ich kann an kein Fach des Schreibtisches allein heran, nichts selbst erreichen; das ist nicht so einfach. Manche Stunde taucht mich auch tief in körperliche Schmerzen; aber keine ist ohne Gegenwart Gottes, ohne Bewußtsein seiner Nähe, ohne die lebendige Freude auf sein Kommen.«
»Eine Harfe, vom König selbst gestimmt«
Eine der inhaltlich und auch der Form nach wertvollsten Dichtungen Hedwig von Rederns ist das Lied: »Wir haben eine Speise, der Welt hier unbekannt« Darin heißt es
» Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld. Wir haben einen Helfer von liebevolle,- Huld. Wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt. Wir haben eine Harfe, vom König selbst gestimmt. «
Diese Harfe tont durch die Lieder unserer Dichterin Diese Harfe hat viele Gläubige zum Lob des Königs, der starb und auferstand und der wiederkommen wird in Herrlichkeit, geführt und sie darin ermuntert. Wir nennen die Anfänge einiger Lieder: »Ich habe nur ein Leben, und das gehört dem Herrn -Hier hast du meine beiden Hände - Näher, noch näher, fest an dein Herz - Du brauchst nichts mehr zu tragen als nur die Last von heut'- Du stehst am Platz, den Gott dir gab - Den Schlüssel zum Herzen, dem kranken, hat Jesus der Hirte, allein - Ach nein, das ist kein Sterben, wenn Christen heimwärts gehn«.
Zu drei Liedern seien noch einige Anmerkungen gemacht. Das erste ist das bekannte:
» Weiß ich den .Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; das macht die Seele still und friedevoll.
ist's doch umsonst, daß ich mich sorgend müh',
daß ängstlich schlägt mein. Herz, sei's spät, sei's früh.«
Das Lied hat seine wohl größten Stunden gehabt, als es die deutschen Menschen tröstete, die im Frühjahr 1919 von den Bolschewisten in der Stadt Riga im Baltenland eingekerkert worden waren. Eine Mitgefangene, die zweiundzwanzigjährige Baronesse Marion von Klot, stimmte es jeden Tag ihren Leidensgefährten zum Trost an.
Die Unglücklichen lebten sechs Wochen der Qual aus den überirdischen Quellen des Wortes Gottes und des Liedes Hedwig von Rederns. Als die deutschen Befreier die Stadt stürmten, erschossen die Bolschewisten noch sechsunddreißig Männer und Frauen, darunter die junge Sängerin, die glaubend und hoffend daran festhielt:
»Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, - das ist genug. «
Als 1930 »Mutter Eva« von Tiele-Wmckler von den Diakonissen des Mutterhauses »Friedenshort« in Miechowitz (Oberschlesien) zu Grabe getragen wurde, sangen diese auf dem stillen Schwesternfriedhof zum Abschied das Lied Hedwig von Rederns, das mit den Worten beginnt
»An dem Fuß des Kreuz esstammes,
wo du, Herr, gestorben bist,
lege ich zum Preis des Lammes
hin mein Leben, wie es ist.
Das ist Seligkeit,
wenn ein armes, armes Leben
ist ihm ganz geweiht!«
Wie oft ist schon bei Gedächtnis- und Trauerfeiern, aber auch am Ende von Abendmahlsfeiern und bei andern Gelegenheiten, das Lied angestimmt worden:
»Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schaun meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein!«
Bei einer großen Gemeinschaftskonferenz fand das abschließende Abendmahl statt. Es war den Versammelten, als ob der Himmel sich über ihnen öffnete. Sie spürten die Kräfte der zukünftigen Welt. Die feiernde Gemeinde ging in großer Stille aus der Kirche! Draußen aber stimmte irgend jemand das Lied an: »Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein.. .«
Bald waren der ganze Kirchplatz und die einmündenden Straßen voller Gesang. Die Menschen der Großstadt lauschten auf. Ein alter hinfälliger Mann faßte nach der Hand seiner Gattin, während in seinen Augen der Blick des Friedens und der Hoffnung lag: »Nun habe ich noch einmal dieses Lied im Kreis der Gemeinde singen dürfen.«
Arno Pagel ISBN 3-88224-056-3
