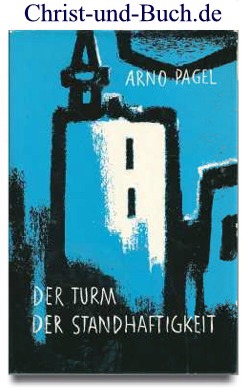Keine Bewertungen gefunden
Der Turm der Standhaftigkeit - Bericht von hugenottischer Glaubenstreue, Arno Pagel
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
WIDERRUF UND FOLGEN Ein König, ein Gesetz, ein Glaube!
Für die französischen Protestanten, deren Geschichte reich ist an Leiden und Verfolgungen, brachten die langen Jahre der Regierung des Königs Ludwig XIV. (1661-1715) ein besonderes Maß an
Ängsten, Qualen und Bedrückungen. Der „Sonnenkönig", von dessen verschwenderischer Prachtliebe
das Schloß von Versailles noch heute Zeuge ist, bedeutet in der französischen und überhaupt der europäischen Geschichte den Höhepunkt des Absolutismus, der fürstlichen Alleinherrschaft. Er ist der unbeschränkte Herr über Land und Untertanen. Alle leben und arbeiten nur für ihn, für den Glanz seines Königtums. Die Maßlosigkeit seines Selbstbewußtseins drückt der Ausspruch: „Der Staat - das bin ich!" aus.
Wüste Ausschweifungen kennzeichnen die frühen Jahre des Königs. Später wendet er sich einem sittlich geordneten Leben und einer kalten, herzlosen Frömmigkeit zu. Dabei fühlt er die Verpflichtung, seine evangelischen Untertanen in den Schoß der alleinseligmachenden römischen Kirche zurückzuführen. Ein König, ein Gesetz, ein Glaube! Eine andere Auffassung kann das absolutistische Denken nicht dulden. Im Jahre 1598 hatte der Großvater Ludwigs XIV., Heinrich IV., der seinem evangelischen Glauben abgeschworen hatte, weil „ihm Paris eine Messe wert" schien, das Edikt von Nantes erlassen. Darin war zwar die katholische Religion
als die herrschende Frankreichs klar bevorzugt, den Protestanten wurde aber ein erträglicher Raum für Lehre, Predigt, Gottesdienst und kirchliche Organisation zugestanden. In einer Zeit, die den Grundsatz der Glaubensfreiheit kaum kannte, geschweige denn ausübte, war das Edikt von Nantes zweifellos ein Fortschritt. Es war als ein „immerwährendes und nie zu widerrufendes" Gesetz erlassen worden. Ludwig XIV. hat es mit einem Federstrich ausgelöscht!
Ähnliche Bücher:
Mein Konto
Direkter Kontakt zu uns:
- Christ und Buch
- Günter Arhelger
- +49 2736 298277
- 9:00 Uhr — 18 Uhr
Montag - Freitag - [email protected]