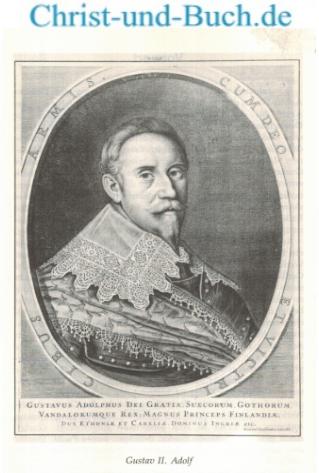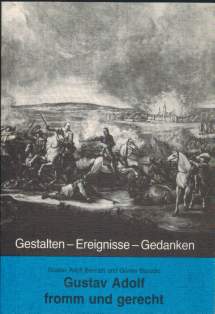Keine Bewertungen gefunden
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
Vorwort
Die Jubiläen der Haupt- und Frauengruppen des Gustav-Adolfs-Werks e.V. m diesem und in den nächsten Jahren geben Anlaß für das Diasporawerk der Evangelischen Kirche m Deutschland, sich auf seinen Namensgeber und auf seine historische und kirchengeschichtliche Bedeutung zu besinnen. Schwedens Eingreifen im Dreißigjährigen Krieg beruhte auf verschiedenen Motiven Die Geschichtsschreibung hat bei dem Lutheraner Gustav H. Adolf, je nach Haltung des Autors, den Nachdruck entweder mehr auf das Eintreten für die deutschen Glaubensgenossen oder mehr auf die weiträumigen Großmachtinteressen des skandinavischen Nachbarn gelegt Beide Faktoren haben eine Rolle gespielt, das wird von niemandem bestritten Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich allem auf deren Rangordnung
Auch den beiden Autoren dieser Broschüre kann es nicht um ein Entweder-Oder gehen Aus der Perspektive des kirchlichen Werks, das seit 160 Jahren an verschiedenen Stellen zum Gedächtnis an den „Löwen aus Mitternacht" wirkt, geht es um seine Glaubensgrundlage und um eine vorsichtige Annäherung an seinen Charakter, Fromm und gerecht, das ist das Urteil, das belegt und untermauert wird Zwar gehen die beiden Kennzeichen nebeneinander her und ineinander über, aber die Ausführungen von Prof. Dr. Gustav Adolf Benrath, Mainz, beschäftigen sich mehr mit Gustav Adolfs Frömmigkeit, wahrend der als Verfasser von „Gustav Adolf - der Große, eine politische Biographie" (Frankfurt/M., 1982) bestens ausgewiesene Dr. Gunter Barudio Frankfurt/M., den schwedischen Herrscher als gerechten und maßvollen König nachzuzeichnen sucht. Beide Deutungen sind nicht als offizielle Stellungnahmen des Gustav-Adolf-Werks zu verstehen. Aber hier sprechen fachlich ausgewiesene Autoren; der Leser ist zum Mitdenken aufgefordert. Gustav Adolf gewinnt in diesen beiden Beiträgen neues Profil. Darum aber geht es dem Gustav-Adolf-Werk ebenso wie den beiden Autoren.
Der Dreißigjährige Krieg war eine Schreckenszeit für die Menschen in Deutschland. Die Greueltaten damaliger Zeit wurden vielfach den schwedischen Truppen angelastet. Man kann der Ansicht sein, daß erst nach seinem Tod das ganze Elend des Dreißigjährigen Krieges begann. Wir wissen, daß es Gustav Adolf sehr um die strenge Disziplin seiner Truppen gegangen ist. Seine liefe Frömmigkeit, kindlich erworben, aber, wie Benrath sagt, „über Kindheit und Jugendzeit hinaus bruchlos erweitert", verwies ihn in seinem Königtum immer wieder auf die höhere Macht Gottes, der er sich auch verantwortlich wußte. Die religiöse Motivation seines Kriegseintritts kann nicht übersehen werden. Es ist wohl eine Tatsache, daß ohne sein Eingreifen in den Kampf die schwer bedrängten und zersplitterten Protestanten in Deutschland kaum überlebt hätten.
In seinem sehr dicht und engagiert geschriebenen, auch aktualitätsbezogenen Beitrag setzt sich Barudio mit heutigen Urteilen über den schwedischen König auseinander. Als guter Kenner des damaligen schwedischen Kanzlers Axel Oxenstierna, mit dem er sich eingehend beschäftigt hat, trägt Barudio zu einer Korrektur des Bilds von marodierenden, brandschatzenden, die Einwohner drangsalierenden Schweden bei. Dieses Klischee zu widerlegen und an Gustav Adolf den Wahrer des Rechts hervorzuheben stellt Barudio in den Mittelpunkt seiner Deutung des „Teutschen Krieges". Sein eingehendes Quellenstudium schlägt sich auch in einer Ausdrucksweise nieder, -die nahe am Wortschatz! dieser Zeit bleibt. Die Vorstellung von einem schwedischen Angriffskrieg widerlegt er. Weil das gegnerische Lager vielfach die verfassungsmäßigen Grenzen überschritt, sieht der Verfasser das Eingreifen Gustav Adolfs als gerechtfertigt an. Die hohen ethischen Maßstäbe des schwedischen Königs lassen seine Armee zu einem politischen Instrument werden. Und Barudio geht so weit, den Soldaten zum „Lebenserhalter" zu erklären und für die damalige Zeit festzuhalten, daß dieser Krieg kein Selbstzweck gewesen sei.
Eher als frühere Generationen sind wir gerade jetzt in der Zeit der „kleinen" Kriege in der Lage dazu, das Schicksal der Menschen im Dreißigjährigen Krieg nachzuvollziehen. Die menschenverachtenden Sitten - man denke nur an den „Schwedentrunk", bei dem den armen Betroffenen Jauche in den Hals gegossen wurde -‚ die Plünderungen und Brandschatzungen dieser Zeit, die manchen Ort in Deutschland von der Landkarte verschwinden und fast keine Gegend Deutschlands unverschont ließen, sind mit dem Geschehen im ehemaligen Jugoslawien wieder einmal deutlich nachvollziehbar geworden. Mehr als frühere Generationen können wir uns heute, wo die Grausamkeiten südslawischer und anderer Völker knallhart auf dem Bildschirm geliefert werden, vorstellen, daß die Verrohung im Kriege alle Kriegsparteien erfaßt, Das kann und soll die schwedischen Übergriffe damaliger Jahrzehnte nicht entschuldigen oder beschönigen. Es soll auch nicht Gustav II. Adolf von der Mitverantwortung freisprechen. Das wäre auch nicht in seinem Sinn gewesen. Er hat die Bürde dieser Verantwortung getragen und hat sich ihr nicht. entzogen.
Die Welle der Sympathie, die Gustav II. Adolf 1832 zufloß und zur Gründung der Gustav-Adolf-Vereine führte, kann nicht ohne die vorausgehende Napoleonische Fremdherrschaft verstanden werden. Wachsendes deutsches Nationalbewußtsein nach den Freiheitskriegen, Erstarken des Protestantismus durch die Ausweitung Preußens und ein neues Lebensgefühl haben dazu beigetragen, die besondere Leistung von Gustav II. Adolf neu zu verstehen und dafür Opfer aufzubringen. Das sind Voraussetzungen, die heute in einer ganz anderen Form weiter bestehen. Sie fordern zu neuer Besinnung auf. Die Hilfe für Minderheiten, die Gustav Il. Adolf zur Intervention auf dem Festland veranlaßte, sieht heute anders aus, bleibt aber als • mitmenschlicher und mitchristlicher Auftrag weiterhin gültig.
Karl-Christoph Epting Präsident des GAWZustand: leichte Gebrauchsspuren
Ähnliche Bücher:
Mein Konto
Direkter Kontakt zu uns:
- Christ und Buch
- Günter Arhelger
- +49 2736 298277
- 9:00 Uhr — 18 Uhr
Montag - Freitag - [email protected]