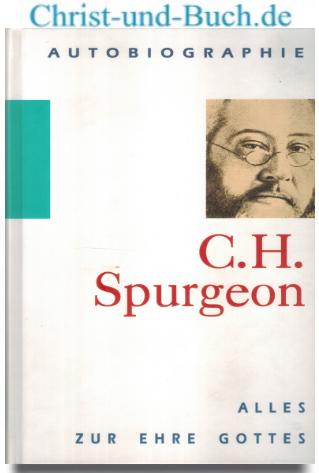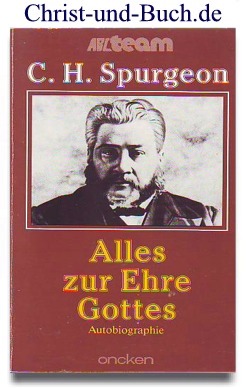Keine Bewertungen gefunden
- Verkäuferinfos & Geschäftsbedingungen
- glückliche Kindheit - Richard Knill u.a. Kindheitserlebnisse - Maidstone und Newmarket - frühe religiöse Eindrücke
- viel Trübsal - große Veränderung - nach der Bekehrung - Tagebuchaufzeichungen und Briefe - gutes Bekenntnis
- erste Dienste für den Herrn - Plädoyer für den Calvinismus - der junge Prediger im Marschland - der junge Seelengewinner in Waterbeach - Erinnerungen als Dorfpfarrer - Ruf nach London - Beginn des langen Pastorates - Liebe, Freierspfade und Ehe
Wer bisher Spurgeon durch seine Andachtsbücher, Predigtbände und Kleinschriften kennengelernt hat, wird sicher gern etwas aus erster Hand über sein Leben erfahren wollen. Diese Autobiographie (hier in Auswahl dargeboten) stammt zum größten Teil aus Spurgeons eigener Feder. Seine Frau und sein Sekretär haben sie herausgegeben und ergänzt. Auch hier versteht es Spurgeon, seine Leser wie seine damaligen Hörer zu fesseln, sowohl durch seine praktische und humorvolle Erzählweise als auch durch seine Konzentration auf das, was ihm allein wesentlich war. Seinen Studenten hat er es eingeschärft: »Gottes Ehre ist unser Ziel. Wir suchen sie, indem wir uns bemühen, die Heiligen zu erbauen und die Sünder zu retten.«
Anhand zahlloser Episoden und Dokumente lernen wir einen überaus erfolgreichen und bei aller Berühmtheit zugleich bescheidenen Mann kennen: den erst 18jährigen Gemeindepastor, den Erwekkungsprediger - dem man ein Gebäude errichten muß, da seine Zuhörerschaft ständig über 5000 Menschen umfaßte -, den Gründer eines Predigerseminars, eines Waisenhauses, den kämpferischen Theologen, den Schriftsteller, dessen Bücher längst zu den Klassikern der christlichen Literatur gehören.
1. Glückliche Kindheit
2. Das Gemeindehaus in Stambourne
3. Richard Knill und andere Kindheitserlebnisse
4. Erinnerungen an Maidstone und Newmarket
5. Frühe religiöse Eindrücke
6. Durch viel Trübsal
7. Die große Veränderung
8. Erfahrungen nach der Bekehrung
9. Tagebuchaufzeichnungen und Briefe
10. Ein gutes Bekenntnis
11. Erste Dienste für den Herrn
12. Plädoyer für den Calvinismus
13. Der junge Prediger im Marschland
14. Der junge Seelengewinner in Waterbeach
15. Erinnerungen als Dorfpfarrer
16. Der Ruf nach London
17. Der Beginn des langen Pastorates, 1854
18. Liebe, Freierspfade und Ehe
19. Frühe Kritiken und Verleumdungen – erste literarische Freunde
20. Wunderbares Wachstum – Daten und Fakten
21. Die Mitarbeiter
22. »Ich habe mehr gearbeitet«
23. Erster Besuch in Schottland
24. Der Seelengewinner
25. Eine neue Prophetenschule
26. Erste Veröffentlichungen – Verfasser, Verleger und Leser
27. Die ersten Ehejahre
28. Die Katastrophe in der Royal Surrey Gardens Music Hall 1856
29. Gottesdienste 1858–1860
30. Der Bau »unseres heiligen und herrlichen Hauses«
31. Spätere Gottesdienste in der Music Hall
32. Versammlungen im noch unfertigen Tabernakel
33. Das Tabernakel wird eröffnet
34. Denkwürdige Gottesdienste im Tabernakel 1861–1874
35. Predigten im Freien
36. Das Predigerseminar, 1861–1878
37. Der Segen der gedruckten Predigten
38. Ein Heim für die Vaterlosen – die Waisenhäuser
39. Das neue Helensburgh House
40. Suchende und Bekehrte
41. Westwood
42. Aus der Arbeit zweier Tage
43. Spurgeon als Leser und Autor
44. Die Down-grade-Kontroverse von Spurgeons Standpunkt aus
45. Das letzte Jahr
VORWORT
Hätte Charles Haddon Spurgeon Wesentliches ergänzt oder weggelassen, wenn er selbst letzte Hand an das umfangreiche Werk hätte legen können? Er war zu früh gestorben, und mit 58 Jahren überdenkt man wohl die Ereignisse der Kindheit und Jugendzeit – eine Summe des eigenen Lebens und Wirkens mag man kaum ziehen. Nun haben es andere für ihn getan: seine Witwe Susannah und sein erster Sekretär, die ihm beide am nächsten standen.
Sie entnahmen der Fülle des vorliegenden Materials, was ihnen für Spurgeon charakteristisch und wesentlich erschien. Während Spurgeon in den ersten Kapiteln bis etwa zur Hälfte des Buches von seiner Kindheit und Jugend erzählt – und die Anfänge
seines erstaunlichen und vollmächtigen Dienstes als Prediger fallen in diese Zeit –, berichtet Susannah über herausragende Ereignisse ihres gemeinsamen Lebens, und zusammen mit Spurgeons Sekretär ergänzt sie aus Presseberichten, Briefen, Spurgeons Aufzeichnungen und mitstenografierten Reden und Predigten, was der Leser über Spurgeons Leben wissen sollte und was er an keiner anderen Stelle erfährt.
Es gehörte nun zur Aufgabe der deutschen Herausgeber, aus der großen vierbändigen und der ebenfalls umfangreichen zweibändigen englischen Ausgabe ein überschaubares Opus vorzulegen, das Charles Haddon Spurgeon vor dem Hintergrund seiner Zeit und im Ringen um eine verständliche Verkündigung biblischer Wahrheit, wie er sie als ganz junger Mensch erkannt und erlebt hat, lebendig werden lässt.
Dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Mann mit herausragenden Begabungen handelt, der mit beispielloser Intensität die Sache Gottes zu der seinen machte, zeigen nicht nur seine Selbstdarstellung und die ergänzenden Beiträge seiner Freunde, sondern auch die von ihm in spürbarer Gelassenheit aufgenommenen Angriffe und Fehden derer, die das Wunder dieses »Boy-Preachers« auf der Kanzel des Metropolitan Tabernakels nur mit Misstrauen zur Kenntnis nehmen konnten.
Durch Helmut Thielickes »Begegnung mit Spurgeon« 1961 ist im deutschsprachigen Raum eine Art Spurgeon-Renaissance in Gang gekommen. Spurgeons »Ratschläge für Prediger« und seine Predigten gehören wieder zur Standardausrüstung jeder theologischen Bibliothek. So soll nun auch die Lebensgeschichte dieses »Fürsten der Prediger« folgen; sie wird nachdenklich machen und sicher auch viele ihrer Leser ermutigen.
Der Verlag
1. Glückliche Kindheit
Charles Haddon Spurgeon wurde am 19. Juni 1834 in dem kleinen Dorf Kelvedon in der Grafschaft Essex geboren. Er hatte keine Erinnerung mehr an seinen Geburtsort, denn die Eltern zogen schon zehn Monate nach seiner Geburt nach Colchester, und nach vier weiteren Monaten brachte man das Kind zu seinen Großeltern nach Stambourne. Hier blieb er, bis der etwa Fünfjährige zu seinen Eltern zurückkehrte.
So beziehen sich Spurgeons früheste Erinnerungen auf seine Großeltern und das Pastorat in Stamboume, wo der Großvater James Spurgeon (1776–1864) seit 1810 als Pastor einer Independentengemeinde diente.
Obwohl es keine menschliche Begründung dafür gibt, dass Spurgeon seine Kindheit bei den Großeltern verbrachte, bei der Frage nach Gottes Absichten mit dieser Führung tappen wir nicht im Dunkeln. Der alte Pastor von Stambourne scheint einer der letzten Vertreter der alten »Dissenters« gewesen zu sein. In jeder Hinsicht gehörte der Veteran zu einer »längst überholten Generation«: In Stambourne hielt man sich noch an die alte Theologie, die man im ganzen Commonwealth predigte, als Essex die Hochburg der Puritaner war – die Gemeinde in Stambourne nun seit zweihundert Jahren.
Es schien, als hätten die alten Mauern dieses Pastorats das Zeugnis der Puritaner so lange aufbewahrt, bis einer kam und sie zu neuem Leben erweckte. Möglicherweise gehören nicht alle der hier erzählten Stambourner Geschichten in Spurgeons erste fünf Lebensjahre; einiges mag auch in den langen Ferien geschehen sein, die den Schüler immer wieder hierher führten.
Weder diese alte Zeichnung noch meine Beschreibung des alten Pfarrhauses von Stambourne kann dem Leser die bezaubernde Atmosphäre vermitteln, die wir in diesem Pastorat erlebten, in dem mein Großvater mehr als fünfzig Jahre lang mit seiner großen Familie wohnte. Für einen Pastor, der nicht der offiziellen anglikanischen Kirche angehörte, muss dieses Haus seinerzeit recht großzügig gewesen sein, ein eindeutiger Beweis dafür, dass er entweder selber genügend Geld besaß oder dass seine Brotgeber offene Herzen und Geldbeutel hatten. Es war in jeder Hinsicht ein Herrenhaus der alten Zeit. Inzwischen ist es durch ein modernes ersetzt worden, wie es dem Geistlichen von heute zweifellos zusteht.
In diesem lieben alten Pfarrhaus, in dem ich meine ersten Lebensjahre zugebracht habe, neigten sich schon die altersschwachen Balken, und es wäre wohl eines Tages zusammengefallen, hätte man es nicht vorher durch einen Neubau ersetzt. Dennoch wünschte ich mir, wir hätten darin wohnen bleiben können. Als der Abbruch bevorstand, schrie es in mir: »Lasst dieses Haus stehen! Rührt keinen Ziegelstein an!« Aber seine Stunde war gekommen. Es hatte einem dauerhafteren Gebäude Platz zu machen.
Es war ein wirklich vornehmes Haus mit acht Fenstern in der Vorderfront! Davon hatte man allerdings mindestens drei, wenn nicht sogar vier zugemauert, die Flächen schwarz angestrichen und darauf mit weißen Linien täuschend ähnlich Fensterrahmen und Scheiben angedeutet. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Fenstersteuer, die damals erhoben wurde. Man schien das Licht, lateinisch lux, für eine alte Handelsware zu halten und besteuerte es deshalb als Luxusartikel.
Das schmale Gehalt eines Predigers jedoch zwang diesen zur Sparsamkeit, und so wurde Zimmer für Zimmer des großen Hauses der Dunkelheit übergeben; ich betrat diese Räume dann stets mit ehrfurchtsvoller Scheu. Über anderen Fenstern wurden Schilder angebracht, auf denen man Molkerei oder Käserei lesen konnte. So waren sie nämlich von der Steuer befreit.
Was für einen verworrenen Verstand muss jener Mensch gehabt haben, der als Erster auf den Gedanken kam, das Licht der Sonne zu versteuern. Sicher, man wollte damit möglichst gerecht die Größe eines Hauses bestimmen und von daher auf den Reichtum des Besitzers schließen. Aber am Ende führte es dazu, dass Besitzer großer Häuser das Licht, für das sie nicht bezahlen konnten, ausschlossen.
Wer das Haus durch die Vordertür betrat, befand sich zunächst in einer geräumigen Halle, deren Fußboden aus Backsteinen mit frischem Sand bestreut war. Hier befand sich der große Kamin, über dem ein Gemälde hing, das David, die Philister und den Riesen Goliath zeigte.
Spurgeons Geburtshaus in Kelvedon/Essex;
In der Halle stand auch das Schaukelpferd »für das Kind«. Es war ein graues Pferd, und man konnte sowohl rittlings als auch im Damensitz darauf reiten. Es war das einzige, auf dem ich jemals gerne geritten bin. Lebende Tiere bewegen sich zu ungleichmäßig, und so zieht mich das Gesetz der Schwerkraft gewöhnlich sehr bald aus dem Sattel. Von meinem Ross in Stambourne behaupte ich jedoch, dass selbst ein Parlamentsabgeordneter darauf seinen Sitz hätte behaupten können. Auf der rechten Seite der Halle lag das beste Zimmer des Hauses, die »gute Stube«. Ihr Fenster war von Kletterrosen umrankt; sie blühten in den Raum herein, wenn es ihnen gelang, die Äste zwischen Mauer und Fensterrahmen zu schieben. Meist fanden sie dafür auch genügend Platz, denn an diesem Haus stand nichts im Lot.
An den Wänden der »guten Stube« hingen die Bilder meiner Großeltern und Onkel. Auf einem Möbelstück stand eine schöne große Schale, die mein Großvater für das benutzte, was er »taufen« nannte. Ich glaube jedoch, dass diese Schale ursprünglich als Bowlen-Schüssel gedacht war. Jedenfalls war es ein Kunstwerk, würdig der Aufgabe, für die es ausersehen war.
Der Apfel in der Flasche Ich erinnere mich noch gut, dass auf dem Kaminsims der Großmutter eine Flasche lag, in der ein ausgewachsener Apfel steckte. Für mich war das ein großes Wunder, und so versuchte ich, es zu erkunden.
Meine Frage war: Wie kam der Apfel in eine so kleine Flasche? Er war ziemlich genau so groß wie der Flaschenkörper. Wie war er dann hineingekommen? Ich nahm, obwohl es als Hochverrat galt, die Schätze auf dem Kaminsims anzufassen, die Flasche herunter und überzeugte meinen kindlichen Verstand, dass der Apfel nie und nimmer durch den Flaschenhals passte.
Dann versuchte ich vergeblich, den Flaschenboden abzuschrauben; der Apfel war also auch nicht von unten in die Flasche gekommen.
Ich schlussfolgerte: Auf irgendeine mir verborgene Weise war die Flasche zerlegt und anschließend so sorgfältig wieder zusammengesetzt worden, dass es von diesem Vorgang keinerlei Spuren mehr gab. Natürlich konnte mich diese Theorie nicht ganz zufriedenstellen; aber da gerade kein Philosoph anwesend war, der einen anderen Lösungsvorschlag hätte machen können, ließ ich die Sache auf sich beruhen.